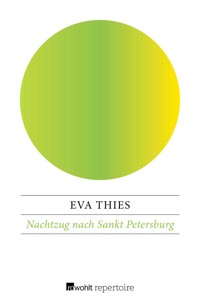
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bewegendes Frauenschicksal aus der Kaiserzeit Die Waise Katerina von Echternberg wird von verarmten Verwandten lieblos erzogen. Als der junge preußische Offizier Bendix von Boythin in ihr Leben tritt, sieht sie in ihm die Chance, diesem Dasein zu entkommen. Sie heiratet ihn und folgt ihm an die deutsche Gesandtschaft in Peking. Erst in den Wirren des blutigen Boxeraufstands begreift sie, wen sie da geheiratet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eva Thies
Nachtzug nach Sankt Petersburg
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein bewegendes Frauenschicksal aus der Kaiserzeit
Die Waise Katerina von Echternberg wird von verarmten Verwandten lieblos erzogen. Als der junge preußische Offizier Bendix von Boythin in ihr Leben tritt, sieht sie in ihm die Chance, diesem Dasein zu entkommen. Sie heiratet ihn und folgt ihm an die deutsche Gesandtschaft in Peking. Erst in den Wirren des blutigen Boxeraufstands begreift sie, wen sie da geheiratet hat.
«Eine anrührende Liebesgeschichte.»
Badisches Tagblatt
Über Eva Thies
Eva Thies, 1947 in Holstein geboren, hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat bereits mehrere Romane geschrieben.
«Nachtzug nach Sankt Petersburg» erschien zuvor unter dem Titel «Sei allem Abschied voran».
Inhaltsübersicht
meiner Agentin für Anregung und Kritik
Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
dir, wie der Winter, der eben geht.
Denn unter Wintern ist einer so endlich Winter,
dass, überwinternd, dein Herz überhaupt widersteht.
Rilke
1
Seine Hand sacht unter meinem Ellbogen.
Es gibt nicht viele Berührungen, die Mann und Frau in der Öffentlichkeit erlaubt sind. Den Arm um die Schulter des Mädchens legen kann der Bursche auf dem Heimweg vom Dorftanz. Verstohlen Hand in Hand gehen die blutjungen Verliebten auf stillen Parkwegen. Auf dem Sonntagsspaziergang hängt sich die Frau in den Arm ihres Gatten ein, und beide bewachen ihre Sprösslinge, die schicksalsergeben vor ihnen hertrotten.
Wir aber kamen nicht vom Dorftanz, wir waren nicht blutjung, und wenn er auch vor dem Gesetz mein Mann war, so waren wir doch kein Paar, noch würden wir jemals eines sein. Dies waren unsere letzten Minuten zusammen.
Ich glühte vor Verlangen, ihn zu umarmen.
Aber wir waren in der Öffentlichkeit. Nichts konnte öffentlicher sein als der Bahnhof zur Hauptbetriebszeit. Gepäckträger schoben hoch beladene Karren vor sich her, Kinder zerrten plärrend an den Händen ihrer nervösen Mütter. Ein altes Ehepaar zankte sich laut und routiniert, ein Verkäufer kurvte mit einem Gestell vorüber, auf dem Obst und Zeitungen lagen, und rief die neueste Schlagzeile aus. Wie kleine Riffe vor der Küste, die die Brandung teilen, standen Wartende inmitten ihrer Koffer, allein, zu zweit, ganze Großfamilien tauschten die letzten Grüße und Ermahnungen, und um sie herum floss der Strom derjenigen, die den Bahnsteig hinuntergingen auf der Suche nach dem richtigen Waggon.
Er hatte seine Hand unter meinen Ellbogen gelegt.
Ich ging neben ihm her, die Mauer der Reisenden öffnete sich vor uns. Der Hutschleier verdeckte mein Gesicht, und niemand konnte ahnen, wie sehr sie mich aufwühlte, diese zarte Berührung. Als würden nicht sein Handschuh und mein Jackenärmel dazwischen liegen, brannte meine Haut unter der Berührung seiner Finger, und ich wagte nicht, ihn anzusehen, aus Angst, ich könnte dann nicht mehr weitergehen, ich müsste mich auf der Stelle in seine Arme werfen und ihn anflehen, mich niemals zu verlassen. Ich wusste nicht, welche Kraft mich aufrecht hielt und einen Fuß vor den anderen setzen ließ, so unauffällig, als sei nichts zwischen uns als diese kleine konventionelle Berührung, mit der er mich durch den Menschenstrom steuerte, diese ritterliche Geste der Fürsorge.
Seine Finger hätten mich nicht so sorglos locker gehalten, wenn er gewusst hätte, was ich vorhatte. Während ich an seiner Seite ging, spähte ich nach einer Gelegenheit zur Flucht. Es musste eine geben. Es musste möglich sein, in dieser hektischen Betriebsamkeit untertauchen zu können.
Erst hatte ich gedacht, ich könnte mich in der Halle unauffällig entfernen, mich mit den zum Ausgang Strömenden hinausschwemmen lassen in die Stadt, unter deren Millionen Menschen ich unauffindbar wäre. Aber er hatte sich stets so dicht neben mir gehalten, dass schon ein Schritt zur Seite seine Aufmerksamkeit hätte erregen können. Nun hoffte ich, dass sich eine Möglichkeit auf dem Bahnsteig ergäbe. Und fürchtete sie zugleich.
Unser Zug war noch nicht eingefahren. Auf dem Nebengleis stand ein anderer bereit zur Abfahrt. Die Lokomotive ließ zischend Dampf aufsteigen, der Abfertigungsbeamte setzte schon die Trillerpfeife an den Mund, Bahnbeamte schlossen die Türen, eine laute Stimme befahl, zurückzutreten. Der Junge mit den Zeitungen und dem Obst tauchte vor uns auf, und ich sagte, dass ich gern Weintrauben hätte. Er winkte dem Jungen, wandte sich von mir ab, ich machte drei, vier Schritte nach links, stand vor dem Waggon, der Mann, der die Tür schließen wollte, half mir die Stufen hinauf, warf die Tür hinter mir zu, der Zug setzte sich in Bewegung und rollte langsam aus der Halle.
Ich blieb mit dem Rücken zum Bahnsteig stehen. Nur nicht hinausblicken, nicht sehen, wie er sich mit dem Obst von dem Jungen abwandte, mich nicht mehr an seiner Seite sah, sich suchend umschaute und dann begriff.
Der Zug hatte die Halle verlassen und beschleunigte sein Tempo.
Ich konnte nicht mehr zurück.
Ich zitterte.
Ich stand auf jenem schwankenden Boden, der zwei Waggons miteinander verband, aber nicht deshalb zitterte ich, sondern weil ich fror. In mir breitete sich Kälte aus, die aus der Endgültigkeit kam.
Eine Stimme hinter mir sagte etwas, das ich nicht verstand, laut und böse. Eine Hand legte sich auf meine Schulter und drückte mich zur Seite.
Ich schrak auf, blickte mich um und begriff, dass ich den Weg versperrte. Hinter mir hatte sich eine Schlange von Leuten gebildet, mit Koffern und Taschen beladen, schwankend im Rhythmus des Zuges, die vorwärts wollten in den nächsten Waggon, auf der Suche nach einem Sitzplatz.
Ich schüttelte die Hand des Mannes von meiner Schulter ab, wandte mich um und öffnete die Tür zum nächsten Abteil.
Es war ein Wagen der dritten oder vierten Klasse. Auf Holzbänken saßen dicht gedrängt alte stoppelbärtige Männer, Priem kauend, und Frauen, die kein Alter hatten, weil sie schon mit Ende zwanzig, von der Arbeit verbraucht, jede Jugendlichkeit verloren hatten. Sie hielten Körbe auf dem Schoß umklammert oder wiegten Kinder an der Schulter. Der Geruch von feuchter Wolle, abgestandenem Atem und Schweiß stieg von ihnen auf und ließ keine Luft mehr zum Atmen. Als ich die Tür öffnete, starrten sie mit müden Augen herüber, in denen nur noch ein Gefühl stand, der Hass auf die Neuankömmlinge, die ihnen ihren Platz streitig machen würden.
Ich durchquerte schlingernd den Wagen, wich Körben aus und ausgestreckten Beinen, stolperte einmal über eine abgewetzte Ledertasche, deren Bügel sich öffnete und einen Blick freigab auf zerknüllte braune Tücher, die sich ineinander wanden wie Gedärm. Der Besitzer der Tasche begann zahnlos zu keifen, aber ich hatte schon die Tür erreicht und rettete mich auf den Perron. Der Wind fuhr mir unter den Schleier und sprühte mir Regen ins Gesicht. Ich holte Atem und zog die kalte klare Luft tief ein.
Die nächsten Waggons gehörten zur zweiten Klasse. Voll waren auch sie, aber das Publikum bürgerlicher, die Männer zuvorkommend, die Frauen höflich, man teilte mir mit, die erste Klasse sei noch drei Wagen entfernt, räumte mir Hindernisse aus dem Weg und öffnete mir die Türen.
Ich band den Schleier wieder unter dem Kinn fest und stieß die Tür zur ersten Klasse auf.
Im ersten Abteil saßen eine Mutter mit Kleinkind, das vom Brüllen ein angeschwollenes Gesicht hatte, und eine alte Frau, wohl die Großmutter, die sich mit der Mutter bemühte, das zornrote Kind zu beschwichtigen. Sie blickten nicht auf, als ich vorüberging. Im zweiten Abteil umarmte sich ein Pärchen, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um mich zu bemerken. Der Schmerz fuhr wie ein Messerstich durch mich. Das dritte Abteil war vollständig belegt von kichernden Mädchen und einer streng blickenden Gouvernante. Als ich durch das Fenster in das vierte Abteil sah, blickte ich direkt in die Augen der Fürstin Milinskova.
Es war zu spät, mich abzuwenden.
Sie hatte mich erkannt, lächelte mir zu, winkte und machte eine knappe Kopfbewegung. Die Frau, die ihr gegenübersaß, sprang auf und öffnete die Tür.
Jelena Sergejewnas Wortschwall hüllte mich sofort ein, ebenso wie das schwere orientalische Parfüm, das sie reichlich benutzte und das die Luft des Abteils geschwängert hatte.
«Katja, Katja! Wie schön, Sie zu sehen! Zuletzt in Paris, nicht wahr? In der Oper. Sie sind nicht zu meinem Diner ins Maxim gekommen. Und Ihr Mann? Sagen Sie ihm, er soll sich zu uns gesellen, damit wir von alten Zeiten plaudern können. Nein, bleiben Sie hier! Sagen Sie Madame Depors, wo er sitzt, und sie wird ihn zu uns bitten. Setzen Sie sich, Katja, mein Engel!»
Ich sank auf das Polster neben ihr. Madame Depors, die Gesellschafterin der Fürstin, war stehen geblieben und sah mich erwartungsvoll an.
«Ich bin allein», sagte ich.
Von jetzt an und für immer allein.
Nie wieder seine Hand unter meinem Ellbogen spüren, nie wieder diesen Geruch von Leder, Sandelholzseife und Tabak einatmen, nie wieder diese Stimme hören, die ihre Wärme unter einem ironischen Tonfall verbirgt, nie wieder das Lächeln sehen in den grauen Augen, nie wieder das Klopfen seines Herzens unter meiner Wange fühlen, nie wieder dahinschmelzen, wenn seine Hände über meinen Rücken streichen, und nie wieder auflodern, wenn sein Mund mein Begehren weckt.
Allein.
Jelena Sergejewna wandte sich an ihre Gesellschafterin.
«Maria Petrowna, nehmen Sie die Tasche! Die kleine, blaue.»
Madame Depors streckte sich zum Gepäcknetz und holte das Verlangte herunter.
«Schenken Sie ein», fuhr die Fürstin fort.
Madame Depors öffnete die Tasche, holte einen Flakon heraus und schraubte den silbernen Becher ab, mit dem er verschlossen war, kaum größer als ein Fingerhut. Sie goss eine klare Flüssigkeit aus dem Flakon in den Becher und reichte ihn Jelena Sergejewna, die ihn mir hinhielt.
«Trinken Sie, Kindchen.»
Meine Hand zitterte so stark von dem Frost, der mich schüttelte, dass ich den Fingerhut nicht fassen konnte. Die Fürstin hielt ihn mir an die Lippen und sagte scharf: «Trink!»
Ich kannte diesen Ton. So hatte sie in Peking im Lazarett die Verwundeten angeherrscht, die ihre Medizin nicht nehmen wollten. Jahrhunderte, in denen die Bojaren Tausende von Seelen besessen hatten, die sich zitternd unter ihren Befehlen krümmten, hatten ein Selbstbewusstsein geschaffen, dem niemand widerstehen konnte. Gehorsam öffnete ich den Mund und schluckte die Flüssigkeit, die scharf in meiner Kehle brannte.
Ich hustete.
«Wodka», sagte die Fürstin, «es gibt nichts Besseres in einer Krise als Wodka.»
Mit einem flüchtigen Blick auf Madame Depors fuhr sie fort:
«Lassen Sie die Flasche hier, Maria Petrowna, und leisten Sie Sofia und Aljoscha Gesellschaft. Ich werde Sie zu finden wissen, wenn ich Sie brauche.»
Madame Depors warf mir einen Blick tief empfundener Abneigung zu, knickste und sagte mit flacher Stimme:
«Wie Sie befehlen, Madame la princesse.»
Ich sank auf die Polster gegenüber der Fürstin. Jelena Sergejewna schenkte von neuem Wodka ein und hielt mir den Becher hin. Ich schüttelte den Kopf. Darauf kippte sie den Schnaps selbst hinunter, schraubte die Flasche wieder zu und stellte sie neben sich.
«Sie haben ihn also verlassen», sagte sie.
Der Wodka war mir ins Blut gegangen, das nun rascher durch meine Adern strömte und mich erwärmte. Meine Hände zitterten nicht mehr.
«Ja», sagte ich.
Jelena Sergejewna musterte mich schweigend. Sie war in jenem Alter, in dem Frauen Geburtstage nicht mehr feiern. Durchtanzte und am Spieltisch verbrachte Nächte, ein reichlicher Konsum von Alkohol und zahllose Liebhaber hatten dieses einmal sehr schöne Gesicht verwüstet. Nur ihre Augen waren immer noch wunderbar, groß und dunkel, die Augen einer Frau, die vieles gesehen hatte und vieles begriff und wusste, was zu tun war. Sie beschränkte sich auf das Praktisch-Vernünftige.
«Nehmen Sie den Hut ab und ziehen Sie die Jacke aus, Katja», sagte sie, «dieser Zug ist übertrieben geheizt. Haben Sie Gepäck?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Das macht nichts. Madame Depors hat etwa Ihre Figur. Sie wird Ihnen mit dem Nötigsten aushelfen. Haben Sie eine Fahrkarte?»
Ich schüttelte wiederum den Kopf.
«Gut, wir werden nachlösen. Wohin wollen Sie fahren?»
«Wohin fährt denn der Zug?»
Sie zeigte keinerlei Erstaunen.
«Nach St. Petersburg.»
«Das ist gut.»
St. Petersburg war weit fort. Und hinter St. Petersburg erstreckte sich Russland bis nach Sibirien und in die Mandschurei, ein riesiges Reich, groß genug, um sich darin zu verstecken.
«Haben Sie Ihren Pass?»
Ja, meinen Pass hatte ich. Er steckte in der kleinen Handtasche, die an meinem Handgelenk hing und die nichts enthielt als einen Kamm, eine Puderquaste, den Pass und, in ein Taschentuch gewickelt, meinen Schmuck, zwei, drei Ringe, eine Brosche, einen Armreif aus dem Besitz meiner Mutter, die Matilda für mich beiseite geschafft hatte, bevor alles versteigert wurde. Und die Kette mit den Saphiren und Brillanten, die ich niemals verkaufen würde, und wenn ich verhungern müsste.
Meine Fahrkarte steckte in seinem Jackett, und sie war nicht nach St. Petersburg ausgestellt. Meine zwei großen Koffer, in die das Dienstmädchen eilig geworfen hatte, was ihr aus dem Schrank zuerst in die Hände fiel, waren im Gepäckwagen auf dem Weg nach Hamburg, wo sie auf ein Schiff nach England verladen werden sollten.
«Gut, dass Sie Ihren Pass haben. Das erleichtert die Sache ungemein. Heutzutage ist die Bürokratie nicht mehr unbedingt bestechlich, und wir hätten Schwierigkeiten an der Grenze bekommen können. Manche Beamte machen sich geradezu ein Vergnügen daraus, Aristokraten besonders zu schikanieren. Sie wittern, dass eine Revolution in der Luft liegt, und hoffen, so auf der richtigen Seite zu stehen. Toren! Als ob nicht jeder Aufstand sowieso mit Bajonetten niedergeschlagen wird. Es ist also ausgemacht, mein Kind. Sie begleiten mich nach St. Petersburg.»
Ihre Nachdrücklichkeit erleichterte mich. Es war, als hätte die Mutter, die ich nicht hatte, für mich diese Entscheidung getroffen, und ich fügte mich, weil ich wusste, dass sie das Beste für mich wollte.
«Möchten Sie etwas essen, Katja? Oder etwas trinken?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Nein, danke, Jelena Sergejewna. Ich brauche nichts.»
Draußen schien ein graues Tuch über den Himmel gespannt, der schwer über den winterkahlen Feldern lagerte. Hin und wieder wurde diese Monotonie unterbrochen von hellen Farben, weiß getünchten Wänden, roten Dachschindeln, wenn der Zug an einem Dorf oder einem kleinen Städtchen vorbeiraste.
Saß er inzwischen im Zug nach Hamburg? Hatte der Schaffner ihn schon kontrolliert? Dann hatte er sein Portefeuille aus der Brusttasche gezogen und den Umschlag gefunden, auf dem nur sein Name stand. Er würde die Schrift nicht kennen, denn außer meiner Unterschrift unter der Heiratsurkunde hatte er nie etwas Schriftliches von mir gesehen. Aber es würde trotzdem keinen Zweifel geben, von wem der Brief stammte. Ich sah vor mir, wie seine Hände das Kuvert hielten, es zögerlich hin- und herdrehten, diese schmalen Hände mit den langen, spitz zulaufenden Fingern, schmucklos bis auf den Goldreif an der rechten Hand, Hände, die meinen Körper in Besitz genommen hatten, nach deren Berührung meine Haut schrie. Jetzt würde er den Umschlag aufschlitzen und das Blatt herausziehen, das ich in fliegender Hast bekritzelt hatte.
Dabei hätte es keiner Erklärung bedurft. Ich konnte nicht bei ihm bleiben. Er kannte den Grund dafür so gut wie ich. Und ich musste diejenige sein, die unsere Trennung vollzog. Ich musste das Opfer bringen. Wie mein Vater. Wie meine Mutter. Alles hingeben, was ich war. Das Opfer, nach dem Boythin sich gesehnt hatte. Warum konnte es nicht Liebe ohne Opfer geben? Ich hatte den Brief mit seinem Namen begonnen, zum ersten Mal und zum letzten Mal seinen Namen geschrieben. Meine Hand hatte gezittert. Nein, ich hatte nicht geschrieben, um etwas zu erklären. Ich hatte geschrieben, weil ihm mit diesem Brief etwas von mir bleiben sollte.
Und wenn er den Zug nicht genommen hatte? Wenn er mir folgen wollte? Wenn er den nächsten Zug nach St. Petersburg nahm? Er würde mich nicht finden. Mit Hilfe der Fürstin würde ich in Russlands Weiten verschwinden.
Ich fragte mich, ob seine Hände zitterten, während er las. Mühsam riss ich mich zusammen, versuchte, seine Hände aus meinen Vorstellungen zu verbannen, mein heftig schlagendes Herz zu beruhigen, indem ich langsam und konzentriert atmete und der Fürstin zuhörte.
«Es verblüfft mich immer wieder», sagte Jelena Sergejewna, «wie schnell und bequem man sich mit der Bahn fortbewegt. Meinen ersten Zug sah ich erst, als ich schon achtzehn war. Bis dahin war ich aus unserem Landkreis nicht fortgekommen. Ich glaube heute, dass mir meine Eltern einen großen Gefallen damit getan haben, dass sie mich auf dem Lande haben erziehen lassen. Eine liebevolle Amme, ein strenger, anspruchsvoller Lehrer, wenige Nachbarn, auf deren Gesellschaft man angewiesen ist und die man deshalb, wie verschroben sie auch sein mögen, liebenswürdig behandeln muss – das ist die beste Vorbereitung auf ein Leben in der Gesellschaft.»
Sie erwartete keine Antwort.
Zu klug und zu taktvoll, um mich gleich mit der Frage nach meinem Unglück zu überfallen, plauderte sie mit der heiteren Gewandtheit der Gesellschaftsdame, die eine Katastrophe ignoriert, damit sie ihr mit Haltung begegnen kann.
«Es mag Ihnen paradox erscheinen, aber ich glaube fest daran. In einem so überschaubaren Kreis wird das Kind genau beobachtet und korrigiert. Es steht im Mittelpunkt seines kleinen Hofstaates, fühlt sich behütet und anerkannt. Ein solches Kind kann, wenn es erwachsen ist, der Welt im vollen Bewusstsein seines eigenen Wertes entgegentreten. Schlimm hingegen die Kinder, die in den großen Häusern der Hauptstadt aufwachsen. Sie sind jedermann im Wege, werden heute gehätschelt, morgen beiseite geschoben und übermorgen vergessen. Heutzutage kann man Kinder wahrscheinlich gar nicht mehr so auf dem Lande isolieren. Bahnhöfe gibt inzwischen in jeder Kleinstadt. Die jungen Leute wachsen mit dem Fortschritt auf, der in einem Tempo vorwärts schreitet, das uns Alten den Atem nimmt. Ich glaube fast, dass ich mich demnächst noch überreden lasse, mir ein Automobil zuzulegen. Natürlich nicht in Russland. Aber wenn ich nach Nizza zurückgehe – wer weiß? Ein Automobil und ein hübscher junger Chauffeur mit fescher Livree – was meinen Sie?»
Ich versuchte, mich ihrem Ton anzupassen.
«Warum nicht? Bestimmt werden Sie eine Sensation sein.»
«Ich bin immer eine Sensation gewesen», sagte die Fürstin achselzuckend, «seit ich aus Borodino in die große Welt gekommen bin. Ich wusste, was ich wollte und wie ich es bekam – das reicht für eine Frau schon aus, um als extravagant zu gelten. Ein Ruf, der äußerst angenehm ist. Jedenfalls wenn man reich ist. Andernfalls gilt man ja nur als verrückt. Aber reicht es heutzutage wirklich schon aus, sich im Automobil chauffieren zu lassen? Vielleicht, wenn ich selbst am Steuer sitzen würde? Es soll ganz einfach sein, hat man mir gesagt. Und das Lenkrad verdirbt die Hände nicht wie die Zügel. Vielleicht lerne ich es noch. Obwohl – die Entwicklung schreitet so rasant voran, dass das Automobil vielleicht in einigen Jahren überholt ist, verdrängt durch die Flugmaschine, von der man neuerdings so viel hört. Man hat mir von zwei Brüdern erzählt – wie hießen sie noch gleich? Na, egal – die arbeiten jedenfalls an einer Maschine, die durch die Luft segelt und Passagiere mitnehmen kann wie ein Heißluftballon. Sind Sie einmal in einem solchen Ballon geflogen? Ich habe in Paris …»
In Paris hatte er das Kollier gekauft. Ein Dutzend blauer Saphire in einer Silberfassung mit einem Diamantverschluss.
«Die Farbe deiner Augen», hatte er gesagt. Er war hinter mich getreten. Ich konnte im Spiegel sehen, wie er die Hände hob, die Kette über meinen Kopf hielt und sie langsam senkte, bis die Steine kalt auf meine Haut trafen und ich erschauerte. Seine Fingerspitzen berührten meinen Nacken.
Die bloße Erinnerung machte mich wehrlos gegenüber der heißen Welle, die meinen Körper überrollte. Meine Brüste schmerzten vor Sehnsucht nach seinen Händen, die sie umschlossen hatten, und mein Schoß brannte vor Verlangen nach der Erfüllung, die er mir geschenkt hatte.
Ich musste diese Erinnerung aus meinem Kopf bekommen. Ich musste sprechen. Über irgendetwas. Ich würde mich konzentrieren müssen auf das, was ich sagte. In meinem Kopf würde kein Raum bleiben für einen anderen Gedanken. Ich musste über etwas sprechen, was weit weg war, was in keiner Verbindung zu ihm stand. Worüber hatte Jelena Sergejewna gesprochen? Fahrzeuge. Luftschiffe, Automobile, Eisenbahnen. Eisenbahnen!
«Ich bin zum ersten Mal mit der Eisenbahn gefahren, als ich fünf Jahre alt war. Von Verona nach Berlin. Als ich die Lokomotive erblickte, so groß, so schwarz und Dampf speiend, da erschrak ich wie vor einem Drachen in einem der Märchen, die mir Matilda immer erzählte.»
Jelena Sergejewna lehnte sich zurück. Ein leises Lächeln der Befriedigung zuckte um ihre Mundwinkel. Ihre Methode, mich abzulenken, hatte sich bewährt.
«Matilda?», fragte sie.
«Mein Kindermädchen. Sie stammte aus dem Aostatal und wusste viele schaurig-schöne Geschichten, die die alten Frauen in ihrem Dorf beim Spinnen erzählten. So wie zu Zeiten der Brüder Grimm, die über Land gingen und die Märchen aufschrieben. Manche von Matildas Geschichten waren ihnen ähnlich, handelten von dummen Jungen, die ins Unbekannte gingen und die Jungfrau und den Schatz heimbrachten, andere waren unheimlich, handelten von Untoten und Vampiren, wieder andere waren hell und fröhlich und erzählten davon, dass gute Hexer und Hexen nachts ausfuhren, um die Bösen listig zu bestrafen und die Guten zu belohnen. Ich erinnere mich noch an viele von Matildas Geschichten. Sonst weiß ich nur noch wenig von der Zeit in Italien.»
«Wo haben Sie denn gelebt?»
«Meine Eltern hatten ein Haus oberhalb des Gardasees, ein großes Landhaus, die Casa arranciata, inmitten eines blühenden Gartens mit Zitronen- und Orangenbäumen. Wenn ich an meine frühe Kindheit denke, dann erinnere ich mich immer an drei Momente. An das helle Lachen meiner Mutter, begleitet von dem dröhnenden Bass meines Vaters, der mich hochhebt und auf seine Schultern setzt. Ich klammere mich an seinen Haaren fest und schaue von oben auf die Welt herab, als säße ich auf einem Thron. Ich erinnere mich daran, wie ich in der Schubkarre hocke und der Gärtner mich den Abhang hinunterschiebt. Bei jeder flachen Stufe hüpft die Karre empor und ich mit ihr, dann plumpse ich wieder zurück und jauchze in einer Mischung aus Angst und Lust. Und ich fühle wieder die Wärme der Feldsteinmauer unter meinem Bauch, während ich ganz still liege und die Eidechse beobachte, die sich eine Armlänge von mir entfernt sonnt. Langsam strecke ich die Hand aus, aber nicht behutsam genug. Die Eidechse schreckt auf und verschwindet blitzschnell in einem Mauerspalt. Das ist es vor allem, was ich mit der Casa arranciata verbinde. Wirklich genau erinnere ich mich nur an den Tag, an dem ich das Haus für immer verließ.»
2
Mein Cousin Wilhelm von Warstede holte mich ab. Allerdings war er mit seiner Aufgabe, ein elternloses Kind tagelang quer durch Europa zu transportieren, überfordert. Er erledigte alle Formalitäten bei Grenzübertritt und Zugwechsel anstandslos, aber mit mir wusste er nichts anzufangen. Zwar war er noch jung, nur fünfzehn Jahre älter als ich, aber er war ohne Geschwister aufgewachsen, in seinem zwölften Lebensjahr in die Kadettenanstalt eingetreten und seither in diesem Ghetto aufgewachsen, in dem die Söhne des preußischen Adels vom Rest der Welt fern gehalten wurden. Nichts hatte ihn darauf vorbereitet, ein fünfjähriges verstörtes Kind zu trösten. Was ihm zu diesem Zweck unterwegs einfiel, beschränkte sich auf Fragen danach, ob ich müde oder hungrig sei, und das Angebot von Schokolade, die er offensichtlich für einen Kindertröster von umfassender Wirkung hielt. Dass ich trotz der fünf Tafeln, die ich zwischen Verona und Berlin hinunterwürgte, meistens mit tränenverschmiertem Gesicht dasaß und, je länger wir fuhren, desto hartnäckiger nach Matilda jammerte, brachte ihn aus der Fassung.
Hilflos und nervös spulte er alle Redensarten ab, mit denen er selbst früher ruhig gestellt worden war, erlebte aber, dass sie keinerlei Wirkung zeigten. Regelmäßig endete der fruchtlose Versuch dann mit den Sätzen: «Es tut mir schrecklich Leid. Möchtest du Schokolade?»
Allein reisende Damen setzten sich gern in unser Abteil, aber sie erhöhten sein Unbehagen nur. Sogar ich in meinem Kummer spürte, dass ihr Interesse an mir nur ein vorgeschobenes war und ihr girrendes «Die süße Kleine. So ein hübsches Kind, was hat sie denn?» dem erwachsenen Begleiter in seiner Leutnantsuniform galt und nicht mir. Die Anwesenheit einer Frau machte mir jedes Mal schlagartig wieder die Abwesenheit Matildas bewusst, und ich brach von neuem in Schluchzen aus.
Es war Matilda, die ich vermisste, und nicht meine Eltern. Meine Eltern waren so in ihre Liebe zueinander versunken gewesen, dass ich in ihrem Leben nur eine Nebenrolle spielte. Während meine Tage von Matildas fröhlicher Gesellschaft erfüllt waren, machte ich meinen Eltern nur nach dem Frühstück einen Knicks, empfing von meiner Mutter eine duftende Umarmung und sah sie erst abends wieder, wenn ich im Bett lag, bereit zum Gutenachtkuss. An meine Mutter dachte ich immer wie an eine Fee aus einem von Matildas Märchen, schön und nur selten erscheinend, an meinen Vater aber wie an einen der Könige, die ihre Söhne in die Welt hinausschickten: ein großer, stattlicher Mann mit dröhnendem Lachen und einem dichten feuerroten Bart, der kitzelte, wenn er mich hochhob und an sich drückte.
Matilda war meine Mutter, meine Schwester, meine Spielgefährtin. Sie badete mich, sie zog mich an, sie erzählte mir Geschichten, sie spielte mit mir im Garten, sie ging mit mir spazieren, sie aß mit mir, sie brachte mich zu Bett und sang mir ein Schlaflied. Sie war es, mit der ich die Feste feierte. Sie nahm mich mit zu ihrer großen, lauten, herzlichen Familie, wenn eines ihrer zahlreichen Geschwister Geburtstag hatte. Ich überreichte ein Geschenk, wurde von Matildas überlebensgroßer Mutter an den üppigen Busen gedrückt, rechts und links schallend auf die Wangen und dann auf den Mund geküsst und mit einem Klaps verabschiedet: Auftakt zu den wilden Spielen mit Matildas kleinen Brüdern, von denen ich verschwitzt, verdreckt und strahlend glücklich zurückkehrte. Diese Geburtstage waren für mich Höhepunkte des Jahres, fast ebenso sehr herbeigesehnt wie Weihnachten, weil ich an diesen Tagen nicht das kleine Fräulein aus der Villa war, sondern ein Kind sein durfte wie alle anderen auch. Matilda nahm mich auch sonntags in die Messe mit. Meine Eltern, die selbst niemals eine Kirche besuchten, duldeten diese Gottesdienstbesuche als ein Stück italienischen Volkslebens wie die Geburtstage in Matildas Familie. Für mich aber waren sie Ausflüge in eine andere Welt.
Die Dorfkirche war ein achteckiger Zentralbau, von einer flachen Kuppel überwölbt, mit kleinen Fenstern hoch oben in der Wand, von denen nur spärliches Licht in das Innere fiel. In der Dämmerung, im zuckenden Licht der Kerzen, die während der Messe auf dem Altar brannten, glänzten geheimnisvoll die goldenen Mosaiken hinter dem Altar, auf denen Engel und Apostel nach oben schwebten in die Kuppel. Von dort blickte in strenger Majestät Christus als Weltenherrscher auf uns herab, die wir auf den kalten Bodenfliesen knieten und zu seinen Ehren Gebete in die weihrauchgeschwängerte Luft murmelten. Es war in dieser tausendjährigen Dorfkirche, die noch an jene Zeiten erinnerte, da Byzanz Venedig und sein Hinterland beherrscht hatte, dass ich zum ersten Mal dem Bild eines majestätischen, in den Himmel entrückten Gottes begegnete, dem die Menschen gleichgültig waren.
Einmal, meine Eltern waren nach Verona gereist, wo eine russische Balletttruppe gastierte, nahm Matilda mich auf eine Wallfahrt mit. Ich war überwältigt von einer Barockkirche mit riesigen Ausmaßen, lichtdurchflutet, von Gold strotzend, voller fetter kleiner Engel. An Matildas Hand wanderte ich umher und war fest überzeugt, dass dieses Gebäude keine Kirche war, auch wenn alle es so nannten, denn der mächtige Gott, dessen Bild ich in unserer Kirche kennen gelernt hatte, feierte keine heiteren Feste in einem Ballsaal.
In einer Seitenkapelle waren die Wände über und über behangen. Da waren hölzerne Arme und Beine, Finger, Ohren, Füße, Hände, geschnitzte Kleinkinder in Spitzensteckkissen, kleine Gemälde, die Unwetter oder Unfälle darstellten und auf denen in Knittelversen der Hergang des Unglücks geschildert war, und es gab eine Madonna, die mit Gold und Edelsteinen behängt war und auf ihrem Arm einen der fetten kleinen Engel hielt, der in purem Gold erglänzte.
Ich stand staunend und etwas schaudernd davor und klammerte mich an Matildas Hand.
«Was ist das?», flüsterte ich.
«Es sind Geschenke für Maria und das Jesuskind», flüsterte sie zurück.
Ich starrte auf die Körperteile.
«Aber warum schenken die Leute ihnen Arme und Beine zum Geburtstag?»
«Dummchen, das sind doch keine Geburtstagsgeschenke. Es sind Gaben, weil Maria geholfen hat.»
«Wie geholfen?»
«Schau einmal das Ohr da! Bestimmt hatte jemand heftige Ohrenschmerzen oder war schwerhörig oder taub. Da hat er eine Wallfahrt hierher gemacht und Maria um Hilfe angefleht. Dann hat sie geholfen, das Ohr wurde wieder gesund, er konnte wieder hören, und er hat dieses Holzbild gestiftet.»
«Du meinst, man muss Maria ein Ohr aus Holz schenken, und dann kann man wieder hören? Warum gibt es dann noch taube Leute?»
«So einfach ist das nicht, Katja. Diese Gaben sind nur Erinnerungen an die Heilung. Wenn man will, dass Maria hilft, dann muss man ein Gelübde ablegen.»
«Ein Gelübde?»
Eine der guten Eigenschaften Matildas war, dass sie nie die Geduld verlor. Trotz der bösen Blicke, die uns streiften, weil wir sprachen, statt still zu beten, fuhr sie leise fort:
«Ein Gelübde ist ein Versprechen, das du nie brechen darfst. Wenn du die Gottesmutter um etwas bittest, dann musst du ihr etwas versprechen, was dir besonders wichtig ist. Und je größer deine Bitte ist, desto Größeres musst du ihr versprechen. Wenn du zum Beispiel um das Leben deines Kindes bittest, dann musst du etwas sehr Großes opfern.»
«Was denn?», fragte ich.
«Als meine große Schwester die Halsbräune hatte, ist meine Mutter hierher gekommen und hat um Agatas Leben gebeten. Und sie hat der Muttergottes versprochen, dass Agata ins Kloster geht, wenn sie wieder gesund wird.»
Agata war das einzige von Matildas Geschwistern, das ich nicht kannte, weil sie bei den Klarissinnen lebte.
«Aber das Opfer hat doch Agata gebracht und nicht deine Mutter», sagte ich logisch.
Matilda schüttelte den Kopf.
«Meine Mutter hat auf Agatas Kinder verzichtet», erklärte sie, «sie wird von allen ihren Kindern Enkel haben, nur nicht von Agata.»
Hinter uns schnaubte eine Frau missbilligend. Matilda fasste meine Hand und zog mich fort. Auf der Schwelle drehte ich mich noch einmal um. Über einem Meer von Kerzen, das zu ihren Füßen brannte, schwebte die Madonna mit dem Kind am Pfeiler und schenkte mir ein Lächeln.
Es war Matilda, die den Mittelpunkt meines Lebens bildete, und nicht meine Eltern, und als die Katastrophe hereinbrach, traf sie mich nicht, weil ich meine Eltern, sondern weil ich Matilda verlor. Wenn ich mich in den folgenden Jahren einsam und ausgestoßen fühlte, dann jammerte ich abends unter der Bettdecke nach Matilda, die mich so schmählich verraten hatte.
Denn während sie für mich die Welt gewesen war, hatte es für Matilda noch ein Leben außerhalb der Casa arranciata gegeben. Sie war mit einem Winzer aus dem Ort verlobt. Nachdem meine Eltern gestorben waren und ich zu der Schwester meines Vaters in den Norden gebracht werden sollte, entschied sie sich, mich nicht in das ferne dunkle Land zu begleiten, sondern ihren Winzer zu heiraten. Ich, die nicht begriff, dass es für Matilda einen Menschen auf der Welt geben konnte, der ihr wichtiger war als ich, verstand nur, dass sie mich in dem Augenblick im Stich ließ, da ich sie am meisten brauchte. Sie händigte mich dem Fremden aus, der mich in einer Sprache anredete, die ich kaum verstand, küsste mich zum Abschied und vergoss ein paar Tränen, die sie, noch bevor ich in die Kutsche geklettert war, abwischte. Dann wandte sie sich lächelnd ihrem Bräutigam zu, der neben ihr stand.
Als ich erwachsen war, begriff ich natürlich, dass sie kaum anders hätte handeln können. Wie leicht wäre sie diesem Bauern aus dem Sinn gekommen, wenn sie sich von ihm entfernte. Es gab viele Mädchen mit tanzenden Locken und sprühenden Augen, mit fröhlichem Lachen und schwingenden Hüften – er hätte nicht jahrelang warten müssen, bis Matilda mich verlassen konnte, weil ich sie nicht mehr brauchte. Matilda war eben nicht meine Mutter, sie war nur ein bezahlter Dienstbote. Hätte sie mich begleitet, so hätte sie mir ihre Zukunft zum Opfer gebracht. Und dennoch, sooft ich mir später sagte, dass Matilda nur vernünftig gehandelt hatte und mein Zorn auf sie der Zorn eines unverständigen Kindes gewesen war – wenn ich an ihre letzte Geste dachte, wie sie sich mit dem Handrücken über die Augen fuhr und dann ein Lächeln hervorzauberte, das nicht mir galt, wurde mein Herz wieder von Bitterkeit erfüllt.
In Berlin stiegen wir aus und machten uns in einer Kutsche auf den Weg nach Warstede. Fünf Stunden waren wir unterwegs, und das Wetter war so trübsinnig wie meine Stimmung.
Der Regen trommelte auf das Verdeck und lief in dichten Rinnsalen die Scheibe herunter, sodass ich nur verschwommen eine Landschaft wahrnehmen konnte, in der sich die Bäume untertänig vor dem Wind verbeugten, der tief hängende dickbäuchige Wolken über flaches grünes Land trieb.
Mir war kalt, und mir blieb die ganzen achtzehn Jahre kalt, die ich in Warstede verbrachte, auch wenn die Sonne schien und die Temperaturen manchmal im Sommer italienische Höhen erreichten.
Vom Gutshaus selbst nahm ich durch die nassen Scheiben zunächst nichts anderes wahr als einen roten Farbfleck in dem trüben Grau, dann wurde der Kutschenschlag geöffnet, das Trittbrett herabgelassen, mein Cousin sprang hinaus, streckte mir die Hand entgegen, und unter einem riesigen schwarzen Schirm, den ein Diener hielt und der jeden Blick auf Haus und Himmel versperrte, betrat ich das Haus.
Es roch streng nach Bohnerwachs und Kampfer. Am Fuß der Treppe stand meine Tante und sagte:
«Das ist also das Kind.»
Dieser Augenblick entschied auf immer über unsere Beziehung.
Erst später wurde mir klar, wie tief sie meine äußere Erscheinung verabscheut haben musste, meine Lackschuhe, den Samtmantel, die offen auf die Schultern fallenden Locken, den Hut mit der kecken Feder und Miranda, meine große Puppe im Seidenkleid, die ich fest an mich gedrückt hielt. Ich war für sie «die Tochter dieser Person«, und jahrelang war es ihr ganzes Bestreben, mich zu einer anderen zu machen, zu einem ehrbaren jungen Mädchen aus guter Familie, das einmal die passende Gattin eines preußischen Landjunkers und Mutter eines schneidigen Leutnants werden konnte.
Ich spürte die Abneigung, die hinter ihrer Bemerkung steckte. Nie zuvor war mir dergleichen widerfahren. Nie hatte mich ein so missbilligender Blick getroffen. Ich starrte sie an, diese hagere Frau in dem einfachen schwarzen Kleid, ein Kleid, wie es meine Mutter, die Duftiges, Wehendes, Schleier und Spitzen geliebt hatte, nie getragen hätte. Ich fürchtete mich vor ihrem strengen Gesicht mit dem schmallippigen Mund.
Mein Cousin sagte:
«Das ist Katerina, Mutter. Wir sind zu Hause, Kind. Dies ist jetzt dein Heim, und das ist deine Tante Hermine, die dir eine Mutter sein wird. Geh und begrüße sie!»
Dies war nicht mein Zuhause. Und diese Frau war nicht meine Mutter. Die Zumutung, die in seinen Worten lag, dieses übel riechende Haus und diese hässliche Frau könnten für mich dasselbe sein wie die Heimat, die ich verloren hatte, und die Mutter, die mir genommen worden war, zusammen mit meiner erregten Übermüdung erweckten in mir einen Trotz, der meine Furcht besiegte.
Ich blieb stehen, hob mein Kinn voller Kampfbereitschaft und sagte:
«Nein.»
Tante Hermines Mund wurde noch schmaler, sonst veränderte sich in ihrem Gesicht nichts. Sie blieb schweigend an ihrem Platz, ich an dem meinen, und wir maßen uns wie zwei Ringer vor dem Kampf.
«Nein», sagte ich noch einmal und stampfte nachdrücklich mit dem Fuß auf.
Tante Hermine ging auf mich zu und machte Miene, mich zu ohrfeigen. Mein Cousin trat rasch dazwischen und sagte beschwichtigend:
«Sie ist noch ganz wild und unerzogen, Mutter. Du hast eine schwere Aufgabe vor dir. Aber bedenke auch, alles ist ihr hier noch fremd. Sie muss sich erst in ihr neues Leben einfinden.»
Später stellte er sich nie wieder auf meine Seite. Aber das elternlose Kind, das so verloren in der Diele stand, mochte ihn an seinen ersten Tag in der Kadettenanstalt erinnert haben, und er hatte mein Leid und meine Verstörung nachfühlen können.
Von diesem Tag an schlugen wir unsere Schlachten. Tante Hermine gewann sie alle, denn die Kräfte, die eine erwachsene Frau, unangefochtene alleinige Herrin des Hauses, mobilisieren kann, sind so viel größer als die eines verlassenen Kindes. Stubenarrest, Essensentzug und das Einsperren in einen dunklen Schrank waren Waffen, denen ich nur Trotz und einen Durchhaltewillen entgegensetzen konnte, der schwer zu brechen, aber immerhin doch zu brechen war.
Tante Hermine fuhr mit einer harten Bürste durch meine Haare und flocht sie zu festen Zöpfen, sie ersetzte meine Samt- und Seidenkleidchen durch karierte Kattunkleider und die Lackschühchen durch feste Schnürschuhe, sie lehrte mich stricken und Hohlsäume sticken, nähen und flicken, Gemüse putzen, einkochen, entsaften, backen und ließ mich an Schlachttagen beim Wurstkochen helfen. Sie fragte mich den Katechismus ab und bestand eisern auf dem buchstabengetreuen Wortlaut, überwachte erbarmungslos stundenlange Etüden auf dem Klavier und verbot jeden Walzer. Im Winter blieb mein Zimmer ungeheizt, denn es war wichtig, nicht zu verweichlichen. Bei Tisch ließ sie mich Bücher unter die Oberarme klemmen, damit ich lernte, mit angelegten Ellenbogen zu essen. Wenn ich vor ihr herging, stieß sie mich mit knöchernem Zeigefinger zwischen die Schulterblätter, damit ich mich gerade hielt. Sonntags ging ich in schwarzem Kleid mit weißem Kragen, das Gesangbuch in der behandschuhten Hand, neben ihr in die Kirche.
Ich war an einem Mittwoch in Warstede angekommen, und als ich am Samstag hörte, dass ich am nächsten Morgen mit meiner Tante in die Kirche gehen sollte, schöpfte ich in meinem Jammer Hoffnung. Ich setzte mich am Nachmittag hin und malte sorgfältig das Bild einer Frau, die Matilda darstellen sollte und ihr zumindest darin glich, dass sie schwarze Haare und schwarze Augen hatte. Dann wühlte ich in meinen Sachen und fand schließlich ein Spitzentüchlein, mit meinem Monogramm bestickt, das Matildas Mutter mir einmal zum Geburtstag geschenkt hatte. Als Erinnerungsstück war es mir lieb, und ich glaubte, es sei deshalb wertvoll genug, dass die Madonna es als Geschenk annehmen würde. Einen Augenblick erwog ich, ihr meine Puppe zu schenken, aber nach einigem Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass sie ja eine Puppe nicht gebrauchen konnte, da das Jesuskind ein Junge war und gewiss nicht mit Puppen spielte.
Am nächsten Morgen hüpfte ich an der Hand meiner Tante aufgeregt der Kirche entgegen. Mein Leiden würde bald ein Ende haben. Ich würde der Madonna Matildas Bild zu Füßen legen und ihr das Spitzentuch versprechen, und sie würde mich zu Matilda zurückführen.
Die Kirche war eine bittere Enttäuschung. Schon in dem Moment, als ich sie betrat. Sie glich weder jenem goldenen Festsaal des Wallfahrtsortes noch der mosaikbeglänzten Düsternis der Dorfkirche, in der ich sonntags neben Matilda gekniet hatte. Sie war ein einfacher lang gestreckter Bau, im Inneren waren Decke und Wände weiß getüncht, die Pfeiler aus rohem Backstein. Dieser Farbkontrast war der einzige Schmuck der Kirche, abgesehen von dem riesigen Kreuz, das über dem Altar hing und in grässlichem Realismus den gefolterten Leib eines Toten darstellte, dessen Kopf mit geschlossenen Augen zur Seite hing: Wangen und Stirn waren blutüberströmt, Hände und Füße nageldurchbohrt, ein Loch klaffte in der linken Seite.
Während ich neben meiner Tante saß, wandte ich den Kopf von einer Seite zur anderen, rutschte hin und her und reckte mich. Es musste doch in dieser Kirche irgendwo eine Statue der Madonna geben, der ich mein Opfer bringen konnte.
Meine Tante ermahnte mich flüsternd zur Ruhe, und als das nichts half, kniff sie mich schmerzhaft in den Arm und drohte mir, ich müsse mein Essen allein auf meinem Zimmer einnehmen, wenn ich mich nicht benehmen würde.
Am Ende eines Gottesdienstes, in dem laut und falsch gesungen wurde und ein schwarz gekleideter, rotgesichtiger Herr eine lange Predigt hielt, von der ich nichts verstand, führte meine Tante mich durch den Mittelgang endlich ins Freie. Ich war froh, dem Anblick des Toten zu entkommen. An der Kirchentür stand der Prediger und begrüßte meine Tante.
Sie stellte mich vor.
«Meine Nichte, Katerina von Echternberg, die Tochter meines verstorbenen Bruders.»
Der Pastor neigte sich zu mir herunter, sodass ich sehen konnte, wie sein grauer Haarkranz die rosige Kahlheit auf seinem Kopf umrahmte.
«Nun, kleines Fräulein, gefällt dir unsere Kirche?»
«Nein», sagte ich prompt.
«Warum denn nicht?», fragte er.
«Es gibt keine Madonna, die ich um etwas bitten kann», sagte ich.
Meine Tante schnaubte.
«Sie hat bisher in Italien gelebt. Da hat man ihr den Kopf mit diesem papistischen Unsinn voll gestopft.»
«Du brauchst keine Madonna», sagte der Pastor, «wenn du etwas erbitten willst, dann wende dich nur immer gleich an Gott. Er kennt dich gut, er sieht dich bei Tag und bei Nacht, auch im Dunkeln und unter der Bettdecke, und wenn du ein braves Mädchen bist und seine Gebote einhältst, dann magst du ihn auch um etwas bitten.»
Ich ging mit hängendem Kopf nach Hause. Meine Augen brannten, aber die erlösenden Tränen wollten nicht fließen. Ich fühlte mich so verlassen wie in der Minute meiner Ankunft auf Warstede.
3
Es ist ein sonderbares Ding, das Gedächtnis. Nur über Eisenbahnen hatte ich mit der Fürstin reden wollen, ein neutrales Thema, zu dem sie, die Weitgereiste, viel mehr beitragen konnte als ich, Stichwortgeberin hatte ich sein wollen für ihren Monolog, hinter dem ich mich dann hätte verstecken können. Stattdessen war ich in das Dickicht meiner Vergangenheit geraten. Ich fürchtete die Gewächse hier. Wenig duftende Rosen, aber viel scharfes Gezweig, das die Haut aufritzte, manche Dornen so tief, dass die Wunde blutete.
Ich hätte von der Zukunft sprechen sollen, nicht von der Vergangenheit. Aber es war zu spät. Ich hatte angefangen zu erzählen, und Jelena Sergejewna war nur zu bereit, mich weiter zu begleiten. Alles, was mir blieb, war der Versuch, mich zwischen sie und die Dornensträucher zu stellen. Nicht alles, was an Erinnerungen in mir auftauchte, war für sie bestimmt. Ich würde mich sehr beherrschen, was das Reden betraf. Wenn ich mich nur mit derselben Kontrolle auch vor den Bildern schützen könnte, die in meinem Kopf erschienen!
«Ich verstehe gut, wie trist Ihnen Preußen vorkommen musste. Es ist freilich ein sprödes Land und ohne die heitere Festlichkeit Italiens. Kein Land, in dem Amoretten sich als Engel verkleiden und die Pfarrer ihr Wissen um die Sünde lächelnd in Rotwein versenken. Ein Land, in dem die Geistlichen vorwiegend aus dem Alten Testament zitieren und die Zehn Gebote schon den Wickelkindern einimpfen.»
«Der Pastor von Warstede kannte noch ein elftes Gebot, und er wurde nicht müde, es Sonntag für Sonntag von der Kanzel zu verkünden: Du sollst deiner Obrigkeit dienen mit Leib und Seele und niemals wider den Stachel löcken. Die Obrigkeit – das war für mich meine Tante, denn mein Cousin war bei seinem Regiment und tauchte nur zu kurzen Besuchen auf – und meine Tante blieben für mich immer diese Mischung aus Bohnerwachs und Kampfer und schwarzen Kleidern. Mein erster Eindruck verschärfte sich eher, als ich sie näher kennen lernte. Die Dienstboten hatten Angst vor ihren scharfen Augen und ihren schneidenden Worten, und die Landarbeiter nahmen die Mütze ab, wenn sie vorbeikam, und verbeugten sich tief. Sie hatte Macht, die Macht der schwarzen Königin aus Matildas Märchen, und ich schwöre Ihnen, Jelena Sergejewna, wo sie vorbeiging, verdorrten die Blumen.»
Als ich jetzt Luft holte, schüttelte die Fürstin den Kopf.
«Immer noch so verbittert? Kein Erbarmen mit dieser Frau?»
Ich starrte sie an.
«Erbarmen? Mit dieser Zuchtmeisterin? Die kein Lachen, keine Schönheit, keinen Geist kannte, nur Härte, Nüchternheit und Nützlichkeit? Erbarmen mit ihr, die eine Kinderseele im Korsett der Wohlanständigkeit zu Tode schnüren wollte? Hatte sie denn auch nur eine Spur Mitleid mit mir?»
Jelena Sergejewna füllte den Flaschendeckel voll Wodka und bot ihn mir an. Ich schüttelte den Kopf, und sie leerte ihn selbst in einem Zug.
«Sie sind doch jetzt alt genug, Katja, um zu wissen, was eine Frau dazu bringt, so zu versteinern.»
«Mangel an Liebe, meinen Sie? Kaum. Ich habe gehört, dass mein Onkel – der bei Sedan gefallen war – sie aus Liebe geheiratet hat. Sie hatte einen Sohn, den sie lieben konnte und der sie wieder geliebt hätte, statt sie nur zu respektieren. Das war es, was sie wollte. Sie wollte Respekt, nicht Liebe. Sie wusste gar nicht, wie man das Wort buchstabiert, glaube ich. Ich habe es nie aus ihrem Munde gehört.»
Die Fürstin lächelte.
«Ach, Katja, seien Sie doch nicht so dumm. Ihre Tante hatte Angst.»
«Angst?»
«Natürlich. Sie hat in sich und bei Ihnen alle Gefühle unterdrückt, vor denen sie selbst Angst hatte. Das Korsett ist ein wirksames Instrument. Es schnürt das Fleisch ein und hält es in Form. Wenn man es öffnet, dann quillt alles heraus, bordet über, kennt keine Grenzen mehr, und vielleicht kann man es niemals wieder bändigen. Sie fürchtete das Überwältigtsein durch das Gefühl als Katastrophe, und wer weiß, ob sie nicht einmal in ihrem Leben einer solchen Katastrophe nur knapp entgangen ist. Ihre Respektabilität war der Damm gegen die zerstörerischen Fluten, vor denen sie sich und Sie bewahren wollte.»
«Mit liebloser Härte.»
«Natürlich. Dämme werden aus Steinen errichtet. Ihre Tante hat es aber nicht fertig gebracht, Sie zu einem so musterhaften Exemplar einer Preußin zu erziehen, wie sie es selber war.»
«Nein. Ich hatte einen Fluchtweg, von dem sie nichts ahnte. Die Bücher. Meine Tante, die selbst nur die Bibel las, hatte zu wenig Phantasie, um sich vorzustellen, welchen Fluchtweg Bücher eröffnen können. Sobald ich lesen gelernt hatte, war ich stundenlang frei.
Es gab keine Schule im Dorf. Die Grundbegriffe des Lesens, Schreibens und Rechnens erlernte ich im Pfarrhaus, wo die Pastorsfrau, die früher Gouvernante gewesen war, mich mit ihren beiden Töchtern unterrichtete. Später verbrachte ich die Werktage in einer Mädchenpension in der kleinen Stadt in unserer Nähe. Dort gab es ein Bildungsinstitut für höhere Töchter, eine kleine Villa, in der uns die Vorsteherin mit ihrer Schwester und zwei oder drei anderen Lehrkräften beibrachte, was sich für Mädchen unseres Standes zu lernen schickte. In Gesellschaft der Töchter des Arztes, des Apothekers und einiger Gutsnachbarn lernte ich Französisch, singen, aquarellieren, verbesserte mein Klavierspiel und bekam Tanzstunden – natürlich ohne die Anwesenheit von jungen Männern als Übungspartner. Sonntags und in den Ferien fuhr ich nach Warstede, und meine Tante prüfte, was ich gelernt hatte.»
4
An diesem Institut gab es einen Lehrer für Französisch und Deutsch, Richard Allbrook. Er war kein junger Mann mehr, war groß und fett, ohne ein einziges Haar auf seinem glänzenden Schädel. Aber er hatte schöne, dunkle, brennende Augen. Er unterrichtete uns ohne Geduld, verlangte, dass wir nicht nur sauber, sondern auch schön schrieben, und ließ uns das besonders an Gedichten üben. Wer sich verschrieb oder einen Vers schlecht sprach, forderte einen Ausbruch homerischen Zornes heraus. Seine Lieblingsdichter waren die Romantiker. Es dauerte nicht lange, da bemerkte er, dass die Verse über die Sehnsucht mich vor allen anderen besonders berührten. So behielt er mich manchmal länger in der Schulstube, sprach noch über das eine oder andere Gedicht, und ich erzählte ihm von meiner Herkunft aus Italien. Das war der Beginn einer geheimen Freundschaft zwischen uns. Er lieh mir Bücher, wie ich sie in Warstede nicht fand. Dort gab es zwar einen Raum, der Bibliothek genannt wurde, der einzige Bücherschrank enthielt aber neben illustrierten Werken über die Jagd nur den Gotha, den Hofkalender und eine Biographie der Königin Luise.
Nachdem ich Eichendorff gelesen hatte, lieh er mir Novellen von Ludwig Tieck, Achim von Arnim, Gottfried Keller und C.F. Meyer. Je älter ich wurde, desto größer wurde mein Hunger nach anspruchsvoller Lektüre. Schließlich gab er mir – das Äußerste an Kühnheit – auf mein Drängen sogar Dramen Schillers zu lesen. Mit glühenden Wangen las ich an einer abgelegenen Stelle im Park «Die Jungfrau von Orleans» und wünschte mich an Johannas Stelle. Das Land zu verlassen, das Schwert zu ergreifen und ein Königreich zu retten, das schien mir das erstrebenswerteste Ziel. Schließlich gedieh meine heimliche Beziehung zu Allbrook so weit, dass er mir sogar die Gedichte zeigte, die er selbst geschrieben hatte, Verse von dunkler rätselhafter Schönheit über Krieg, Tod und Untergang.
So setzte ich Tante Hermines Nüchternheit insgeheim ein Reich der Phantasie und der Freiheit entgegen, und ihre Dressur zu einer protestantischen Landedelfrau, der sie mich unterwarf, blieb eine äußerliche.
Nach meiner Konfirmation wurde erwogen, mich in ein Pensionat zu geben, in dem ich zusammen mit hochgeborenen Töchtern den so genannten letzten Schliff erhalten würde.
Meine Tante fragte nicht mich nach meiner Meinung dazu, sondern meinen Cousin Wilhelm, der aus Berlin angereist war. Er hatte es inzwischen zum Hauptmann der Gardedragoner gebracht, kaschierte eine beginnende Stirnglatze damit, dass er sich Haarsträhnen ins Gesicht kämmte, und hatte sich eine abgehackte, schnarrende Sprechweise angewöhnt.
«Pensionat wichtig. Trifft da Töchter aus den besten Familien. Wird eingeladen. Findet einen Ehemann.»
Meine Tante hielt ihm vor, dass ein Pensionat teuer sei.
«Wovon sollen wir das bezahlen? Das Kind – Gott sei es geklagt – hat keinerlei eigenes Geld. Mein Bruder hat nichts als Schulden hinterlassen, und von der Familie ihrer Mutter – nun, da kann man nichts erwarten.»
«Trotzdem. Sind es uns schuldig», widersprach mein Cousin, «Familientradition.»
«Es ist die Frage, ob Katerina überhaupt von einem vornehmen Pensionat akzeptiert wird», gab meine Tante zu bedenken, «sie trägt zwar einen guten alten Namen, aber der Skandal ist durchaus noch nicht vergessen, das kannst du mir glauben. Jedermann wird die alte Geschichte wieder ausgraben. Katerina wird nicht als eine Echternberg gelten, sondern als die Tochter dieser Person.»
Mein Cousin nahm eine Prise Schnupftabak und schwieg nachdenklich.
«Außerdem ist die Frage ihrer Heirat so einfach nicht zu behandeln», fuhr meine Tante fort, ihren Vorteil wahrnehmend, «ein Mädchen ohne Mitgift und mit ihrer Herkunft hat keine Aussicht, in eine der großen Familien einzuheiraten. Daher ist das Geld für ein teures Pensionat rausgeworfen.»
«Was denn dann?»
«Vielleicht fragt mich einmal jemand, was ich will», sagte ich.
Mein Cousin und meine Tante drehten sich zu mir um. Tante Hermines Gesicht war gerötet vor Ärger, mein Cousin hob voller Erstaunen sein Monokel ans Auge.
«Und? Was willst du?«, fragte er.
Ich wusste, was ich wollte. Einen Beruf, der mich unabhängig machte und in dem ich lesen konnte, so viel ich wollte.
«Ich will überhaupt nicht heiraten. Ich will auf das Lehrerinnenseminar und später unterrichten. Dann kann ich mir mein Geld selbst verdienen.» Und dann fügte ich noch wütend hinzu: «Und euch jeden Pfennig zurückzahlen, den ihr für mich ausgelegt habt.»
«Da spricht der schiere Undank», sagte meine Tante, und mein Cousin erledigte meinen Plan mit der knappen Bemerkung:
«Eine Echternberg arbeitet nicht.»
Wäre ich ein Junge gewesen, hätte ich mich als blinder Passagier an Bord eines Schiffes nach Amerika geschlichen und wäre dort vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestiegen. Zurückgekehrt, hätte ich entdeckt, dass Warstede überschuldet war und die Auktion bevorstand. Ich hätte das Gut ersteigert und meiner Tante mit großer Geste erlaubt, für immer dort zu wohnen, abhängig von meiner Gnade.
Leider war ich ein Mädchen.
Ich fragte Richard Allbrook, was ich tun könnte.
«Nichts», sagte er, «solange Sie nicht mündig sind, können Sie gar nichts tun. Sie haben nur das Recht, nein zu sagen, wenn man Sie mit einem bestimmten Mann verheiraten will.»
«Und wenn ich mündig bin?»
«Dann können Sie fortgehen und Ihr eigenes Leben führen. Aber es ist schwer zu sagen, wie Sie das tun sollen, ohne über eigenes Geld zu verfügen. Jede Ausbildung kostet Geld.»
«Andere Frauen arbeiten auch.»
«Ja, aber das sind keine Gräfinnen», erwiderte er.
Es war die schlichte Wahrheit. Ich war zu vornehm, um arbeiten zu können, und zu arm, um einen eigenen Hausstand zu gründen, und so konnte ich nur in Warstede sitzen und abwarten. Drei Lösungen gab es für mein Leben: Entweder fand ein Bewerber ins Haus, dessen Antrag ich akzeptierte, oder ich würde eine alte Jungfer werden, die in Warstede dahinwelkte, meinem Cousin und seiner künftigen Frau und ihren Kindern zur Last. Oder ich fand – trotz meiner Abstammung von «der Person» – ein Damenstift, das mich aufnahm, wo ich den Rest meines Lebens in Gesellschaft anderer Sitzengebliebener mit Stricken für die Mission, dem Backen von Apfelkuchen für das Kirchweihfest und dem Eindicken von Holunderbeersaft für die Stiftsküche verbringen würde.
«Und wenn ich durchbrenne und zum Theater gehe und einen falschen Namen annehme? Schließlich war meine Mutter Tänzerin. Was sie konnte, kann ich auch.»
Allbrook winkte ab.





























