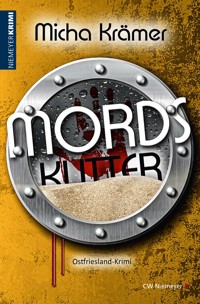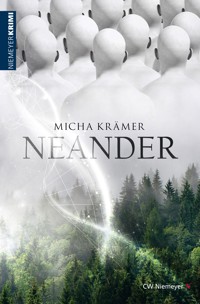
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach einem Discobesuch im Jahr 1991 verschwindet die 17-jährige Sabine Schiller spurlos. Dreiundzwanzig Jahre später tritt die junge Humangenetikerin Dorothea Mühlflug eine Stellung in einem geheimen unterirdischen Forschungslabor im Westerwald an. Schnell wird ihr klar, dass ihre Kollegen nicht nur an Primaten die Möglichkeiten einer neuen menschlichen Evolutionsstufe erforschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über den Autoren
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Nachwort
MICHA KRÄMER
NEANDER
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2016 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-9792-4
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing
www.ansensopublishing.de
Die Geschehnisse in diesem Roman sind reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Über den Autoren:
Micha Krämer wurde 1970 in Kausen, einem kleinen 700 Seelen Dorf im nördlichen Westerwald, geboren. Dort lebt er noch heute mit seiner Frau, zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen und seinem Hund. Der regionale Erfolg der beiden Jugendbücher, die er 2009 eigentlich nur für seine eigenen Kinder schrieb, war überwältigend und kam für ihn selbst total überraschend. Einmal Blut geleckt, musste nun ein richtiges Buch her. Im Juni 2010 erschien „KELTENRING“, sein erster Roman für Erwachsene, und zum Ende desselben Jahres folgte sein erster Kriminalroman „Tod im Lokschuppen“, der die Geschichte der jungen Kommissarin Nina Moretti erzählt. Was als eine einmalige Geschichte für das Betzdorfer Krimifestival begann, hat es weit über die Region hinaus zum Kultstatus gebracht. Inzwischen findet man die im Westerwald angesiedelten Kriminalromane in fast jeder Buchhandlung im deutschsprachigen Raum.
Neben seiner Familie, dem Beruf und dem Schreiben gehört die Musik zu einer seiner großen Leidenschaften.
Mehr über Micha Krämer auf www.micha-kraemer.de
Für meinen Papa, der den Kampf gegen den Krebs verlor, während ich dieses Buch schrieb.
Danke
PROLOG
24.12.2013, 23:04 Uhr
Westerwald
Sie rannte so schnell sie nur konnte. Der Schnee unter ihren nackten Füßen war eiskalt und schmerzte bei jedem Schritt. Das Laufen fiel ihr so schwer. Sie wusste nicht, wie lange es her war, dass sie ihre Beine zuletzt benutzt hatte. Doch es ging. Es ging sogar besser als erhofft. Die Bewegungen schienen in ihrem Kopf gespeichert gewesen zu sein. Sie musste nichts dafür tun. Nicht überlegen. Sie musste einfach nur weiter wollen. Alles andere erledigten ihre Beine ganz automatisch für sie.
Immer wieder peitschten Äste aus der Dunkelheit heraus über ihr Gesicht. Kurz hielt sie inne und lauschte in die Nacht. Das Kläffen der Hunde schien näher zu kommen. Wie besessen stolperte sie weiter. Schritt für Schritt. Dornen griffen nach ihr, schnitten tief in ihre Haut, rissen an dem dünnen, durchnässten Hemd und brachten sie mehrfach zu Fall. Doch sie rappelte sich immer wieder auf. Weiter. Sie musste weiter. Fort von hier und all dem Wahnsinn. Dass ihr die Flucht überhaupt gelungen war, grenzte an ein Wunder, das sie selber kaum verstehen konnte. Dann war der Wald plötzlich zu Ende. Sie stand auf freiem Gelände. Die Schneekristalle glitzerten im Schein des Mondes.
In der Ferne entdeckte sie die Umrisse von Gebäuden, in denen sogar Licht brannte. Sie blieb stehen und rang nach Atem. Ihre Lungen füllten sich mit der klaren, eisigen Luft. Auf seltsame Weise war es schön. So also roch die Freiheit. Ein längst vergessener Geruch. Wie lange es wohl her war, seit sie ihn zuletzt wahrgenommen hatte? Vielleicht Tage, Monate oder gar Jahre? Sie hatte keine Ahnung.
Angestrengt starrte sie zurück. In der Dunkelheit des Waldes bewegten sich die Kegel von einigen Taschenlampen hektisch hin und her. Das Gebell wurde lauter. Verzweifelt sah sie sich um und rannte dann in Richtung der Häuser. Den Schlag, als die Kugel ihre Schulter durchschlug, spürte sie bereits, bevor sie den Schuss hörte. Sie strauchelte und stürzte in den knöcheltiefen Schnee. Die Stelle an ihrer Schulter wurde warm. Sie tastete nach der Wunde und fühlte die klebrige Flüssigkeit, die der Stoff des Hemdes in sich aufsog. Dann kam der Schmerz. Langsam, pochend, immer heftiger. Mühsam raffte sie sich auf. Sie musste weiter. Immer weiter. Die endgültige Freiheit war doch fast zum Greifen nahe. Doch es war zu spät. Ihre Verfolger waren fast bei ihr. Die Kraft, mit der der Hund sie zurück zu Boden riss, die Gewalt, mit der sich seine Zähne in ihr Fleisch bohrten, war unfassbar. Und es tat so weh. So fürchterlich weh, dass sie sich den schnellen Tod nun herbeisehnte. Dann wäre sie endlich wieder frei.
KAPITEL 1
10.08.1991, 20:52 Uhr
Montabaur, Westerwald
Mit einem lauten Krachen fiel die Haustür ins Schloss. Diese blöden Spießer, die hatten doch überhaupt keine Ahnung. Warum behandelten die sie so? Schließlich war sie kein Kind mehr, das man herumschubsen konnte und dem man sagen musste, was richtig oder falsch war. Was für sie gut war oder nicht, das konnte sie wohl allein am besten entscheiden. Sabine Schiller stülpte den Helm über, setzte sich auf ihre alte Zündapp und trat das Mofa wutentbrannt an. In zwei Monaten würde sie achtzehn werden und endlich ausziehen können. Wohin, wusste sie nicht. Das war auch egal, Hauptsache weg von ihren rechthaberischen Eltern. Am liebsten in Richtung Limburg, wo sie seit einem Jahr eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin absolvierte. Sie würde damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens entkäme sie endlich der Bevormundung ihrer Eltern und zweitens könnte sie morgens länger ausschlafen. Die einstündige Fahrt mit dem Bus nervte schon gewaltig. Jeden Morgen eine Stunde hin und nachmittags wieder eine Stunde zurück. Mit dem Auto, über die A3, waren es bis Limburg noch nicht mal zwanzig Minuten, aber der blöde Omnibus musste ja in jedem der doofen Westerwaldkäffer auf der Strecke anhalten. Im Augenwinkel bemerkte sie ihren Vater, der mit hochrotem Kopf nun in der Haustür stand und ihr irgendetwas hinterherschrie. Sollte er doch. Ihretwegen konnte er schreien, bis er schwarz wurde. Sabine drehte mehrmals am Gashebel. Der Zweitakter röhrte rhythmisch. Dann legte sie den ersten Gang ein, ließ die Kupplung kommen und schoss aus der Einfahrt auf die Straße. Je weiter sie sich von ihrem Elternhaus entfernte, desto besser fühlte sie sich und desto mehr beruhigte sie sich. Ginge es nach ihren Eltern, müsste sie heute Abend brav mit ihnen zu Hause hocken und Scrabble spielen. Familienabend. Pah, ihre Familie konnte sie mal. Heute war Freitag. Freitags ging man aus. In die Diskothek nach Elz. Zu Hause hocken und Scrabble spielen konnte sie später im Altenheim genug. Sie war jung und wollte unter Menschen sein, und wenn ihre Eltern das nicht kapierten, dann war das deren Pech. Der Tacho des Mofas bewegte sich zitternd auf die fünfzig zu. Sabine musste grinsen. Die zwanzig Mark, die sie Tobi und Mark gegeben hatte, damit die beiden die alte Kiste ein wenig frisierten, hatten sich gelohnt. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrrads mit Hilfsmotor hatte sich tatsächlich verdoppelt. So kam man wenigstens voran. In Malmeneich bog sie auf die B8 in Richtung Elz ab. Es dämmerte bereits, und als sie das Stück durch den Wald kurz vor Elz fuhr, war sie froh, dass Tobi noch am Nachmittag das Birnchen in dem kleinen Scheinwerfer ausgetauscht hatte. Schnell wie der Wind schoss die alte Zündapp das leichte Gefälle hinunter und um ein Haar wäre sie an der Abbiegung zum Industriegebiet, in dem sich die Diskothek Anyway befand, vorbeigerauscht.
Vor der Disco wartete Annika auf sie. Annika lernte, genau wie Sabine, Zahnarzthelferin und genau wie sie, war die Freundin nun im zweiten Lehrjahr. Allerdings bei der Konkurrenz, wenn es so etwas bei Ärzten gab. Sie beide kannten sich aus der Berufsschule. Annika war ein Jahr älter als sie und wohnte seit Kurzem mit André, ihrem neuen Freund, in einer kleinen Wohnung mitten in der Limburger Innenstadt. Ein Zustand, von dem Sabine nur träumen konnte. Eine eigene Wohnung, natürlich in ihrem Fall ohne André, da der Typ ein Idiot war. Sie selber war derzeit solo. Wobei derzeit vielleicht nicht der richtige Ausdruck war, da sie bisher noch nie mit einem Jungen gegangen war. Es war halt noch nicht der Richtige dabei gewesen.
Sie musste an Tobi denken. Eigentlich fand sie den Sohn ihrer Nachbarin nett. Tobi hatte sie auch neulich erst gefragt, ob sie mit ihm gehen wollte, doch Sabine hatte sein Angebot ausgeschlagen. Tobi war fünfzehn, also zwei Jahre jünger als sie. Außerdem kannten sie sich schon ewig. Er war mehr wie ein kleiner Bruder für sie. So etwas ging doch gar nicht.
Annika lehnte lässig an Andrés altem Opel Ascona und zog an einer Zigarette. Sabine parkte das Mofa direkt daneben, stieg ab und begrüßte die Freundin mit einer Umarmung. Dann deutete Annika auf André, der einige Meter entfernt mit zwei Jungs bei einem tiefergelegten VW Golf stand und wild gestikulierte.
„Siehst du den Typ mit dem schwarzen Hemd?“, flüsterte sie verschwörerisch.
Natürlich sah Sabine ihn. Der Zwei-Meter-Kerl mit dem hellblonden Bürstenschnitt war schließlich nicht zu übersehen.
„Was ist denn mit dem?“, hakte sie deshalb nach.
Annika kicherte und flüsterte dann: „Das ist Volker, ein Freund von André. Er ist momentan solo.“
Sabine verstand nicht.
„Na und? Ich dachte, André wäre deine große Liebe?“
Annika verdrehte die Augen.
„Klar, du Dummchen. Ich dachte da ja auch eher an dich.“
Sabine schüttelte energisch den Kopf.
„Quatsch. Spinnst du? Was soll ich denn mit so ’nem alten Sack? Der ist doch schon mindestens Ende zwanzig.“
Annika schüttelte den Kopf.
„Mensch Bine, besser ’nen richtigen Kerl, der zehn Jahre älter ist, als so einen Milchbubi wie diesen Tobi.“
In diesem Moment ärgerte sich Sabine, der Freundin von Tobi erzählt zu haben. Aber sie hatte vermutlich recht. Dieser Volker besaß immerhin ein Auto und so ganz hässlich war er auch nicht. Annika nahm ihr den Helm ab, warf ihn auf den Beifahrersitz des Opel Ascona und zog sie mit zu den jungen Männern. Dort angekommen, stellte sie Sabine vor. Dieser Volker war, aus der Nähe gesehen, noch weniger ihr Typ als André. Trotzdem ließ sie sich nachher von ihm, als sie endlich in der Disco waren, aushalten. Volker konnte quatschen wie ein Wasserfall. Das Wichtigste in seinem Leben schien die Bundeswehr zu sein. Dicht dahinter kam sein Golf GTI, von dem er ununterbrochen sprach. Sabine wusste noch nicht mal, was das ganze Auto-Chinesisch bedeutete. Zwar hatte sie Begriffe wie Nockenwelle und Einspritzpumpe schon einmal gehört, aber wo die Teile hingehörten, war ihr schleierhaft und eigentlich auch ziemlich egal. Tanzen war für den Typen ein Fremdwort. Dazu kam, dass er sein Bier schneller herunterkippte als er nachbestellen konnte. Sie hingegen trank nur Cola.
Als sie gegen halb zwölf auf die Uhr sah, torkelte Volker gerade Richtung Toilette. Sie hatte nicht unhöflich sein wollen, trotzdem sah sie nun ihre Chance. Sie schaute sich um – er war nirgends zu sehen. Annika stand einige Meter entfernt mit André an einem Pfeiler und knutschte. Sie ließ das halb volle Glas auf dem Tresen stehen. Die letzte Coke hatte eh merkwürdig bitter geschmeckt. Dann schob sie sich durch die Menge zu der Freundin, tippte ihr auf die Schulter und schrie gegen das Dröhnen der Lautsprecherboxen: „Ich brauche meinen Helm.“
Annika sah sie verwirrt an.
„Warum? Willst du etwa schon los?“
Sabine nickte nur. Annika löste sich von André und beide gingen in Richtung Ausgang. Die frische Luft, die Sabine entgegenschlug, als sie endlich ins Freie trat, tat gut. Obwohl sie nur Cola getrunken hatte, war ihr fürchterlich komisch. Sie fühlte sich schwindlig und leicht benommen.
„Ach Mensch, Bine“, maulte Annika. „Du willst doch nicht schon nach Hause?“
Sie antwortete nicht, sondern ging schnurgerade auf den Ascona zu. Sie wollte nach Hause, einfach nur nach Hause in ihr Bett. Und das sofort!
„War der Typ denn so schlimm?“, hörte sie Annika hinter sich fragen.
Sabine blieb stehen und wirbelte herum. Dabei wurde ihr so schwindelig, dass sie beinahe gestürzt wäre.
„Nee, noch schlimmer. Der Freak hat mich über zwei Stunden lang nur von seiner blöden Karre vollgelabert!“
Annika verdrehte die Augen.
„Mann Bine, so sind die Typen alle, da gewöhnst du dich schon dran. Das hört auf, wenn du mit ihnen das erste Mal in der Kiste gewesen bist. Danach entwickeln die auf einmal ganz andere Interessen.“
Sabine glaubte, sich verhört zu haben. Niemals würde sie mit so einem Proll wie diesem Volker in die Kiste gehen. Allein der Gedanke daran ekelte sie.
„Gib mir den Helm. Ich muss nach Hause“, erklärte sie nun entschlossen und ging die letzten Schritte zu dem Opel.
Dabei blinzelte sie immer wieder mit den Augen. Verflucht, warum sah sie denn plötzlich alles so verschwommen?
„Sach ma, hast du was getrunken?“, erkundigte sich Annika, als sie ihr den Motorradhelm reichte.
Sie klang nun besorgt. Sabine schüttelte den Kopf.
„Nein, ich bin nur müde.“
„André kann dich fahren“, schlug die Freundin vor.
Sabine lehnte ab. Sie würde einfach das Visier auf lassen. Das Einzige, was ihr jetzt fehlte, war frische Luft. Sie stieg auf die Zündapp, drehte den Schlüssel um und trat den Motor an.
Als sie auf die Bundesstraße abbog, musste sie trotz der enormen Konzentration, die die Fahrt in der Nacht ihr heute abverlangte, an Tobi denken. Sie wünschte sich in diesem Moment so sehr jemanden zu haben, der ihr zuhörte und mit dem sie reden könnte. Vielleicht sollte sie doch mit ihm gehen? Was waren schon zwei Jahre Altersunterschied? In dem zitternden Rückspiegel nahm sie die Scheinwerfer eines Autos wahr, das einige Hundert Meter hinter ihr den Berg hinaufkroch, aber, wie es schien, nicht näher kam. Immer wieder sah sie von nun an in den Rückspiegel. Waren das die Bullen? Schauten die etwa, wie schnell sie fuhr? Verdammt, wenn die Polizei sie mit dem frisierten Mofa anhielt, konnte sie ihren Autoführerschein mit achtzehn vergessen. Einem Freund war es ähnlich gegangen. Zu allem Übel, wurde mit jedem Meter, den sie fuhr, das Schwindelgefühl stärker. Kurz vor Malmeneich passierte es dann. Sie verlor die Kontrolle über das Zweirad und rammte einen der Leitpfosten rechts am Fahrbahnrand. Sie merkte noch, wie sie durch die Luft flog und unsanft im feuchten Gras landete. Dann verlor sie das Bewusstsein.
*
Als Sabine wieder zu sich kam, lag sie in einem Bett. Dass es nicht ihr eigenes war, merkte sie sofort. Noch immer sah sie nur verschwommen. Alles um sie herum schien sich zu drehen und zu wanken. Verflucht, wo war sie? Der Raum, in dem sie sich befand, lag im Halbdunkel. Rechts neben sich erkannte sie einige Apparate und einen Monitor, dessen heller Bildschirm die einzige Lichtquelle zu sein schien. War das ein Krankenhaus? Ja, das könnte sein. Natürlich! Sie befand sich in einer Klinik. Das Mofa fiel ihr ein – der Sturz. Sie musste sich bei dem Sturz verletzt haben, das Bewusstsein verloren haben und dann von einer Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Sie versuchte sich zu bewegen, doch es ging nicht. Panik überkam sie. Sie würde schreien. Schreien so laut sie konnte. Aber auch dieser Versuch scheiterte. Kein Wort kam über ihre Lippen. Sie war nicht Herr über ihren Körper. Er gehorchte ihr nicht mehr. Sie bemerkte, wie sich eine Tür an der Wand rechts von ihr öffnete. Dann trat eine Gestalt in ihr Blickfeld. Noch einmal versuchte sie, etwas zu sagen. Der Mann, es handelte sich eindeutig um einen Mann, trug einen grünen Kittel und einen Mundschutz. Mehr konnte sie nicht erkennen. Noch immer tanzten Nebelschleier vor ihren Augen hin und her. Sie spürte, wie der Fremde ihre Augenlider anhob und es daraufhin gleißend hell wurde. Erst an ihrem rechten, dann an ihrem linken Auge. Durch das Piepen der Apparate nahm sie noch ein anderes Geräusch wahr. Es klang wie Pfeifen. Irgendwer pfiff eine ihr bekannte Melodie, einen Schlager aus den Siebzigern, den ihre Mama in der Küche öfters sang. O la Paloma Blanca. Das Pfeifen schien von dem Mann in dem grünen Kittel zu stammen. Sie spürte, wie er ihren Arm griff, dann den stechenden Schmerz einer Nadel. Unmittelbar danach wurde der Nebel dichter. Die Dunkelheit nahm zu und Sabine entfernte sich immer mehr von ihrem Körper.
KAPITEL 2
Montag 30.12.2013, 16:36 Uhr
ICE Köln/Frankfurt
Es war faszinierend, zu sehen, wie schnell die Ortschaften in der kargen Landschaft des Westerwaldes an dem Fenster des ICE von Köln nach Frankfurt vorbeiflogen. Andererseits war es auch fürchterlich langweilig. Das Bild hinter der Scheibe war immer das gleiche. Öde Landschaft und Schnee. Die Faszination lag demnach mehr in der Tatsache, dass sie es immer noch nicht glauben konnte, überhaupt hier zu sein. Hier, auf dem Weg in einen neuen Abschnitt ihres Lebens. Einem Abschnitt, von dem sie nicht viel mehr wusste, als dass er mit Verspätungen und kleineren Umwegen begann. Etwas, das nicht nur für die Zugfahrt an sich galt.
In Köln war sie umgestiegen. Der ICE, mit dem sie aus Hamburg gekommen war, hatte wegen eines Oberleitungsschadens über zwei Stunden Verspätung gehabt. Ihr Anschlusszug war natürlich schon weg gewesen. Auf den nächsten Zug, der auch in Montabaur hielt, musste sie dann ganze zweieinhalb Stunden warten. Sie war nunmehr fast acht Stunden unterwegs und seit gut und gerne zwölf Stunden auf den Beinen. Es war halb fünf am Nachmittag, draußen dämmerte es bereits und ihre innere Anspannung war kurz davor, sie förmlich zu zerreißen. Als wäre dies nicht genug, kamen auch immer wieder Selbstzweifel in ihr auf. War das, was sie gerade tat, richtig?
Thea ließ die Landschaft Landschaft sein, schüttelte die lästigen Zweifel ab und sah sich suchend um. Sie musste sich ablenken. Etwas anders denken und ihre wirren Gedanken ordnen. Ihr Blick wanderte zu dem Krimi, der auf dem kleinen Tisch vor ihr lag und den sie sich spontan in der Kölner Bahnhofsbuchhandlung gekauft hatte. Nein, lesen mochte sie nicht mehr. Es würde sich auch nicht mehr wirklich lohnen, da ihre Reise in diesem Zug sowieso gleich zu Ende war. Ihr Augenmerk fiel auf einen Mann, der schräg vor ihr auf der anderen Seite des Ganges, gegen die Fahrtrichtung, saß. Sein grauer Anzug passte perfekt. Er wirkte sportlich, hatte dichtes dunkles Haar mit einem leichten grauen Ansatz an den Schläfen. Er las auf einem Tablet-Computer. Thea schlussfolgerte, dass der Typ also nicht nur gut aussah, sondern auch noch etwas im Kopf haben musste. Zumindest konnte er lesen. Eine nicht ganz alltägliche Kombination in ihrem Leben. Ihr letzter Freund, beziehungsweise ihr Ex-Verlobter, war optisch auch ein Wahnsinnstyp gewesen. Gut aussehend und sogar auf seine Weise intelligent. Dazu adelig. Alles bestens. Könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen. Leider war Jannik aber auch ein riesen Charakterschwein. Hatte lustig auf ihre Kosten in den Tag gelebt und so ziemlich alles begattet, was nicht bei drei auf den Bäumen war, während sie versuchte Geld zu verdienen, damit sie beide über die Runden kamen. Als sie endlich aufwachte und merkte, dass er sie zwei lange Jahre nur belogen, betrogen und ausgenutzt hatte, war ein großer Teil ihres Erbes bereits unter die Räder gekommen. Sie besaß zurzeit noch nicht einmal mehr ein eigenes Auto, geschweige denn eine eigene Wohnung. Dabei war die Eigentumswohnung damals ein Geschenk ihrer Mutter zum bestandenen Abitur gewesen. Okay! Im Grunde besaß sie die Wohnung schon noch. Sie war eben nur für sie im Moment unbewohnbar, da Jannik dort nun mit seiner Neuen, einer gewissen Angie Schliffering, wohnte und vögelte. Der Gipfel der Unverfrorenheit war allerdings, dass diese Ziege nun sogar Dorotheas Mini-Cooper benutzte, während sie selber, mit fast fünf Stunden Verspätung, in der Eisenbahn durch den Westerwald gurkte.
Der Typ gegenüber sah von seinem Tablet auf und schaute in ihre Richtung. Ihre Blicke trafen sich und er lächelte. Machte der sie jetzt an? Dorothea sah demonstrativ weg. Was fiel diesem Kerl ein, sie hier anzumachen? Sicher war er verheiratet oder zumindest in einer festen Beziehung und baggerte nun hier wildfremde Weiber an, während seine Frau vermutlich zu Hause auf ihn wartete. Bestimmt mit drei Kindern, einem Hund und im achten Monat schwanger. Sah sie etwa aus wie Freiwild? Sah man ihr es an, dass sie solo war? Was für ein Arschloch. Diese Typen waren doch alle gleich. Zornig sah sie lieber wieder aus dem Fenster.
Der Zug wurde merklich langsamer. In der Ferne tauchte so etwas wie eine Stadt auf. Sie erkannte das große gelbe Gebäude auf dem Hügel zwischen den Häusern. Schloss Montabaur. Sie hatte Bilder im Internet gesehen, als sie Montabaur gegoogelt hatte. Laut Wikipedia besaß das Städtchen tatsächlich über zwölftausend Einwohner. Also nur unwesentlich weniger als Hamburg, stellte sie sarkastisch fest.
Als der Headhunter sie vor einigen Wochen zum ersten Mal kontaktierte und fragte, ob sie sich vorstellen könnte, einen Job in einer Forschungseinrichtung in der Nähe von Montabaur anzunehmen, hatte sie ihn gefragt, ob es sich bei Montabaur um eine tropische Krankheit handelte. Natürlich war dies ein Witz gewesen, da sie wusste, dass es eine solche Krankheit nicht gab. Aber von Montabaur hatte sie wirklich noch nie gehört.
Obwohl der Zug noch nicht zum Halten gekommen war, stand Thea auf und schaukelte zu ihrem Koffer, der in der Nähe des Ausgangs stand. Die Luft war eisig, als sie ausstieg. Der Bahnsteig fast leer. Die sprichwörtliche Luzie war hier nicht los. Ihr erster Gedanke, als sie vom Westerwald hörte, schien sich zu bestätigen. Trotzdem war sie davon überzeugt, dass ihr Schritt, den Job am Ende der Welt anzunehmen, richtig gewesen war. Sie brauchte Abstand. Von Hamburg, von Jannik, seiner Angie und allem was ihr bisher lieb und teuer gewesen war. Darüber hinaus wurde ihre neue Stelle, hier am Hinterteil der Welt, super gut bezahlt. Ein sechsstelliges Jahresgehalt, von dem sie als junge Doktorin in der Forschung nie zu träumen gewagt hätte. Und das genau in ihrem Spezialgebiet: Humangenetik. Ein Traumjob!
Neben dem Bahnsteigaufzug wartete ein älterer Herr in einem beigen Wintermantel. In der Hand hielt er ein Schild auf dem groß „Dr. Dorothea Mühlflug“ stand. Sie war erleichtert, dass trotz der Verspätung jemand auf sie wartete und die Mail, die sie in Köln von ihrem Handy aus an ihren neuen Arbeitgeber geschickt hatte, demnach angekommen war.
Der Mann, anfang sechzig, stellte sich ihr als Walter Weinbrenner vor und wirkte extrem nett und zuvorkommend. Er erinnerte sie ein wenig an ihren Onkel Kurt. Weinbrenner begrüßte sie freundlich und nahm ihr den schweren Koffer ab. Sie folgte ihm zum Wagen, einer schwarzen Mercedes G-Klasse.
Bis zum Firmensitz der MP Medicaltech war es noch ein gutes Stück Fahrt. Nicht einen Namen der kleinen Ortschaften, durch die sie fuhren, hatte Thea jemals zuvor gehört. Am Ortsschild von Ettinghausen musste sie trotz der inneren Anspannung kurz kichern. Der Name klang für Dorothea irgendwie nach Filzstift. Wobei man den Stift ja ganz anders schrieb.
Irgendwann bog Walter von der Hauptstraße auf einen gut befestigten Waldweg ab. Dorothea wurde unruhig. Viel wusste sie im Grunde nicht über ihren neuen Arbeitgeber. Die Suchmaschinen im Internet gaben so gut wie gar nichts her. Das Unternehmen besaß noch nicht einmal eine eigene Website. Egal! Bei einem sechsstelligen Gehalt in Traumposition musste man auch nicht jede Kleinigkeit hinterfragen. Trotzdem wuchsen ihre Bedenken mit jedem Kilometer, den sie fuhren.
„Sind Sie sicher, dass wir hier noch richtig sind, Herr Weinbrenner?“
Er lachte laut.
„Natürlich, junge Frau. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich will Sie nicht im Wald aussetzen. Wir sind gleich da.“
Sie glaubte ihm. Trotzdem blieb die innere Unruhe. Hinzu kam, dass es zwischenzeitlich stockfinster geworden war.
Einige Minuten später erreichten sie ein großes schmiedeeisernes Tor. Von der Hauptstraße bis hierher hatte sie nicht ein einziges Haus oder Gebäude entdecken können. Nichts als Wald, unterbrochen von einigen Feldern oder Wiesen, was wegen der geschlossenen Schneedecke aber nicht genauer zu unterscheiden war.
Rechts und links des Tores erhob sich ein mehrere Meter hoher Zaun, auf dessen Spitze ein Geflecht aus Stacheldraht zu sehen war. In regelmäßigen Abständen standen Masten mit Scheinwerfern und Kameras. Unwillkürlich stellte sich Thea die Frage, wovor oder vor wem man hier mehr Angst hatte. Vor Einbrechern oder Ausbrechern?
Walter ließ die Seitenscheibe herunter und stoppte an einem kleinen Terminal.
„Ja, bitte“, sagte eine Lautsprecherstimme.
„Hier ist Walter Weinbrenner. Ich bringe die neue Frau Doktor.“
Dorothea bemerkte, wie sich eine der Kameras neben dem Tor bewegte. Dann wurde es geöffnet. Walter fuhr langsam weiter. Nachdem das Fenster wieder geschlossen war, schnaufte er verächtlich.
„Pah. Diese Idioten benehmen sich wie die Grenzer damals an der Zonengrenze. Totale Paranoia. Und trotz ihrer teuren Technik ist ihnen Heiligabend eines ihrer Viecher entlaufen.“
Thea sah zu ihm hinüber.
„Was für ein Viech war das denn?“ Er schien über ihre Frage erschrocken. Vermutlich bereute er gerade, dass er überhaupt etwas gesagt hatte. „Keine Ahnung. Ich hab es auch bloß von einem Kollegen gehört. Ein Affe oder so, glaub ich“, stammelte er und Thea hatte das Gefühl, dass Weinbrenner mehr wusste, als er zugeben wollte.
Das Gebäude, vor dem sie hielten, erinnerte an eine Villa, schien aber eher ein Gutsgebäude oder so etwas zu sein, da sich mehrere flache Nebengebäude anreihten. Neugierig fragte sie nach: „Was war das hier früher mal?“
Walter lächelte wissend.
„Das Ganze hier war früher einmal eine Erzgrube. Sehen Sie die kleine Halle da drüben, bei den Garagen?“
Thea nickte.
„Da oben raus lugte bis in die Zwanzigerjahre ein Förderturm. Dann haben sie den Laden zugemacht – Weltwirtschaftskrise.“
Thea deutete auf das Haupthaus und stellte fest: „Und in der Villa wohnte der Chef.“
Er zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung, Frau Doktor. Ich denke aber, das war mehr so ein Verwaltungsgebäude oder etwas in der Art.“
Thea stieg aus und sah an dem alten Haus empor. Kurz meinte sie, an einem der erleuchteten Fenster im Obergeschoss eine Gestalt zu erkennen. Sie hörte, wie Weinbrenner hinter ihr den Kofferraum öffnete.
„Gehen Sie schon mal, Frau Doktor, der Herr Professor Ulbrecht wartet sicher schon. Ihr Gepäck stelle ich dann in die Diele.“ Thea drehte sich fragend zu ihm um. Weinbrenner lächelte wieder und deutete auf die Tür.
„Treppe hoch, zweite Etage und dann letzte Tür rechts. Können Sie gar nicht verfehlen.“ Sie bedankte sich und stieg dann die Stufen zur Haustür empor. Als sie die Tür vorsichtig aufdrückte, erwartete sie erstens ein lautes Quietschen und zweitens dahinter ein muffiges altes Gemäuer. Beides war nicht der Fall. Die Tür öffnete sich lautlos und der Flur, den sie nun betrat, wirkte modern und teuer. Alles war hell erleuchtet und der letzte Architekt, der hier Hand angelegt hatte, hatte mit Glas, Edelstahl und Licht nicht gespart. Während sie die Treppe ins Obergeschoss emporstieg, betrachtete sie die Bilder an den Wänden. Auch hier keine verstaubten Schinken aus den vorletzten Jahrhunderten, sondern moderne, futuristisch anmutende Kunst. Im Gebäude war es totenstill. Einzig ein leises Summen, das von einer der Überwachungskameras kam, nahm sie wahr. Thea spürte die Blicke aus dem Verborgenen, die auf sie gerichtet waren. Schon in Hamburg, in ihrem letzten Job, hatte sie sich mit den allgegenwärtigen Kameras nicht anfreunden können. Doch sie glaubte, dass diese heutzutage zur Gesellschaft gehörten. Ein notwendiges Übel. Jeder Schritt eines jeden wurde überwacht. Die Menschen wurden immer mehr gläsern. Die Frage war nur, wen es so brennend interessierte, was die Menschen taten. Was geschah mit den Daten und Bildern der Leute, die tagtäglich von Millionen Kameras, abgehörten Telefonen und abgefangenen Mails gesammelt wurden? Diese Gedanken waren Thea in diesem Sommer bereits öfters gekommen. Noch immer waren die Medien überladen mit dem Abhörskandal rund um den amerikanischen Geheimdienst NSA und die anderen Nachrichtendienste. Fast alle Regierungschefs Europas waren ausgespäht worden. Trotzdem konnte sie sich nicht vorstellen, was das alles sollte. Wen interessierte es, das Leben einer Thea Mühlflug? Vielleicht ihre Mutter? Ja, ganz bestimmt. Ihre Mutter interessierte es immer, was Thea tat, da sie grundsätzlich gegen das war, was sie gerade machte. Sicherlich hätte es sie auch brennend interessiert, dass ihre Tochter gerade fünfhundert Kilometer von Hamburg entfernt, am Ende der Welt, eine neue Arbeitsstelle antrat. Und ganz sicherlich hätte sie, wie jedes Mal, versucht, es Thea auszureden. Ja, in diesen Dingen war ihre Mutter schon immer gut gewesen. Bereits als Thea noch ein Kind war, versuchte sie, wo immer es ging, Theas Wege in die, für Muttern, richtige Richtung zu lenken. Im Grunde hatte sie es sogar fertiggebracht, sie mit Jannik zu verkuppeln. Zu gut konnte Thea sich an den Nachmittag erinnern, als Mutter ihr den Sohn ihrer ehemals besten Schulfreundin vorstellte. Jannik von Klausewitz. Ein junger Mann aus gutem Haus, tönten Mutters Worte noch immer in Theas Ohren. Aus heutiger Sicht jedoch war das Muttersöhnchen aus altem Adelsgeschlecht ein klassischer Blender gewesen. Außen hui, innen pfui. Dazu arm wie eine Kirchenmaus. Thea blieb vor der letzten Tür rechts stehen und holte noch einmal tief Luft. Noch bevor ihr Knöchel das Türblatt berührte, bat eine heisere Stimme von innen sie, hereinzukommen. Ihr Blick schweifte noch einmal kurz zu einer der Überwachungskameras. Natürlich, sie wurde ja beobachtet. Dann trat sie ein. Das Arbeitszimmer war im Gegensatz zum Rest des Gebäudes recht altmodisch eingerichtet. Schwere Eichenmöbel dominierten das Bild. Dazu passte der ältere Herr, der in einem von zwei großen Sesseln vor dem Kamin saß und genüsslich an einer Pfeife zog. Der Geruch des Tabaks lag süßlich schwer, aber nicht unangenehm in der Luft. Neben dem Herrn, bei dem es sich wohl um Professor Ulbrecht handelte, stand eine offene Flasche Rotwein und ein halb volles Glas, dessen Inhalt im Schein des Kaminfeuers rubinrot leuchtete. Er legte die Pfeife beiseite, erhob sich und kam auf Thea zu.
„Herzlich willkommen, Frau Doktor Mühlflug. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise.“
Thea ergriff zögerlich die ausgestreckte Hand des Professors und nickte verlegen.
„Ja, danke. Sehr angenehm“, log sie und schüttelte dann den Kopf.
„Nein, Herr Professor. Um ehrlich zu sein, war die Reise mit der Bahn wenig erfreulich.“
Ulbrecht lachte.
„Ja, das denke ich mir. In Anbetracht der Uhrzeit muss es wirklich nicht sehr angenehm gewesen sein.“
Er deutete auf den zweiten Sessel.
„Darf ich Sie trotz der späten Stunde noch zu einem Glas Bordeaux einladen?“
Thea zögerte. Sie war hin- und hergerissen zwischen Müdigkeit und Neugierde. Außerdem konnte sie doch unmöglich eine Einladung ihres neuen Chefs ausschlagen. Neugierde und Vernunft gewannen schließlich. Sie nahm Platz und sah sich um, während Ulbrecht ein Glas von einer Anrichte holte, eingoss und es ihr reichte. Der große Raum beherbergte Unmengen von Büchern. Uralte hölzerne Regale reichten bis zur Decke und boten einigen Tausend davon Platz.
„Bücher sind eine Leidenschaft von mir“, erriet Ulbrecht ihre Gedanken und hob sein Weinglas.
„Auf eine gute Zusammenarbeit, Frau Mühlflug.“
Sie erwiderte die Worte und prostete ihm zu. Dann hielt er kurz inne, schien zu überlegen und sagte schließlich: „Stört es Sie, wenn ich Sie Dorothea nenne? Ich finde, unter Kollegen wäre dies angebrachter.“
Thea nickte verlegen.
„Selbstverständlich, Herr Professor.“
„Klaus, Dorothea. Nennen Sie mich bitte Klaus.“
„Natürlich, Klaus, auf eine gute Zusammenarbeit.“
Der Wein schmeckte vorzüglich, soweit sie das beurteilen konnte, da sie im Grunde eher selten Wein trank. Eine Weile sahen sie sich schweigend an. Thea musste sich zwingen, dem Blick des älteren Herrn standzuhalten. Es war ihr irgendwie unangenehm, wie der Mann, der sicherlich schon jenseits der siebzig war, sie beobachtete.
„Sie erinnern mich sehr an jemanden, den ich einmal kannte, Dorothea“, erklärte er schließlich und Thea hätte bei den Worten fast das Glas fallen lassen.
„Wer? Wen meinen Sie? Kannten Sie vielleicht meinen Vater?“, brachte sie schließlich erstaunt und leicht zittrig hervor. Ihr Vater war, genau wie Thea, Genetiker gewesen. Gut möglich, dass Ulbrecht ihn gekannt hatte. Der alte Mann nickte.
„Ja, natürlich. Ich dachte, Sie wüssten das.“
Nein, Thea hatte keine Ahnung gehabt. Über ihren Vater und über seine Arbeit wusste sie so gut wie gar nichts. Darüber hinaus wusste sie auch niemanden, außer ihrer Mutter und ihrem Onkel, der ihren Vater wirklich richtig gekannt hatte. Er war bereits kurz nach Theas Geburt gestorben. Ein Flugzeugabsturz in der Taiga, wo er Ausgrabungen im Permafrost leitete. Jäger hatten damals Überreste einiger Mammuts gefunden. Sofort setzte sich ihr Vater in das nächste Flugzeug und flog mit einem Team der Universität Moskau dort hin. Das Unglück ereignete sich auf der Rückreise nach Deutschland, als die Maschine im dichten Nebel an einem Berg im Ural zerschellte und vollkommen ausbrannte. Seine sterblichen Überreste konnten niemals geborgen werden. Vermutlich war auch nichts, was sich zu bergen lohnte, übrig geblieben. Eine scheußliche Vorstellung. Thea war noch zu klein gewesen, um die Geschehnisse mitzubekommen. Das, was sie wusste, wusste sie aus Erzählungen ihres Onkels Kurt. Mutter sprach nie darüber. Das Thema war ein Tabu.
„Dorothea?“, erkundigte sich Ulbrecht besorgt.
Sie schreckte aus ihren Gedanken.
„Entschuldigung, Herr Professor. Ich war in Gedanken.“
Die Tatsache, dass Ulbrecht ihren Vater gekannt hatte, hatte sie mehr aus dem Gleichgewicht gebracht als sie je gedacht hätte. Ihre Blicke trafen sich. Was sollte sie jetzt sagen? Reden war noch nie Theas Stärke gewesen. Verlegen nippte sie erneut an ihrem Glas, glücklich darüber, so dem Blick des alten Mannes ausweichen zu können. Ulbrecht stand auf, ging zu einem der Regale und entnahm ihm ein Album. Noch im Gehen schlug er es auf und reichte es ihr. Das Bild, auf das er tippte, zeigte zwei Männer. Der rechte mit dem Spitzbart war ihr Vater, der andere unverkennbar Ulbrecht. Das Bild musste kurz vor dem Tod ihres Vaters aufgenommen worden sein. Im Hintergrund erstreckte sich eine karge, öde Landschaft. Unter dem Foto stand mit Bleistift geschrieben: Jakutsk 17. August 1986. Das Unglück war am 18., also nur einen Tag später, geschehen. Thea betrachtete das Bild eine Weile. Dabei kaute sie auf ihrer Unterlippe, eine dumme Angewohnheit, die sie selber noch nicht einmal wahrnahm.
„Ihr Vater hat das auch immer getan“, schreckte Ulbrechts Stimme sie aus ihren Gedanken.
„Äh, wie bitte? Was meinen Sie?“, stammelte sie.
Er lächelte gütig.
„Wenn Ihr Vater hoch konzentriert war, hat er, genau wie Sie, auf seiner Unterlippe gekaut. Sie sind ihm wirklich sehr ähnlich.“
„Was genau haben Sie beide damals in der Tundra gemacht?“, wechselte sie blitzschnell das Thema. Ulbrecht schien belustigt.
„Sie wissen nicht viel über seine Arbeit, nicht wahr?“
Thea reagierte nicht auf die Frage. Aber er hatte recht. Eigentlich wusste sie überhaupt nichts, außer dass ihr Vater sich als Biochemiker auf Vererbung und Gentechnik spezialisiert hatte. Immer auf den Spuren Darwins. Sie beobachtete, wie Ulbrecht den Rauch der Pfeife in Richtung der hohen Stuckdecke blies.
„Wir haben Geschichte geschrieben, Thea.“
Sie stutzte.
„Es heißt, mein Vater habe ein Wollmammut ausgegraben.“
„Natürlich haben wir das.“
Er lächelte und nippte an seinem Wein.
„Was haben Sie sonst noch gefunden, Klaus?“, hakte sie nach, da sie das Gefühl nicht loswurde, dass er wollte, dass sie genau dies fragte.
„Thea, was denken Sie, warum ich Sie eingestellt habe?“, wechselte er nun das Thema. Thea wurde unruhig. Was, zum Teufel, sollte dieses Gespräch? Was wollte Ulbrecht von ihr? War das jetzt ein verspätetes Einstellungsgespräch? Irgendein Test? Ulbrecht gab nach einer kurzen Pause selber eine Antwort auf seine letzte Frage.
„Ich wollte Sie hier haben, hier an meiner Seite, um das Lebenswerk Ihres Vaters, unser Lebenswerk, zu vollenden.“
Thea sah ihn verständnislos an.
„Sie wollen mir sagen, Sie haben mich nicht wegen meiner Qualifikation eingestellt, sondern nur, weil ich die Tochter meines Vaters bin?“
Er hob abwehrend die Hände.
„Nein, nein, Thea. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sehen Sie es als Fügung des Schicksals. Ich brauchte jemanden mit Ihren Fähigkeiten. Einen qualifizierten Biochemiker. Dass Sie die Tochter Ihres Vaters sind, ist ein herrlicher Zufall. Der Headhunter, der Sie angesprochen hat, hat mir außer den Ihren, noch Unterlagen von einem guten Dutzend weiterer möglicher Kandidaten vorgelegt. Aber als ich Ihren Namen las, wusste ich, dass Sie es sein müssen. Im Übrigen waren Sie, wenn es Sie beruhigt, auch die Qualifizierteste unter den möglichen Kandidaten.“
„Sie halten es also für eine göttliche Fügung?“, erklärte sie eher sarkastisch.
Er wiegte den Kopf hin und her.
„So in etwa, mit dem Unterschied, dass ich nicht an Gott glaube. Die Erfindung eines Gottes oder von Göttern geschah, wie ich denke, immer nur, um Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Aber ich denke auch, diese Frage ist hier und jetzt nicht von Relevanz.“
Er nippte erneut an seinem Glas, bevor er weitersprach.
„Was wissen Sie über die Entstehung der Hominiden?“
Thea stutzte erneut. Humangenetik war ihr Spezialgebiet. War das jetzt eine Fangfrage?
„Ich glaube zu wissen, dass die weiblichen Individuen dieser Art nicht aus einer Rippe des Mannes entstanden sind, so wie es uns die Bibel weismachen will“, wich sie der Frage, wie sie glaubte, geschickt aus.
Ulbrecht begann laut zu lachen.
„Das ist gut, Thea, das gefällt mir.“
Dann wurde er schlagartig wieder ernst.
„Verstehe ich Sie richtig? Sie haben diesen Job angenommen, ohne auch nur eine Ahnung zu haben von dem, was wir hier tun, und auf wen Sie sich überhaupt einlassen?“
Thea wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Es war auch nicht nötig, da Ulbrecht weitersprach, ohne eine Antwort abzuwarten.
„Glauben Sie mir, Thea, ich verspreche Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden. Neben dem, was wir beide gemeinsam schaffen werden, ist die biblische Schöpfung nichts. Und wir“, er machte eine kurze Pause. „Wir brauchen dazu noch nicht einmal eine komplette Rippe.“
KAPITEL 3
Sonntag, 31.12.2013, 1:32 Uhr
Gelände der MP Medicaltech, Westerwald
Thea lag wach auf ihrem Bett und stierte auf den Mond, der durch das kleine Fenster rechts von ihr schien. Das möblierte Quartier, das die Firma ihr fürs Erste zur Verfügung gestellt hatte, war klein aber fein. Die Möbel allesamt modern, und wie es schien, nagelneu. Es traf ihren Geschmack. Sie selber hätte es nicht anders eingerichtet. In dem kleinen Bungalow, der sich direkt auf dem Firmengelände befand, gab es neben dem Schlafraum noch eine kleine Küche, ein Wohn- und Arbeitszimmer sowie ein großzügiges Bad. Der Wachmann, ein grobschlächtiger riesiger Kerl Ende vierzig mit kurz geschorenen, fast schneeweißen Haaren, der sie und ihr Gepäck zum Blockhaus gebracht hatte, war äußerst wortkarg gewesen. Ulbrecht hatte ihn Volker genannt. Das war alles, was Thea von ihm wusste. Auch sonst wusste sie im Grunde noch immer nichts. Nichts über Ulbrecht, die Firma, noch nicht einmal, wo sie genau war. Irgendwo im Westerwald, in einem Waldgebiet, weit weg von jeglicher Zivilisation. Wieder zweifelte sie, ob das, was sie gerade tat, richtig war. Aber was genau tat sie eigentlich? Was war ihre Aufgabe in dieser Firma? Woran würde sie forschen? Das Gespräch mit ihrem neuen Chef hatte mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Obwohl Professor Klaus Ulbrecht einen durchaus sympathischen Eindruck auf sie machte, sagte irgendetwas tief in ihr, dass sie vorsichtig sein musste. Was diesen Instinkt weckte, wusste sie nicht. Vielleicht war es auch nur die Tatsache, dass Ulbrecht ihr Chef war.
Merkwürdig war ebenfalls, dass sie sich in den letzten drei Stunden, seitdem sie hier lag, mehr Gedanken über ihren Vater als über sich selber machte. Im Grunde wusste sie über ihn genauso viel oder wenig wie über die Firma, in der sie nun arbeitete. Ihre Mutter sprach nicht gerne über ihn. Die Tatsache, dass sie bereits ein Jahr nach dem tragischen Unfall erneut geheiratet hatte, ließ jedoch den Schluss zu, dass ihr an dem Erzeuger ihrer Tochter vermutlich nicht so viel gelegen war, wie sie es Thea gegenüber gerne vorgab. Thea vermutete, dass es ihrer Mutter bei jedem der Männer, mit denen sie seit damals liiert war, nur um das Geld der heiratswilligen Kandidaten ging. Zumindest hatte sie sich bei keinem ihrer vier Ehegatten finanziell verschlechtert oder gar arbeiten müssen. Was Thea über ihren Papa wusste, wusste sie von seinem Bruder Kurt, Theas Patenonkel. Onkel Kurt war immer für sie da gewesen, zumindest, so weit das möglich gewesen war. Er war einer der Verlierer der Wende, wie er es immer zu sagen pflegte. Als ehemaliger Offizier der Staatssicherheit der DDR gab es nach dem Fall der Mauer keinen Platz mehr für ihn im vereinten Deutschland. Seitdem schlug er sich als Nachtwächter bei einer drittklassigen Sicherheitsfirma durch.
Die Frage, die sie in dieser Nacht immer wieder beschäftigte war, was ihr Vater und Ulbrecht damals nordöstlich von Jakutsk gefunden hatten. Vermutlich war es kein Wollmammut gewesen. Aber was dann? Thea hatte da so eine Vermutung. Warum sonst wollte Ulbrecht wissen, was sie über Hominiden wusste? Warum diese Frage, wenn es nicht auch um etwas Menschliches ging? Es war ihr Spezialgebiet und das stand bestimmt auch in den Unterlagen, die er zweifelsohne über sie besaß. Einen Moment war ihr der Gedanke gekommen, die beiden hätten dort im Permafrost tatsächlich eine neue Menschenrasse entdeckt. Aber auch wenn dem so war, darum ging es hier sicher nicht. Das würde nicht den Aufwand erklären, der in diesem Institut in die Sicherheit gesteckt wurde. All die Wachleute, die Kameras und Zäune. Das musste Unmengen an Geld verschlingen. Egal, was in diesem Institut erforscht und entwickelt wurde, man musste damit Geld verdienen können. Viel Geld! Theas Vater arbeitete damals für die Akademie der Wissenschaft der DDR. Was er dort getan hatte, wusste nicht einmal Onkel Kurt. Zumindest behauptete er das. Vater war oft in Russland gewesen, in der sibirischen Taiga. Was genau er dort als Biochemiker wollte, war ihr schleierhaft. Vor einigen Jahren hatte Thea Akteneinsicht in die Stasi-Akten beantragt, leider ohne Erfolg. Es existierte keine Akte Franz Mühlflug, auch an anderen Stellen nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass es noch nicht einmal ein Grab mit seinem Namen gab, waren Thea sogar kurz Zweifel gekommen, ob es überhaupt einen Mann mit diesem Namen gegeben hatte. Was natürlich Unsinn war. Warum auch sollte jemand die Existenz eines Menschen erfinden? Solche Verschwörungstheorien waren unterste Schublade und vollkommener Quatsch.
Sie schaltete die Nachttischlampe an und schwang sich aus dem Bett. Sie würde sowieso nicht schlafen können. In der Küche nahm sie ein Glas aus dem Schrank, füllte es mit Leitungswasser und trank einen Schluck. Der Blick auf ihr Smartphone war ernüchternd, das Gerät fand kein Netz.
„Willkommen am Arsch der Welt, Thea“, flüsterte sie und musste über ihre Feststellung lachen.
Im Wohn-Arbeitszimmer gab es neben einem Computerarbeitsplatz sogar ein Telefon. Thea hob den Hörer ab und lauschte auf das Freizeichen. Dann suchte sie in ihrem Handy die Mobilnummer von Onkel Kurt und gab sie in den Apparat auf dem Schreibtisch ein. Wie erhofft hob Kurt nach dem zweiten Läuten ab. Thea merkte förmlich, wie es ihr leichter ums Herz wurde. Es tat gut, eine vertraute Stimme zu hören.
„Hallo Thea“, begrüßte er sie überrascht.
„Mit dir hätte ich um diese Zeit überhaupt nicht gerechnet. Warum rufst du mich nachts um zwei Uhr mit unterdrückter Rufnummer an?“
„Ähm, das ist nicht mein Anschluss“, beeilte sie sich zu sagen. „Mein Handy hat hier keinen Empfang.“
Kurt schwieg einen Moment.
„Kind, bist du in Schwierigkeiten?“, fragte er dann.
Thea verneinte und erklärte ihm die Situation. Kurt hörte geduldig zu.
„Das klingt alles sehr gut“, sagte er nach einer weiteren kurzen Pause. Obwohl er es nicht aussprach, hörte Thea das „Aber“ zwischen seinen Worten überdeutlich.
„Was sagt deine Mutter dazu?“, erkundigte sich Kurt.
Thea überlegte kurz.
„Ich werde es ihr morgen sagen.“
Kurt begann zu lachen.
„Du hast es ihr noch nicht gesagt?“
Sie verneinte abermals und stellte dann die Frage, die ihr schon seit einigen Stunden im Kopf herumschwirrte.
„Sag mal, Onkel Kurt, kennst du einen Professor Klaus Ulbrecht? Hat Vater ihn einmal erwähnt?“
Sie hörte, wie der alte Mann am anderen Ende die Luft einsog. Theas Herz schlug schneller. Kurt kannte ihn. Doch zu ihrem Entsetzen fiel die Antwort anders aus als erhofft.
„Keine Ahnung, Kind, kann sein, dass ich den Namen schon einmal gehört habe. Sicher bin ich nicht. Warum fragst du?“
Thea kannte Kurt. Sie merkte immer sofort, wenn er sie anlog. Aber warum heute? Warum gab er vor, Ulbrecht nicht zu kennen? Stattdessen gähnte er gekünstelt.
„Thea, ich bin müde. Was hältst du davon, wenn wir morgen am Tag weiter telefonieren?“ Sie stutzte wieder. Was zum Teufel sollte das? Kurt arbeitete seit zwanzig Jahren als Nachtwächter, tagsüber schlief er meist.
„Kann ich dich morgen Mittag anrufen?“, fragte er.
„Ähm, ja gut“, stotterte sie irritiert. „Ich weiß aber nicht, welche Nummer ich hier habe.“
Kurt lachte gequält und unecht.
„Das ist nicht schlimm, ich rufe dich auf deinem Handy an. Sagen wir um Punkt zwölf.“
Sie schüttelte energisch den Kopf.
„Nein, nein das geht nicht, ich habe hier doch keinen Empfang, das Handy funktioniert nicht.“
„Dann suchst du dir halt einen Ort, wo du Empfang hast!“, herrschte er sie in einem Ton an, den sie nicht an ihm kannte.
Es knackte in der Leitung. Kurt hatte einfach aufgelegt. Sie starrte den Hörer in ihrer Hand an und legte ihn dann verwirrt auf den Apparat. Thea verstand die Welt nicht mehr.
*
Die Luft war herrlich, kühl und frisch. Der glatte knöcheltiefe Schnee auf den Feldern und Wiesen glitzerte in der Morgensonne. Thea streckte die Füße aus und gähnte. Verflixt, war sie noch müde. Die Nacht war eindeutig zu kurz gewesen. Sie überlegte, wie weit sie wohl vom Institut aus gelaufen war, bis sie endlich Empfang gehabt hatte. Thea schätzte, dass es locker zwei Kilometer gewesen waren, wenn nicht sogar mehr. Seit gut einer halben Stunde hockte sie nun auf einem Jägerstuhl, unweit des schmalen Teerweges, über den sie gestern gemeinsam mit Walter zum Institut gefahren war. Auf ihrem Marsch hierher waren ihr weder ein Auto noch ein anderer Mensch begegnet. Die Gegend wirkte wie ausgestorben. Vermutlich lag das an den Feiertagen. Die meisten ihrer neuen Kollegen waren noch im Weihnachtsurlaub. Morgen war Neujahr. Es würde also noch bis übermorgen dauern, bis sie endlich mit der neuen Arbeit beginnen konnte. Falls sie bis dahin nicht vor Neugierde sterben würde. Sie schaute auf das Display des Handys. Es war fünf vor zwölf. Das Gerät zeigte drei Balken Empfang an. Gut so. Ihr Blick schweifte über die hügelige Landschaft. In einiger Entfernung stiegen dünne Rauchfahnen zum Himmel und verloren sich in dem tiefen Blau. Es wohnten tatsächlich Menschen in dieser Einöde. Keine hundert Meter von ihr entfernt lief ein Fuchs über das schneebedeckte Feld. Vorhin hatte sie sogar eine Gruppe Rehe zwischen den Bäumen entdeckt, die aber flüchteten, als sie Thea bemerkten. Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihren Gedanken.
„Onkel Kurt!“, begrüßte sie ihn stürmisch. Zu ihrer Enttäuschung war es nicht der ersehnte Anruf des Onkels, sondern ihre Mutter. Thea hätte sich ohrfeigen können. Warum nur hatte sie nicht auf den Namen des Anrufers auf dem Display geachtet?
„Weshalb dachtest du, ich wäre Kurt?“, keifte ihre Mutter vorwurfsvoll, ließ Thea aber gar keine Zeit, auf ihre Frage zu antworten.
„Wo, zum Kuckuck, steckst du, Dorothea? Ich versuche dich seit Tagen zu erreichen. Entweder du gehst nicht ans Telefon oder dein Anschluss ist nicht erreichbar. Jannik behauptet, du seist verreist. Was ist da los bei euch?“
„Mama, stopp“, unterbrach Thea den Redefluss. „Es ist gerade ganz schlecht.“
„Bei dir ist es immer schlecht!“, motzte ihre Mutter. „Wo bist du?“
Geistesgegenwärtig hielt Thea das Handy etwas von sich weg und brüllte dann: „Mama! Hallo, Mama! Hörst du mich? Ich habe wirklich einen ganz schlechten Empfang. Ich rufe dich später zurück. Hallo?!“
Dann legte sie einfach auf. Die Uhr auf dem Handydisplay zeigte nun genau eine Minute vor zwölf. Während sie weiter auf den Anruf von Onkel Kurt wartete, musste sie unweigerlich wieder an ihre Mutter denken. Irgendwie tat es ihr leid, dass sie sie gerade eben so abgefertigt hatte. Andererseits war sie froh darüber, das Gespräch beendet zu haben. Dies lag sicherlich nicht nur an der Tatsache, dass sie die Leitung für den Anruf aus Berlin frei machen wollte. Thea konnte nicht sagen, seit wann sich das Verhältnis zwischen ihnen beiden so verschlechtert hatte. Doch je länger sie darüber nachdachte, desto mehr kam sie zu der Überzeugung, dass es eigentlich nicht schlimmer geworden war. Nein, es verhielt sich eher so, dass die Beziehung zwischen ihnen schon immer schwierig gewesen war. Nur früher war Thea immer diejenige gewesen, die zurücksteckte. Um des lieben Friedens willen. Sichtlich wandelte sich das Verhältnis, als Thea auszog. Die eigenen vier Wände hatten sie verändert. Sie sah wieder auf das Handy. Mittlerweile war es zwanzig nach zwölf. Merkwürdig. Es lag nicht in der Natur von Onkel Kurt, unpünktlich zu sein. Kurzerhand ergriff sie die Initiative und wählte seine Nummer.
„Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar“, erklärte eine weibliche Computerstimme.
Sie beendete das Gespräch, legte das Telefon neben sich auf die Bank des Ansitzes und rieb sich die Hände. Obwohl die Sonne schien, war es eiskalt. Nach einer Weile versuchte sie noch einmal, Kurt zu erreichen. Vergeblich. Ob er noch schlief? Der Onkel arbeitete seit zwanzig Jahren ausschließlich in der Nacht. Vermutlich hatte er vergessen, dass er Thea zurückrufen wollte. Sie steckte das Telefon in ihre Tasche, kletterte flink die Leiter hinunter und machte sich auf den Weg zurück in die Firma. Sie würde es morgen erneut versuchen.
Den freien Nachmittag nutzte sie, um sich ein wenig auf dem Gelände des Instituts umzusehen. Das Areal war wesentlich größer als sie gedacht hatte und als das, was sie gestern in der Dunkelheit bereits davon gesehen hatte. Wie Herr Weinbrenner am Vorabend, betätigte sie die Klingel am Tor. Sofort ertönte ein ‚Ja, bitte‘ aus der Gegensprechanlage. Thea nannte ihren Namen und das Tor öffnete sich. Sie schlenderte über die sauberen, vom Schnee geräumten Wege zum Haupthaus. Wie viele Leute hier an einem normalen Werktag wohl arbeiten mochten? Der Parkplatz hinter dem villenähnlichen Verwaltungsgebäude bot Platz für an die einhundert Pkws. Aber in nur acht der Parkbuchten standen auch wirklich Wagen, drei davon mit Schnee bedeckt. Fast kam es ihr vor, als wäre sie alleine auf dem Gelände. Der Eindruck änderte sich schlagartig, als sie zu dem Gebäude kam, in dem sich laut dem alten Fahrer früher einmal der Bergwerksschacht befunden haben musste. Vor dem überdachten Eingang standen zwei Männer, rauchten und unterhielten sich dabei. Den einen Mann erkannte Thea sofort. Es war der Wachmann, den Ulbrecht gestern Volker genannt hatte. Er trug schwarze Armeekleidung, dazu passend hochgeschnürte Stiefel und auf dem Kopf eine ebenfalls schwarze Wollmütze. Der zweite war wesentlich jünger. Thea schätzte, dass er in etwa so alt wie sie selber sein mochte. Er sah gut aus. Sehr gut! Im Gegensatz zu Volker trug er Laufbekleidung und Turnschuhe. Als er Thea bemerkte, warf er seine Zigarette weg, lächelte sie an und trat einen Schritt in ihre Richtung.
„Guten Tag, die Dame“, begrüßte er sie spaßig.
Thea fasste all ihren Mut zusammen, ging auf die beiden Männer zu, streckte freundlich ihre Hand hin und stellte sich mit ihrem Namen vor.
„Patrick Ulbrecht“, erklärte der Jüngere, während Volker nur knapp grüßte, sich dann empfahl und wieder in dem Gebäude hinter sich verschwand.
„Es freut mich, Sie endlich kennenzulernen, Dorothea. Ich habe bereits viel von meinem Vater über Sie gehört.“
„Sie sind der Sohn von Herrn Professor Ulbrecht“, stellte sie verwundert fest.
Er lächelte sie immer noch an.
*