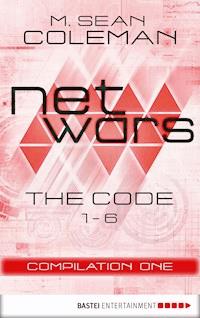4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: netwars
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal alle Folgen der Cyber-Thriller Serie in einem Sammelband!
-- Edward Snowden und die NSA sind erst der Anfang. Der aktuelle Thriller zum Thema Cyberwar, Hacker, Internet-Sicherheit, Internet-Kriminalität und Cyber-Terrorismus.
-- Willkommen im Deep Web. Dem Teil des Internets, das von keiner Suchmaschine erfasst wird. Dem Ort, wo man alles kaufen kann - Drogen, Kinder, Waffen. Jeder kann es. Jederzeit.
-- Anthony Prince, Chef der Sicherheitsfirma PrinceSec, die Software für die Regierung entwickelt, stirbt beim Absturz seines Privatflugzeugs. Verantwortlich für Prince' Tod war ein Hacker namens Strider. Unter seinem wirklichen Namen, Scott Mitchell, arbeitet er als Berater für die National Cyber Crime Unit. Als Mitchell verfolgt er die Bösen mit legalen Mitteln. Striders Mittel sind nicht ganz so legal. In derselben Nacht, als Anthony Prince getötet wird, gibt es einen Hackerangriff auf dessen Firma. Die Spur führt zu einer kriminellen Hacker-Gruppe namens Black Flag. Kann Mitchell seine Identität als Strider schützen und zugleich Black Flag aufhalten, bevor es zu spät ist?
-- "Netwars: Der Code" ist Teil eines Transmedia-Projekts mit der Doku-Webseite "www.netwars-project.com" zum Thema Internet-Sicherheit, einer Fernsehdokumentation für Arte und ZDF über Hacker-Angriffe und der interaktiven Graphic Novel App "netwars: The Butterfly Attack". Für Leser von Dave Eggers, DER CIRCLE, Marc Elsberg, BLACKOUT und ZERO, Daniel Suarez, DARKNET, für Fans von Filmen wie DER STAATSFEIND NR. 1 und alle, die Spionage und High-tech Thriller lieben.
-- Über den Autor: M. Sean Coleman begann als Scriptwriter für Douglas Adams' Hitchhikers Guide to the Galaxy Online. Für seine Beiträge für MSN, O2, Sony Pictures, Fox, die BBC und Channel 4 wurde er mehrmals mit Preisen ausgezeichnet. Er lebt in London.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Code
Erste Episode – Sturzflug
Regel Nr. 1: Mach dich bekannt
Regel Nr. 2: Es ist nichts Persönliches
Regel Nr. 3: Unfälle passieren
Regel Nr. 4: Bleib in den Schatten
Die dunkelste Stunde ist die vor Anbruch der Dämmerung
Zweite Episode – Verrat
Regel Nr. 5: Nichts übereilen
Mädchen 219
Regel Nr. 6: Halte deine Feinde nahe bei dir
Regel Nr. 7: Kümmere dich ums Geschäft
7 Uhr
Dritte Episode – Anschlag
Regel Nr. 8: Ich komme, ob du willst oder nicht
Regel Nr. 9: Schlaf ist dein einziger Freund
Regel Nr. 10: Zu viel Vertraulichkeit schadet nur
Regel Nr. 11: Ein Tag nach dem anderen
In der Dunkelheit
Vierte Episode – Täuschung
Regel Nr. 12: Arzt, heile dich selbst
Regel Nr. 13: Der frühe Vogel fängt den Wurm
Regel Nr. 14: Der Schein kann trügen
Regel Nr. 15: Niemand ist eine Insel
Der gute Samariter
Fünfte Episode – Enthüllung
Regel Nr. 16: Übernimm die Kontrolle
Regel Nr. 17: Geheimnisse und Lügen
Regel Nr. 18: Keine Verhandlungen
Regel Nr. 19: Der Spatz in der Hand
Menschlichkeit
Sechste Episode – Rache
Regel Nr. 20: Die Straße ins Nichts
Regel Nr. 21: Nicht verstecken, weglaufen!
Regel Nr. 22: Mit Geduld und Spucke
Regel Nr. 23: Irgendwann ist jeder Spaß vorbei
Neustart
Über den Autor
M. Sean Coleman begann seine schriftstellerische Laufbahn als Scriptwriter für Hitchhikers Guide to the Galaxy Online (h2g2.com). Seitdem hat er Shows für MSN, O2, Sony Pictures International, Fox, die BBC und Channel 4 geschrieben und produziert, für die er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Er wohnt in London und schreibt weiterhin Romane, Graphic Novels und Fernsehscripts.
Der Code
M. Sean Coleman
Thriller
Aus dem Englischen von Kerstin Fricke
beTHRILLED
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln,
und filmtank GmbH, Hamburg
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Projektmanagement: Helmut Pesch, Lori Herber
Titelillustration: © thinkstock/Tashatuvango
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0395-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Der Code
Sie werden mich nie kennenlernen, aber ich bringe Ihnen den Tod.Ich weiß, was Sie getan haben, denn ich sehe alles, was Sie tun.Ich habe gehört, was Sie gesagt haben, denn ich kenne jedes Ihrer Geheimnisse.Ich weiß, wohin Sie gegangen sind, denn ich folge Ihnen überallhin.Sie werden geprüft, denn ich prüfe alles.Sie stehen nicht über dem Gesetz, denn ich bin das Gesetz.Bitten Sie nicht um Vergebung oder Mitleid.Seien Sie sich nur über eins im Klaren:Wenn Sie nicht nach dem Code leben können, müssen Sie nach dem Code sterben.
Strider
Erste EpisodeSturzflug
Regel Nr. 1: Mach dich bekannt
Ein Ziel sollte wissen, dass es angegriffen wurde, und weshalb. Vor allem sollte es erkennen, dass sein Geheimnis ans Licht gekommen ist.
Er hasste Paris im Frühling. Es war so klischeehaft: Paare, die Hand in Hand über die Champs-Élysées schlendern und sich für gestellte Fotos unter dem Eiffelturm küssen oder sich überteuerte langstielige Rosen von Straßenverkäufern in Cafés andrehen lassen, nur weil die anderen Paare das auch tun. Natürlich war ihm klar, dass sie alle einem romantischen Stereotyp nacheiferten, schließlich waren sie deshalb hierhergekommen, aber diese Einfallslosigkeit ärgerte ihn maßlos. Letztendlich sorgte diese banale Zurschaustellung von Verliebtheit nur dafür, dass in der Stadt der Liebe der Tourismus boomte.
Strider, wie er online hieß, saß in seiner eleganten Wohnung in der Nähe der Rue de Sévigné und lauschte dem regen Treiben im 3. Arrondissement, während er sich wieder einmal fragte, weshalb er so zynisch geworden war. Was ging es ihn an, ob andere Leute ihr Liebesleben nach dem ausrichteten, was sie in Schnulzen zu sehen bekamen? Warum sollte er sich daran stören, wenn es sie glücklich machte?
Vielleicht ärgerte er sich über diesen Affenzirkus, weil er selbst kein Interesse an einer Beziehung hatte. Manchmal hatte er den Eindruck, ihn würde alles kaltlassen, was andere Menschen erstrebten. Und wenn es um Beziehungen oder auch nur um Freundschaften ging, erschien ihm vieles unlogisch. Aus welchem Grund sollte man einen anderen Menschen so nah an sich heranlassen? Oder zulassen, dass er einen von Grund auf kennenlernte? Wie konnte man jemanden so tief in die eigene Seele blicken lassen, dass der andere erkennen konnte, wer man wirklich war?
Ihn, Strider, jedenfalls hatte noch nie jemand so gut gekannt, nicht einmal die Leute, die sich als seine Freunde bezeichneten. Keiner von ihnen wusste, was er tat oder wer er war. Letzten Endes würde er immer alleine sein. Vielleicht war das der Grund, weshalb er Paris nicht allzu sehr mochte. Hier wurde ihm sein Alleinsein jedes Mal besonders deutlich bewusst. Aber das würde vorbei sein, sobald er im Hochgeschwindigkeitszug saß, auf dem Rückweg in die relative Normalität Londons.
Strider war nervös, wie jedes Mal, wenn ein Auftrag kurz vor dem Abschluss stand. Dann schien sich die Zeit zu verändern, schien ihr Tempo zu variieren. Zuerst schlich sie ermüdend langsam dahin, um dann, wenn der Augenblick der Wahrheit gekommen war, in Windeseile zu verstreichen, sodass man kaum etwas mitbekam.
Auch diesmal spürte Strider in der Magengrube, wie die Zeit immer schneller ablief, wie seine Unruhe wuchs. Und mit der Nervosität kam wie jedes Mal das beinahe spirituelle Gefühl, dass dies hier seine Bestimmung war, sein Schicksal.
Striders Wohnung, eines von mehreren Verstecken, die in ganz Europa verstreut lagen, war Labor und Büro zugleich. Er hatte die Wohnung umgebaut, um den Lärm der Stadt so gut wie möglich auszublenden. Heute genoss er die Stille mehr denn je, da er den Nachmittag damit verbracht hatte, seine Arbeit in Ruhe zu überprüfen und sicherzustellen, dass auch wirklich alles perfekt war. Nach der monatelangen Vorbereitung kam es nun vor allem auf diesen einen Augenblick absoluter Konzentration an.
Und er musste sich sehr konzentrieren.
Der Tod eines Mannes hing davon ab.
Anthony Prince verließ die kleine Privatlounge, trat hinaus auf die Startbahn des Flughafens Paris-Le Bourget und ging direkt zu seinem Privatjet, einer Cessna Citation Mustang. Sie war sein Ein und Alles. Wenn er sich zwischen seiner Frau und der Cessna entscheiden müsste, sagte er oft und gern im Scherz, würde die Cessna gewinnen.
Genau das war nun geschehen. An diesem Abend flog Prince unter anderem deshalb zurück nach London, weil er seiner Frau erklären wollte, warum er sie verlassen würde. Es war sinnlos, weiterhin eine Lüge zu leben, aber er wollte ihr zumindest eine Begründung liefern. Außerdem musste er in London noch einiges erledigen, bevor er endgültig untertauchte.
Prince zog den Kragen seines Designermantels bis zu den Ohren hoch und senkte den Kopf, um sich vor dem kalten Regen zu schützen. Eigentlich hatte er gehofft, längst in der Luft zu sein, bevor das Wetter schlechter wurde, doch er hatte noch ein paar Telefonate mit seinem Geschäftspartner in London führen müssen. Prince’ Firma, die PrinceSec, ein auf Sicherheitssoftware spezialisiertes Unternehmen, das Regierungen und Firmen in ganz Europa mit hochmodernen Cybersicherheitssystemen belieferte, würde in Kürze Upgrades ihrer Vorzeigesoftware Cryptos ausliefern. Prince hatte sein äußerst erfolgreiches Unternehmen auf ein paar Codezeilen aufgebaut und durch harte Arbeit und völlige Missachtung von Fair Play an die Spitze geführt. Im Laufe der Zeit hatte er sich eine Vielzahl von Großkunden im Vereinigten Königreich gesichert. Dank der neuen Version von Cryptos würde er sein Geschäftsfeld nun auf die EU erweitern.
Prince liebte es, die Zügel in der Hand zu halten und seine Macht auszudehnen, doch im Moment hatte er das Gefühl, jegliche Kontrolle verloren zu haben. Er musste zurück nach Großbritannien, damit er die Beweise beseitigen und so schnell wie möglich wieder von dort verschwinden konnte, bevor die Morgennachrichten die Leichen in seinem Keller publik machten.
Prince stieg alleine in den leeren Jet. Er saß gern selbst am Steuerknüppel, auch wenn das in der Firma nicht gern gesehen wurde. Aber für Prince waren diese Stunden kostbar, boten sie ihm doch die Möglichkeit, sich auf etwas anderes als auf die Führung seines Unternehmens zu konzentrieren. Dann gab es nur ihn, das Flugzeug und die Elemente. Keine Anrufe, keine Meetings, keine Termine. Es galt nur, den Vogel in der Luft zu halten und sicher zu landen. Und er war ein guter Pilot.
Mit einem grimmigen Lächeln stieg er in das kleine Cockpit und begann mit dem Preflight-Check. Sein Umfeld gefiel ihm: Paris-Le Bourget war ein Flughafen mit einer langen Geschichte. Der Höhepunkt seiner illustren Vergangenheit war die Landung von Charles Lindbergh am 21. Mai 1927, nachdem er in seinem einmotorigen Eindecker, der Spirit of St Louis, als erster Mensch alleine den Atlantik überquert hatte. Obwohl Prince’ Cessna technisch sehr viel fortgeschrittener war, stellte er sich in den Minuten vor dem Start gern vor, er wäre einer der großen Helden der Luftfahrtgeschichte, der nun angeschnallt in seiner primitiven Maschine saß und nicht wusste, ob der bevorstehende Flug sein letzter sein würde.
Doch an diesem Tag war alles anders. Heute fühlte Prince sich ganz und gar nicht wie ein Held der Lüfte. Er hatte eher das Gefühl, auf ein Schlachtfeld zu fliegen.
Er schob seinen Laptop in den kleinen Safe neben dem Copilotensitz. Auch wenn er alleine flog, wusste er seinen Rechner gern gut gesichert, schließlich befanden sich Geheimnisse darauf, die nicht für die Augen anderer bestimmt waren. Doch selbst wenn sein Laptop jemandem in die Hände fallen sollte – seine Dateien waren bestens verschlüsselt, und sein nahezu unknackbares Passwortsystem würde es selbst einem erfahrenen Hacker nicht leicht machen, etwas Belastendes zu finden.
Trotzdem beruhigte es ihn, den Laptop im Safe zu wissen. Insbesondere jetzt. Er musste zurück nach Großbritannien, die Daten auf seinen sicheren Server laden und die Festplatte löschen. Die Prozedur nach diesen kleinen, außerplanmäßigen Reisen war immer dieselbe, aber nun, da sein Geheimnis gelüftet worden war, schien sie ihm noch viel wichtiger zu sein. Prince musste sämtliche Beweise vernichten, die ihn mit seinen Kontaktpersonen in Verbindung bringen konnten. Möglicherweise gelang es ihm, den britischen Behörden zu entkommen, wenn er vorsichtig war, aber falls einer seiner neuen Geschäftspartner belastet wurde, würde man ihn, Prince, zweifellos finden und töten. Er durfte keine Spuren hinterlassen.
»Tower, hier Citation Charlie Juliet Four, halte vor Piste zwei rechts«, meldete er dem Kontrollturm. Er merkte, dass seine Stimme schwankte, und räusperte sich.
»Bestätigt, Citation Charlie Juliet Four. Wind zweihundert Strich sieben, Piste zwei rechts, Starterlaubnis erteilt«, kam die Antwort mit starkem französischen Akzent.
Prince drückte den Steuerknüppel leicht nach vorn und spürte, wie das Triebwerk reagierte. Er lenkte das Flugzeug durch den strömenden Regen zu Startbahn zwei, während die Scheibenwischer über die Windschutzscheibe huschten. Obwohl Prince mehrere hundert Flugstunden auf dem Buckel hatte, wurde er immer noch nervös, wenn er im Dunkeln und bei Regen starten musste. Doch heute hatte er keine andere Wahl. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit.
»Wenn Sie Zweifel haben, bleiben Sie am Boden«, hatte sein Fluglehrer ihm eingetrichtert. Prince war sich nicht sicher, ob der Ratschlag auch dann galt, wenn er Angst davor hatte, nach der Landung verhaftet zu werden, so wie diesmal.
»Vorwärts, Tony! Mit beiden Eiern!«, rief er über das Heulen des Triebwerks hinweg, um sich aufzuputschen. Diese seltsame Ermutigung war eine Art Familientradition. Mit diesen Worten hatte sein spanischer Vater ihn immer angetrieben, wenn er geschwächelt hatte. »Vamos, Antonio! Con dos cojones!«, hatte er dann fröhlich gerufen, und Anthony hatte seine Bemühungen tatsächlich verdoppelt. Eine einfache, aber effektive Methode der Motivation.
Als Prince den Steuerknüppel nach vorn drückte, rollte der kleine Jet auf die Startbahn und beschleunigte. Der Regen peitschte gegen die Windschutzscheibe, und die Scheinwerfer konnten die Finsternis kaum durchdringen.
»Paris im Frühling, was für eine Scheiße«, murmelte Prince, als die Cessna leicht schwankend vom Boden abhob. Nicht, dass er sich Sorgen gemacht hätte. Diesen Flug über den Kanal und den Süden Englands bis zu dem kleinen Flughafen in Surrey, auf dem Roger, sein Chauffeur, auf ihn wartete, machte er regelmäßig. Selbst bei diesem Wetter war das keine große Sache.
Prince beendete den Steigflug. Er wünschte sich, in dem trüben Licht mehr erkennen zu können, doch er verließ sich auf die Instrumente. Sekunden später wies ihn ein Piepen von der Steuerkonsole darauf hin, dass er die gewünschte Flughöhe erreicht hatte.
»Leicht verdientes Geld«, sagte er laut. Das war eine seiner Lieblingsredewendungen.
Nachdem er sich beim Tower abgemeldet und alle Anzeigen überprüft hatte, aktivierte er den Autopiloten. Jetzt konnte die Cessna die Arbeit übernehmen. Er saß ganz still und blickte hinaus auf die vorüberhuschenden Nebelfetzen. Dabei dachte er an die Ereignisse der vergangenen Woche zurück und an die Transaktion, die er gerade erst abgeschlossen hatte. Er verzog das Gesicht, denn für einen Mann in seiner Position war es eine verabscheuungswürdige Tat. Der Skandal würde den Ruf von PrinceSec beschädigen und seinen Angestellten zusetzen, aber Prince interessierte sich nur für einen einzigen Menschen. Außerdem würde ihm selbst nichts passieren. Hoffte er zumindest.
Ich hätte mich da raushalten sollen, dachte er reumütig.
Das vergangene Jahr war das stressigste und aufregendste in Prince’ Leben gewesen. Er hatte schon immer hart gearbeitet und gut verdient, und auf dem Weg an die Spitze war er ein paar Leuten auf die Füße getreten – aber wie sollte man sonst ganz nach oben kommen? Außerdem war er stets korrekt geblieben. Natürlich gab es da seine schmutzigen kleinen Geheimnisse, zum Beispiel seine Vorliebe für junge Mädchen und seine Privatsammlung anstößiger Bilder, die er unter dem Deckmantel der Anonymität von zwielichtigen Zwischenhändlern erwarb. Er hatte nie begriffen, weshalb die Gesellschaft so etwas als verbrecherisch erachtete. Er schaute sich die Fotos doch nur an. Jedenfalls, bei seiner Suche nach Bildern war er auf ein Netzwerk von Leuten mit ähnlicher Veranlagung gestoßen, dass sich »Teddybear’s Picnic Network« nannte. Für Prince war es ein Ort gewesen, an dem er seine Gefühle erkunden und seine Vorlieben teilen konnte, und das völlig anonym. Es war sein kleines Geheimnis, und niemand würde je erfahren, wer er war.
Doch vor einem Jahr war alles anders geworden. Eines Abends – er arbeitete noch spät im Büro – bekam er einen Anruf auf seiner Direktleitung. Der Anrufer hatte sich mit dem ominösen Namen »Nightshade« gemeldet und Prince zu einem sicheren Server dirigiert, über den sie sich eine Stunde lang über einen Instant Messenger unterhalten hatten. Als das Gespräch beendet war, wusste Prince, dass nichts mehr so war wie früher. Der Anrufer wusste alles über ihn, seine Familie, sein Bankkonto, sein ganzes Leben. Das allein hätte Prince keine allzu großen Sorgen bereitet, da man ziemlich leicht an solche Informationen herankam; außerdem hatte er an dieser Front nichts zu verbergen. Aber der Anrufer besaß detaillierte Informationen über Prince’ illegale Vorliebe, die Kinderpornografie. Als Nightshade dieses Wort getippt hatte, wäre Prince beinahe das Herz stehen geblieben. Woher wusste der Mann so gut Bescheid? Teddybärs Picknicknetzwerk garantierte doch Anonymität!
Nightshade hatte Prince in dieser Nacht ein Angebot unterbreitet: sein Schweigen als Gegenleistung für Daten und Zugriffsrechte. Widerstrebend hatte Prince sich einverstanden erklärt. Es widersprach all seinen Grundsätzen, aber Nightshade hatte ihn am Wickel. Sein Geheimnis durfte um keinen Preis bekannt werden.
Aber es war keine gewöhnliche Erpressung. Nightshade hatte ihm eine lukrative Partnerschaft angeboten. Einen Ausweg aus dem Leben, das Prince geführt hatte. Eine Chance, seine abartigsten Gelüste zu erkunden. Einen Weg, mehr Geld zu verdienen, als er sich je hätte erträumen können. Warum hätte er da nicht zugreifen sollen? War er es nicht sowieso leid, sich mit den Bürokraten in der Regierung anzulegen? Hatte er nicht ohnehin die Nase voll davon, dass die Umsätze von PrinceSec in den Keller gingen, weil die Politiker und millionenschwere Unternehmen zu geizig waren, ihre Sicherheitssysteme zu erneuern? Sie alle kannten das Risiko, aber sie warteten lieber, bis ihnen jemand bewies, wie anfällig sie waren.
Nightshade hatte Prince erklärt, er sei eine Art Repräsentant einer Untergrundorganisation namens Black Flag. Prince hatte schon von Black Flag gehört – eine elitäre Gruppe von Hackern, die auf dem kriminellen Markt des Deep Web agierte. Dabei handelte es sich um genau die Art von Hackern, denen Cryptos, die Sicherheitssoftware, in die Suppe spucken sollte. Doch am Ende seines Gesprächs mit Nightshade hatte auch Prince fast schon zu Black Flag gehört. So, wie Nightshade es ihm erklärte, war es das Logischste auf der Welt. Schließlich hatte Prince Regierungen und Großunternehmen über Jahre hinweg vor möglichen Cyberangriffen geschützt – und was hatte er jetzt davon? Wer waren diese Bonzen, dass sie darüber bestimmen konnten, was richtig und was falsch war, wo sie doch weitaus schlimmere Verbrechen gegen ihre eigenen Leute begangen hatten?
Allmählich gelangte Prince zu der Erkenntnis, dass er die Falschen beschützt hatte. Was Black Flag tat, war real und fand im Hier und Jetzt statt. Sie erzwangen Veränderungen – auf eine Art und Weise, die den Regierungen unangenehm war, und nun konnte Prince ein Teil davon sein. Überdies konnte er ein Vermögen verdienen und seinen Fantasien freien Lauf lassen.
Also hatten er und Nightshade einen Plan entworfen. Zunächst einmal sollte Prince dafür sorgen, dass die Cryptos-Software bei so vielen Firmen, Energieversorgungsunternehmen, Wasseraufbereitungsanlagen und anderen nationalen Infrastrukturbetrieben wie nur möglich installiert wurde. Cryptos sollte so schnell und weit verbreitet werden, wie es ging. Nightshade behauptete, Kontakte beim Militär und in städtischen Behörden zu haben, sodass der Vorgang sich hier und da durch Schmiergeldzahlungen beschleunigen ließ, aber die meisten Geschäfte mussten auf regulärem Weg abgeschlossen werden. PrinceSec war seit Jahren der Marktführer auf dem Gebiet der Sicherheitssoftware, und da ihre Programme bereits auf wichtigen Steuerungssystemen in ganz Europa liefen, hatten sie einen gewaltigen Vertrauensvorsprung. Daher dauerte es nicht lange, bis die Software dank reduzierter Preise flächendeckend eingeführt worden war.
Teil eins des Plans war erstaunlich gut aufgegangen. Eine preiswerte, zuverlässige Software, die für Sicherheit sorgte – wer konnte dazu schon Nein sagen? In Großbritannien waren bereits mehr als fünfzig Prozent der wichtigsten Infrastruktur- und Herstellungsprozesse mit Cryptos gesichert; bald darauf war die Software auch auf dem Kontinent zum Verkaufsschlager geworden. Über elf Millionen Geräte in Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Raffinerien und Transportnetzwerken waren damit ausgestattet. Aber das alles war nebensächlich. Im Grunde kam es nur auf ein ganz bestimmtes Steuerungssystem an, auf dem Cryptos seit dem letzten Monat ebenfalls installiert war.
Jetzt konnten Nightshade und Prince zu Phase zwei des Plans übergehen. Und Prince wusste, dass er zu Hause sein musste, damit sie beginnen konnte. Außerdem wusste er, dass er dicht davor stand, mit alldem durchzukommen. Er musste nur noch den nächsten Tag überstehen, dann wäre seine Beteiligung an der ganzen schmutzigen Vereinbarung vorüber. Mit mehr Geld, als er je im Leben ausgeben konnte, würde er Großbritannien verlassen und im Paradies untertauchen. Zwar würde PrinceSec nicht mehr existieren, aber das war ihm inzwischen egal. Im vergangenen Jahr hatte er einen Weg gefunden, sich jeden seiner Wünsche zu erfüllen, ohne Angst haben zu müssen, erwischt zu werden – dank des Deep Webs mit seinen geheimen, anonymen Foren. Oh, was er da alles gesehen hatte! In welche Tiefen er vorgedrungen war!
Anscheinend konnte Geld alleine doch glücklich machen. Prince hatte bereits ein Vermögen für ein luxuriöses Haus in Thailand ausgegeben. Mithilfe neuer Papiere und seiner Freunde aus Teddybärs Picknicknetzwerk konnte er nun Pläne für eine kleine Einweihungsparty nach seiner Ankunft in Südostasien schmieden. Endlich konnte er seine Träume verwirklichen. Er hatte sich einen Palast gebaut, und schon bald würde er eine kleine Prinzessin gefunden haben, die sein Playboyleben mit ihm teilte. Nightshade und seine Arbeitgeber konnten den Rest haben. Prince wusste, dass er eigentlich Schuldgefühle hätte empfinden müssen, aber darüber war er längst hinweg. Nun konnte ihn nichts mehr aufhalten, und er genoss es, Teil einer illegalen Aktion zu sein.
Erneut gab die Steuerkonsole ein Ping von sich und riss ihn aus seinem Tagtraum.
»Dämliches Mistding!«, fluchte er. Der Höhenanzeiger spielte verrückt – wie schon auf dem Hinflug – und warnte ihn, obwohl alles in Ordnung war. Er hatte das Flugzeug während seines Aufenthalts in Paris überprüfen lassen, und der Mechaniker hatte ihm versichert, alles sei bestens. Prince tippte gegen das Lämpchen. Es leuchtete weiter, starrte ihn wie ein boshaftes Auge an. Scheiß drauf. Heute Nacht hatte er keine Zeit, dieses Problem beheben zu lassen.
Aber da war eine andere Sache, die Prince Sorgen machte – große Sorgen. »Das wurde für Sie abgegeben«, hatte der Mechaniker mit leiser Stimme zu ihm gesagt und ihm einen Umschlag in die Hand gedrückt. Prince hatte sich gewundert, dass jemand einen Privatbrief bei einem Mechaniker abgab, hatte der Sache aber keine weitere Beachtung geschenkt. Er hatte den Brief und das Wartungsbordbuch entgegengenommen, hatte dem Mechaniker dankend zugenickt und weitertelefoniert. Erst nach Öffnen des Umschlags, als er längst in der Businesslounge saß, war Prince bewusst geworden, dass er in höllischen Schwierigkeiten steckte.
Der Umschlag hatte ein einziges Blatt Papier enthalten, auf dem eine Reihe von Zahlen stand. Vier Zahlengruppen, genauer gesagt, durch drei Punkte getrennt. Prince erkannte sie sofort als numerische Webadresse. Noch in der Lounge des Flughafens hatte er einen sicheren Browser auf seinem Laptop geöffnet und die Zahlen eingegeben. Da er auf diese Weise häufig Informationen von seinen Kontaktleuten erhielt, hatte die ganze Sache ihn nicht allzu sehr verwundert.
Die Adresse führte ihn zu einem Verzeichnis mit mehreren Links. Neben dem ersten Link stand: »Lies mich.« Als Prince ihn anklickte, wurde die Seite aktualisiert, und eine ebenso rätselhafte wie bedrohliche Nachricht erschien:
Sie werden mich nie kennenlernen, aber ich bringe Ihnen den Tod.Ich weiß, was Sie getan haben, denn ich sehe alles, was Sie tun.Ich habe gehört, was Sie gesagt haben, denn ich kenne jedes Ihrer Geheimnisse.Ich weiß, wohin Sie gegangen sind, denn ich folge Ihnen überallhin.Sie werden geprüft, denn ich prüfe alles.Sie stehen nicht über dem Gesetz, denn ich bin das Gesetz.Bitten Sie nicht um Vergebung oder Mitleid.Seien Sie sich nur über eins im Klaren:Wenn Sie nicht nach dem Code leben können, müssen Sie nach dem Code sterbenStrider
Prince hatte noch nie von Strider gehört, aber diese Nachricht war beängstigend. Als er versuchte, das Fenster zu schließen, erschien eine Reihe neuer Pop-ups. In jedem wurde ein anderer Teil von Prince’ Onlineleben dargestellt: seine Aktivitäten innerhalb von Teddybärs Picknicknetzwerk, seine geschäftlichen Transaktionen und Kopien der Fotos, die er geteilt hatte, sogar ein Foto seines neu erworbenen Hauses in Thailand – jede Minute, die er in den dunklen Winkeln des Internets verbracht hatte, war zum Vorschein gekommen. Aber nirgendwo waren Forderungen oder ein Ultimatum zu sehen gewesen.
Prince hatte sofort Nightshade angerufen und ihm die Nachricht vorgelesen. Nightshade war erschrocken gewesen, was Prince der Stimme des Hackers deutlich anhören konnte, aber er hatte ihm versichert, er werde sich um die Sache kümmern. Diese Rückendeckung war einer der Vorteile, die Prince dank seiner Arbeit für Black Flag zuteilwurde, und er war zuversichtlich, dass es Nightshade gelingen würde, jegliche Gefahr zu beseitigen, die von dieser neuen Quelle für ihre Pläne ausging. Trotzdem missfiel ihm der Gedanke, dass es da draußen noch eine Person gab, die seine Geheimnisse kannte. Er fragte sich, wie viel dieser Strider sonst noch wusste.
Und nun, in dem kleinen Jet, stieg erneut Panik in Prince auf. Er beschloss, zurückzufliegen und die Festplatten in seinem Büro zu vernichten. Wie dumm er gewesen war! Und wenn Strider bereits die Behörden informiert hatte? Vielleicht wartete die Polizei schon am Flughafen auf ihn. Dann wäre alles vorbei. Aber das machte ihm weniger Sorgen als die Vergeltungsmaßnahmen, die er von Black Flag zu erwarten hatte. Wenn ihr Plan jetzt aufflog, konnte die gesamte Organisation enttarnt werden, und das wäre allein seine Schuld. Er war unachtsam geworden. Und zu gierig. Wenn wegen seiner Dummheit auch nur ein Mitglied von Black Flag gefasst wurde, würde er einen schrecklichen Preis für sein Versagen zahlen müssen, das war Prince klar.
Ping. So langsam fing er an, dieses seltsame kleine Lämpchen zu hassen. Er deaktivierte den Autopiloten und versuchte, den Jet auszurichten. Dabei hatte er das Gefühl, als würde die Steuerung gegen ihn ankämpfen. Ihm drehte sich der Magen um, als die Cessna ins Schlingern geriet. Verdammt, was ist hier los? Die Steuerung, die zuvor nicht reagiert hatte, schien nun genau das Gegenteil von dem zu tun, was Prince wollte. Wie aus dem Nichts begann der Jet zu trudeln und jagte auf spiralförmigem Kurs in die Tiefe.
»Mayday!«, rief Prince über Funk. »Hier Charlie Juliet Four, habe die Kontrolle über die Steuerung verloren! Ich stürze ab! Mayday, Mayday, Mayday!«
Er horchte, hörte aber nichts als statisches Rauschen. Prince hatte Ähnliches schon einmal erlebt, denn die Cessna war ein launisches Flugzeug; nun aber musste er schnell handeln. Er riss sich zusammen, ließ den Steuerknüppel los und drückte ihn dann wieder nach vorn. Sofort spürte er, wie die Maschine reagierte, wie sie ruhiger und bald darauf wieder gerade flog. Du bist ein guter Pilot. Erneut versuchte er, sich zu beruhigen, und atmete tief durch. Er hatte das Gefühl, die Cessna wieder unter Kontrolle zu haben. Ein Blick auf die Steuerkonsole bestätigte ihm, dass er an Höhe verloren hatte, also zog er den Steuerknüppel vorsichtig nach hinten, um die Abweichung zu korrigieren.
»Hier Citation Charlie Juliet Four. Alles okay, alles okay. Habe alles unter Kontrolle«, sagte er.
»Gute Nacht, kleiner Prinz«, kam die ironische Antwort.
Prince blickte gerade noch rechtzeitig von der Steuerkonsole auf, um die weißen Klippen von Dover direkt vor sich aufragen zu sehen. Die Cessna jagte dicht über der Wasseroberfläche dahin. Prince hatte nicht einmal Zeit zu schreien, bevor sein Jet gegen die weißen Felsen prallte und in einem Flammenball explodierte.
»Gute Nacht, kleiner Prinz«, wiederholte Strider und grinste. Das Radargerät auf seinem Schreibtisch zeigte ihm, dass die Cessna direkt an der britischen Küste abgestürzt war. Anthony Prince hatte es nicht ganz bis auf heimatlichen Boden geschafft.
Strider gönnte sich einen Moment, um den Triumph auszukosten. Er liebte das Gefühl von Macht und Kontrolle, das er in Augenblicken wie diesem spürte, doch am heutigen Abend genoss er es nicht allzu lange. Er hatte eine anstrengende Woche hinter sich, und es gab noch viel zu tun, bis sein Job beendet war.
Schnell und effizient baute er die Geräte auf seinem Schreibtisch ab, zog vorsichtig die Kabel heraus und rollte sie präzise zusammen. Seine Ausrüstung war kostbar. Für diesen speziellen Auftrag hatte Strider einen genauen und funktionstüchtigen Nachbau des Flugsteuerungssystems konstruiert, das die französische und britische Flugüberwachung benutzte. Das war viel leichter gewesen, als man glauben sollte, denn Teile dieses Systems waren seit den 1970er-Jahren nicht erneuert worden, und viele Handbücher und Protokolle, sogar Ersatzteile ließen sich online beschaffen. Verdammt, einige der Teile hatte er direkt bei eBay ersteigert. Bei seinem Job war eine gute Vorbereitung das Wichtigste. Vorbereiten, zuschlagen, verschwinden. Jede Stufe der Mission war so wichtig wie die nächste.
Der eigentliche Angriff war meist das Einfachste. Deutlich schwieriger war es, sich seinem Ziel zu nähern und es gut genug kennenzulernen, bis man wusste, wie man es aufhalten konnte – und gleichzeitig den Schaden zu minimieren, den der Tod des Opfers anderen zufügte. Auch beim heutigen Angriff war es nicht anders abgelaufen. Strider war Anthony Prince im Geheimen mehr als drei Monate lang gefolgt. In dieser Zeit hatte er sehr viel über den Chef des angesehensten Herstellers von Sicherheitssoftware in Europa in Erfahrung gebracht. Er wusste, wovor Prince Angst hatte, wogegen er allergisch war und was er gut konnte. Er wusste sogar, was Prince seiner Frau zum letzten Geburtstag geschenkt hatte. Eigentlich hatte er, Strider, es ihm sogar vorgeschlagen – unterschwellig, versteht sich. Ihm gefiel der Gedanke, dass er sich so lange im System dieses Mannes aufgehalten hatte, ohne sichtbar zu werden.
Doch das Wichtigste war, dass er Prince’ dunkelstes Geheimnis kannte. Strider hatte schon einige schlimme Dinge gesehen, und es gab nur wenig, das ihn nachts nicht schlafen ließ, aber Kinderschänder und Pädophile konnte er nicht ausstehen. Teddybärs Picknicknetzwerk – oder TPN, wie sie in ihren Chatrooms genannt wurden – bildete eine exklusive Gemeinde, die die Privatsphäre ihrer Mitglieder sehr ernst nahm. Strider hatte beobachtet, wie sie sich gegenseitig schützten. Tatsächlich hatte er Prince’ Verfolgung erst aufgenommen, nachdem es diesem Kerl gelungen war, sich trotz der Ermittlungen gegen das TPN der Entdeckung zu entziehen. Strider gab der Gerechtigkeit immer gern eine Chance – aber er hatte mit angesehen, wie die Gruppe zusammenrückte, um ihre Mitglieder zu schützen, wie sie Beweise vernichtete und Server verbrannte, als die Behörden anrückten. Als Strider dann auch noch herausfand, dass Prince plante, seine Leidenschaft auf andere Art auszuleben, hatte er eingegriffen. Kinderhandel war in seinen Augen unverzeihlich. Prince hatte definitiv gegen den Code verstoßen.
So war Prince zu Striders nächstem Ziel geworden, und er hatte sich darangemacht, alles über diesen Mann in Erfahrung zu bringen. Es war ihm nicht schwergefallen, herauszufinden, dass Prince am liebsten selbst flog. Er wusste auch genau, wann Prince an diesem Abend von Paris-Le Bourget abfliegen wollte, wie sein Flugplan aussah und wie lange er in London zu bleiben gedachte. Prince’ Aufenthalt in Großbritannien sollte nur kurz sein, und er hatte bereits einen gefälschten Flugplan für seine Abreise eingereicht. Strider wusste, dass es die richtige Nacht war, um zuzuschlagen. Zu seiner großen Freude hatte Prince in Paris dann auch noch um einen Check seines Flugzeugs gebeten, was Strider die Sache noch mehr erleichtert hatte.
Die soziale Überwachung war eine entscheidende Waffe in Striders Arsenal. Er konnte überzeugend in jede Verkleidung schlüpfen und problemlos beliebige Personen verkörpern. Die Leute glaubten immer, Hacker wären gesellschaftliche Außenseiter, blasse, introvertierte Freaks, die alleine in abgedunkelten Räumen saßen und zu keiner Interaktion mit der realen Welt fähig waren. Doch Strider war das genaue Gegenteil: jung, charmant und ziemlich attraktiv, von durchschnittlicher Größe und Statur, mit neutraler Stimme. Er fiel nicht weiter auf. Besonders stolz war er darauf, dass er sogar den am besten geschützten Menschen der Welt nahe gekommen war, ohne dass sie es bemerkt hatten. Wie paranoid die Leute in anderen Bereichen ihres Lebens auch sein mochten – aus irgendeinem Grund vergaßen sie, in der digitalen Welt ebenso aufmerksam über ihre Schulter zu schauen. Bisher hatte noch niemand das digitale Äquivalent zu einem Bodyguard gefunden.
Normalerweise verbrachte Strider jede Sekunde seiner Freizeit damit, Hintergrundinformationen über wichtige Personen zu sammeln, falls der Anruf kommen sollte. Er beobachtete sie alle, den ganzen seltsamen Zirkus, und notierte sich auch das kleinste Detail. Es waren immer die Details, in denen sich die wichtigsten Hinweise versteckten. Man musste vorbereitet sein. Manchmal waren seine Ziele Politiker, Abgeordnete oder Chefs großer Unternehmen. Was sie verband, war ihre arrogante Selbsteinschätzung, über dem Gesetz zu stehen. Tja, das mochte vielleicht sein, aber dem Code unterlagen sie dennoch.
Wenn man überlegte, dass Prince der Chef einer globalen Cybersicherheitsfirma gewesen war, fand Strider den Abgang dieses Mannes ziemlich enttäuschend. Es war bemerkenswert einfach gewesen, sich als Cessna-Mechaniker auszugeben. Um durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen zu kommen, hatte er nur ein Firmenlogo und eine laminierte Mitarbeiterkarte benötigt, die er in seiner Wohnung angefertigt hatte. Natürlich benutzte er immer eine ausgesprochen professionelle Ausrüstung, um sicherzustellen, dass alles authentisch aussah, aber das war selten nötig, da nur wenige Leute genauer hinschauten. Und wer würde sich schon die Mühe machen und sich als Mechaniker für Privatjets ausgeben?
Strider hatte nicht lange gebraucht, um seinen Virus in das GPS-Steuerungssystem hochzuladen, das den Autopiloten der Cessna steuerte. Darüber hinaus hatte er Prince sogar persönlich die Dokumente zurückgegeben, hatte ihm in die Augen geschaut und ihm einen guten Flug gewünscht. Als Prince in der Luft war, hatte er nur noch warten müssen, bis der Mann sich bei der französischen Flugsicherung abgemeldet und den Autopiloten eingeschaltet hatte. Nach dessen Aktivierung konnte Strider die meisten Funktionen an Bord der Cessna steuern und Prince sogar daran hindern, den defekten Autopiloten wieder auszuschalten.
Als Prince den britischen Luftraum erreicht hatte, war es zu spät gewesen. Er hätte sich selbst dann nicht mehr retten können, wenn er bemerkt hätte, dass er keine Kontrolle mehr über sein Flugzeug besaß.
Er war gewarnt worden, und jetzt war er tot.
Strider fühlte sich niemals schuldig. Warum auch? Er tat der Gesellschaft einen Gefallen. Er überwachte diejenigen, die die Polizei nicht verhaften konnte, und zeigte jenen Leuten die Grenzen auf, die keine zu kennen schienen. Die Ironie war ihm durchaus bewusst. Letzten Endes tötete er jemanden und verabschiedete sich damit endgültig von seiner Menschlichkeit. Nach so einer Tat stand man abseits, betrachtete alles von außen und fand nicht mehr den Weg zurück in die normale Existenz. Aber Strider war schon seit so langer Zeit ein Außenseiter, dass er sich nicht mehr erinnern konnte, wie es war, dazuzugehören. Alles an ihm war nur Fassade.
Nachdem er alles deinstalliert hatte, brachte Strider die Teile seines behelfsmäßigen Labors in den mit Blei ummantelten Lagerraum, den er hinter einer falschen Wand im Eingangsbereich eingerichtet hatte. Jemand, der nicht darauf achtete, würde gar nicht bemerken, dass die Diele kleiner war als in den anderen Wohnungen in diesem Gebäude. Aber Strider bekam ohnehin nie Besuch, und die neugierigen Nachbarn hatten den Versuch, den gut aussehenden, aber scheuen jungen Mann in ein Gespräch zu verwickeln, längst aufgegeben. Selbst das Mädchen vom Stockwerk unter ihm kam nicht mehr mit irgendeinem fadenscheinigen Vorwand vorbei. Es hatte ein paar Monate gedauert, bis sie endlich begriffen hatte, dass er an keiner Beziehung interessiert war.
Er dachte an Anthony Prince und dessen arme, seit Langem leidende Ehefrau. Sie hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun und war vollkommen schuldlos. Doch Strider wusste, dass sie in den nächsten vierundzwanzig Stunden ohnehin von ihrem nunmehr verblichenen Gemahl verlassen worden wäre. Immerhin würde sie jetzt nicht mehr erfahren, auf welche Perversitäten ihr Gatte abgefahren war. Für sie und den Rest der Welt war Anthony Prince’ Tod ein tragischer Unfall, und seine Geheimnisse würden nie ans Licht kommen. Es war die sauberste und sicherste Methode, eine Leiche zu entsorgen, indem man das Töten der Technik überließ.
Zuvor an diesem Abend hatte Strider dafür gesorgt, dass alle noch offenen Probleme gelöst worden waren. Er hatte auf Prince’ Desktopcomputer im PrinceSec-Büro in London zugegriffen und einen verschlüsselten Bilderordner gelöscht, um ihn dann mit einem Ordner voller Dokumente ähnlicher Größe zu überschreiben: Familienfotos, die er von Prince’ Laptop gezogen hatte. Sobald man von Anthony Prince’ tragischem Unfall erfuhr, würde es zweifellos eine Untersuchung geben, und wenn man seine letzten Aktionen nachvollzog, sollte niemand auf den Gedanken kommen, irgendjemand hätte einen Grund gehabt, Prince ins Jenseits zu befördern. Es war unabdingbar, dass Prince unauffällig starb, wenn Striders Plan aufgehen sollte, Teddybärs Picknicknetzwerk auszuschalten.
Strider verließ seine Wohnung, ging hinaus in den Regen und öffnete seinen Schirm. Er war mit seiner Arbeit zufrieden. Vielleicht war Paris ja doch nicht so übel.
Es war noch nicht bestätigt worden, aber Nightshade wusste Bescheid. Prince hatte versprochen, sich sofort nach der Landung bei ihm zu melden. Inzwischen war es vier Uhr früh, und er hatte noch immer nichts gehört. Erst nachdem Nightshade den Bericht der Küstenwache über einen Privatjet erhalten hatte, der abgestürzt war, wusste er Bescheid. Anthony Prince war tot. Das war bedauerlich und kam zur denkbar ungünstigsten Zeit. Jetzt musste Nightshade sich um gründliche Aufräumarbeiten kümmern und dafür sorgen, dass Prince keine Spuren hinterlassen hatte, die zu ihm und seinem Team führten. Aber darum konnte er sich jetzt nicht kümmern, er hatte erst einmal ein weitaus größeres Problem. Mit Prince war auch ihre Informationsquelle und Zugriffsmöglichkeit verschwunden. Er musste einschreiten und so viel wie möglich sicherstellen, bevor irgendjemand in der Firma realisierte, dass der Boss gestorben war. Nightshade hatte sich in der Vergangenheit schon häufiger mit Prince’ Anmeldedaten eingeloggt, aber durch Prince’ Tod war das unmöglich geworden. Dennoch, er musste alles in Erfahrung bringen, was Prince wusste. Der ganze Plan hing davon ab.
»Denk nach, denk nach«, murmelte er und trommelte mit den Fingerspitzen auf seine Schläfen, als könne er auf diese Weise Befehle in sein Hirn eintippen. Er saß im Schneidersitz auf dem Fußboden, die nackten Füße unter die Knie geklemmt, den Laptop auf dem Schoß. Schließlich nahm er die Hände herunter, tippte vorsichtig auf der Tastatur und drückte die Enter-Taste. Ein Piepton war zu hören.
»Verdammt!«, fluchte er, als das Passwort vom Remote-Server auch jetzt nicht akzeptiert wurde. Er starrte auf den Anmeldebildschirm von Prince’ Remote-Desktop. Wieso war das Passwort geändert worden? Prince konnte das nicht getan haben, es gehörte nicht zum Plan. Außerdem sicherte Nightshade sich für Notfälle stets doppelt ab. Auch wenn er überzeugt gewesen war, dass Prince seinen Teil des Plans wie angewiesen ausführen würde, hatte er nichts dem Zufall überlassen. Gleich zu Beginn ihrer Partnerschaft hatte er daher einen Keylogger, ein kleines Programm, das sämtliche Eingaben des Benutzers über die Tastatur aufzeichnete, auf allen Geräten installiert, die Prince besaß. Er war sicher, dass Prince darüber Bescheid wusste, schließlich war er Experte für Computersicherheit, aber er hatte nie versucht, Nightshade den Zugriff zu verweigern. Doch aus irgendeinem Grund war Prince’ Passwort jetzt anders als beim letzten Mal. Was bedeutete, dass es von einem Gerät aus geändert worden war, das Nightshade nicht überwachte.
»Denk nach!«, trieb er sich selbst an und versuchte, klar und analytisch zu denken. War Prince wirklich tot? Vielleicht war er untergetaucht. Möglicherweise hatte er kalte Füße bekommen, weil er wusste, dass dieser Strider ihn über kurz oder lang bloßstellen würde. War ihm das Risiko doch zu groß geworden, und er hatte den Schwanz eingekniffen? Nein. Das ergab keinen Sinn. Prince musste gewusst haben, dass er zu diesem Zeitpunkt unmöglich noch aussteigen konnte. Nightshade ermahnte sich selbst, Ruhe zu bewahren. Er durfte sich jetzt nicht verrückt machen lassen.
»Denk nach, denk nach.« Dieses Mal trommelte er mit den Fingerspitzen seitlich gegen den Laptop. Und dann kam ihm eine Idee. Doppelte Absicherung. Er musste gar nicht auf Prince’ Computer zugreifen. Mit etwas Glück konnte er sich direkt auf den Server einloggen. Nur drei Mitarbeiter des Unternehmens hatten umfassende Administratorrechte auf dem Firmenserver, und Prince war einer davon. Selbst wenn jemand das Passwort auf seinem Desktop geändert hatte, war es unwahrscheinlich, dass auch das Admin-Passwort auf dem Server geändert worden war. Nightshade würde auf die harte Art reingehen müssen.
Mit einem leisen Gefühl der Erregung rief Nightshade via Secure Shell den Server auf, suchte rasch in seinen Notizen nach dem richtigen Admin-Passwort und gab es ein. Ein beruhigendes Ping sagte ihm, dass es funktioniert hatte.
Er war drin.
Nightshade vergeudete keine Zeit und beschaffte sich sofort alles, was er brauchte: die komplette Cryptos-Kundendatenbank von PrinceSec zusammen mit allen Firewall-Informationen, Benutzer-IDs der Administratoren, IP-Adressen, Sicherheitslücken und aktuellen Softwareversionen. Alleine diese Daten wären dem richtigen Käufer Millionen wert gewesen. Aber Nightshade wollte sie gar nicht verkaufen. Diese Datenbank war der Schlüssel zu Phase zwei ihres Masterplans, und der war noch sehr viel mehr wert.
Nightshade entfernte sämtliche Beweise für seine Beziehung zu Prince. Sie waren sehr vorsichtig gewesen und hatten nie echte Namen oder Aufenthaltsorte benutzt, aber Nightshade wollte auf Nummer sicher gehen. Während er sorgsam seine Spuren verwischte, durchsuchte er den Server nach sämtlichen Hinweisen auf seine Verbindung zu Prince. Er war sicher, dass Prince ihn nie über seinen Firmencomputer kontaktiert hatte, überprüfte es aber dennoch. Nachdem Nightshade sich davon überzeugt hatte, dass es keine Hinweise auf ihre Partnerschaft gab, loggte er sich aus. Erleichtert reckte er die Arme über den Kopf. Es war eine lange, auf seltsame Weise aber auch unterhaltsame Nacht gewesen.
Seitdem Prince ihn angerufen und über die Drohung informiert hatte, war Nightshade den größten Teil des Abends auf der Suche nach Informationen über den Hacker gewesen, der sich Strider nannte. Während er im Deep Web unterwegs war, hatte sich nach und nach ein Bild geformt, und Nightshade war klar geworden, wozu dieser Strider imstande war. Er war gerissen, geheimnisvoll und offensichtlich gefährlich – ein Mann, der sich als würdiger Gegner erweisen konnte. Nightshade verspürte widerwilligen Respekt für die Fähigkeiten dieses Hackers. Obwohl Strider ihm heute Nacht dazwischengefunkt hatte, wünschte Nightshade sich beinahe, sie könnten zusammenarbeiten. Es kam extrem selten vor, dass man ein solches Talent in Verbindung mit einem offenkundig mörderischen Verstand entdeckte. Aber einen Hacker wie Strider durfte man nicht frei herumlaufen lassen. Erst recht nicht, wenn dieser Hacker um ein Haar Nightshades Pläne zunichtegemacht hätte. Und niemand, niemand tötete ein Mitglied von Black Flag und kam damit durch. Sie würden sich seiner entledigen.
Aber noch nicht, überlegte Nightshade und lächelte. In diesem Lächeln lag pure, verderbte Boshaftigkeit. Er würde sich noch eine Zeit lang mit Strider amüsieren. Die Arbeit dieses Hackers kam ihm auf irritierende Weise vertraut vor, und Nightshade wollte mehr über ihn wissen. Außerdem war es sinnlos, seinen Gegner auszuschalten, ohne ihn wissen zu lassen, dass er besiegt worden war. Wo blieb denn da der Spaß?
»Wie sieht’s aus, Strider?«, murmelte er. »Machen wir ein Spielchen?«
Regel Nr. 2: Es ist nichts Persönliches
Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass niemand über dem Gesetz steht, aber du führst keine Rachefeldzüge.
Das Internet. Wunder des modernen Zeitalters. Förderer der freien Rede und des schöpferischen Ausdrucks. In den letzten zwanzig Jahren hat die menschliche Interaktion dank der nahezu globalen Ausbreitung webfähiger Computer eine tiefgreifende Verwandlung durchgemacht. Dank des World Wide Web ist die Welt viel kleiner geworden. Das Web ist ein Ort für soziale Netze, Google-Suchen, Musikstreams, Desktop-Proteste, Self-Publishing, Informationen in Nanosekunden, für das Teilen und Verbreiten, für Communitys und die Produktivität. Hier findet jeder, was er braucht. Für alles, was man sich denken kann, gibt es Seiten im Internet. Zumindest sieht es der Großteil der surfenden Bevölkerung so. Nur sehr wenige von uns denken darüber nach, wie viele unserer alltäglichen Aktivitäten heutzutage online stattfinden. Ja, wir wissen von Identitätsdiebstahl, Spamming, Phishing, Viren und Würmern, aber nur wenige von uns betrachten das Web, das entwickelt wurde, um unser Leben zu erleichtern, als potenzielle Waffe.
Im Grunde kann alles, was eine elektronische Komponente besitzt, gehackt werden und verheerenden Schaden anrichten. Ein automatisches Infusionssystem in einer Klinik beispielsweise lässt sich so umprogrammieren, dass der Tropf eine tödliche Dosis abgibt, um dann von selbst auf die Ausgangseinstellung zurückgesetzt zu werden, bevor das Krankenhauspersonal etwas bemerkt. Ein simples Sicherheitsupdate der Computer im Kontrollraum eines Kraftwerks könnte Hackern Zugriff auf das gesamte System des AKWs verschaffen. Mithilfe Ihres Smartphones und der WLAN-Verbindung an Ihrer Arbeitsstelle könnten Sie der Konkurrenz sämtliche Firmengeheimnisse zuspielen. Ihr Handy, Ihr Haus, Ihr Herzschrittmacher, sogar Ihre Autoschlüssel lassen sich gegen Sie einsetzen, falls jemand diesen Wunsch verspürt.
Warum erleben wir dann nicht tagtäglich mehr solcher Angriffe? Das tun wir, es wird nur nicht ausgiebig darüber berichtet. Vielleicht lassen sich viele solcher Vorfälle auch auf technische Fehler zurückführen. Und verständlicherweise geben Unternehmen und Regierungen nicht gern zu, dass sie angreifbar sind – schließlich würde sich das schlecht auf ihre Aktienkurse oder Wiederwahlchancen auswirken.
Vermutlich liegt der Grund dafür, dass wir nichts über die große Zahl an persönlichen Cyberangriffen auf ganz normale Menschen hören, aber auch darin, dass diejenigen, denen der Sinn danach steht, zu töten oder zu verstümmeln, einfach zu einem Messer oder einer Pistole greifen, weil das viel schneller und leichter geht.
Im Allgemeinen sehen wir uns nicht als potenzielle Opfer eines Onlineangriffs, weil wir das Gefühl haben, zu unwichtig zu sein, oder weil wir glauben, dass jemand auf uns aufpasst. Selbst wenn man sich die Zeit nehmen würde, darüber nachzudenken, wie so ein elektronischer Angriff aussehen mag oder woher er kommen könnte, müsste man über das hinausschauen, was wir als das Internet kennen. Unter der sozialen, unterhaltsamen, informativen und praktischen Oberfläche, auf der wir uns jeden Tag bewegen, schlummert die dunkle, unheilvolle Seite des Internets, die umgangssprachlich »Deep Web« genannt wird. Hier ist die Anonymität so gut wie garantiert, wenn man sich vorsieht. Im Deep Web kann man Drogen, Pornografie, Waffen, sogar den Tod suchen und kaufen. Auf zahlreichen Online-Schwarzmarktseiten lässt sich eine Lieferung Methamphetamin ebenso problemlos bestellen, wie Sie eine Pizza ordern. Mithilfe von Tor, einer kostenlosen Open-Source-Software, die den Internet-Traffic durch ein weltweites Netzwerk von Freiwilligen mit über dreitausend Relais umleitet, ist alles möglich. Man könnte anonym jemanden anheuern, der für einen stiehlt, entführt, vergewaltigt, oder man könnte ein Kind kaufen oder verkaufen. Alles wird mit einer anonymen digitalen Währung bezahlt. Es gibt keine Fragen. Jeder von uns wäre theoretisch dazu in der Lage. Jeder mit einem Computer und der richtigen Einstellung könnte auf das Deep Web zugreifen.
Nicht alles im Deep Web ist illegal. Tatsächlich ist vieles eine Art Rebellion gegen den sogenannten Überwachungsstaat. Vor allem aber ist das Deep Web ein Schwarzmarkt. Und wie bei jedem Schwarzmarkt gibt es auch hier unterschiedliche Levels der Gefährlichkeit und Verderbtheit. Deshalb muss man sehr genau wissen, wonach man sucht und wo man es finden kann. Aber es gibt leicht zugängliche Wikis und Listen, die einem dabei helfen. Je mehr man über den Markt weiß, desto besser findet man sich darin zurecht. Sie würden ja auch keinem x-Beliebigen auf der Straße Waffen, Drogen oder Dienstleistungen abkaufen. Doch man sollte wissen, worauf man sich einlässt, wenn man sich ins Deep Web begibt, denn es ist ein gefährlicher Ort. Es existiert nicht einfach in einer anonymen Blase. Es ist und bleibt ein Schwarzmarkt, und wie auf jedem Schwarzmarkt gibt es auch hier Menschen, die jeden Tag um die Vorherrschaft kämpfen.
Menschen wie Scott Mitchell, Sonderberater der National Cyber Crime Unit. Als Abteilung der National Crime Agency, des »britischen FBI«, hatte die NCCU sich mit der ehemaligen Serious Organized Crime Agency zusammengeschlossen, um gemeinsam mit anderen Behörden eine vereinte Streitmacht im Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu bilden. Die Mitarbeiter der NCA konnten einen Einfluss ausüben, der weit über den eines gewöhnlichen Polizisten hinausging. Jeder von ihnen besaß die Befugnisse eines Polizei-, Zoll- und Einwanderungsbeamten. Scott Mitchell war kein Agent, arbeitete aber seit drei Jahren als Berater für die NCCU. Das Team, mit dem er zusammenarbeitete, respektierte ihn, kannte ihn allerdings nicht besonders gut. Mitchell wusste, dass einige NCCU-Agenten ihn noch immer als ehemaligen kriminellen Hacker betrachteten, den man zu ihrer Unterstützung geholt hatte. Manchmal hatte er sogar das Gefühl, dass sie ihn deswegen verabscheuten.
Doch Mitchell war hochtalentiert und erfahren, obwohl er noch nicht einmal dreißig war. Sein größter Fehler bestand darin, dass er sich zu sehr in bestimmte Verbrechen oder Verbrecher verbiss. Dann konnte er sich tagelang auf der Online-Suche nach Hinweisen und Spuren verlieren – mit der Folge, dass er nicht am normalen Büroalltag teilnahm oder nach Feierabend mit den Kollegen mal in die Kneipe ging.
Mitchell war dennoch zufrieden mit seinem Job. Schließlich hatte er die Beraterstelle nicht angenommen, um Freunde zu finden. Er zog es vor, sich in der digitalen Welt aufzuhalten, zu lauern, zu suchen, sich anzupirschen. Erst dann fühlte er sich richtig lebendig.
In den letzten sechs Monaten hatten Mitchell und sein Team bei der NCCU gemeinsam daran gearbeitet, einen besonders aktiven Kinderpornografiering auszuschalten, der sich »Teddybärs Picknicknetzwerk« nannte. Die Sache widerte Mitchell an – nicht nur, was dort gepostet wurde, oder der dreiste Name. Es war vor allem der Mangel an Ressourcen der NCCU bei der Bekämpfung derartiger anonymer Verbrechen, die Mitchell zu schaffen machte.
Immerhin hatten sie vor einem Monat eine Textnachricht abgefangen, die es ihnen nach sehr viel Arbeit ermöglicht hatte, auf einen Server in Brighton zuzugreifen, der als Hoster für die Bilder von Teddybärs Picknicknetzwerk genutzt wurde. Daraufhin waren sie in der Lage gewesen, eine beachtliche Zahl an Mitgliedern aufzuspüren. Sie hatten eine Handvoll verhaftet und die Server beschlagnahmt. Mitchell hatte häufig das Gefühl, nur Geduld haben zu müssen, um erfolgreich zu sein. Wenn man Verdächtige lange genug beobachtete, machten sie irgendwann einen Fehler. Oft wurden die cleversten Verbrecher durch einen winzigen Fehltritt zu Fall gebracht. Steuerschulden, defekte Bremslichter oder nicht bezahlte Fernsehgebühren – irgendeine Kleinigkeit, die oft nicht einmal mit ihrem Verbrechen zu tun hatte, führte mitunter dazu, dass die Behörden an die Tür klopften und die Gelegenheit bekamen, sich im Keller dieser Leute umzusehen.
Genau das hatte Mitchells Team bei Teddybärs Picknicknetzwerk getan. Für die Außenwelt war es eine Erfolgsstory der NCCU gewesen, die wieder einmal eine Horde Perverser aus dem Verkehr gezogen und die Unschuldigen beschützt hatte. Für Mitchell jedoch hatte es vor allem harte Arbeit, ein Quäntchen Glück und viel Frust bedeutet. Das Pädophilen-Netzwerk war nach wenigen Tagen auf neuen Servern wieder aktiviert worden. Die meisten Rädelsführer hatten sich der Verhaftung oder Identifikation entziehen können. Beweise waren über Nacht verschwunden, sogar nachdem Mitchell sie mit eigenen Augen gesehen hatte. Er wusste, dass das Netzwerk jemanden bei der NCCU bezahlt haben musste, um das belastende Material verschwinden zu lassen. Er hatte geschworen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, hatte bisher aber nicht die leiseste Ahnung, um wen es sich handelte.
In der Zwischenzeit hatte die Abteilung sich anderen Fällen zugewandt, denen sie ihre Zeit und ihre Ressourcen opferte. Doch Mitchell mochte keine halben Sachen und setzte die Jagd auf das Pädophilen-Netzwerk fort. Er hatte ein einfaches Programm geschrieben, das die Foren, von denen er wusste, durchstöberte und nach den Benutzernamen Ausschau hielt, deren Besitzer er zur Strecke bringen wollte. Wenn sie wieder online waren, weil sie glaubten, die Luft wäre rein, würde Mitchell davon erfahren. Er hatte geschworen, jedes Mitglied von Teddybärs Picknicknetzwerk zu erwischen, und wenn es das Letzte war, was er tat.
Am Sonntagmorgen um 8 Uhr saß Mitchell vor seinem Laptop und wartete ungeduldig darauf, dass die Seite aktualisiert wurde. Seine Suchsoftware hatte einen Hinweis gefunden und ihn alarmiert. Ein Mitglied, das sich Brown Bear nannte und das Mitchell nur zu gut kannte, hatte Freitagnacht eine Nachricht in einem der allgemeinen Foren gepostet. Mitchell blickte auf den Text.
Brown Bear: Geht heute nicht in den Wald.
»Faszinierend«, murmelte Mitchell.
Diese Nachricht hatte er schon unzählige Male gesehen. Es war eine Warnung an das restliche Netzwerk, dass man ein Mitglied ihres Teams entweder erwischt hatte, oder dass es sich bedroht fühlte. Das Pädophilen-Netzwerk war engmaschig, und die Mitglieder passten aufeinander auf. Schließlich wussten sie nur zu gut, dass sie alle auffliegen konnten, wenn auch nur ein Mitglied enttarnt wurde.
Mitchells Telefon klingelte, aber er beachtete es gar nicht. Er war auf Bärenjagd.
Rebecca MacDonald betrachtete sich in dem Ganzkörperspiegel. Sie wollte die perfekte Kombination aus Weiblichkeit und Professionalität erreichen, war sich aber nicht sicher, ob ihr das jemals gelingen würde. Ihr schottischer Vater hatte eine stolze Kenianerin geheiratet; das lockige, dunkelbraune Haar war ein Erbe ihrer Mutter, ebenso Rebeccas Eigenwilligkeit, ihre überdurchschnittliche Intelligenz und ihre dreckige Lache. Als einziges dunkelhäutiges Mädchen im schottischen Dorf Glenfinnan war sie schon als Kind die Zielscheibe von Spott und Herablassung gewesen, und ihre Eltern hatten ihr stets bewusst gemacht, dass sie es im Leben nicht leicht haben würde. Rebecca gab sich alle Mühe, stets freundlich und rücksichtsvoll zu sein. Es fiel ihr nicht immer leicht, zumal sie ein aufbrausendes Temperament und eine spitze Zunge besaß, doch sie bemühte sich redlich um die Selbstbeherrschung, die ihre Mutter ihr immer eingetrichtert hatte. »Wenn du Erfolg haben willst, musst du lernen, dir auf die Zunge zu beißen«, hatte sie jedes Mal gesagt, wenn sie Rebecca nach einer rassistischen Beschimpfung trösten musste. Obwohl sie groß, attraktiv und intelligent war, wusste Rebecca nur zu gut, dass sie auch heute noch um ihren Platz im Leben kämpfen musste.
»Du schaffst das schon«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild.
Rebecca kam gerade aus dem Bad, als das Telefon klingelte. Sie zuckte zusammen. Wer um alles in der Welt rief so früh an einem Sonntagmorgen an? Sie wickelte sich in ein Handtuch und nahm den Hörer ab.
»Hallo?«, fragte sie mit nervöser Stimme.
»Rebecca? Hier ist Jack. Entschuldigen Sie, dass ich so früh anrufe. Ich habe Sie doch nicht geweckt?« Jack Taylor war ihr Chef bei PrinceSec. Er hatte sie direkt von der Uni in die Firma geholt und war in ihrem ersten Jahr gewissermaßen zu ihrem Mentor geworden. Aber bisher hatte er sie noch nie zu Hause angerufen.
»Natürlich nicht. Ich stand nur gerade unter der Dusche.« Sie legte sich das Handtuch um die Schultern. »Ist alles in Ordnung?«
»Nein.« Jack zögerte. »Das heißt, ich weiß es nicht. Es geht um Tony Prince.«
Rebecca hatte nicht viel mit dem Firmenchef zu tun, aber sie hielt Prince für einen anständigen Kerl, und er war immer freundlich zu ihr gewesen.
»Was ist mit ihm?«
»Er ist verschwunden.«
»Was soll das heißen?«
»Sein Flugzeug ist Freitagnacht in Paris gestartet, aber er ist nie am Biggin-Hill-Flughafen angekommen.«
»Großer Gott!«
»Es kommt noch schlimmer.«
Rebecca runzelte die Stirn. »Reden Sie weiter.«
»Offenbar hatte Tony vor, sich abzusetzen. Er hat seine Anteile an der Firma schon vor etwa einem Monat verkauft. Angeblich war er in finanziellen Schwierigkeiten, aber das Geld ist auf keinem seiner bekannten Konten zu finden. Seine Frau Barbara weiß nichts von Geldproblemen, aber sie sagt, er wäre in letzter Zeit sehr beschäftigt und geheimnistuerisch gewesen. Er war viel unterwegs, bekam seltsame Anrufe und dergleichen. Sie ging davon aus, dass er eine Affäre hatte. Doch heute Morgen hat sie einen Brief von seinen Anwälten mit den Scheidungspapieren erhalten. Sie hatte keine Ahnung, dass Tony sich von ihr scheiden lassen wollte.«
Rebecca versuchte zu begreifen, was sie da gerade hörte. »Und er hat Ihnen nichts gesagt?«, fragte sie schließlich.
Jack war Prince’ rechte Hand und hätte eigentlich davon wissen müssen, wenn Prince seine Frau verlassen wollte. Auf jeden Fall hätte er gewusst, dass der Firmenchef die Absicht hatte, seine Anteile zu veräußern.
»Nein, er hat nichts gesagt. Aber als er am Donnerstag das Büro verließ, wollte er mit mir etwas trinken gehen. Leider hatte ich noch mit den Cryptos-Updates zu tun. Vielleicht wollte er mir bei einem Drink alles erzählen.«
»Sie glauben doch nicht wirklich, dass er sich aus dem Staub gemacht hat?«
»Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Die Polizei hat mich informiert, dass ein Privatjet an der Küste abgestürzt ist, in der Nähe von Dover. Bisher ist es ihnen noch nicht gelungen, Teile der Maschine zu bergen, aber wir sollten davon ausgehen, dass es Prince’ Cessna gewesen ist.«
»Haben Sie die Polizei schon über die Scheidungspapiere und den Verkauf der Anteile informiert?«
»Nein.«
»Was hat das alles zu bedeuten, Jack? Glauben Sie, Prince steckte in Schwierigkeiten?« Rebecca fragte sich, warum Jack Taylor ausgerechnet sie anrief und ihr diese Mitteilungen machte. Er war offensichtlich erschüttert, aber eine eher unbedeutende Sicherheitsexpertin wie sie war kaum die richtige Ansprechpartnerin, wenn er nach Hinweisen suchte.
»Vor etwa fünf Minuten hat Günther Klein mich angerufen und mir erzählt, dass jemand sich am frühen Samstagmorgen per Remote-Zugriff in den Server eingewählt hat.« Jack Taylor klang nervös. Er zögerte. Rebecca konnte ihn atmen hören. Schließlich fuhr er fort: »Man hat Prince’ Admin-Passwort verwendet, um auf den Datenbankserver zuzugreifen.«
Jetzt begriff Rebecca, warum Jack sich bei ihr gemeldet hatte. Die Datenbank war das Herzstück der Cryptos-Software. Darin stand alles über ihre Klienten, auf welchen Computern sie Cryptos installiert hatten, welches Betriebssystem sie benutzten, welche Updates installiert waren und welche Patches sie aufgespielt hatten. Außerdem waren Zugangsdaten darin eintragen, beispielsweise Benutzernamen und die IP-Adressen aller Geräte, auf denen Cryptos installiert war. Es wäre fatal für PrinceSec, wenn die Datenbank auf irgendeine Weise kompromittiert worden war.
Rebecca schwieg verblüfft und hörte Jack weiter zu.
»Der Unfall soll sich Freitagabend gegen zweiundzwanzig Uhr ereignet haben«, fuhr er fort. »Wenn wir davon ausgehen, dass es Prince’ Flugzeug war, das abgestürzt ist, bedeutet das entweder, dass er gar nicht im Flieger gesessen und selbst auf die Datenbank zugegriffen hat, oder …« Wieder machte er eine Pause. »Oder jemand anders hat sich mit seinen Daten angemeldet. So oder so – wir haben ein Problem.«
Rebecca wusste, dass sie wenigstens eine Stunde brauchen würde, um quer durch London zur Zentrale von PrinceSec zu fahren, einem viktorianischen Gebäude. Jack hatte sie gebeten, sich zu beeilen. Er wollte, dass sie sich die Serverdaten ansah, da es ihr Spezialgebiet war, und ihr dabei über die Schulter schauen. Günther Klein, der Sicherheitschef von PrinceSec, hatte nicht herausfinden können, von wo der Zugriff erfolgt war oder wie lange der Eindringling sich auf dem Server umgesehen hatte, und setzte seine Hoffnungen nun auf Rebecca. Außerdem sollte die NCCU eingeschaltet werden, allerdings erst, nachdem Rebecca sich ein Bild davon gemacht hatte, wie schlimm der Schaden war.
Rebecca versuchte noch immer zu begreifen, welches Ausmaß das Chaos haben würde, falls wirklich jemand in die Datenbank eingedrungen war. Sie wollte gar nicht daran denken, was passieren konnte, wenn die Daten in die falschen Hände gerieten. In den meisten Systemen, in denen Cryptos eingesetzt wurde, lief das Programm hinter den Standard-Sicherheitsprotokollen wie Firewalls oder VPNs, daher würde ein Angriff auf Cryptos bedeuten, dass man diese Abwehrmechanismen bereits ausgeschaltet hatte. Rebecca dachte daran, wie unzureichend die meisten dieser Standardmaßnahmen waren. Vor allem aus diesem Grund hatte man die Behörden und Unternehmen davon überzeugen können, Cryptos zu installieren. Das Programm war sozusagen der zweite Rettungsring, wenn der erste versagte. Falls die Kundendatenbank von PrinceSec kopiert worden war, besaßen die Hacker alle Informationen, die sie brauchten, um sich Zugriff auf sämtliche Systeme auf der Liste zu verschaffen – Wasseraufbereitungsanlagen, Streckennetze, Verkehrssteuerung und –überwachung, das Überlandleitungsnetz und zahlreiche Großunternehmen. Und der Angriff konnte überall erfolgen.
Wo sollten sie mit der Suche beginnen? Rebecca war überzeugt, dass die Antwort auf Prince’ Computer und in den Serverdaten zu finden sein musste.
Sie konnte nur hoffen, dass sie fündig wurde, bevor etwas Schreckliches geschah.
Ohne den Code wäre Strider nur einer von vielen kleinen Crackern gewesen – ein krimineller Hacker, der sich gegen einen gesichtslosen, namenlosen Feind stellte. Seine Angriffe wären ebenso wild wie nutzlos gewesen. Er hatte schon früh begriffen, dass er für seine Arbeit Richtlinien brauchte. Jeder Mensch brauchte Regeln, selbst wenn es sich dabei um einen einfachen Verhaltens-Code handelte. Mit den vom Staat erlassenen Gesetzen hatte Strider allerdings nicht viel am Hut. Nur weil etwas legal war, musste es noch lange nicht richtig sein. Im Umkehrschluss war etwas Illegales noch lange nicht falsch. Strider wandelte auf dieser dünnen Linie zwischen Richtig und Falsch, zwischen Gut und Böse, wie ein Seiltänzer, der unbeachtet hoch oben zwischen zwei Wolkenkratzern balancierte. Und um im Bild zu bleiben: Er hielt sich schon so lange dort oben auf, dass er sich an seine besondere Sicht der Welt gewöhnt hatte.
Strider gefiel das Wort »Attentäter«. Es klang unverfänglicher, neutraler als das blutrünstige »Killer« oder »Mörder«, und nicht so offiziell und sanktioniert wie »Henker«, auch wenn alle diese Bezeichnungen genauso zutreffend waren. Ein Attentäter war per Definition jemand, der einen Überraschungsangriff auf eine wichtige Person plante und ausführte. Kein Wort konnte das, was Strider tat, besser beschreiben.
Die meisten Attentäter hatten eine Art Code in Bezug darauf, wen sie töteten und wen nicht. Jeder hat irgendwo eine Schmerzgrenze, selbst wenn es um Mord geht. Keine Frauen oder Kinder, lautete bei vielen die Standardregel. Strider teilte diese Ansicht nicht. Frauen und Minderjährige waren genauso wie jeder erwachsene Mann in der Lage, schreckliche Verbrechen zu begehen. Und seiner Ansicht nach musste jeder mit den Konsequenzen leben, wenn er ein Verbrechen verübte. Man mochte über den Gesetzen des Landes stehen, aber Strider hatte sein eigenes Gesetz, den Code.
Er hatte den Code in einer sehr frühen Version durch einen Kontaktmann kennengelernt, den er in einem der Foren im Deep Web getroffen hatte. Bevor er sich den Namen Strider zugelegt hatte, verbrachte er viel Zeit im Deep Web, schärfte seine Fähigkeiten und prahlte mit seinen Talenten. Jemand, der sich »Salesman« nannte – Strider ging davon aus, dass es sich um einen Mann handelte -, hatte ihn damit aufgezogen, und sie waren ins Plaudern gekommen. Zu jener Zeit war Strider ein zorniger junger Mann mit einer tiefen Abneigung gegen Autoritäten gewesen – ein Rebell, der kein echtes Ziel gehabt hatte, an dem er seine Aggressionen auslassen konnte. Schon als Heranwachsender hatte er Probleme mit der Polizei gehabt und eine schwere und schmerzhafte Kindheit durchlitten, aber er war extrem clever und besaß all die Eigenschaften und das Wissen, das man bei einem kriminellen Hacker erwartete.
Erst der Salesman hatte ihm gezeigt, wie er seine Wut kanalisieren und die Behörden an den Stellen treffen konnte, an denen es wehtat. Der Salesman hatte ihm demonstriert, dass er in zu kleinen Dimensionen dachte, wenn er versuchte, Großunternehmen mit wiederholten DDoS-Attacken oder Malware-Einschleusungen – den Standard-Cyberangriffen – zuzusetzen. Sicher, die Firmen waren genervt, und die Produktionsabläufe wurden gestört – vielleicht konnte sogar das Vertrauen in die Marke untergraben werden -, aber im Endeffekt mussten vor allem die Arbeiter und mittlere Führungskräfte darunter leiden. Sie waren diejenigen, die die Kürzungen und Entlassungen zu spüren bekamen, während die Bonzen immer fetter wurden. Und das konnte ja wohl nicht richtig sein.