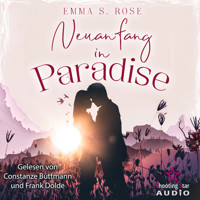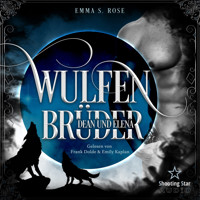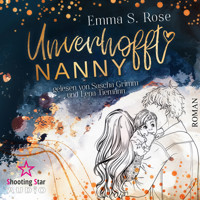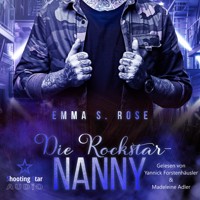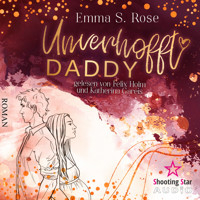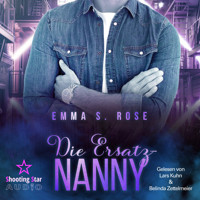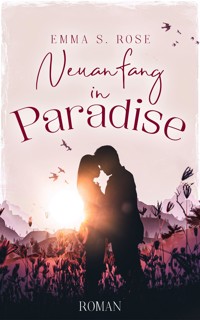
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn dein Herz noch vor dir weiß, was es braucht … Das Leben in Paradise ist vor allem eins: ruhig und beschaulich. Julia liebt die Idylle, den Zusammenhalt und ihren Job als Lehrerin. Eines Tages bekommt sie einen neuen Schüler. Noah Fitzpatrick ist erst vor kurzem mit seinem Vater Scott aus New York hergezogen. Und er ist verstummt. Ein tragischer Unfall hat die Fitzpatricks nach Paradise getrieben. Im Haus von Scotts Großeltern wollen die beiden endlich ihren Frieden finden. Was Scott definitiv nicht sucht, ist eine Frau. Aber Julia, das Good-Girl von Paradise, erwärmt nicht nur Noah schnell für sich, sondern auch seinen Vater. Was anfangs wie keine gute Idee erscheint, wird schon bald sehr ernst. Doch was, wenn die Schrecken der Vergangenheit noch längst nicht bewältigt sind?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Neuanfang in Paradise
EMMA S. ROSE
Für Jens,
meine Zuflucht, mein Paradies.
Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Danksagung
Newsletter
Über den Autor
Emma S. Rose
Neuanfang in Paradise
1. Auflage
Mai 2022
© Emma S. Rose
Rogue Books, Inh. Carolin Veiland, Franz – Mehring – Str. 70, 08058 Zwickau
Buchcoverdesign: Sarah Buhr / www.covermanufaktur.de unter Verwendung von Stockgrafiken von Thomas; Johnstocker / Adobe Stock
Alle Rechte sind der Autorin vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Autorin gestattet.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung des Werkes in andere Sprachen, liegen allein bei der Autorin. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu entsprechendem Schadensersatz.
Sämtliche Figuren und Orte in der Geschichte sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Orten entspringen dem Zufall und sind nicht von der Autorin beabsichtigt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Die Sonne stand bereits schräg am Himmel und tauchte die Welt in orangerotes Licht. Ich schnappte mir die Sonnenbrille und schob sie auf die Nase, um mich vor dem tiefstehenden Licht zu schützen, das meine Augen tränen ließ.
Langsam wurde diese Fahrt anstrengend – eine Feststellung, die mir nach fast fünf Stunden Interstate definitiv zustand. Aber wir näherten uns dem Ende. Die Grenze zu New York hatte ich hinter mir gelassen, nun fuhren wir das letzte Stück über die Landstraße. Zu meiner Rechten erstreckte sich der Lake Champlain, der die vielen Inseln einschloss, die zum Grand Isle County gehörten.
Und eine dieser Inseln war unser Ziel.
Ich warf den wohl hundertsten Blick in den Rückspiegel, um zu sehen, dass sich die schmale Gestalt meines Sohnes kaum verändert hatte. In sich zusammen gesunken, die Augen geschlossen, schlafend. Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich geglaubt, er wirke friedlich. Keinerlei Sorgen in seinem Gesicht, das von feinem, blondem Haar umrahmt war – ein starker Kontrast zum dunklen Haar seiner Mom …
Ein schmerzhafter Stich durchfuhr meine Brust, während ich mich wieder auf die Straße konzentrierte, die sich malerisch am See entlang schlängelte und wie leergefegt vor mir lag. Nein. Diesen Pfad würde ich nicht betreten. Auf gar keinen Fall. Nicht jetzt – und auch nicht so bald. Mühsam schob ich jede Erinnerung an Amalia beiseite und tat das, was mir am meisten lag: Ich konzentrierte mich auf Fakten.
Laut Navi brauchten wir noch etwas mehr als eine halbe Stunde, ehe wir unser Ziel erreichten. Dreißig Minuten auf der Interstate brachten uns weit. Dreißig Minuten hier draußen waren gar nichts in Sachen Entfernung. Während ein Teil von mir es kaum noch erwarten konnte, anzukommen, wollte der andere umkehren und nach Hause fahren.
Nach Hause.
Nie zuvor hatte ich weniger sagen können, wo genau sich das noch befand.
Bis vor kurzem wäre meine Antwort jedenfalls eine andere gewesen: Da hätte ich mir nichts anderes vorstellen können, als in meinem Penthouse in New York zu leben. Mein Alltag war durchstrukturiert gewesen, bestimmt von meinem Job, und ich hatte für alles eine Lösung gehabt. Nannys, Haushaltshilfen, sogar eine zusätzliche Köchin, die sich um abwechslungsreiche Mahlzeiten unter der Woche gekümmert hatte. Schon mit Amalia hatte es einen Haufen Menschen gegeben, die für mich – für uns – gearbeitet hatten, doch nach ihrem Unfall hatte ich aufgestockt. So funktionierte ich. Je stressiger eine Situation wurde, desto mehr kühlte mein Verstand ab. Für Probleme gab es Lösungen, die mit Geld zu kaufen waren. So funktionierte es innerhalb meines Jobs, und so funktionierte auch mein Leben.
Zumindest glaubte ich das für eine ganze Weile. Wie naiv und kurzsichtig ich doch gewesen war.
Die Stille meines Sohnes, sein Verhalten im Allgemeinen, hatte mich zwar das eine oder andere Mal tangiert, doch in der Regel hatte es genug andere Dinge gegeben, die mich schnell davon abgelenkt und nachhaltiger beschäftigt hatten. Am Ende ließ sich mein Verhalten ziemlich einfach auf den Punkt bringen: Ich war ein Arschloch von Vater und hatte mich nicht ausreichend um den einzigen Sohn gekümmert, was ernsthafte Folgen nach sich gezogen hatte. Folgen, die allesamt an einem einzigen Freitagvormittag eskaliert waren. Ein Freitagvormittag, der mein Leben von einem auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt und dafür gesorgt hatte, dass ich nun, zwei Wochen später, mit Noah im Auto saß und zu dem einzigen Ort fuhr, der mir noch eingefallen war.
Paradise.
Früher ein Ort unbeschwerter Sommerurlaube, dann für lange Zeit der Grund für Beklemmung und Erschaudern, und jetzt womöglich die einzige Option, die mir, uns, noch blieb.
Meine Knöchel stachen weiß hervor, als ich das Lenkrad fester umfasste und meinen Kiefer anspannte.
Jahr für Jahr hatte ich einige Wochen meines Lebens dort verbracht, im Haus meiner Großeltern, die es geliebt hatten, mich und meinen Bruder aufzunehmen. Was früher das ultimative Abenteuer gewesen war, war irgendwann jedoch langweilig geworden, fad, zum Zeitfresser. Ein Teenager konnte sich Besseres vorstellen, als auf einer Insel nahe der Grenze Kanadas festzuhängen, wo es weitaus mehr Bäume als Menschen gab. Ich hatte damals bereits in New York gelebt und begonnen, das Pulsieren der Stadt zu schätzen. Also kämpfte ich erbittert darum, diese Tradition zu brechen – und gewann. Weil ich früh in meinem Leben beschlossen hatte, auf der Gewinnerseite zu stehen. Dass ich damit nicht nur die Tradition brach, sondern auch das Herz meiner Großeltern, hatte ich, naiv wie ich war, billigend in Kauf genommen.
Seitdem war meine Haltung Paradise gegenüber mehr als zwiespältig.
Doch nun war ich auf dem Weg dorthin. Meine Großeltern lebten schon lange nicht mehr. Wir hatten unsere Beziehung irgendwann kitten können, allein um meines Bruders willen, doch es war nie wieder so geworden wie früher. Gedanken daran verdrängte ich, weil sie mich mit schlechtem Gewissen erfüllten. Das wiederum ließ mich schwach werden – und Schwäche war etwas, das ich mir normalerweise nicht zugestand. Dummerweise stand ich im Begriff, genau in diesen Morast tief einzutauchen. Schwierig, mich nicht mit meinem damaligen Verhalten auseinanderzusetzen, wenn ich zum Kern des Geschehens zurückkehrte.
Ein leises Geräusch ertönte hinter mir. Ich warf einen weiteren Blick in den Rückspiegel und sah, dass Noah sich regte. Das leise Stöhnen war wie ein Paukenschlag, so selten war es geworden, dass er akustisch auf sich aufmerksam machte. Jeglicher Gedanke an meine Vergangenheit verpuffte, während ich sah, wie mein Sohn seinen Kopf hin und her warf. Mein erster Gedanke, er könne aufwachen, verflog, als mir klar wurde, dass sich einer seiner Albträume ankündigte. Verdammt. Mein Puls beschleunigte sich, während ich nach einer Gelegenheit Ausschau hielt, um möglichst schnell anzuhalten. Ein paar hundert Meter weiter zweigte ein schmaler Weg ab, und ich setzte den Blinker. Kaum standen alle vier Räder still, sprang ich bereits vom Fahrersitz und glitt neben Noah auf die Rückbank. Sein Stöhnen wurde abgehackter, seine Kopfbewegungen hektischer. Ich löste den Gurt und zog seinen schmalen Körper aus dem Sitz direkt auf meinen Schoß. Er zitterte, seine Haut war feuchtwarm, und die Spannung in seinen Muskeln war mir bereits allzu bekannt. Schmerz tobte in meiner Brust, während ich begann, beruhigend auf ihn einzureden. Etwas, das noch vor wenigen Wochen undenkbar gewesen wäre.
Es dauerte, das tat es immer. Ein befreundeter Psychotherapeut hatte mir geraten, ihn in solchen Momenten nicht zu wecken, obwohl das normalerweise mein erster Impuls gewesen wäre. Riss ich ihn aus seinem Traum, nahm er ihn mit an die Oberfläche seines Bewusstseins und er würde sich daran erinnern. Hielt ich ihn, redete ich beruhigend auf ihn ein, in der Hoffnung, den Traum so zu durchbrechen, und schlief er dabei weiter, standen die Chancen gut, dass er nach dem Aufwachen nicht wusste, was geschehen war. Erstere Option war für mich leichter, zweitere für ihn. Ich hatte schnell begriffen, dass daher nur der zweite Weg infrage kam, auch wenn er mich weitaus mehr Kraft und Nerven kostete.
Seufzend kniff ich die Augen zusammen. Obwohl ich mittlerweile nicht mehr zählen konnte, wie oft ich ihn durch Albträume dieser Art begleitet hatte, und wusste, dass er am Ende immer wieder rausfand, war die zermürbende Hilflosigkeit dieselbe.
Meine Kehle verschnürte sich, während ich meine Arme fester um den zuckenden Körper meines Sohnes schlang, der nicht einmal in der Lage war, richtig zu weinen. Einzig das abgehackte Stöhnen und die wellenartigen Krämpfe, die seinen Körper schüttelten, deuteten auf die schrecklichen Bilder hin, die ihn gerade quälten.
Hilflosigkeit.
Ein Gefühl, das lange Jahre keinen Bestand in meinem Leben gehabt hatte, fraß mehr und mehr von mir auf. Die Leere, die dadurch entstand? Sie schwächte mich. Hinderte mich daran, mein Leben so fortzuführen, wie es einst war.
Und deshalb stand ich jetzt hier. Auf einer kleinen Nebenstraße, kurz vor jenem Ort, der Frieden und Schrecken zugleich für mich bedeutete. Ich wusste nicht, ob es die richtige Entscheidung war.
Wusste nicht, ob ich damit alles schlimmer machen würde.
Eins wusste ich allerdings: dass ich nicht mehr so weitermachen konnte wie zuvor. Nicht, wenn ich endlich der Vater sein wollte, den mein Sohn verdiente.
Und deshalb war dies hier unsere einzige Option.
Ob ich es nun wollte oder nicht.
»Guten Morgen, Mrs. Pemplefort!« Lächelnd grüßte ich die alte Dame, die den kleinen Coffeeshop an der Hauptstraße besaß und laut eigener Aussage dort arbeiten würde, bis man ihre »Überreste nach draußen kratzen musste«. Sie stand vor der gläsernen Tür, die in ihren Laden führte, und wirkte, als hätte sie auf mich gewartet.
Was überraschenderweise auch der Fall war.
»Julia!« Ein breites Lächeln erhellte ihre Züge, und sie winkte mich heran. Obwohl ich wusste, dass ich bereits knapp dran war, folgte ich ihrer Aufforderung. Langsam dämmerte mir, was mich erwartete, und ich konnte die Mischung aus Freude und Unbehagen nur schwer bekämpfen. »Sophie hat mir erzählt, wie du gestern Nachmittag dafür gesorgt hast, dass die Jungs sie in Ruhe lassen. Komm, lass mich dir deinen Vanille-Kaffee machen, ja?«
Ich schüttelte mit dem Kopf, obwohl ich nichts gegen die Extradosis Koffein einzuwenden hatte. Insbesondere, wenn Vanille eine Rolle spielte. »Aber das ist doch mein Job. Natürlich greife ich ein, wenn …«
Mrs. Pemplefort stemmte die Arme in die Seiten und musterte mich mit diesem kritischen Blick, den ältere Damen drauf hatten und bei dem ich mich sofort wie ein kleines Kind fühlte. Ein kleines, gerügtes Kind. »Na, na, na. Spiel es nicht herunter, Liebes. Du hättest nicht eingreifen müssen, aber das hast du getan. Sophie möchte so werden wie du, weißt du? Du bist ihr großes Vorbild. Warst du vorher schon, seit gestern aber umso mehr.«
Wärme explodierte in meiner Brust, verjagte den letzten Funken Unbehagen, während ich zusah, wie Mrs. Pemplefort den Kaffee zubereitete und ihn mir überreichte.
»Danke«, sagte sie mit so viel Aufrichtigkeit, dass ich nicht anders konnte, als freudig zu lächeln.
»Immer wieder gerne«, gab ich fröhlich zurück. »Ich habe zu danken …«
Sie legte ihre Hände über meine, drückte sie sanft und sah mir fest in die Augen. »Menschen wie du machen das Leben hier besonders, Julia. Bitte bleib immer so, wie du bist. Du bist eine wahre Bereicherung für unsere kleine Gemeinde.«
Nun geschah es doch – die Wärme ihrer Worte, die Geste mit dem Kaffee überwältigten mich. Meine Augen brannten, und ich blinzelte, in der Hoffnung, die verräterischen Tränen zurückhalten zu können, die meine Rührung verraten wollten.
Vielleicht bemerkte Mrs. Pemplefort etwas, vielleicht war sie selbst verlegen über ihren Ausbruch. Sie war bekannt für Fairness und guten Kaffee, aber nicht unbedingt für übertriebene Gefühlsduselei. Also schnalzte sie laut mit der Zunge, während sie mich losließ und die Hände in die Seiten stemmte. »Ach komm, nun geh. Ehe du zu spät kommst! Und verbrenn dir bloß nicht die Schnute, der Kaffee ist heiß!«
Lachend verließ ich das Sweet&Coffee, um das letzte Stück bis zur Schule hinter mich zu bringen. Ich nippte an dem Becher, obwohl ich damit wirklich ernsthaft riskierte, mir den Mund zu verbrennen, und versuchte, das angenehm warme Gefühl zu konservieren, das mich bei den Worten der alten Dame erfüllt hatte.
Sophie war ein kleines, aufgewecktes Ding, allerdings viel zu oft in Gedanken verloren. Ich erkannte viel von mir in ihr wieder, und zu hören, dass sie mich als Vorbild nahm, machte mich stolz. Allerdings wusste ich auch, was es bedeutete, sich in eigenen Fantasien zu verlieren. Kinder in diesem Alter konnten grausam sein – und gestern hatten die Jungs Sophie damit aufgezogen, dass sie sich mit sich selbst unterhalten hatte. Die Wärme wurde von Wehmut ersetzt, während ich Erinnerungen an meine eigene Kindheit beiseiteschob. Die Schule war in Sicht. Ich hatte noch fünfzehn Minuten, bis ich im Klassenzimmer sein musste. Genug Zeit, um meine Sachen wegzubringen und meinen Kaffee zu genießen.
Der strahlend blaue Himmel und die angenehm frische Luft versprachen einen wunderschönen Frühlingstag. Ich war bereit, ihn anzugehen. Bereit, alles für meine Schüler und Schülerinnen zu geben. Ob es nun bedeutete, dass ich ihnen Rechnen und Schreiben beibrachte – oder dass ich kleine Mädchen auf dem Schulhof davor bewahrte, von großen Jungs aufgezogen zu werden.
* * *
»Ein neues Kind? Einfach so?«
Stirnrunzelnd musterte ich Monica Mitchell, unsere Schulleitung, die mich in der ersten größeren Pause zu sich ins Büro zitiert hatte. Für kurze Zeit war ich nervös geworden – Kam jetzt die gegenteilige Reaktion auf mein gestriges Eingreifen? –, doch über diesen Vorfall hatte sie kein Wort verloren. Im Gegenteil.
Monica schob ihre Brille zurück auf die Nase. Sie war nur wenige Jahre älter als ich, wirkte jedoch, als wäre sie mir mindestens ein Jahrzehnt voraus. Das mochte daran liegen, wie holprig ihr Weg gewesen war, bis sie hinter ihrem Schreibtisch hatte Platz nehmen können, vielleicht war es aber auch einfach ihre Art. Die schicken Rock-Blazer-Kombinationen, die sie grundsätzlich zur Arbeit trug, spielten mit Sicherheit ebenso eine Rolle wie die dick gerahmte Brille im Leopardenmuster und die einreihige, dicke Perlenkette, die sie Tag für Tag trug.
Ich strich mein eigenes Shirt glatt, verdrängte das Gefühl, zu leger gekleidet zu sein, das ich immer in ihrer Nähe hatte, und hockte mich auf die Kante des gepolsterten Lederstuhls, der vor ihrem Schreibtisch stand. Monica ließ sich ebenfalls nieder.
Sie wirkte gestresst, so wie immer, aber nicht angespannt.
»Bei dem Kleinen handelt es sich in gewisser Weise um einen Sonderfall, weshalb ich ihn auch gerne in deiner Klasse unterbringen würde.«
Nun wurde ich hellhörig. Es war bereits überraschend genug, im letzten Drittel des Schuljahrs noch einen neuen Schüler zu bekommen. Als Sonderfall angekündigt zu werden, weckte definitiv mein Interesse. Ich konnte nur noch nicht abschätzen, ob das gut oder schlecht war. »Ich bin ganz Ohr.«
»Der Junge spricht nicht …« Ich riss meinen Mund auf, doch ehe ich etwas sagen konnte, fuhr Monica eilig fort. »Dabei handelt es sich nicht um eine angeborene Störung, sondern vielmehr um eine psychosomatische Antwort auf den traumatischen Verlust seiner Mutter. So hat es zumindest sein Vater erklärt. Der Zeitpunkt seines Verstummens überschneidet sich mit ihrem Unfalltod.«
Eine heftige Welle aus Schmerz und Mitgefühl für diesen kleinen, mir unbekannten Jungen erfasste mich, und ich presste meine Hand vor die Brust. »Der arme, kleine Schatz. Wie alt ist er? Und wieso weiß ich nichts von seinem Schicksal?«
Monica warf einen kurzen Blick auf ein Formular, das vor ihr auf dem Schreibtisch lag. »Noah Fitzpatrick, sieben Jahre alt. Du kannst nichts von ihm wissen, weil er bis vor kurzem noch in New York gelebt hat. Sein Vater ist gerade erst mit ihm hergezogen …«
»Wieso ausgerechnet hierher?« Ich blickte sie verwirrt an. »Ich meine, Paradise ist schön, ich liebe es – aber wieso zum Teufel kommt ein New Yorker auf die Idee, seine Zelte hier aufzuschlagen?«
Monica musterte mich milde belustigt, zuckte jedoch mit den Schultern. »Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Sie gehört nicht gerade zu den Aufnahmekriterien unserer Schule, und ich wollte Mr. Fitzpatrick auch nicht zu nahe treten. Ich weiß nicht, wie langfristig dieser Umzug gedacht ist, aber offenkundig dauerhaft genug, um den Jungen hier zur Schule zu schicken. Über die Beweggründe hat Mr. Fitzpatrick jedenfalls nichts gesagt, außer, dass er sich ein ruhiges und stabiles Umfeld für seinen Sohn wünscht. Das sollten wir ihm hier in Paradise allemal bieten können. Also, wie sieht es aus? Kann ich Noah in deine Klasse stecken oder nicht?«
Ich nickte, ohne nachzudenken. »Selbstverständlich. Ich werde ein besonderes Auge auf den Jungen werfen.«
Monica lächelte mich zufrieden an – und in diesem Moment hätte der Altersunterschied zwischen uns nicht enormer sein können. »Gut. Dann ist es beschlossene Sache. Noah Fitzpatrick wird in deine Klasse wechseln.«
»Und wann?« Es war Mittwoch, ich konnte mir kaum vorstellen, dass Mr. Fitzpatrick seinen Sohn nicht nur mitten im Schuljahr, sondern darüber hinaus auch noch mitten in der Woche in eine neue Schule schicken würde …
»Freitag. Wir hielten es für angemessen, dass Noah schon einmal die Chance bekommt, in die Klasse zu schnuppern und alle kennenzulernen, ehe es dann in der folgenden Woche richtig losgeht. Stundenpläne und Materialien habe ich den Fitzpatricks bereits mitgegeben.«
Mein Mund klappte auf. »Deine Frage war also rhetorischer Natur.«
Monica schob ihre Brille auf die Nasenspitze und grinste mich fast schon spitzbübisch an. »Ja – und nein. Mir war klar, dass du nicht ablehnen würdest, wenn du erst einmal Bescheid weißt.« Ihre Miene wurde ernst. »Darüber hinaus wissen wir beide, dass ich deine Erlaubnis nicht brauche, um ein Kind in deine Klasse zu stecken. Also gut, du weißt Bescheid. Freitag wird Noah das erste Mal diese Schule besuchen. Ich vertraue darauf, dass du deine Schüler sensibel auf ihn vorbereitest.«
Meine Gedanken schossen augenblicklich zu Sophie; sie wäre die perfekte Sitznachbarin für Noah. Ich nickte Monica zu, bereits im Begriff, zu gehen und in Gedanken bei meiner neuen, anstehenden Aufgabe.
Ein kleiner Junge, verstummt nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter.
Erneut verkrampfte sich meine Brust vor Mitgefühl für den kleinen Mann, obwohl ich ihn weder kannte noch ein ähnliches Schicksal erlebt hatte.
Es war Mittwoch. Noah würde uns am Freitag besuchen.
Mir blieben also noch zwei Tage, um mich auf meinen neuen Schüler vorzubereiten. Diese Zeit würde ich mit Sicherheit auch brauchen.
* * *
An diesem Abend war ich bei meiner Familie zum Barbecue eingeladen. Ich brachte eine große Schüssel meines berühmten Nudelsalats mit, außerdem Vorfreude auf einen gemütlichen und lustigen Abend.
Wenn wir uns bei meinen Eltern trafen, was nicht gerade selten vorkam, endete es meist unerwartet. Wenn ich davon ausging, dass wir uns nur für ein bis zwei Stündchen sahen, wurde es ein Abend mit offenem Ende – und andersherum. Schon vor einer Weile hatte ich mir angewöhnt, am besten gar keine Erwartungen mehr zu haben. So auch heute. Ich wusste, mein Bruder würde da sein, gemeinsam mit seiner frischvermählten und schwangeren Frau Tracy. Ben arbeitete in der Stadtverwaltung, weshalb er immer einer der Ersten war, der Bescheid wusste, wenn es etwas Neues gab. Er oder mein Dad. Auch der hatte in der Stadtverwaltung gearbeitet, war mittlerweile aber pensioniert. Was die beiden Männer nicht herausfanden, das wusste Mom. Sie war aufs Beste mit der Tratschleitung der Stadt vernetzt, was bedeutete, dass sie regelmäßig zu Spieleabenden ging, bei denen eine Handvoll älterer Damen zusammensaß, Tee oder Scotch trank, scrabbelte und den neuesten Klatsch austauschte. Manchmal, wenn sie ganz wild drauf waren, spielten sie sogar Rommé.
Mein Elternhaus befand sich am östlichen Rand von Paradise. Der Garten war nach hinten ausgerichtet, was bedeutete, dass ich schon als kleines Kind in den Genuss gekommen war, einen unverbauten Blick auf die teilweise dichte Bewaldung unserer kleinen Insel zu haben. Es hatte Zeiten gegeben, da ich lieber direkt am Wasser gelebt hätte, doch mittlerweile wusste ich die Lage zu schätzen. Am Wasser war immer viel los. Ich selbst hatte mich als Teenager gerne am Strand aufgehalten, wohl wissend, dass ich mich dabei teilweise über Privatgrundstücke geschlichen hatte. Verdammt, ich hatte meine Jungfräulichkeit an einem solchen Platz verloren. Das Ende vom Lied? Die Besitzer hatten uns gutmütig verjagt – und ich konnte ihnen bis heute nicht in die Augen sehen, ohne zu erröten. Unangenehm, weil ich ihre Enkelkinder mittlerweile unterrichtete. Begegnungen waren also unumgänglich.
Aber so war das wohl. Jeder blickte auf einige Fehlentscheidungen in seiner Jugend zurück. Das war meine.
Zum Glück hatte ich die meiste Zeit nichts an meinem Zuhause auszusetzen . Auf unserer Insel war man sowieso nie weit entfernt vom Wasser, selbst wenn man sich mitten im Zentrum befand. Ein Wald, der grenzenlose Abenteuermöglichkeiten bot, unzählige Spielideen und Orte, um Hütten zu bauen, war schlussendlich doch die coolere Variante gewesen.
Melancholisch lächelnd klopfte ich gegen die Eingangstür – und schob sie dann einfach auf. Wie so oft, wenn meine Eltern uns erwarteten, ließen sie sie für uns offen. Ich hatte deshalb schon mehr als einmal geschimpft, doch in dieser Hinsicht nahm mich niemand ernst. Weder meine Familie noch sonst jemand.
In Paradise passierte doch nichts!
»Mom? Dad? Ben?«
»Tracy?«
Ich lachte los, als meine Schwägerin ächzend aus der Tür neben mir trat, Hände in den Rücken gestemmt und eindeutig gestresst aussehend, wenn auch nicht gestresst genug, um darauf zu verzichten, mich nachzuäffen. »Julia, dieses Kind macht mich wahnsinnig. Bitte erinnere mich regelmäßig daran, dass es in einem Akt der Liebe entstanden ist, ja? Ich schwöre, ich war bereits das dritte Mal pinkeln.«
»Wie lange seid ihr denn hier? Eine Stunde?«
Tracy verdrehte die Augen. »Dreißig Minuten, maximal.«
Mein Lachen verwandelte sich in ein Schnauben, ehe ich sie kurz an mich drückte, ein Unterfangen, das sich nicht nur wegen meiner Salatschüssel, sondern auch wegen ihres kugelrunden Bauches als schwierig gestaltete. Ich ließ meine Tasche zu Boden gleiten, während sie sich in diesem für Schwangere so typischen, wiegenden Gang Richtung Küche bewegte, von wo aus eine Tür hinaus in den Garten führte, in dem der Rest der Meute mit Sicherheit zusammensaß und auf mich wartete.
Nun, Überraschung: Obwohl ich die mustergültige Lehrerin war, hatte ich einen ganz besonderen Makel.
Ich kam gerne zu spät. Und dafür war ich auf der ganzen Insel mehr als bekannt.
Wärme braute sich in meiner Magengrube zusammen, während ich meiner Schwägerin durch mein heimeliges altes Zuhause nach draußen folgte. Der Duft von Vanille und Lavendel kroch in meine Nase; eine Kombination, die mich mit Frieden und Nostalgie erfüllte. Das hier war die Essenz meiner Kindheit. Die unzähligen Bilder, die die Wände im Flur zierten, visualisierten meine Vergangenheit. Es gab Porträts, Gruppenbilder und eine Auswahl all dieser klassischen Momente, die ein junges Leben ausmachten: Einschulung, Weihnachten, Familienfeiern, sogar Bilder von Ben und mir in voller Montur nach unseren Studienabschlüssen. Lächelnd strich ich über den Rahmen eines vergilbten Bildes von Wuffels, unserem Familienhund, der vor zehn Jahren gestorben war. Nach seinem Tod hatten wir es nicht übers Herz gebracht, einen neuen Welpen in die Familie zu holen. Schätze, die Flut an Tränen, die wir damals alle vergossen haben, war einfach zu viel gewesen. Kopfschüttelnd betrat ich die große Küche mit dem riesigen Tisch, an dem eine Fußballmannschaft Platz nehmen konnte, und trat durch die offene Terrassentür nach draußen.
Meine Familie war sehr eng miteinander verbunden – und ich liebte es, Zeit mit ihr zu verbringen. Ohne Wenn und Aber. Meine Großeltern mütterlicherseits hatten bis letztes Jahr noch zwei Häuser weiter gewohnt, doch sie waren in ein Pflegeheim in Swanton gezogen, als es ihnen zunehmend schwergefallen war, den Alltag allein zu bewältigen. Unsere Angebote, uns um sie zu kümmern, hatten sie abgeschmettert. Früher wären sie an einem Abend wie diesem mit von der Partie gewesen, und wie immer erfüllte mich deshalb für einen kurzen Moment Melancholie, wenn ich meinen Blick schweifen ließ und feststellte, wer da war – oder eben auch nicht.
»Hi«, rief ich in die Runde und lächelte, als mir eine Flut an Begrüßungen und gutmütigen Hinweisen auf die Uhrzeit entgegenschlug. Meine Mom sprang auf, um mir ein Küsschen zu geben, und nahm mir gleichzeitig den Nudelsalat ab.
»Dann können wir ja endlich loslegen«, stellte mein Dad grinsend fest. »Kommst du, Ben?«
Damit war also der Startschuss für dieses typische Männerding gefallen, das ich noch nie richtig verstanden hatte. Hah, ich mache Feuer. Ich grille Fleisch auf Feuer. Ich guter Mann.
Oder so ähnlich.
Tracy, Mom und ich wechselten Blicke, während Dad und mein Bruder ihre Arbeit aufnahmen. Stöhnend ließ ich mich auf den letzten freien Stuhl fallen.
»Möchtest du einen Eistee? Ich habe Pfirsich und Rosmarin im Angebot.«
»Gern.« Dankbar reichte ich ihr mein Glas und sah zu, wie die orangebraune Flüssigkeit gemeinsam mit einem Zweig Rosmarin und einigen klirrenden Eiswürfeln hineinglitt. Hier oben, an der Grenze zu Kanada, erlebten wir für gewöhnlich eher mildere Temperaturen in der warmen Jahreszeit, doch diese Woche war erstaunlich warm – für unsere Lage und für den Monat Mai. Ich wischte mir über die Stirn, lockerte mein Shirt, das mir am Körper klebte, und nahm einen großen Schluck aus meinem Glas, wohl wissend, dass Mom den Eistee immer selbst machte und er eine echte Wucht war. Sie und Tracy knüpften an ein Gespräch an, das sie offenbar vor meiner Ankunft begonnen hatten, und ich hörte schnell heraus, dass es um einen weiteren Arztbesuch ging. Neugierig lehnte ich mich auf dem Stuhl zurück und lauschte Tracys Berichten. Offenbar entwickelte sich das Kind mehr als prächtig. Leider war sie immer noch nicht bereit, uns das Geschlecht zu verraten. Es sollte eine Überraschung zur Geburt werden, was es mir verdammt schwer machte, mein Geschenk passend fertig zu stellen. In den vergangenen Monaten hatte ich hundertmal versucht, ihr diese Info zu entlocken, direkt oder versehentlich, aber Tracy hatte jedes Mal dicht gehalten. Bei Ben brauchte ich es gar nicht erst zu versuchen, er würde sich niemals derart mit seiner Frau anlegen. Kluger Mann … wenn auch blöd für mich.
Während Dad und Ben am gemauerten Grill standen, den sie erst letzten Sommer gemeinsam gebaut hatten, und das Zischen sich schließender Poren verriet, dass sie Steaks auf den Rost geworfen hatten, schloss ich die Augen, um die überraschend kräftigen Strahlen der frühabendlichen Sonne zu genießen, ehe sie verschwand. Kribbelndes Wohlbehagen überzog meinen Körper. Das hier … es war mein Zuhause. Für mich gab es keine perfektere Definition für dieses Wort. Ich hatte es nie weit von hier weggeschafft, wenn man mein Studium abzog, und selbst währenddessen war ich an jedem Wochenende hierher zurückgekehrt. Paradise war meine Heimat, seit ich denken konnte, und das in jeder Hinsicht. Dass ein fremder Mann entschieden hatte, den langen Weg von New York hierher auf sich zu nehmen, hätte mich nicht überraschen sollen – wie jeder, der seine Heimat liebte, war ich in dieser Hinsicht absolut patriotisch. Dennoch war es mir ein Rätsel, wie ein Großstädter ausgerechnet auf uns stoßen konnte. Ich beschloss, die anderen zu fragen, ob sie schon etwas von unseren Neuankömmlingen gehört hatten, sobald wir alle am Tisch versammelt waren.
»Und was gibt es Neues bei dir?« Schlagartig richtete sich die Aufmerksamkeit der beiden Frauen auf mich.
Ich zwirbelte eine Strähne meines Haars auf. »Nicht allzu viel. Heute Morgen hat Mrs. Pemplefort …«
»Dir einen Gratiskaffee gemacht, stimmt.« Tracy grinste mich spitzbübisch an. »Als ich gegen Mittag da war, um mir ein paar von ihren sündhaften Cookies zu holen, hat sie das erzählt. Und ich vermute, auch jedem anderen, der heute in ihren Laden gekommen ist.«
Ich begrub mein Gesicht stöhnend in den Händen. »Wieso das? Ich habe doch nichts weiter getan, als Sophie zu helfen.«
Tracy deutete mit ihrer Gabel auf mich. »Genau das ist es. Du hast geholfen, und du willst dafür keine Lorbeeren. Das macht dich zu diesem süßen, kleinen Ding, das du nun mal bist und wofür jeder hier dich liebt.«
Sie meinte es absolut nicht böse, und doch lösten ihre Worte Unbehagen in mir aus. Ich warf Mom einen Blick zu, die mich jedoch nur stolz anlächelte. »Genau so ist es, mein Schatz.«
Ich stöhnte erneut. »Wie auch immer. Über den Kaffee heute Morgen habe ich mich natürlich gefreut, klar. Aber ich wäre dankbar, wenn Mrs. Pemplefort die Sache nicht so an die große Glocke hängen würde. Ich habe lediglich ein paar Jungs gesagt, dass sie still sein sollen. Das ist alles.« Ich pustete eine Strähne aus der Stirn. »Darüber hinaus wäre ich wirklich glücklich, nicht wie dieser brave Unschuldsengel dargestellt zu werden. Irgendwie macht mich das langweilig, oder nicht?«
Tracy und Mom blickten mich ungerührt an, doch ehe die Situation unangenehm werden konnte, kehrten Dad und Ben mit einem Teller voller Steaks und einer dampfenden Schale Grillgemüse an den Tisch zurück.
In den kommenden Minuten verstummte jedes Gespräch. Ich belud meinen Teller mit Fleisch, Salat und Gemüse und genoss die Gesamtsituation: Gutes Essen im Kreise meiner Familie. Das leise Zirpen von Grillen, die Brise, die die Wipfel der Bäume am hinteren Ende des Gartens zum Rauschen brachte und meine Haut etwas abkühlte.
Ein idyllischer Tag in Paradise auf einer Insel im Norden Vermonts. Der Name war wirklich Programm.
»Habt ihr schon gehört, dass wir Neuzugänge haben?« Wie aus dem Nichts durchschnitt ausgerechnet Ben die rosa Wattewolke, in die ich mich soeben gehüllt hatte. Vorbei war sie, meine schwelgende Nostalgie, stattdessen musterte ich ihn aufmerksam, den Mund voller Kartoffel und Sour Cream.
Dad brummte los. »Du meinst den Kerl, der ins alte Haus der Grahams gezogen ist?«
Ben schnaubte. »Natürlich weißt du schon davon. Ja, genau den.«
»Ins Haus der Grahams?« Ich runzelte die Stirn. »Aber steht das nicht bereits seit Jahren leer?«
»Ja, seit ihrem Tod. Gott sei ihrer Seelen gnädig.« Mom seufzte leise auf. »Ich vermisse Anne bis heute, sie war so eine liebe Frau – und ein echter Star im Scrabble.«
Nachdenklich tippte ich mir an die Lippe. Ob es hier wirklich um die Fitzpatricks ging? Ich beschloss, ausnahmsweise auch einmal mit Wissen zu glänzen. »Monica hat mich heute darauf hingewiesen, dass ich einen neuen Schüler bekommen werde. Wenn wir also über dieselben Neuzugänge sprechen, handelt es sich um einen Witwer mit seinem siebenjährigen Sohn.«
Diese Info löste eine wahre Welle der Anteilnahme aus, ähnlich wie ich sie am Morgen bereits empfunden hatte. Tracy schossen sogar Tränen in die Augen. Die Schwangerschaftshormone übernahmen ständig die Kontrolle. Den Gedanken, noch weiter ins Detail zu gehen, verwarf ich eilig wieder, ich wollte Mom und Tracy nicht aufregen. Außerdem war es nicht meine Geschichte, also war es auch nicht meine Aufgabe, sie noch weiter auszubreiten.
»Vermutlich reden wir über denselben Mann, ja. Allzu oft kommt es schließlich nicht vor, dass jemand in unsere Gemeinde zieht.« Ben nickte mir zu, seine Mundwinkel zuckten. »Sie sind vergangenes Wochenende angekommen. Hab nicht damit gerechnet, dass sie einfach so in das Haus ziehen. Da muss doch ein Haufen zu tun sein – oder hat jemand von euch mitbekommen, dass dort im Vorfeld gearbeitet wurde?«
Dad zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ist er ein Handwerker, der sich selbst darum kümmert, eine Art Langzeitprojekt. Schön wäre es, gute Handwerker sind Mangelware, sowohl hier als auch auf den anderen Inseln.«
»Er kommt aus New York«, platzte es aus mir heraus. »Keine Ahnung, ich stelle ihn mir nicht gerade als Handwerker vor.«
Meine Mutter schnalzte mit der Zunge. »Na, na, na. Das ist Schubladendenken, Liebes. So haben wir dich nicht erzogen.«
Ich verdrehte die Augen – was mir einen Tritt gegen das Schienbein einbrachte. Von Ben. Er schüttelte warnend den Kopf.
»Wie auch immer«, stellte ich leichthin fest. »Sein Sohn wird Freitag das erste Mal meine Klasse besuchen. Ich bin schon sehr gespannt auf ihn.«
Mom seufzte verzückt auf. »Ein neues Kind in Paradise. Diese Gelegenheiten kann man auch an einer Hand abzählen.«
»Seit wann?«, frotzelte Ben. »Seit Stadtgründung oder seit …«
»Sei still«, zischte Mom gutmütig. »Iss lieber auf, ehe es kalt wird. Wir haben noch eine Fuhre Fleisch, die gegrillt werden muss.«
Das ließ Ben sich nicht zweimal sagen. Wir tauschten einen Blick, so wie wir es taten, seit wir denken konnten. Mom und Dad waren liebenswürdige, liebevolle Eltern, aber wenn es darauf ankam, streng und in mancher Hinsicht nahezu altertümlich eingestellt. Bestes Beispiel: Sie hatten darauf gedrängt, dass Ben und Tracy vor der Schwangerschaft heirateten, nicht erst danach.
Also hatten sie es auch getan, obwohl Tracy Hochzeitsbilder ohne Babybauch bevorzugt hätte. Böse waren sie ihnen deshalb jedenfalls nicht.
Während ich selbst das letzte Stück Steak aufspießte, wanderten meine Gedanken einmal mehr zu den Fitzpatricks. Was zog sie ins Haus der Grahams? Wie war der kleine Noah – und sein Vater?
Nun, ich würde es schon bald herausfinden. Sobald Noah mein Schüler war, gab es keinerlei Möglichkeit, ihn nicht kennenzulernen, und was seinen Dad betraf: Selbst wenn er zu jener Art von Vater gehörte, die sich in der Schule rar machte, auf einer Insel wie dieser war es nahezu unmöglich, sich langfristig aus dem Weg zu gehen. Früher oder später würden sich unsere Wege also kreuzen.
Die anderen schienen sich jedenfalls nicht weiter mit den Neuen beschäftigen zu wollen. Während sich die Gespräche neuen Themen zuwandten, blieb ich bei dem unbekannten Jungen hängen. Wie es ihm gehen musste? Erst verlor er seine Mutter, dann auch noch sein gewohntes Umfeld. Wahnsinnig viel Umstellung für so eine arme, kleine Seele.
Ich hoffte sehr, ihm irgendwie helfen zu können.
»So eine verfluchte Scheiße …«
Gereizt wischte ich mir Schweiß und Staub von der Stirn, während ich das Rohr anfunkelte, als wäre es mein persönlicher Feind.
Was es in gewisser Weise auch war. Irgendwo befand sich eine undichte Stelle, und ich schaffte es einfach nicht, sie abzudichten.
Wie bereits vermutet, war das Haus meiner Großeltern in einem abenteuerlichen Zustand. Optimistisch formuliert. Gestern waren unsere Sachen von der Spedition geliefert worden, doch der Großteil stand nach wie vor in der Garage, weil das Haus ein einziges Chaos war.
Ein Punkt, den ich trotz meiner Erwartungen deutlich unterschätzt hatte. Ich atmete tief durch. Ein Schritt nach dem anderen. Eine Liste mit Aufgaben, nach Priorität sortiert, hatte ich bereits nach unserer Ankunft erstellt. Wir hatten ein funktionierendes Badezimmer, zwei der Schlafzimmer waren bewohnbar und das Dach noch dicht. Glaubte ich. Darüber hinaus gab es jedoch verdammt viel zu tun. Nicht nur, dass überall noch die alten, vollgestaubten Möbel meiner Großeltern standen – die Spüle in der Küche tropfte und die E-Geräte mussten dringend ausgetauscht werden. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Heizung nicht mehr richtig funktionierte, und es gab mehr als nur eine Stelle im Fußboden, die mir morsch vorkam. Dass der Garten ein einziger Urwald war, spielte zunächst keine Rolle. Ich ärgerte mich tierisch, dass ich nicht bereits im Vorfeld veranlasst hatte, dass sich Firmen darum kümmerten. Mir war es wichtiger gewesen, in New York alles für unsere Abreise vorzubereiten, außerdem hatte ich geglaubt, dass es nicht so schlimm werden würde.
Nun. Die Substanz war okay. Am Ende würde dem Haus eine Kernsanierung jedoch guttun, und das war nichts, was ich mal eben so machen konnte, wenn wir schon hier wohnten.
Also nach und nach. Später, wenn Noah schlief, würde ich mich auf Recherche begeben und ein paar Firmen heraussuchen, die sich um alles kümmern sollten. Solange ich nicht wusste, wie langfristig unser Aufenthalt war, machte es jedoch wenig Sinn, tausende von Dollar ins Haus zu stecken.
Außer, ich betrachtete es als Investition … doch diesen Gedanken wollte ich nicht vertiefen. Noch nicht. So ambivalent meine Erinnerungen an die Zeit hier auch waren, es fühlte sich falsch an, diese Verbindung zu kappen und das Haus zu verkaufen.
Seufzend sank ich zurück auf meine Fersen. Wenn Amalia jetzt hier wäre, würde ich all das mit ihr besprechen können. Sie war mein Gegenpol gewesen. Die perfekte Mischung aus Emotionalität und Überzeugungskraft. Warm, wenn ich zu kalt gewesen war, und in der Lage, mir völlig neue Sichtweisen zu eröffnen. Doch das war nicht der Fall. Sie war weg, und es gab niemanden, mit dem ich reden konnte, zumindest, wenn ich eine Antwort brauchte.
Verdammt noch mal.
Ich wünschte, ich wüsste, was Noah dachte. Er war ein einziges Rätsel für mich. Nun rächte sich, dass ich in der Vergangenheit sechs Tage die Woche gearbeitet hatte und dabei in der Regel mindestens zehn Stunden außer Haus gewesen war. Eher zwölf. Ich hatte keine allzu enge Beziehung zu meinem Sohn, die hatte ich noch nie, und es gab so vieles, das ich erst noch lernen musste. Eine ziemliche Herausforderung, wenn es plötzlich niemanden mehr gab, der mich im Alltag unterstützte.
Vor zwei Wochen noch im Management einer der größten Firmen in New Yorks Handelssektor, und nun … Handwerker, Koch und Babysitter in einem.
Keine dieser Aufgaben beherrschte ich perfekt. Für jemanden wie mich, der Perfektionismus als oberstes Ziel betrachtete, war das ein echtes Problem.
Ich legte die Rohrzange beiseite, wischte meine Hände an dem Tuch ab, das am Griff der Schranktür hing, und richtete mich ächzend auf. Ich bekam das Ding einfach nicht dicht, ein Umstand, der mich schwach dastehen ließ.