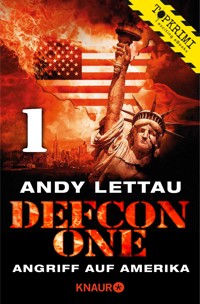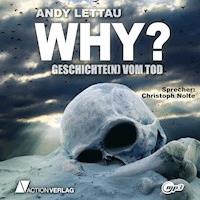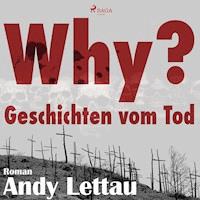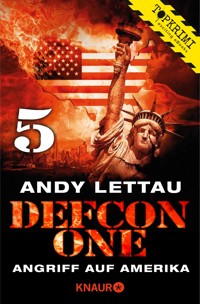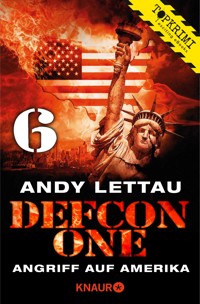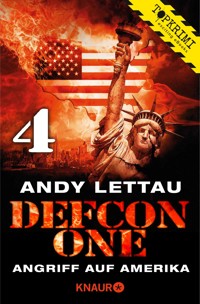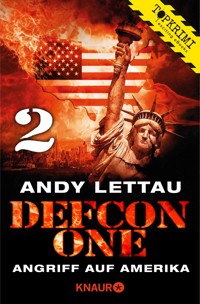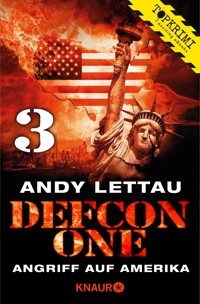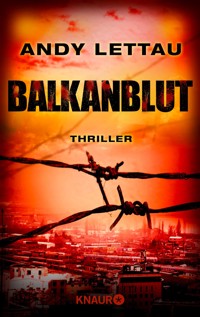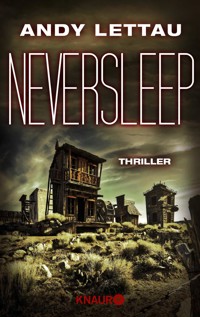
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was würdest du tun, wenn du nicht mehr schlafen müsstest? Und wie würde das deine Umwelt beeinflussen? Dr. Richard Pascoe, leitender Biochemiker bei GLOBALPHARM, hat eine Formel zur Schlafüberwindung entwickelt, die auf der Blutzusammensetzung einer seltenen Giraffenart beruht. Von Gewissensbissen geplagt, erwägt der desillusionierte Wissenschaftler seinen Selbstmord und die Vernichtung der Formel, um die Menschheit vor einer von unendlicher Produktivität geprägten Zukunft ohne Schlaf und ohne Träume zu bewahren. Der skrupellose Chef von GLOBALPHARM setzt einen Auftragskiller auf seinen flüchtigen Mitarbeiter an, um wieder in den Besitz der Formel zu gelangen. Es entwickelt sich eine gnadenlose Hetzjagd durch die Einöde Montanas... Ein chaotischer Höllentrip, bei dem die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn verwischen. Begeisterte Leserstimmen: »Ich kann dieses Buch nur empfelen, es ist wirklich lustig und spannend zugleich.« »Der flüssige Schreibstil von Andy Lettau reißt den Leser in den ersten Seiten mit. « »Eine geniale Story. Wow.« Von Andy Lettau sind ebenfalls bei Knaur eBook folgende Titel erschienen: »Balkanblut« und »Defcon One«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Andy Lettau
Neversleep
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was würdest du tun, wenn du nicht mehr schlafen müsstest? Und wie würde das deine Umwelt beeinflussen?
Dr. Richard Pascoe, leitender Biochemiker bei GLOBALPHARM, hat eine Formel zur Schlafüberwindung entwickelt, die auf der Blutzusammensetzung einer seltenen Giraffenart beruht. Von Gewissensbissen geplagt, erwägt der desillusionierte Wissenschaftler seinen Selbstmord und die Vernichtung der Formel, um die Menschheit vor einer von unendlicher Produktivität geprägten Zukunft ohne Schlaf und ohne Träume zu bewahren.
Der skrupellose Chef von GLOBALPHARM setzt einen Auftragskiller auf seinen flüchtigen Mitarbeiter an, um wieder in den Besitz der Formel zu gelangen. Es entwickelt sich eine gnadenlose Hetzjagd durch die Einöde Montanas …
Ein chaotischer Höllentrip, bei dem die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn verwischen.
Von Andy Lettau sind ebenfalls bei Knaur eBook folgende Titel erschienen: »Balkanblut« und »Defcon One«.
Inhaltsübersicht
Zitat
Prolog
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Zweiter Teil
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
Dritter Teil
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
Epilog
»Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde.
Das erklärt manches.«
Mark Twain
Prolog
Das zehn Kilogramm schwere Herz des Tieres schlug schneller als üblich. Mehr als sechzig Liter Blut pumpte es durch den lang gestreckten majestätischen Körper, der von den Paarhufen bis zu den zapfenförmigen Hörnern am Kopf mehr als fünf Meter maß. Das mit Schweißtropfen durchtränkte Fell roch nach Fäkalien, hervorgerufen durch einen biochemischen Cocktail aus Methylindol, Benzaldehyd und Hexadekansäure. Die bakterien- und pilzhemmende Substanz, deren stechender Geruch in der freien Natur dazu diente, blutsaugende Zecken zu vertreiben, enthielt aber noch eine weitere Ingredienz.
Adrenalin.
Die Giraffenkuh hatte Angst. Die Pupillen ihrer nussbraunen Augen waren geweitet, ihre Ohren aufgestellt, ihre Atmung ging flach und schnell. Die Anspannung der kräftigen Muskeln war an jeder Stelle deutlich sichtbar, insbesondere an ihrem langen Hals, wo das Zusammenspiel der sieben Halswirbel in diesem Moment für eine vornübergebeugte Schwenkbewegung sorgte. Flehend stieß das Tier einen im Infraschallbereich liegenden Laut aus, der für die umstehenden Männer nicht hörbar war. Nur das neugeborene Kalb, welches die Wissenschaftler in den weißen Schutzanzügen in einem verglasten Nebenraum isoliert hatten, konnte die Hilferufe der Mutter durch einen Fensterspalt wahrnehmen.
Ethan Cold, der fast siebzigjährige Vorstandsvorsitzende von GLOBALPHARM, beobachtete die Szene in der keimfreien und mit Neonlicht durchfluteten Laborhalle von einer erhöhten Position aus, auf dessen umlaufender Empore eine Wendeltreppe aus Stahl führte. Seine eiskalten grauen Augen nahmen mit Verärgerung zur Kenntnis, dass sich die Giraffe in dem Metallkäfig widerspenstig zeigte. Mehrmals schon hatte er die Forscher angewiesen, weitere Infusionsnadeln in die Venen des Tieres zu bringen, um an eine größere Menge Blut zu kommen. Doch immer wieder riss sich das langsam in Panik verfallende Tier die spitzen Eindringlinge durch schmerzvolles Reiben an der Box aus dem Körper.
»Könnt Ihr das Scheißvieh nicht einfach betäuben?«, schrie er den stellvertretenden Leiter der Forschungssektion III an, wobei es ihm die Zornesröte in das von Pigmentflecken übersäte Gesicht trieb.
»Wir brauchen das Blut in reinster Form, frei von anderen Substanzen«, erwiderte der korpulente Mann mit der Hornbrille von seinem Kontrollmonitor aus. Seine Antwort klang entschuldigend, fast devot.
»Das liegt an diesem verdammten Käfig«, blaffte Cold und lockerte sich seine teure Seidenkrawatte. »Der Käfig muss viel enger sein, das Vieh darf sich überhaupt nicht bewegen können. Wer hat diese Scheißkonstruktion überhaupt freigegeben?«
Sie selber, hätte der übergewichtige Mann am Fuß der Wendeltreppe am liebsten seinem Arbeitgeber geantwortet, verkniff sich aber jeden Kommentar. Stattdessen schritt er auf die Box zu und unterstützte seine Leute, die immer wieder mit kleinkalibrigen Spezialpistolen auf den eleganten Rumpf der Giraffe feuerten.
Paff! Paff! Paff!
Ähnlich wie bei einer an einem Seil hängenden Harpunenspitze drangen die Kanülen durch das Fell des Tieres, sodass unmittelbar darauf das Blut durch die am Projektil hängenden Plastikschläuche in die Behälter der Messgeräte floss – wenn es denn floss. Denn nur jede dritte Nadel blieb halbwegs unter dem glänzenden Fell stecken. Und bisher hatten sie keine einzige Vene getroffen, obwohl das Tier mit Hunderten von Nadeln übersät war.
Die Giraffe litt entsetzlich.
Ethan Cold dachte nach. Diese Dilettanten waren einfach zu weich für diesen Job. Weich und inkompetent. Sie zeigten Skrupel, obwohl er sie wie Manager von Automobilkonzernen entlohnte. Und sie gefährdeten das gesamte Projekt, die Zukunft von GLOBALPHARM. Seit der Vorgänger dieses Trottels da unten die kurz vor dem Durchbruch stehende Versuchsreihe sabotiert hatte und mit sämtlichen Forschungsunterlagen getürmt war, herrschte hier das totale Chaos. Und langsam gingen ihnen die Giraffen aus, frische Ware aus Uganda traf erst in einer Woche ein. Außerdem hatten diese Dreckskerle von World Wide Found for Nature und ein paar andere durchgeknallte Tierschützer bereits die Spur aufgenommen. Weil irgendein Möchtegern von Enthüllungsjournalist das Maul nicht gehalten hatte. Es war zum Verzweifeln.
GLOBALPHARM brauchte das Giraffenblut, um überleben zu können. Um an die Spitze der Fortune 500 Unternehmen zu kommen. Ohne das Blut würde es den aufstrebenden Pharmakonzern in Kürze nicht mehr geben. Ohne das Blut der Tiere war die Produktion des schlafüberwindenden Präparats nicht möglich. Und aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen standen diese nichtsnutzigen Kreaturen unter Naturschutz. Dabei war ihr Blut das zukünftige Elixier der Menschheit. Denn Giraffen kamen mit weniger als zwei Stunden Schlaf pro Tag aus. Der Gencocktail in ihrem Blut war der Schlüssel zum innovativsten medizinischen Präparat der Menschheitsgeschichte.
Wir müssen Dr. Pascoe finden, dachte Cold grimmig an den wichtigsten Angestellten seines Konzerns, der in einem Anfall von Sentimentalität eine ganze Versuchsreihe eingeschläfert hatte und mit der Formel auf der Flucht war.
Wir müssen ihn finden, bevor es die Konkurrenz schafft.
»Sir? Mr. Cold?«, drang die Stimme dieser fetten inkompetenten Qualle, die dort unten ihren Dienst versah, an sein Ohr.
»Was ist?«, brüllte der Vorsitzende zurück und gab dem ganzen Team zu verstehen, dass er mit seiner Geduld langsam am Ende war.
»Wir verlieren das Tier. Es droht zu hyperventilieren. Wir sollten abbrechen.«
»Wir brechen dann ab, wenn ich es sage!«, schrie Cold. »Haben Sie das verstanden, Dr. Brian?«
»Wir haben nur noch dieses Exemplar. Und das Jungtier. Wir müssen abbrechen, bitte, Sir!«
»Nein!« Ethan Cold schäumte vor Wut. Er öffnete die Knöpfe seines dunkelblauen Zweireihers und warf das Jackett achtlos auf den Boden. Sein kleiner und drahtiger Körper, der das muskelgestählte Resultat von eisenharter sportlicher Disziplin war, machte auf dem Absatz kehrt und verschwand in dem großräumigen Hightech-Büro, welches mit allerlei Jagdtrophäen ausgeschmückt war.
Kurz darauf stand er wieder auf der Empore, eine Benelli M1014 in der Hand. Ein entsetztes Raunen ging durch die Halle. Instinktiv nahmen einige Wissenschaftler Deckung hinter Trennwänden, Säulen oder Computertischen.
»Was wollen Sie mit dem Gewehr?« Dr. Brian wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Hinter den dicken Brillengläsern zuckten seine Augen unruhig hin und her.
»Das ist kein Gewehr, Dr. Brian«, stieß Cold laut und verächtlich hervor, »sondern eine Flinte. Genauer gesagt eine Gasdrucklader-Selbstladeflinte, Kaliber 12/76. Ein Geschenk meines jüngsten Sohns. US Army Standardmodell. Damit knallt man normalerweise einem Taliban das Hirn aus dem Schädel.«
»Bitte, Sir …«, flehte der dicke Wissenschaftler, als Cold die Waffe auf ihn in Anschlag brachte.
Ethan Cold verzog sein Gesicht zu einer brutalen Maske. Nur die Andeutung eines eiskalten Grinsens fuhr über seine schmalen Lippen. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen, die Hakennase nahm den Geruch der Waffe auf und dann den der bestialisch stinkenden Beute, die in diesem Moment in den Metallkäfig urinierte.
»Sie sind nicht eine einzige Kugel wert, Dr. Brian. Aber dieses Scheißvieh da vorne treibt mich zur Weißglut. Sobald ich abgedrückt habe, zapfen Sie ihm alles Blut ab!«
»Oh Gott, Sie können doch nicht einfach …«
»Halten Sie das Maul! Sie bekommen jetzt sechzig Liter Blut für Ihre Versuchsreihe. Und zwei neue Giraffen. In spätestens drei Tagen.«
»Wo wollen Sie so schnell Ersatz organisieren? Sie wissen doch genau, dass die Behörden in Afrika …«
»Afrika interessiert mich einen Scheißdreck«, schnitt Cold dem irritierten Wissenschaftler das Wort ab. »Ich habe andere Verbindungen.«
Es war still geworden in der großen Halle. Nur das leise Summen einiger elektronischer Geräte und der Klimaanlage erfüllte die Umgebung.
Und das nervöse Schlagen von vier Hufpaaren.
Als es verstummte, unternahm Dr. Brian einen letzten zaghaften Versuch, um den egozentrischen und einflussreichen Mann mit der Waffe in der Hand umzustimmen.
»Warum tun Sie das? Das Tier hat nicht die geringste Chance.«
»Ich tue es, weil ich ein gefährlicher Mann bin, Dr. Brian. Vergessen Sie das nie! Sie alle nicht!«, fauchte Cold seine Worte in den vor Spannung knisternden Raum. »Außerdem bin ich von Natur aus ein Jäger. Der Jagdtrieb ist mir in die Gene gelegt.«
Die Giraffe spürte instinktiv die Gefahr und drehte in einer anmutsvollen Bewegung den langen schlanken Hals in die Richtung des Mannes, der sie ins Visier genommen hatte. Die Gejagte blickte in die Augen des Jägers. Es würde ein ungleicher Kampf werden. Doch das Tier schien sich beruhigt zu haben.
Ein letztes Mal wendete die Giraffe den Kopf und senkte den Blick auf ihr Junges, das so nah und doch so unerreichbar war und die noch schwachen Beine x-förmig voneinander streckte.
Nicht bewegen, verdammt noch mal …
Ein seltsamer Glanz lag plötzlich in den Augen der beiden Tiere. Es war, als würden diese zwei wunderschönen Geschöpfe wissen, dass in diesem Moment etwas Trauriges und Unabdingbares geschehen würde. Eine unerklärliche, fast mystische und religiöse Stimmung ging von diesem Bild aus. Einige Wissenschaftler, insbesondere die weiblichen unter ihnen, hatten die Hände wie zum Gebet gefaltet an die Lippen gelegt.
»Möge mir Gott eine ruhige Hand geben, damit ich diese von ihm erschaffene Spezies für den Menschen von Nutzen mache«, sprach Cold zu sich selbst, während sich seine Wut und sein Zorn in freudige Erregung verwandelten. In wenigen Sekunden würde er die Kugel aus ihrem Lauf befreien.
Ich werde den perfekten Treffer landen.
Präzise und tödlich.
Genau zwischen die Augen.
Die Giraffe hatte den Blick von ihrem Jungen abgewendet und schien Ethan Cold anzulächeln. Es war ein gütiges, mildes Lächeln. Ein uraltes Wissen schien darin zu liegen.
Ja, grins mich nur dämlich an, du Vieh. Dein Blut wird mich zum reichsten Mann der Welt machen.
Dann betätigte Ethan Cold den Abzug. Fast lautlos überbrückte das Projektil die Distanz. Nur ein kurzes Pfeifen war zu hören. Das Aufeinanderprallen von Metall und Schädelknochen verlief hingegen geräuschlos.
Das stolze Tier hielt sich noch drei endlos lange Sekunden auf den Beinen, um danach wie eine führungslose Marionette langsam in sich zusammenzusinken.
Von irgendwoher war ein Schluchzen zu hören.
Wahrscheinlich eine Frau, dachte Cold und atmete langsam und entspannt aus. Er war mit dem Schuss mehr als zufrieden. Ein guter Jäger verfehlte niemals sein Ziel.
Die gespenstische Stille verwandelte sich in lautes, hektisches Treiben und eine Armee von weißen Kitteln umlagerte den Käfig, um die vier kleinen Türen zu öffnen. Dann wurde der wertvolle rote Lebenssaft abgezapft, so als ob ein Bohrtrupp die letzten Reserven eines Ölfelds ausplünderte.
Ethan Cold war längst in sein Büro zurückgekehrt und hatte hinter dem gewaltigen Schreibtisch Platz genommen. Er hielt einen Telefonhörer in der Hand und lauschte dem Freizeichen. Schließlich meldete sich eine Männerstimme. Cold kam ohne Umschweife zur Sache.
»Ich bin es. Ich brauche noch mal drei. Bis spätestens übermorgen.«
»Das wird nicht funktionieren. Der Zoodirektor spielt nicht mehr mit.«
»Fragen Sie ihn, ob er auf eine Million Dollar verzichten möchte.«
»Ich werde sehen, was ich tun kann, Mr. Cold.«
»Ich verlass’ mich auf Sie. Und erwähnen Sie nie wieder meinen Namen am Telefon!«
»Ok. Sie hören von mir.«
Es knackte in der Leitung. Der Vorstandsvorsitzende von GLOBALPHARM war sich sicher, dass der Zoo von Los Angeles spätestens morgen Nacht um ein paar tierische Attraktionen ärmer war.
Scheiß drauf, im Serengeti Nationalpark laufen mehr als sechzehntausend davon rum …
Erster Teil
1
Gegen den unaufhörlich auf die Windschutzscheibe einprasselnden Regen waren die Scheibenwischer des betagten Fords nahezu machtlos. In einem sinnlosen Kraftakt versuchten die beiden dünnen Zeiger vergeblich, zwei ineinander überlaufende und transparente Halbkreise zu schaffen, um dem angestrengt dreinschauenden Fahrer des grauen Pick-up einen halbwegs gescheiten Blick auf die vor ihm liegende Straße zu ermöglichen. Die Sicht lag bei unter zwanzig Meter und zum Glück hatte die heraufziehende Nacht die wenigen umherirrenden Fahrzeuge bereits in alle Winde verstreut, sodass das Risiko eines Zusammenstoßes in dieser trostlosen Einöde äußerst gering war.
Endlos lang zog sich die Straße wie eine Schnur durch die Wildnis. Wie das fluoreszierende Augenpaar eines verirrten Insekts bahnten sich die grellen Scheinwerfer ihren Weg durch die bedrohlich wirkende Dunkelheit. Nur gelegentlich gab die Wand aus Regen den Blick frei auf vereinsamt in der Ferne liegende Scheunen und verlassene Unterstände. Hier und da erfüllte ein Grollen die Nacht, woraufhin zuckende Blitze die unheimliche Szenerie in ein gespenstisches Licht tauchten. Die Ausläufer eines Bergmassivs und die vereinzelten ausgedörrten Überreste von abgestorbenen Bäumen unterstrichen den Eindruck, dass in dieser abgelegenen Gegend des Planeten der allmächtige Schöpfer keine Lust verspürt hatte, sich gestalterisch auszutoben.
Dr. Richard Pascoe lauschte entnervt dem monotonen Rumpeln und Ächzen der Karosserie, die mit lärmendem Motor durch die Nacht brummte.
Gelegentlich versuchte er durch Drehen des Frequenzknopfes einen Sender zu empfangen, der irgendein musikalisches Programm brachte. Doch der Empfang blieb aus, Funkwellen schienen diese Ecke des Landes zu meiden. Vor ihm verlor sich die stark abgefahrene Fahrbahnmarkierung anscheinend unsichtbar in einem Schwarzen Loch.
Eigentlich war es Dr. Richard Pascoe gleichgültig, ob er einen Song hören würde oder nicht. Er hatte ohnehin beschlossen, seinem knapp fünfzigjährigen Leben in dieser Nacht ein Ende zu setzen. Allerdings musste er vorher noch ein letztes Telefonat führen. Und das konnte er nur vom nächsten Motel aus erledigen, da sein Mobiltelefon nur noch ein unnützes Stück Plastik war. Zerschmettert von einer verirrten Kugel, die ihm vor wenigen Stunden gegolten hatte. Deshalb galt seine größte Sorge dem unbekannten Killer, der ihm seit Stunden auf den Fersen war. Pascoe hoffte zwar, dass der Mann die Spur verloren hatte und seit dem überhasteten Aufbruch aus dem letzten Kaff in eine der drei anderen Himmelsrichtungen gefahren war, aber das war wohl Wunschdenken.
Pascoe war bereit, die Konsequenz aus einer Fehlentscheidung zu ziehen und sich selber zu richten. Und ausgerechnet ein Killer wollte dies verhindern. Es war eine absurde Situation.
Wahrscheinlich bin ich der einzige Selbstmörder auf diesem Planeten, der gerade vor seinem Mörder flieht.
Pascoe konnte die Umrisse eines Schildes erkennen, das schemenhaft aus der Dunkelheit auftauchte. Er verlangsamte die Fahrt und brachte den Wagen zum Stehen. Er ließ das Seitenfenster auf der Beifahrerseite runter, beugte sich über den Sitz und las die Aufschrift:
JOHNSON MOTEL, 13 MEILEN
Eine Krähe näherte sich dem Schild, landete und beäugte ihn. Durch das heruntergelassene Fenster trieb der Wind Regen ins Wageninnere und verteilte kleine Rinnsale über das fein geschnittene und von Bartstoppeln übersäte Gesicht. Eine Weile starrte Pascoe auf den pechschwarzen Vogel, unentschlossen darüber, ob dieser womöglich ein Sendbote des Teufels war und ein weitaus größeres Unheil ankündigte als jenes, welches ihm selber bevorstand. Schließlich drehte sich der Kopf der Krähe in einer ansatzlosen Bewegung in Richtung des ausgewiesenen Motels. Es war ein verstörender, unheimlicher Anblick.
Pascoe betätigte das Gaspedal und setzte seine Fahrt fort, während der Regen an Heftigkeit zunahm und ein starker Wind vereinzelt entwurzelte Sträucher quer über die Straße jagte. Es war eine monotone Reise durchs Nirgendwo, unterbrochen von gelegentlichen Korrekturen des Lenkrads, wenn immer wieder auftauchende Schatten, die lediglich das Produkt seiner Einbildung waren, plötzlich inmitten der Fahrbahn illuminierten und seine Sinne täuschten.
Ohne es bewusst wahrzunehmen, drückte sein rechter Fuß das Pedal immer tiefer nach unten, sodass die rasselnden Zylinder unter der Motorhaube den Pick-up schneller werden ließen.
Pascoe wollte endlich das Motel erreichen, eine heiße Dusche nehmen, das letzte Telefonat seines Lebens führen, sich auf das hoffentlich bequeme Bett legen und sich eine der beiden im Magazin der Waffe verbliebenen Kugeln in den Kopf jagen, und zwar bevor ihn der Killer aufspüren konnte, um ihm das Geheimnis zu entreißen.
Als sich die Tachonadel bedrohlich in den 100-mp/h-Bereich bewegte, riss ihn ein Lichtreflex auf dem Rückspiegel jäh aus seinen düsteren Gedanken. Im selben Augenblick sah er das Hindernis vor sich auf der Fahrbahn. Ein undefinierbarer schwarzer Klumpen, triefend nass und hüfthoch, unbeweglich, monströs.
Pascoe stieg voll in die Eisen.
Unüberhörbar folgte ein lang gezogener quietschender Ton als Folge der blockierten Bremsscheiben. Der Wagen drohte auszubrechen und Pascoe steuerte sofort gegen, um nicht von der Straße abzukommen. In Bruchteilen von Sekunden musste er abwägen, ob er den Ford in den Graben oder vor das Ding auf der Straße setzen wollte. Seitlich registrierte er Schwärze, vor sich etwas Undefinierbares. Also entschied er sich für die goldene Mitte – irgendwie vorbei über den Mittelstreifen.
Wuuuuuschhh!!! Der rechte Vorderreifen touchierte das auf der Straße liegende Ding, während der Ford in der letzten Phase seines Bremsweges einen heftigen Satz machte. Panisch riss Pascoe das Steuer herum und versuchte den Fliehkräften entgegenzusteuern. Vergeblich. Mehrmals rotierte der Pick-up um die eigene Achse und stoppte in einer abrupten Bewegung. Pascoe knallte mit der Stirn auf das Lenkrad und zog sich eine klaffende Platzwunde zu. Sekunden später trat Stille ein, die nur vom Rhythmus der unbeirrt weiter arbeitenden Scheibenwischer unterbrochen wurde.
Benommen rappelte sich Pascoe hoch und begutachtete im Rückspiegel seine Stirn. Die Wunde sah wilder aus, als sie tatsächlich war, aber das war im Moment das geringste Problem. Er hatte irgendwen oder irgendwas überfahren, und das galt es sofort zu klären, bevor der tanzende Lichtpunkt in der Ferne zu ihm aufschließen würde. Wenn das Licht am Horizont vom Wagen des Killers herrühren sollte, durfte er keine Zeit verlieren. Nach einem flüchtigen Blick in den Seitenspiegel setzte er den Pick-up vorsichtig zurück und kurvte um den leblosen Körper, der mitten auf der Straße lag. Als das angefahrene Hindernis direkt im Kegel seiner strahlenden Scheinwerfer lag, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen.
Vor ihm lag eine Kuh.
Hastig stieg er aus, um das gewaltige Tier aus nächster Nähe zu begutachten. Wo noch vor einer Minute der Kopf gewesen sein musste, breitete sich jetzt eine blutige, fleischige Masse aus, aus der ein einziges zermalmtes Auge und die zerrissenen Überreste einer Zunge grotesk hervorlugten. Der Kadaver verströmte einen unangenehmen Geruch, ein mögliches Anzeichen dafür, dass das Tier schon vor geraumer Zeit verendet war. Aber was auch immer der Grund für den Tod dieses Viehs gewesen war, er musste weiter, bevor es zu spät war. Irgendjemand würde das Problem auf der Straße schon regeln.
Straße?
Irritiert blickte sich Pascoe um. Er nahm seine Hand schützend vor die Augen, als er sich in die Lichtwand seiner eigenen Scheinwerfer drehte und wie in Zeitlupe registrierte, wo er sich eigentlich befand. Der Unfall hatte sich mitten auf einer einsamen Kreuzung ereignet. Am Schnittpunkt von vier schnurstracks aufeinander zulaufenden Linien, zu deren Seiten sich – so weit sich das bei den jetzigen Lichtverhältnissen erkennen ließ – nur endlose Weite und die schemenhaften Umrisse gewaltiger Berge ausbreiteten. Sein dröhnender Schädel verursachte Kopfschmerzen und er hatte Mühe, die Orientierung zurückzugewinnen. Aus welcher Richtung war er eigentlich gekommen?
Langsam drehte er sich um die eigene Achse. Er blinzelte und spekulierte, von wo der letzte Lichtpunkt gekommen war. Aber da war nichts. Keine Scheinwerfer, keine tanzenden Bündelungen von Helligkeit, die auf ein fernes Fahrzeug hindeuteten. Nur ein umgeknickter Pfahl, an dessen Ende ein Wegweiser hing. Entnervt schlug Pascoe den Kragen seines Trenchcoats ein Stück nach oben und schritt durch den kalten und ungemütlichen Regen auf das Schild zu, ohne dem am Boden liegenden Tier noch weitere Aufmerksamkeit zu schenken.
JOHNSON MOTEL, 7 MEILEN
»Sieben Meilen? In welche Richtung? Verdammt!«
Sein Fluch hallte durch die rabenschwarze Nacht und verlor sich im Nirwana. Pascoe war Wissenschaftler, genauer gesagt Genforscher. Er war es gewohnt, analytisch zu denken und dementsprechend zu handeln. Er schritt zu seinem Wagen zurück, kramte eine Taschenlampe hinter dem Sitz hervor und leuchtete über den Asphalt, da er sich nicht mehr erinnern konnte, aus welcher Himmelsrichtung er gekommen war. Die Bremsspuren auf dem glitzernden Asphalt zeigten ihm die Richtung an.
Und dann sah er sie wieder, die Scheinwerfer eines anderen Autos, schätzungsweise zehn Meilen von ihm entfernt. Für einen kurzen Moment verschwanden die Lichter, wahrscheinlich, weil der Wagen gerade eine abgesenkte Stelle passierte. Ihm blieb nicht viel Zeit und er musste sich für eine der drei Richtungen entscheiden, um das Motel zu erreichen.
Die Rockies liegen links. Also Norden.
Er setzte sich wieder hinter das Steuer und überlegte. Während der Fahrt hatte er das Handschuhfach inspiziert und eine halb volle Flasche Whiskey entdeckt. Kurzerhand griff er zu, schraubte den Metallverschluss auf und genehmigte sich entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten einen Schluck. Dann legte er die Flasche achtlos auf den Beifahrersitz und gab Gas. In der Hoffnung, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben, raste er mit dem gestohlenen Ford dem vermeintlichen Ziel entgegen. Zwei Meilen später gab es erneut ein Problem. Mit einem lauten Knall platzte einer der Reifen und Dr. Richard Pascoe fing langsam an durchzudrehen.
2
Joey Di Santos steuerte seinen heruntergekommenen Dodge Challenger im halsbrecherischen Tempo über den nassen Asphalt und fluchte ununterbrochen über das Wetter, den schlechten Radioempfang und sich selber. Gelegentlich kurbelte er das Seitenfenster herunter, um durch den Fahrtwind frische Luft in das verqualmte Innere des Wagens zu lassen. Unmittelbar darauf zündete er sich jedes Mal eine neue Zigarette an, die er lässig zwischen seinen Mundwinkeln hin- und herwandern ließ, während er in tiefen Zügen das Nikotin in seine Lungen sog. Die abfallende Asche landete in regelmäßigen Abständen auf seiner abgewetzten Jeans oder dem durchgescheuerten Lederbezug zwischen seinen Beinen. Auf dem Beifahrersitz und im Fußraum des Wagens stapelten sich leere Pizzaverpackungen, zerknüllte Zigarettenschachteln, zerfledderte Zeitungen und ein halbes Dutzend leere Bierdosen. Über dem ganzen Chaos war eine Faltkarte von Montana ausgebreitet.
Nervös trommelte Di Santos auf der Mittelkonsole herum und langte dann über das Armaturenbrett, um nach der neun Millimeter Tanfoglio zu greifen, einer in seiner Branche relativ selten verwendeten Waffe. Irgendwo da vorne hatte er vor wenigen Sekunden etwas gesehen, er wusste aber nicht genau was. Vielleicht Rücklichter. Vielleicht weit entfernte Scheinwerfer.
Kurz darauf sah er das Schild mit dem Vogel.
Di Santos stieg in die Eisen, der Dodge kam zwanzig Meter hinter dem Schild zum Stehen.
Rückwärtsgang.
Johnson Motel, 13 Meilen, wie schön, dachte er und glotzte die Krähe durch das heruntergelassene Fenster an. Ohne Vorwarnung hob er die Waffe, zielte auf den Vogel und drückte ab. Aufgescheucht durch die vorbeipreschende Kugel erhob sich die Kreatur krächzend in die Luft und verschwand in einem Vorhang wie aus pechschwarzer Tinte.
»Scheißvieh!« Er gab erneut Gas.
Joey Di Santos war ein Profi mit über zwanzig Jahren Berufserfahrung. Seinen ersten Auftrag hatte er mit sechzehn erledigt, irgendwo in der Bronx. Seitdem hatte er sich in der Personenbeseitigungsbranche einen Namen gemacht. Seine Auftraggeber, die immer über Mittelsmänner an ihn herantraten und ihn nie persönlich zu Gesicht bekamen, zahlten im Voraus, meist fünfstellig. Und es war ihm noch nie passiert, dass er einen Job vermasselt hatte.
Bis auf diesen.
Vielleicht weil dieser anders war. Weil er den Kerl erst verhören musste, um an die Formel zu gelangen. Das war etwas komplexer, als einfach nur abzudrücken.
Der Name von dem Kerl, den er umlegen sollte, lautete Pascoe. Doktor Richard Pascoe. Viel mehr wusste Di Santos nicht über seinen Klienten. Und das war auch gut so. Denn schließlich wollte er sich mit dem Mann ja nicht anfreunden. Alles was Di Santos wollte, war eine kurze Mitteilung an seinen Mittelsmann, dass der Kunde zufrieden sein durfte. Weil er, Joey Di Santos, mal wieder einen Klienten verloren hatte. Woraufhin der Bonus fällig werden würde. So einfach war das.
Dummerweise war die Sache heute Morgen schiefgelaufen. Dieser Typ hatte einfach nicht reden wollen und war dann getürmt. Und eine Kugel, die ihn hätte stoppen sollen, war irgendwo gelandet, bloß nicht im Bein von Pascoe. Das war peinlich genug. Aber zu allem Überfluss war dieser Doktor auch noch mit einer fremden Karre getürmt, was über kurz oder lang die Bullen auf den Plan rufen würde. Aber das konnte noch dauern, denn das hier war Montana, die weitläufige Kornkammer des Landes, irgendwo in der Pampa, am Arsch der Welt.
Obwohl die Sicht nahezu bei Null lag, trat Di Santos tiefer aufs Gaspedal und ließ den satten Sound des alten Muscle Car erklingen. Er warf einen Blick in den Rückspiegel und knautschte sich das vernarbte Gesicht rund um die rot geränderten Glupschaugen, um die Müdigkeit loszuwerden. Dann fuhr er sich mit seinen mehrfach beringten Fingern durch das ölig glänzende schwarze Haar, das ihm fast bis zu den Schultern reichte und am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengeknüpft war. Obwohl er T-Shirt, Baumwollhemd, Jeans-Weste und einen langen Ledermantel trug, fror er, da die Heizung des Dodge nicht mehr richtig funktionierte. Es wurde Zeit, dass er sich nach was Neuem umschaute. Diese ’72er-Kiste brachte es einfach nicht mehr. Frustriert schlug er mit seiner Faust auf die Lüftungsschlitze und drehte an dem Heizungsregler. Aber es blieb arschkalt. Genauso kalt wie damals im Kühlraum der Metzgerei seines alten Herrn, der ihm immer gesagt hatte, er solle sich einen vernünftigen Job suchen und Karriere machen, irgendwo an der Wall Street.
Das mit der Karriere hatte ja einigermaßen geklappt. Zwar nicht an der Wall Street, aber immerhin. Sein erster Auftragsmord hatte ihm damals zehn Riesen gebracht, ausgezahlt durch einen Klein-Mafioso, der für einen aalglatten Immobilienspekulanten tätig war. Seitdem hatte Joey Di Santos keinen Vater mehr. Und die Bronx eine Metzgerei weniger.
Der Dodge Challenger erreichte nach einer lang gezogenen abgesenkten Strecke wieder den höchsten Punkt des Straßenverlaufs und schoss mit fast achtzig Meilen durch eine Wand aus Wasser, welches sich nach links und rechts zerteilte und hinter den Rücklichtern zu einer Fahne aus Gischt verwirbelte. Die Scheibenwischer arbeiteten auf Hochtouren und das durch sie verursachte Geräusch machte Di Santos fast wahnsinnig. Als der Wagen wegen des Aquaplanings kurz die Bodenhaftung verlor, ging der schmächtige Killer vorsichtshalber vom Gas. Außerdem musste er seit mindestens drei Stunden pinkeln und hatte nur deshalb einen kurzen Stopp ignoriert, weil er keine Lust auf diesen verdammten Regen hatte. Aber es nutzte nichts, er musste anhalten, bevor ihm seine Blase bei der nächsten Bodenwelle in den Magen schwappen würde.
Als Di Santos den dunkelbraunen Dodge auf offener Straße abbremste und langsam ausrollte, erblickte er ein Kreuzungsschild und fuhr noch ein paar Meter weiter. Dann sah er dieses Ding am Boden. Instinktiv schloss sich sein Griff um die Pistole etwas enger. Vorsichtig öffnete er die Fahrertür und stieg aus. Keine zwei Sekunden später war er bis auf die Unterwäsche durchnässt. Er schritt auf die Mitte der Kreuzung zu und hielt die Waffe im Anschlag. Obwohl die Scheinwerfer den Ort perfekt ausleuchteten und Di Santos jetzt erkennen konnte, was da vor ihm lag, blieb er auf der Hut. Dies war womöglich ein Hinterhalt, aus dem gleich Pascoe auf ihn zugestürmt kam.
Nachdem mehr als eine Minute vergangen war und sich nichts regte, ließ er die Waffe sinken. Da war nichts. Nichts und niemand. Die Luft war rein. Irgendein Idiot hatte wahrscheinlich am Steuer gepennt und das Vieh umgenietet. Und war dann getürmt. Er selber hätte es nicht anders gemacht. Wen interessierte schon ein totes Vieh mehr oder weniger?
Dann öffnete er umständlich seinen Hosenschlitz, um sein Teil auszupacken und sich zu erleichtern. Während er darüber nachdachte, welchen Weg Pascoe eingeschlagen hatte, sah er mit einem gleichgültigen Blick dabei zu, wie der Urinstrahl auf das zerquetschte Auge der Kuh traf.
3
County Sheriff Paul D. Swifty brachte gut und gerne dreihundert Pfund auf die Waage und erinnerte in seiner gesamten birnenförmigen Erscheinung an einen Barbapapa in Polizeiuniform. Sein rosafarbenes Gesicht und seine blank polierte Glatze schimmerten im grellen Licht einer blinkenden Neonreklame, die auf dem Dach des gegenüberliegenden Pubs angebracht war. In Ritas World, so der verheißungsvolle Name der einzigen Lokalität von Ferguson, gab es die besten Chili-Burger im Umkreis von zweihundert Meilen. Drei von ihnen hatte Sheriff Swifty bereits in seinem Wagen vertilgt, Nummer vier wartete auf dem Armaturenbrett in einer Pappschachtel auf das bevorstehende Ende.
Es war Swiftys letzte Schicht vor dem Wochenende, sein Dienst war eigentlich schon beendet. Aber irgendein durchreisender Handelsvertreter hatte vor einer Stunde draußen eine verendete Kuh mitten auf einer Kreuzung gemeldet, welche es nun zu inspizieren galt.
Na ja, zieh ich das Vieh halt mit dem Abschleppseil aus dem Gefahrenbereich, dachte sich der älteste Sheriff im County und ließ den Motor seines Plymouth an.
Knapp eine Minute später hatte er das Ortsschild von Ferguson passiert, um in Richtung der Unfallstelle weiterzufahren. Seine Gedanken kreisten um die bevorstehende Pensionierung in knapp einem Monat. Er würde seine Arbeit vermissen, so viel stand schon jetzt fest. Auch wenn Kadaver-Beseitigung nicht unbedingt zu den bevorzugten Aspekten seiner Laufbahn gehört hatte. Dass er diesen undankbaren Job in dieser kalten und regendurchpeitschten Nacht übernehmen musste, hatte er ohnehin nur dem Umstand zu verdanken, dass Billy Woddlestock mal wieder voll wie eine Haubitze war, anstatt sich um sein Farm- und Weideland zu kümmern. Es war nicht das erste Mal, dass dessen Kühe und Rinder, die er lediglich für den eigenen Bedarf hielt, auf Wanderschaft gegangen waren.
Sheriff Swifty setzte sich seine Mütze auf und blickte angestrengt auf die vor ihm liegende Straße. Der Regen hatte nachgelassen und die Sicht wurde besser. Da das Land hier platt wie eine Flunder war, konnte er schon von Weitem erkennen, wie eine Meile voraus irgendjemand mit seinem Wagen Probleme hatte.
Auch das noch, seufzte Swifty und bereitete sich gedanklich auf eine weitere nächtliche Abschleppaktion vor. Als er sich der Stelle mit dem warnblinkenden Wagen bis auf fünfzig Meter genähert hatte, kam ihm ein Mann entgegengerannt. Jedenfalls vermutete Swifty, dass es ein Mann war. Körperhaltung und Laufstil ließen keinen anderen Schluss zu. Vorsichtshalber tastete der Police Officer nach seiner Waffe.
»Bleiben Sie bitte bei Ihrem Fahrzeug«, forderte Swifty den Mann über den Außenlautsprecher auf. »Und machen Sie keine hastigen Bewegungen!«
Der hochgewachsene und schlanke Fremde auf der Straße ignorierte die Aufforderung und kam direkt auf den Plymouth zu. Sein hellblauer Anzug, das weiße Hemd mit der roten Krawatte und der beigefarbene Trenchcoat waren vollkommen durchnässt. Aus den Augen des Mannes sprach echte Besorgnis, fast schon Panik. Der Kerl schien ein Problem zu haben.
»Bitte, Officer, Sie müssen mir helfen. Mir ist ein Reifen geplatzt und ich muss dringend telefonieren«, schrie der Fremde und trommelte eine Spur zu heftig gegen die Windschutzscheibe des Polizeiwagens.
»Beruhigen Sie sich!«
»Ok«, erwiderte der Mann und trat einen Schritt auf die Fahrbahn zurück.
»Und jetzt gehen Sie zurück zu Ihrem Wagen. Schön langsam. Ich steige aus und will Ihre Hände sehen.«
Der Fremde gehorchte. Bevor sich Sheriff Swifty aus dem Wagen quälte, betätigte er noch die Einsatzlichter. Das Resultat war eine sich spiegelnde Farborgie in Rot und Blau auf dem nassen Asphalt.
»Wie ist das passiert?«, wollte Swifty wissen und beäugte argwöhnisch die Vorderpartie des lädierten Dodge. Die Stoßstange und ein Kotflügel waren verbeult. An der blanken Felge des rechten Vorderreifens hingen noch einige Gummireste.
»Sie werden es kaum glauben, aber ein paar Meilen weiter liegt eine tote Kuh mitten auf der Kreuzung«, sagte der Fremde. »Der Regen war so heftig, ich habe den Kadaver erst viel zu spät gesehen. Das war ein ziemlich heftiger Satz. Dabei muss der Vorderreifen was abbekommen haben.«
»Und Sie haben keinen Ersatzreifen dabei?«
»Nein.«
Der Sheriff nickte nachdenklich. Das mit der Kuh entsprach der Wahrheit. Trotzdem schien irgendetwas mit dem Kerl nicht zu stimmen. Auf den ersten Blick wirkte er seriös. Auf den zweiten Blick völlig verstört.
»Das Vieh scheint schon eine Weile da draußen zu liegen. Gehörte einem unserer Farmer hier. Ein Durchreisender hat den Vorfall bereits gemeldet. Aber jetzt setzen Sie sich bitte in den Wagen und geben mir die Zulassungspapiere. Ich muss ein Protokoll aufnehmen.«
»Hören Sie, Officer«, wiegelte der Mann ab, »der Schaden an meinem Wagen interessiert mich nicht sonderlich. Das ist nur eine Bagatelle. Aber ich muss wirklich dringend telefonieren.«
»Ach wirklich?«
»Ja, es ist dringend. Wie weit ist es bis zum nächsten Ort?«
»Bis nach Ferguson? Vielleicht fünf Meilen. Aber jetzt erst mal eins nach dem anderen. Geben Sie mir die Papiere, bitte! Und setzen Sie sich endlich in den Wagen«, reagierte Swifty gereizt.
»Dafür habe ich leider keine Zeit.«
»Wie bitte?«
»Hören Sie, Sheriff, die Sache ist die: Ich habe den Wagen von einem Freund geliehen und bin ohne Papiere unterwegs. Den Führerschein habe ich in meiner Brieftasche. Hier, in meiner Hose. Aber ich bitte Sie, mich dringend telefonieren zu lassen. Bevor …«
»Bevor was?«, fragte der Sheriff lauernd und legte seine Hand an das Waffenholster. Routiniert ließ er den Lederverschluss aufspringen und ertastete den Griff der Waffe.
»Bevor mich dieser Typ umnietet.«
Mit einem Mal war County Sheriff Paul D. Swifty in Alarmbereitschaft. »Wie bitte?«
Nervös trat der Fremde mit einem Bein auf der Stelle und schaute sich wie ein gehetztes Tier um. Anscheinend wollte er sich nicht näher äußern, sodass Sheriff Swifty seine Frage präzisierte:
»Wer will Sie umlegen?«
»Ich weiß es nicht, irgendein Kerl eben. Ich kann Ihnen jetzt nicht alles erklären. Aber glauben Sie mir, ich werde verfolgt. Und jemand hat auf mich geschossen.«
»Wann war das?«
»Heute Morgen. In Anaconda.«
»In Anaconda? Das ist fast fünfhundert Meilen von hier entfernt. Dann sind Sie bestimmt über Helena und Great Falls gefahren. Und auf dieser Strecke gibt es ’ne Menge Möglichkeiten, um zu telefonieren. Die Geschichte klingt nicht gerade überzeugend.«
»Ich sagte doch, dass ich verfolgt werde. Ich weiß noch nicht einmal, wo ich jetzt überhaupt bin. Der Wagen hat kein Navigationssystem. Aber bitte, wir verlieren nur Zeit. Der Kerl ist hier irgendwo in der Nähe und sucht mich.«
Sheriff Swifty sah keine andere Möglichkeit, als den Fremden gründlich durchzuchecken. Das würde eine lange Nacht werden. Und er war sich sicher, dass der FBI-Computer irgendwas ausspucken würde.
»Legen Sie die Hände aufs Dach und stellen Sie die Beine auseinander, Sir!«
»Oh Gott, muss das sein?«
Swifty hatte seine Waffe gezogen und entsichert. Dem Fremden blieb keine andere Wahl. Er ließ sich abtasten, wobei die Brieftasche zum Vorschein kam. Vorsichtig bugsierte der Beamte den Mann ein Stück zur Seite, um durch das heruntergelassene Fenster des Pick-ups den Zündschlüssel abzuziehen. Dabei fiel sein Blick auf die halb leere Flasche Whiskey. Anschließend verschwand der Schlüssel in der Hosentasche des Sheriffs.
»Ok, Sie gehen jetzt rüber zu meinem Wagen und nehmen auf der Rückbank Platz.«
»Sheriff, hören Sie mir bitte zu! Ich …«
»Halten Sie jetzt den Mund! Oder ich lege Ihnen Handschellen an«, blaffte Swifty. Dann schob er den Mann in den Fond des Wagens und ließ die Türverriegelung zuschnappen. Schließlich ging er um das Fahrzeug herum, öffnete die Beifahrertür, schob die Burgerverpackungen zur Seite und ließ sich schwer atmend in den Sitz sinken.
»Dann wollen wir doch mal sehen, wen wir hier haben.«
»Pascoe. Dr. Richard Pascoe«, murmelte der Eingepferchte.
Unbeirrt untersuchte der Sheriff die Brieftasche und förderte Kreditkarten und einen Firmenausweis zutage. Zumindest kennt der Kerl seinen eigenen Namen, dachte Swifty und inspizierte neugierig eine kleine schmale Tüte, die etwa die Größe eines Teebeutels hatte und zwischen einer American Express und einer Discover Card steckte.
»Nehmen Sie Drogen, Dr. Pascoe?«
»Gott bewahre, nein!«
»Und was ist das hier?« Swifty wedelte über seinen Rücken mit dem kleinen durchsichtigen Päckchen, in dem irgendein weißes Pulver steckte.
»Es ist nicht das, was Sie vermuten!« Pascoe reagierte beim Anblick des Päckchens entsetzt.
»Ist es nicht?«, amüsierte sich der County Sheriff und reimte sich aufgrund des entdeckten Whiskeys und dem vermeintlichen Beweisstück in der Hand seine eigene Geschichte zusammen. »Ist zwar eine Weile her, seit wir in Ferguson einen Junkie hatten, aber dieses Zeug erkenne ich sofort am Geschmack.«
Durch den geöffneten Sprechschlitz nahm Pascoe den Officer eindringlich ins Visier. »Probieren Sie das nicht. Es ist kein Heroin. Ich schwöre es. Wenn Sie es probieren …«
»Wenn ich es probiere, passiert was?«
»Wenn Sie es probieren, werden Sie sterben.«
»Tatsächlich?«, fragte Swifty mit einer Mischung aus Amüsiertheit und Vorsicht. »Es wird langsam immer mysteriöser, Dr. Pascoe. Finden Sie nicht?« Und nach einer kurzen Pause: »Was machen Sie eigentlich beruflich? Falls Sie nicht gerade vor Killern auf der Flucht sind.«
In diesem Augenblick blitzten zwei grelle Scheinwerfer frontal auf und blendeten die Männer.
»Was zum Teufel«, setzte Swifty an und hielt sich die Hand vor die Augen.
»Oh Gott, das ist er bestimmt«, stöhnte Pascoe.
»Jetzt schalten Sie mal Ihre Betriebstemperatur runter, Dr. Pascoe. Wahrscheinlich ist das noch so ein verdammter Junkie. Fährt ohne Beleuchtung durch die Gegend und blendet dann in letzter Sekunde das Fernlicht auf. Verrückte Nacht!«
»Ich beschwöre Sie, Sheriff, lassen Sie mich hier raus! Der legt uns sonst eiskalt um.«
»Hier legt niemand irgendwen um. Und jetzt halten Sie endlich Ihre Klappe!«
»Das darf doch nicht wahr sein«, unterdrückte Pascoe mit bebender Stimme einen Wutanfall und trommelte gegen das Sicherheitsglas. Dann duckte er sich von der Scheibe weg und verzog sich so tief es ging in den Fußraum des Plymouth.
»Nur die Ruhe. Bin gleich zurück.«
Sheriff Swifty wuchtete seine dreihundert Pfund aus dem Wagen und schritt auf das mit laufendem Motor wartende Auto zu. Er konnte das Fabrikat nicht erkennen, da die Fernlichter zu sehr blendeten. Mit einer Geste gab er dem unsichtbaren Fahrer zu verstehen, dass dieser auf Abblendlicht umschalten sollte.
4
Joey Di Santos hatte den Ablauf der Dinge an der Kreuzung richtig interpretiert. Und dabei mehr Glück als Verstand gehabt. Jetzt sah er Pascoes Wagen vor sich am Straßenrand und vermutete, dass der Typ weiter Richtung Ferguson gerannt war, weil irgendwas mit seiner Karre nicht mehr gestimmt hatte. Wahrscheinlich ein Plattfuß. Verursacht durch eine abgekackte Kuh.
Dummerweise kam jetzt dieser Bulle auf den Dodge zu. Ein fetter Dorfpolizist, wichtigtuerisch und auffordernd provokant mit seinen fleischigen Pranken wedelnd. Er hatte eine Waffe in der Hand, was kein besonders gutes Zeichen war. Aber was im Grunde genommen kein ernsthaftes Problem darstellte. Nicht für Joey Di Santos, einen der treffsichersten Schützen im ganzen Land, dennoch sah er die Probleme, die nach der Liquidierung des Wissenschaftlers auf ihn zukommen würden. Selbst der dümmste Dorfsheriff würde eins und eins zusammenzählen und nach dem Fahrer des Dodge ermitteln, der zu nächtlicher Stunde fast zeitgleich mit Pascoe hier eingetroffen war.
Aber sollte er wirklich ernsthaft eine Kugel an den Cop verschwenden? Kugeln konnten zurückverfolgt werden, auch wenn seine Knarre nicht registriert war.
Ein Tritt auf das Gaspedal und die Sache wäre auch so erledigt. Er musste das Ziel nur im richtigen Winkel erwischen, damit es keinen hässlichen Fettfleck auf der Windschutzscheibe geben würde. Andererseits konnte es ohne ein paar Kratzer und Beulen im Lack nicht ablaufen – und irgendwie hatte der gute alte Dodge das nicht verdient. Auch wenn Di Santos schon tausend Mal über den Wagen geflucht hatte.
Also doch auf die gute altmodische Art? Ein sauberer Schuss zwischen die Augen, aus nächster Nähe? In diesem Moment kam ihm eine geniale Idee.
Warum schiebe ich den Tod des Sheriffs nicht Pascoe in die Schuhe?
Einen Wimpernschlag später trat er das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Drei Sekunden später war County Sheriff Paul D. Swifty der sterbende Beweis dafür, dass die anstürmende Kraft von acht Zylindern sich im direkten Vergleich gegen einen zu knapp siebzig Prozent aus Flüssigkeit bestehenden Körper immer durchsetzen würde.
Neugierig betrachtete Di Santos sein Werk im Rückspiegel. Der dicke Sheriff lag reglos am Boden, wobei seine Beine in einem unnatürlichen Winkel vom Unterleib abstanden. Es war zwar kein perfekter Flug gewesen, dafür aber ein perfekter Aufschlag auf dem Asphalt. Er musste tot sein. Mausetot.
Di Santos parkte seinen Wagen etwa einhundert Meter vom Unfallort entfernt am Straßenrand und stieg aus. Mit einem schiefen Grinsen registrierte er, dass Stoßstange und Motorhaube kaum etwas abbekommen hatten. Dann schritt er ohne Eile zurück zu dem am Boden liegenden Mann und sah ihm ins Gesicht. Unter dessen Kopf breitete sich langsam eine Blutlache aus.
»Das sieht nicht gut aus, mein Freund.«
Er ging zu Pascoes Wagen und inspizierte das Zündschloss. »Mist!«
Der Schlüssel steckte nicht mehr, Pascoe musste ihn mitgenommen haben. Aber vielleicht hatte der Sheriff den Schlüssel an sich genommen, als er das herrenlose Fahrzeug gesehen hatte. Di Santos würde nicht darum herumkommen, die Taschen des Bullen zu untersuchen.
Wenige Augenblicke später hatte er den Schlüssel in Swiftys Hosentasche entdeckt. Es war eine aufwendige Prozedur, bei der er den schweren und widerspenstigen Oberkörper zunächst aufrichten musste. Erneut ging er auf den grauen Pick-up zu, setzte sich hinters Steuer, startete den Motor und legte den Rückwärtsgang ein. Mit einem kreischenden Geräusch drehte sich die reifenlose Felge über den harten Asphalt. Funken sprühten und erloschen sofort in der von Regen geschwängerten Luft.
Di Santos legte gut achtzig Meter im Rückwärtsgang zurück und konzentrierte sich ganz auf sein Ziel. Schließlich beschleunigte er im Vorwärtsgang den Wagen, der nun aufgrund der ramponierten Felge das Geräusch einer Kreissäge von sich gab, und fuhr direkt auf den in seltsam vornübergebeugter Position sitzenden Toten zu. Der zweite Aufprall würde den Sheriff übel zurichten, aber genau das war Di Santos’ Absicht.
Es war ein hässliches Geräusch, als der Pick-up den wuchtigen Körper erfasste und überrollte. Als Di Santos den Motor abstellte, den Zündschlüssel abzog, ausstieg und zum Polizeiwagen zurückkehrte, setzte der Regen wieder ein. Noch immer tauchten die rotierenden Warnlichter die Umgebung in ein unnatürliches Licht und verbreiteten die Stimmung eines echten Tatorts.
Di Santos öffnete die Fahrertür des Polizeifahrzeugs aus reiner Neugier und weil er hoffte, im Wagen des Dicken etwas Essbares zu finden. Und in diesem Moment passierten zwei Dinge gleichzeitig.
Am Horizont, in der Richtung, wo die Kuh auf der Kreuzung lag, fraß sich ein Lichtkegel durch die Nacht, der den Killer sofort aufschrecken ließ. Und auf dem Beifahrersitz, hinter einem aufgetürmten Berg aus leeren Burgerschachteln, erspähte Di Santos eine aufgeschlagene Brieftasche mit einer deutlich sichtbaren American Express Kreditkarte, die auf den Namen Dr. Richard Pascoe ausgestellt war. Auf der Brieftasche lag ein kleines durchsichtiges Päckchen mit weißem Inhalt. Für einen Augenblick war Di Santos verwirrt und blickte sich unentschlossen in der Kabine um. Dann drehte er seinen Kopf nach hinten, sah aber nur eine leere Rückbank hinter der Sicherheitsscheibe.
Seltsam.
Es wurde Zeit zu verschwinden, bevor der größer werdende Lichtkegel in der Ferne sich dem Tatort näherte und irgendein Penner aus dem nahe gelegenen Kaff den Schwindel mit dem getürkten Unfall aufdeckte.
Di Santos blickte auf seine Uhr. Es war zwanzig Minuten vor Mitternacht. Er packte Pascoes Brieftasche mitsamt dem Päckchen in seinen Mantel, wischte seine Fingerabdrücke mit einem Taschentuch ab und sah zu, dass er von hier wegkam. Mit ausgeschalteten Scheinwerfern machte er sich auf die Fahrt Richtung Ferguson, um Pascoe endlich ausfindig zu machen.
5
Billy Woddlestock war voll. Sternhagelvoll. Sein alter John Deere Traktor pfiff aus dem letzten Loch und quälte sich wie ein schnaufendes Dampfross über die endlos lange Straße Richtung Ferguson, die tote und mittlerweise fast abgehäutete Kuh über die altertümliche Aufhängung des Mähbinders hinter sich herziehend.
Wie jeden Freitag trieb es ihn auch an diesem Abend ins Dorf, wo er sich im bereits benebelten Kopf am Tresen von Ritas World niederlassen würde, um sich die dicken Titten der rothaarigen Besitzerin in freigelegtem Zustand vorzustellen. Woddlestock war in der Gegend bekannt wie ein bunter Hund und für seine Saufeskapaden berüchtigt. Seine heruntergewirtschaftete Farm und sein meist brachliegendes Ackerland waren stets Gegenstand von Diskussionen und allgemeinem Kopfschütteln. Wie er überleben konnte und woher er das Geld für seine ausufernden Saufgelage hatte, vermochte niemand zu sagen. Billy Woddlestock, der kleine zahnlose Methusalem mit der verknitterten Visage einer Rosine, hütete sein Geheimnis wie einen Augapfel. Niemand in der Gemeinde wäre jemals auf die Idee gekommen, dass er über drei Millionen Dollar schwer war. Und erst recht wäre niemand auf die Idee gekommen, dass dieses Vermögen als Bargeld in einem ehemaligen Jauchetank seiner Farm deponiert war. Die Lotterie hatte ihn reich gemacht.
Mit fünfhundert Dollar in der Tasche tuckerte er nun über die Straße, während sich hinter ihm das arme Vieh langsam in Wohlgefallen auflöste. Er hatte keine Erklärung dafür, warum er die tote Kuh von der Straßenkreuzung an den Haken genommen hatte und warum er sie den langen Weg bis nach Ferguson mit sich zog. Vielleicht konnte er der rothaarigen Rita damit imponieren und ihr das gute Stück schenken. Vielleicht konnte er damit aber auch Sheriff Swifty zur Weißglut treiben und eine Anzeige wegen Leichenfledderei provozieren. Vielleicht konnte er gegenüber den Bewohnern von Ferguson damit zum Ausdruck bringen, dass sie ihn einfach nur am Arsch lecken sollten und er der Typ mit dem rostigen Nagel im Kopf war. Wer konnte schon wissen, was einem fast neunzigjährigen Suffkopp im Leben Freude bereitete?
Als Woddlestock, der wie jedes Wochenende seinen besten schwarzen Anzug trug, die schon aus der Ferne sichtbaren Warnlichter des Polizeiwagens sah, freute er sich bereits diebisch auf die Begegnung mit dem Sheriff. Doch je näher er kam, desto mehr verfinsterte sich sein Gesichtsausdruck, da dort ganz offensichtlich etwas nicht stimmte. Während der nasskalte Wind durch die altersschwache und provisorisch anmutende Plexiglas-Kabine seines John Deeres pfiff, kehrte fast so etwas wie Nüchternheit in seine mit Whiskey verseuchten Blutbahnen ein.
Dann sah er die grausam zugerichtete Leiche auf der Straße und den großen grauen Pick-up mit der geöffneten Fahrertür.
Heiliger Bimbam. Der erste Unfall in Ferguson, seit Henry Ford 1908 die Tin Lizzie erfunden hat!
Woddlestock ließ den Traktor im Leerlauf und kletterte trotz seines betagten Alters mit der Geschmeidigkeit einer torkelnden Katze vom Hochsitz seines landwirtschaftlichen Oldtimers. Er ging auf die traurigen Überreste des Sheriffs zu und verzog das Gesicht. Hastig nahm er seinen alten Hut ab und hielt ihn wie zum Gebet vor die Brust. Dann spuckte er ein Stück Kautabak auf die Straße und kratzte sich am Hinterkopf.
Was für eine Schweinerei. Der Bestatter wird alle Mühe haben, den guten alten Swifty für die Beerdigung herzurichten.
Dann schritt Woddlestock den Unfallort ab und inspizierte zunächst den offenen Pick-up. Als er die Flasche Whisky auf dem Beifahrersitz entdeckte, krabbelte er in den Innenraum und genehmigte sich einen Schluck. Anschließend warf er einen Blick in das Handschuhfach, ohne zu wissen, wonach er eigentlich suchte. Sofort fiel ihm der .357 Magnum Colt ins Auge. Mit sichtlicher Abscheu nahm er den Revolver in die Hand und überprüfte die Trommel. Es fehlte keine einzige Kugel. Sicherheitshalber nahm er die Waffe an sich und steckte sie in seine Hosentasche, falls der Besitzer zurückkehren würde, um damit Unheil anzurichten.
Plötzlich erklangen gedämpfte Rufe aus Richtung des Polizeiwagens.
6
Dr. Richard Pascoe hatte die Hölle auf Erden durchlebt. Zusammengekauert wie ein Häufchen Elend hatte er unter der schwarzen Wolldecke im Fußraum des Wagens von County Sheriff Paul D. Swifty gelegen und gehofft, dass der Killer ihn nicht entdecken würde. Anscheinend hatte Pascoe es nur dem zufälligen Auftauchen eines Traktorfahrers zu verdanken, dass er nicht jetzt schon tot war. Ohne zu wissen, was draußen genau vor sich gegangen war, hatte er die ganze Zeit den Atem angehalten und sich nicht einen Millimeter bewegt. Aber jetzt schien die Luft rein zu sein und er musste unbedingt aus seinem unfreiwilligen Versteck heraus. Wer immer auch gerade auf der Straße herumschlurfte, es konnte nicht sein Verfolger sein.
Das ist krank, vollkommen krank, dachte Pascoe und musste fast lachen, als er über die Situation nachdachte. Ich will mich umbringen, und stattdessen bin ich in einem Albtraum gefangen. Ich muss unbedingt raus aus dieser Falle und telefonieren. Bevor es zu spät ist.
Pascoe richtete sich vorsichtig auf und warf einen Blick aus dem Seitenfenster. Alles, was er sehen konnte, war ein uralter Traktor, eine tote Kuh, ein blutüberströmter Polizist und ein alter Mann, der in den Pick-up kletterte.
Fieberhaft dachte Pascoe nach, was hier eigentlich geschehen war. Und gab es sofort wieder auf. Alles was jetzt zählte, war die Flucht aus diesem verdammten Polizeiwagen. Er musste hier raus. Er musste telefonieren. Er musste verhindern, dass sich der Lauf der Welt änderte.
Wie von Sinnen schlug er gegen die Fensterscheiben aus Sicherheitsglas und fingerte an den Schlössern herum. Nichts tat sich, nichts bewegte sich, nichts gab nach. Fünf Zentimeter verstärktes Blech und eine gehärtete Scheibe verhinderten seinen Ausbruch. Falls der Killer zurückkehren sollte, wäre alles umsonst gewesen. Pascoe würde hier sitzen und hilflos dabei zusehen, wie ihn die Kugel niederstreckte.
»Hilfe! Verdammt noch mal, helfen Sie mir!«, schrie er und legte sich auf den Rücken, um mit den Füßen gegen das Glas zu trommeln. Er rappelte sich wieder hoch und schlug wie ein Wahnsinniger gegen die Tür. Genauso gut hätte er versuchen können, einen fahrenden Zug mit der bloßen Hand zu stoppen. Es war sinnlos.
Nach einer Weile war der Alte plötzlich da. Neugierig beäugte er Pascoe aus einigen Metern Entfernung, so als könnte dieser jeden Moment durch das Sicherheitsglas springen und ihm die Kehle durchbeißen.