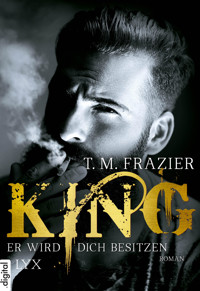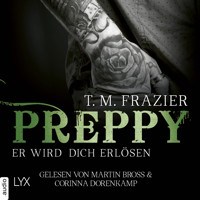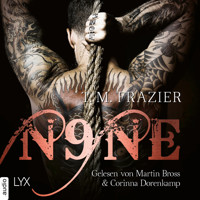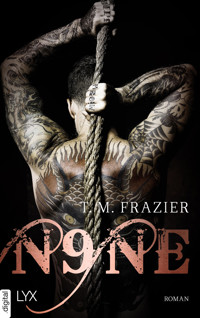
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: King-Reihe
- Sprache: Deutsch
Unsere Liebe war so gewaltig wie zwei Wirbelstürme auf dem Weg miteinander zu kollidieren
Weil die schrecklichsten Monster diejenigen sind, die in uns selbst existieren ...
Als Teenager geriet Kevin "Nine" Clearwater in einen tragischen Unfall, der sein Leben bis heute fest im Griff hat. Das Mädchen - Poe - geht ihm seither nicht mehr aus dem Kopf, und doch weiß er, dass er sie niemals wiedersehen wird. Weil sie seit Jahren als verschwunden gilt. Genauso wie ein Teil von Nine selbst. Doch als er einen Job für seinen Bruder Preppy ausführt, steht sie ihm plötzlich wieder gegenüber. Noch wunderschöner als er sie in Erinnerung hatte. Nine ist augenblicklich zerrissen zwischen dem Verlangen nach der Frau, die sein Herz besitzt, und der Loyalität zu seinem Bruder. Doch als Poe in Gefahr gerät, weiß Nine, dass er sie mit aller Macht beschützen muss, auch wenn es ihn die Familie kosten könnte, nach der er sich sein ganzes Leben lang gesehnt hat ...
"Ich wollte nicht, dass dieses Buch endet. Ich möchte für immer in dieser Welt bleiben!" LEAVE ME ALONE I’M READING
"NINE hat meine Liebe für die KING-Reihe auf ein völlig neues Level gehoben!" GOODREADS
Band 9 der Dark-Romance-Reihe KING von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Anmerkung der Autorin
Widmung
Motto
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Epilog
Bonusepilog
Die Autorin
Die Romane von T. M. Frazier bei LYX
Impressum
T. M. FRAZIER
Nine
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
Zu diesem Buch
Als Teenager geriet Kevin »Nine« Clearwater in einen tragischen Unfall, der sein Leben bis heute fest im Griff hat. Das Mädchen – Poe – geht ihm seither nicht mehr aus dem Kopf, und doch weiß er, dass er sie niemals wiedersehen wird. Weil sie seit Jahren als verschwunden gilt. Genauso wie ein Teil von Nine selbst. Doch als er einen Job für seinen Bruder Preppy ausführt, steht sie ihm plötzlich wieder gegenüber. Noch wunderschöner als er sie in Erinnerung hatte. Nine ist augenblicklich zerrissen zwischen dem Verlangen nach der Frau, die sein Herz besitzt, und der Loyalität zu seinem Bruder. Doch als Poe in Gefahr gerät, weiß Nine, dass er sie mit aller Macht beschützen muss, auch wenn es ihn die Familie kosten könnte, nach der er sich sein ganzes Leben lang gesehnt hat …
Anmerkung der Autorin
Meine lieben, großartigen LeserInnen,
Nine, die Geschichte von Kevin Clearwater, ist zwar ein Spin-off meiner King-Serie, aber man kann sie auch unabhängig vom Rest der Serie lesen. Falls ihr aber mehr über die Figuren, die in diesem Buch auftauchen, wissen und ein maximal genussvolles Leseerlebnis haben wollt, schlage ich vor, ihr beginnt mit King und arbeitet euch durch die folgenden Bücher der King-Serie, inklusive Preppys Trilogie, bevor ihr mit Nines Geschichte anfangt. Außerdem enthält dieses Buch Spoiler aus Preppys Büchern. Betrachtet euch als gewarnt ;)
Danke für all eure Liebe und Unterstützung. Ich kann und werde das gar nicht oft genug sagen. Es bedeutet die Welt für mich. Durch euch kann ich weiter Geschichten schreiben und in meinem Traumjob arbeiten, jeden einzelnen Tag.
Ich werde auf ewig dankbar sein für jede einzelne von euch und für alles, was ihr für mich tut.
Viel Spaß beim Lesen und immer viel Liebe.
Allerliebste Grüße
T. M. Frazier
Für meinen Mann
»Das furchterregendste Monster ist jenes, das in unseren Seelen lauert.«
Edgar Allan Poe
Prolog
Die Zeit ist niemandem untertan.
Sie ist schwer fassbar und doch so real wie Gier.
Sie drängt weiter, wenn sie stillstehen soll, und bleibt gerade dann stehen, wenn man voll aufs Gas drückt.
Egal wie voll der Geldbeutel ist, mehr Zeit kann sich keiner kaufen. Mit ihr gibt es weder Handel noch Diskussion.
Sinnlos, sie anzuhalten oder beschleunigen zu wollen.
Allmächtig. Gottgleich. Die Zeit braucht weder deine Liebe noch deine Hingabe. Sie fordert nur Respekt, ohne großes Trara oder fehlgeleiteten Glauben.
Zeit ist das Eine, das wir alle gemeinsam haben. Ihre Wurzeln reichen tief in alles hinein. Eine ständige Erinnerung, dass sie zwar unendlich ist … aber nicht für uns.
Unsere Atemzüge sind begrenzt.
Unsere Tage sind gezählt.
Rettet euch selbst … bevor die Zeit abgelaufen ist.
Tick für verdammtes Tack.
1
Kevin
Siebzehn Jahre alt
Der Serienkiller und Massenmörder Andrew Kehoe hat einmal gesagt: »Man wird nicht als Verbrecher geboren, sondern dazu gemacht.«
Schon möglich, dass das auf ihn zutrifft, aber nicht auf mich.
Ich wurde ins Chaos geboren, mit Diebstahl im Blut und kochender Wut im Herzen. Ohne große Umschweife in die Welt hinausgestoßen, von jedem, dessen Weg ich kreuzte, ungewollt, meine eigene Schlampe von Mutter eingeschlossen.
Ich musste um alles kämpfen, was ich je hatte. Hatte es mir mit Narben an den Fingerknöcheln und Hass in der Seele verdienen müssen.
Meine einzige Familie war die Straße. Und mein einziges längerfristige Zuhause der Jugendknast.
Vor einem Monat wurde ich aus Letzterem entlassen. Jetzt finde ich mich an einem der Orte wieder, die ich am meisten hasse, aber es ist der einzige, an den man mich von Rechts wegen hin freilassen kann, sagen die, die das Sagen haben.
Wieder mal eine Pflegefamilie.
Mein persönliches Fegefeuer, bis ich entweder achtzehn oder wieder eingebuchtet werde, je nachdem was zuerst kommt.
Ich öffne den Umschlag, den mir meine Sozialarbeiterin, Mrs Peterson, bei unserem letzten Treffen gegeben hat. Normalerweise enthalten diese Päckchen das übliche Zeug: Kopien von juristischen Formularen, Entlassungspapiere, und normalerweise liegen noch irgendwelche Pamphlete dabei, die Mrs Peterson gerne mit reinsteckt, darüber wie man seine Wut ohne Gewalt unter Kontrolle bekommt. Dieser spezielle literarische Schatz stammt aus den Achtzigerjahren und ist mein persönlicher Favorit. Vorne drauf ist eine Gruppe Kinder unterschiedlichster Herkunft abgebildet, die alle glücklich grinsen und so aussehen, als hätten sie irgendwelche Stimmungsaufheller nicht nur widerstandslos geschluckt, sondern zweimal drin gebadet.
Na, klar bewältigen diese Kids ihre Aggressionen nicht mit Gewalt. Die stehen schwer unter Medikamenten – in Vorbereitung auf einen Selbstmordtrip zum Mars mit ihrem Sektenführer.
Aber dieses Päckchen ist anders als die, die ich bisher bekommen habe. Keine Pamphlete. Keine Überweisungspapiere. Sondern ein Brief von meiner Sozialarbeiterin.
Lieber Kevin,
da du bald das Alter erreichst, in dem du aus der staatlichen Fürsorge fällst, und ich weiß, dass du keine Pläne hast, wohin es gehen soll, wenn du achtzehn bist, wollte ich dir helfen, wo ich nur kann. Ich habe ein wenig nachgeforscht. Und ich denke, ich habe deinen Bruder gefunden. Sein Name ist Samuel Clearwater. Seine letzte bekannte Adresse ist in Logan’s Beach.
Viel Glück, Kevin. Ich wünsche dir ehrlich alles Gute. Du bist ein wirklich kluger Junge, und ich hoffe, du nutzt diese Intelligenz, um deinen Platz in der Welt zu finden.
Mrs Peterson.
Meinen Platz in der Welt? Ziemlich sicher, dass der Slogan aus einem dieser berüchtigten Pamphlete stammt.
Mrs Peterson muss echt am Rad drehen, denn ich habe keinen Bruder.
Ich habe niemanden.
Ich stecke den Brief zurück in den Umschlag und hole ein Foto heraus, das sich als Polizeifoto von einem Typen entpuppt, der mir ganz schön ähnlich sieht, nur dass er helleres Haar hat und einen Haufen Tattoos, die aus dem Kragen seines Anzughemdes herausgucken. Mein Herz fängt zu rasen an. Ich setze mich auf und schaue mir das Foto genauer an. Er trägt eine Fliege und passende Hosenträger. Er hat den Kopf schief gelegt und macht einen Kussmund in die Kamera, während er ein Schild hochhält, auf dem steht: VERHAFTET IN LOGAN’S BEACH, SHERIFFBÜRO, und darunter ein Datum von vor zwei Jahren. Ich sehe genauer hin, und mir fällt auf, dass er das Schild nur mit den Mittelfingern hält.
Ich frage mich, ob das Büro des Sheriffs das je gemerkt hat. Und ich grinse in mich hinein.
Ein Bruder. Mein Bruder.
Der Gedanke ist verwirrend, nachdem ich ohne nennenswerte Familie oder sonst jemand aufgewachsen bin, mit dem ich reden konnte, abgesehen von mir selbst und meinem Freund Pike. Also, bis Pike und ich getrennt wurden und wir den Kontakt zueinander verloren, als er im Jugendknast am anderen Ende des Staates landete.
Meine Gedanken werden unterbrochen, als die Realität mich anzischt wie eine Schlange, auf die man fast drauftritt, dank meinem Pflegevater.
»Loretta, wo ist dieser Junge?«, überbrüllt Jameson wütend Willie Nelson, der lautstark jenseits meiner Zimmertür läuft. Die Melodie ist fröhlich, die Situation nicht. Eher so, als würde Don’t Worry, Be Happy in der Hölle aus den Lautsprechern plärren.
»Weiß ich doch nicht! Du willst was von ihm? Dann such ihn!«, lallt Loretta.
Ich war in ganz tollen Familien und in echt schlimmen. Auf einer Skala von eins bis zehn – mit zehn für am schlimmsten – stehen Loretta und Jameson dreistellig irgendwo über dem siebten Kreis der Hölle.
Meine Tür ist zu, aber unter dem Türspalt weht der unverkennbare Gestank von Crack und Körpergeruch durch. Vor ein paar Nächten bin ich aufgewacht, und Jameson saß unten an meinem Bett und hat mich beobachtet. Daraufhin habe ich sehr schnell den Zugang zum Dachboden gefunden, der in einem Wandschrank versteckt ist. Die meisten Nächte klettere ich jetzt hoch in den feuchten, stickigen und staubigen Dachboden und schlafe eingerollt in dem winzigen und niedrigen Stauraum.
Loretta und Jameson ist scheißegal, ob ich da bin oder nicht. Wenn ich also höre, dass sie nach mir suchen, dann geht es normalerweise darum, dass ich ihnen Drogen besorgen soll oder dass sie mich fragen, ob ich Geld habe.
Ich beschließe, mich rarzumachen, klettere hoch in den Dachboden und achte darauf, dass die Luke hinter mir auch zu ist.
Nur ein paar Sekunden später geht meine Zimmertür auf.
»Kacke. Hier drin ist er nicht«, höre ich Jameson mit seinem kräftigen Südstaatenakzent. »Ich dachte, ich hätte ihn vorhin reingehen sehen.«
»Ich habe dir einen Haufen Schotter bezahlt. Der Junge sollte besser noch auftauchen«, sagt eine fremde Stimme.
»Er wird da sein, Henry. Deal ist Deal«, faucht Jameson zurück. »Ich sage dir, was ich allen anderen sage. Sieh zu, dass du keine Spuren an ihm hinterlässt. Ich kann es nicht brauchen, wenn das Jugendamt mir die verdammten Schecks sperrt. Ich habe für den Jungen noch Geld für einen Monat gekriegt, das werde ich nicht platzen lassen.«
»Weiß ich, weiß ich. Ich kippe ihm das Zeug, das du mir gegeben hast, ins Bier, sodass er sich an rein gar nichts erinnert, aber wenn er in den nächsten paar Stunden nicht auftaucht, schuldest du mir die Kohle.«
»Schauen wir hinten nach. Manchmal ist er im Hof und raucht«, meint Jameson und schließt die Tür.
Meine Hände zittern, mein Blut kocht. Der Schweiß, der mir von der Stirn tropft, kommt nicht nur von der Hitze auf dem Dachboden. Ich schwitze vor reiner, ungetrübter Wut.
Ich sage dir, was ich allen anderen sage.
Der Scheißkerl hat mich verschachert … für Crack.
Da wird mir plötzlich alles klar. Nächte, nach denen ich aus einem scheinbar endlosen Schlaf aufgewacht bin, obwohl ich sonst total schlecht schlafe. Schmerzen an Stellen, bei denen ich mir dachte, dass ich wohl zu betrunken war, um mich zu erinnern, dass ich etwas Blödes gemacht habe oder gestürzt bin oder …
Es war überhaupt nichts in der Art.
Ich drehe den Kopf und kotze zwischen die Dachsparren, bis in mir nichts mehr übrig ist als ein überwältigendes Gefühl von Ekel und ein Blutdurst, wie ich ihn noch nie gespürt habe.
Ich warte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Musik aufhört und die gedämpften Stimmen still werden. Langsam und lautlos verlasse ich die Sicherheit meines Verstecks und schnappe mir meinen Rucksack. Ich stopfe den Umschlag mit dem Brief und dem Foto von Mrs Peterson hinein und dazu meinen uralten Laptop. Das ist alles. Mehr habe ich nicht. Irgendwie fühlt es sich blöd an, dass ich überhaupt einen Rucksack habe.
Ich schleiche in das andere Zimmer. Überall liegen leere Flaschen und Dosen herum. Zerknüllte Folie und überquellende Aschenbecher überall auf den Sofas, wo einige Leute weggetreten herumliegen. Loretta ist auch dabei. Ich weiß zwar, dass ich sie nicht aus ihrem Drogenkoma aufwecken könnte, selbst wenn ich ihnen ins Ohr brüllen würde, aber ich sehe Jameson nirgendwo, also schleiche ich nach draußen auf die klapprige Veranda. Erst als ich die unterste Stufe erreiche, traue ich mich auszuatmen.
»Da bist du ja, Junge«, sagt Jameson und stößt sich von seinem verrosteten Truck ab. Dabei fällt er fast über einen alten Reifen auf dem überwucherten Hof. Sein Bart ist nass und tropft vor Whiskey, und sein Hemd hat Schweißflecken am Hals und unter den Armen.
Mir gerinnt das Blut zu Eis. Ich balle die Fäuste und öffne sie wieder. Jeder Muskel in meinem Körper versteift sich. Ich habe immer mit meinen Fäusten gekämpft, aber zum ersten Mal im Leben wünschte ich, ich hätte eine Knarre.
Ein zweiter Kerl, der genauso betrunken oder high ist, bleibt stolpernd neben ihm stehen, ein böses Funkeln in den Augen. Er richtet sein Truckercap. »Wie geht’s denn heute Abend so, Junge? Ich habe auf dich gewartet.«
»Hi«, sage ich durch zusammengebissene Zähne. Du musst dieses Stück Scheiße Henry sein.
»Willst du ein Bier, Junge?«, fragt Jameson und hält mir ein volles Bier hin. Wahrscheinlich läuft der Wichser schon den ganzen Abend damit herum, um mich unter Drogen zu setzen, damit der andere Scheißkerl mich vergewaltigen kann.
Meine Wut wird immer stärker mit jedem Summen der elektrischen Moskitofalle auf der Veranda. Ich könnte weglaufen … oder mich rächen.
»Klar, ich nehme ein Bier«, sage ich, nehme es aus seinen Händen und tue so, als würde ich trinken.
Die zwei wechseln einen wissenden Blick, bei dem ich ihnen am liebsten die Flasche über die Köpfe donnern will. »Wartet mal kurz«, sage ich. »Ihr habt kein Bier. Ich kann ja nicht allein trinken. Bin gleich wieder da.« Ich stelle meinen Rucksack hin, damit sie wissen, dass ich auch vorhabe, wiederzukommen.
»Nett«, flüstert Henry Jameson zu. »Sehr nett.«
Jameson grunzt. »Habe ich dir ja gesagt.«
Mir dreht sich wieder der Magen um, als ich in die Garage gehe und zwei Bier aus dem Kühlschrank neben der Tür hole. Ich kann das präparierte Bier nirgendwo hinschütten, ohne dass es auffällt, also trinke ich die beiden frischen jeweils halb aus und fülle sie mit dem auf, was in meiner Flasche ist. Dann schnappe ich mir ein drittes, sauberes Bier und gehe wieder raus zu Henry und Jameson, die an die Motorhaube des Trucks gelehnt dastehen.
Ich gebe ihnen die präparierten Bierflaschen und verschaffe mir damit etwas Zeit.
»Mächtig nett von dir«, meint Henry und trinkt einen Schluck. Seine Augen unter der Mütze leuchten.
»Komm mal mit, Junge. Ich will dir in der Garage etwas zeigen«, sagt Jameson, und ich höre Henry kichern. Sie stellen ihr Bier auf die offene Ladeklappe.
Oh Shit. Und schon ist meine Zeit um.
Sie kommen auf mich zu, und mir bleibt keine Wahl als in die Garage zurückzuweichen. Ich komme körperlich nicht gegen sie an, auch wenn ich mir das noch so sehr wünsche. Sie sind zu zweit, und sie haben einen Vorteil durch ihre Größe und die Kraft durch das Crack. Ich bin nur ein schlaksiger Jugendlicher mit Aggressionsproblemen. Ich kann mich behaupten, aber ich wähle meine Kämpfe weise, und der hier wäre alles andere als das.
Aber einen Vorteil habe ich, denn ich habe etwas, das diesen Wichsern fehlt: Grips.
Ich gehe auf sie zu, sodass sie mich nicht weiter in die Garage zurückdrängen können. »Ich wollte dir auch etwas zeigen. Ich meine, ich werde ja bald volljährig, und dann bin ich nicht mehr hier. Es … es ist eine Art Abschiedsgeschenk. Da drin. Ich hole es und bringe es raus.«
Jameson runzelt die sonnenverbrannte Stirn. »Junge, seit du hergekommen bist, warst du nichts als ein verdammter Dorn im Auge, und jetzt auf einmal soll ich glauben, dass du ein Geschenk für mich hast?« Er kichert.
»Ist Familie denn nicht dazu da, um sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen?«, frage ich und versuche damit, Wörter über die Lippen zu bringen, die buchstäblich wie Galle im Mund schmecken. »Ist auch nichts Sentimentales, sondern Zeug, von dem ich weiß, dass ihr drauf steht. Von Pike.«
Pike ist nicht nur ein Freund. Er ist ein Drogendealer der Extraklasse, und Jameson weiß das. Kaum erwähne ich seinen Namen, fängt Jameson praktisch vor Gier an zu sabbern, er will sofort probieren, was auch immer ich für ihn haben könnte. Er wedelt mit der Hand zum Haus. »Tja, dann geh es unbedingt mal holen.«
Henry sieht verärgert aus und verdreht die Augen, aber ich habe Jameson am Haken und mir damit die Zeit verschafft, die ich brauche.
Ich gehe zurück in die dunkle Garage und öffne die Tür zum Haus. Als ich sicher bin, dass sie gerade nicht hinsehen, mache ich die Tür wieder zu und krieche auf allen vieren zur Wand gegenüber. Dort schnappe ich mir einen öligen Lappen und stopfe ihn in den Tank von Lorettas holzverkleideten Kombi. Dann mache ich, dass ich zurück zur Tür komme, tue so, als käme ich wieder raus, und schließe unauffällig von innen ab.
»Also, wo ist jetzt dieses Geschenk?«, fragt Jameson und späht in die Dunkelheit.
»Kommt rein. Es liegt vorn in Lorettas Wagen, auf dem Armaturenbrett. Ich wollte es nicht nach draußen bringen, weil doch die Bullen alle paar Stunden hier durch die Straße kommen, seit diese Meth-Typen um die Ecke aufgeflogen sind. Ich dachte mir, wir drei könnten es ja hier drin machen.«
»Schlauer Junge«, brummt Henry, und die beiden kommen in die Garage.
Du hast ja keine Ahnung.
Jameson setzt sich vorn auf den Fahrersitz, Henry auf die Beifahrerseite.
Ich tue so, als würde ich hinten einsteigen, und öffne die Tür. Doch in Wirklichkeit zünde ich mit meinem Feuerzeug den Lappen im Tank an.
»Hier ist es nicht«, sagt Jameson und sucht gereizt das Armaturenbrett mit den Augen ab.
»Was soll der Scheiß, Junge?«, bellt Henry und dreht sich zu mir um.
Ich stehe vor dem brennenden Lappen, sodass er ihn nicht sehen kann.
»Tut mir leid, ich meinte, es ist im Kofferraum. Nur noch einen Moment.« Als er sich wieder zu Jameson umdreht, laufe ich zum Kofferraum und mache ihn auf. Mit dem offenen Kofferraumdeckel können sie nicht sehen, dass ich hinaus auf die Einfahrt gehe und hochspringe, um das Seil zu erwischen, das an der Garagentür hängt, aber das ist sehr hoch, und ich greife daneben.
»Warte mal, ich habe dich den verdammten Kofferraum vorhin gar nicht aufmachen sehen. Was zum Teufel hast du vor?«, krächzt Jameson, aber er kann mich nicht sehen. Er macht die Autotür auf.
Oh Shit. Ich springe noch mal nach dem Seil, und dieses Mal erwische ich es. Kaum habe ich es gepackt, ziehe ich so fest ich kann nach unten. Das Tor fällt mit einem Knall zu, gerade als Jameson und Henry aus dem Kombi steigen. Zum Glück ist es eines dieser alten Garagentore mit einem Schlüssel im Griff, und noch mehr Glück, dass Jameson immer so dämlich ist und den Schlüssel stecken lässt. Ich drehe den Griff, um das Garagentor zu schließen, und dann den Schlüssel, damit es zu bleibt.
»Mach das verdammte Tor auf!«, brüllt Jameson von der anderen Seite.
»Die andere Tür ist auch zu«, ruft Henry.
»Was zum Teufel hast du vor?«
Ich kann nicht widerstehen, zu antworten: »Das ist mein Geschenk. Eine Reise.«
»Wovon zum Teufel redest du da? Reise? Wir sind eingesperrt. Lass uns sofort hier raus!«
Sein panisches Geschrei lässt mich nur kichern.
»Genießt euer Ticket in die Hölle, ihr Hurensöhne.«
»Oh Scheiße, der Tank!«, ruft da einer von ihnen. Das Entsetzen in ihren Stimmen weckt kein Mitleid in mir. Eher will ich mir mit den Fäusten auf die Brust trommeln wie ein triumphierender Gorilla – aber dafür ist keine Zeit. Ich drehe mich um, hebe meinen Rucksack auf und renne weg vom Haus, so schnell ich kann. Vage registriere ich noch ein paar panische »Was soll das?«-Rufe, bevor auch schon der ohrenbetäubende Knall der Explosion und das Brüllen der Flammen die Nachtluft erfüllt.
Endlich verstummen die Stimmen.
Ich werfe einen Blick über die Schulter und schaue zu, wie das ganze Haus Feuer fängt und das Dach innerhalb von Sekunden einstürzt.
Der Geruch von Öl, brennendem Holz und schmelzendem Plastik ist so stark, dass er mir beinahe die Nasenhärchen verätzt.
Es riecht nach … Rache.
Freiheit.
Ich atme tief ein.
So gut hat dieses verdammte Haus noch nie gerochen.
2
Kevin
Mein Bruder ist tot.
Das erfuhr ich fünf Minuten nach meiner Ankunft in Logan’s Beach.
»Was brauchst du, Junge? Bier? Zigaretten?«, fragt mich die Tankstellentussi mit einem Akzent, den ich nicht so ganz einordnen kann.
»Nein, hätte ich schon gern, aber ich habe kein Geld«, antworte ich. Und mein Magen knurrt dabei, als wollte er es noch bestätigen.
Ich habe in den ganzen drei Tagen, die ich brauchte, um per Anhalter nach Logan’s Beach zu kommen, nichts gegessen.
»Was willst du dann?«, fragt sie und schaut auf das Klemmbrett auf ihrer Theke.
»Ich möchte nur wissen, ob Sie den hier kennen«, sage ich und drücke sein Polizeifoto an die kugelsichere Scheibe. »Samuel Clearwater ist sein Name.«
Sie schaut auf das Foto, und in ihren Augen blitzt Erkennen auf. Sie lächelt und zeigt auf meinen Bruder. »Oh ja, ja. Den kennt jeder. Samuel Clearwater, aber er hört auf den Namen Preppy.«
Aufgeregt dränge ich weiter. »Mensch, großartig. Äh … also wissen Sie, wo er wohnt oder arbeitet? Ich versuche, ihn zu finden.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Tut mir leid, Junge. Er ist weg.«
»Weg wohin?«
Sie ruft laut etwas zu jemandem nach hinten, in einer Sprache, die ich nicht verstehe, und dreht sich dann wieder zu mir um. »Fast ein Jahr her, dass er weg ist.«
Meine Stimme wird lauter vor Frust. »Was ist ein Jahr her? Weg wohin? Wo ist er hin?«
Sie lässt die Schultern hängen, und mein leerer Magen füllt sich mit Kummer.
»Fast ein Jahr. So lange ist Preppy schon tot.«
Keine Ahnung, was war, nachdem ich die Tankstelle verlassen habe, aber ich weiß, dass das eine Weile her ist. Zwei Tage? Zwei Wochen?
Ich bin nicht sicher, denn ich bin eingehüllt in einen dichten Nebel, der sich nicht lichten will. Nicht um mich herum, sondern in mir.
Mein Kopf pocht, aber ich kann mich nicht erinnern wieso. Ich atme zischend aus bei dem stechenden Schmerz, als ich prüfend mein rechtes Auge berühre und feststelle, dass es fast zugeschwollen ist.
»Was ist los?«, brumme ich, und dann fällt mir langsam, wenn auch immer noch vage, ein, dass ich vorhin in der Fernfahrerkneipe Prügel bezogen habe. Aber wo bin ich jetzt?
In der Ferne höre ich eine Hupe. Sie wird immer lauter, bis sie meine traumähnliche Trance durchbricht. Ich drehe mich zu dem Geräusch um und bedecke stöhnend die Augen, als mich die blendenden Scheinwerfer des Sedans nur ein paar Schritte von mir weg überfallen.
»Sieh zu, dass du von der verdammten Straße kommst, Junge!«, ruft eine wütende Stimme.
Die Straße? Ich schaue mich um. Ich stehe mitten auf einer Straße. Nein, es ist nicht nur eine Straße. Ich stehe auf einer hohen Brücke. Wie in aller Welt bin ich hier gelandet?
Der Asphalt zerkratzt meine nackten Füße, als ich zur Seite humpele, damit das Auto vorbeifahren kann, und mir fällt ein, dass ich meine Schuhe verloren habe, als die Trucker mich über den Parkplatz gezerrt haben.
Der Fahrer des Autos rauscht an mir vorbei und zeigt mir dabei den Mittelfinger.
Ich stütze mich auf das Geländer, und da stößt etwas in meiner hinteren Tasche an das Metall.
Ich greife herum, stöhne auf, als meine Muskeln protestieren, und dann ziehe ich eine halb leere Wodkaflasche heraus, die aus meiner Tasche ragt.
»Es gibt einen Gott«, brumme ich und trinke zwei große Schlucke. Dann blicke ich auf in den Himmel. »Wo warst du, als ich noch Schuhe hatte?«
Der Nebel übernimmt wieder die Kontrolle. Als ich zu mir komme, finde ich mich auf einem schmalen Sims sitzend wieder, während auf der anderen Seite des Geländers Autos vorbeirauschen. Das Einzige, was mich noch vom Wasser unten trennt, ist die Nachtluft. Ich schaue auf das seichte Wasser unter mir. Die Spitzen scharfkantiger Felsen ragen zwischen den sanft dahinrollenden Wellen heraus.
»Auch ein Weg, um einen Ort zum Ruhen zu finden«, sage ich mir. Ich hebe die Flasche wieder an den Mund und trinke einen tiefen Schluck.
Die Nacht ist feucht und mehr als heiß, aber hier oben auf der Brücke ist die Luft kühler, und der Wind trocknet den Schweiß so schnell, wie er sich auf meiner Haut bildet.
Ich werde nicht springen. Glaube ich zumindest. Deshalb bin ich nicht hier oben. Aber ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Noch nicht. Ich will nur hier sitzen. Ich will nicht sterben, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre ich für den Rest der Welt tot. Trotzdem halte ich die Augen einen Herzschlag länger geschlossen, so lange, dass ich weder die Scheinwerfer des geparkten Autos sehe noch die Person, die aussteigt – bis ich ein Kratzen am Geländer über meinem Kopf höre.
Ich schaue hin, und da ist ein Mädchen. Sie ist etwa so alt wie ich und hat kurzes platinblondes Haar, auf einer Seite kinnlang und auf der anderen ein wenig kürzer. Sie klettert über das Geländer. Die Augen im herzförmigen Gesicht sind riesig, aber ich kann die Farbe nicht erkennen, weil ihre Pupillen ganz groß sind, als sie auf das Wasser unten blickt. Sie atmet schwer. Ihre teuer aussehenden abgeschnittenen Shorts und das hellblaue schulterfreie Top werden schnell schmutzig mit Öl und Dreck von der Brücke. Langsam setzt sie sich hin, die Arme über dem Kopf, sodass sich ihr Brustkorb rausdrückt, als sie sich an die Stahlseile klammert, die an der Brücke entlang verlaufen. Sie schließt die Augen und atmet tief durch die Nase ein.
»Willkommen. Willst du was zu trinken?«, frage ich.
Sie dreht ruckartig den Kopf zu mir, einen bestürzten Ausdruck im Gesicht. »Was machst du hier oben? Wer bist du?«
Ich hebe die Flasche. »Ach, weißt du, ich trinke nur was. Genieße den Wind.« Ich breite die Arme aus. »Das Übliche, was man auf einer Brücke eben so macht.«
Ich kann ihr Gesicht nicht sehen, aber ich kann förmlich hören, wie sie die Augen verdreht. »Klar, ich klettere immer auf die höchste Brücke in der Stadt und hänge mich übers Geländer, nur um den Wind zu fühlen und einen Schlummertrunk zu mir zu nehmen.« Ihre Stimme trieft vor Sarkasmus.
»Hast du einen besseren Grund, um hier zu sein?«, frage ich und trinke noch einen Schluck.
»Vielleicht nicht gerade besser«, meint sie, und ihre Stimme verliert an Schärfe. »Ich wollte nur allein sein.«
»Dito.«
Nach ein paar Sekunden Schweigen, nur mit dem Geräusch gelegentlich vorbeifahrender Autos hinter uns und den sanften Wellen, die unter uns in die Mangroven plätschern, sagt sie wieder etwas. »Was ist mit deinem Gesicht passiert?«
Ich zucke mit den Schultern. »Bin hingefallen.«
»Hingefallen?«, fragt sie. Offensichtlich kauft sie mir das nicht ab. »Lass mich raten: eine Treppe hinunter?«
»Nein, auf die Fäuste von ein paar wütenden Truckern«, krächze ich und erinnere mich mit jedem Moment deutlicher an die Ereignisse des Abends. Der Trucker, den ich beklauen wollte. Die Prügel, die ich dafür bezogen habe.
Das Haar weht ihr ums Gesicht, als sie nach unten schaut, unter ihre baumelnden Füße. Fast als würde sie die Entfernung abschätzen.
»Woher kommst du?«, frage ich.
»Von da.« Sie zeigt auf die andere Seite der Brücke. »Und du?«
»Von hier. Von da. Von überall. Meistens einfach von der Straße.«
Sie antwortet nicht. Sie ist zu konzentriert auf ihre Füße, oder genauer gesagt auf das, was darunter liegt.
»Hast du vor zu springen?«, frage ich beiläufig.
»Ich bin nicht sicher«, flüstert sie. »Ich denke nicht, aber gleichzeitig bin ich einfach … nicht sicher.« Sie schaut immer noch nach unten, als sie fortfährt: »Die Grenzen, die das Leben vom Tod trennen, sind bestenfalls schattenhaft und vage.«
Ich schnaube. »Ach, der gute alte EAP«, sage ich und antworte dann selbst mit einem Zitat. »Ich war nie verrückt, außer bei Gelegenheiten, bei denen mein Herz berührt wurde.«
»Sehr gut, du kennst Edgar Allan Poe?«, fragt sie und blickt endlich auf. Selbst in der Dunkelheit kann ich die Überraschung in ihrem Gesicht fast sehen. Ihr Tonfall ist … niedlich? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je irgendwas oder irgendwen für niedlich gehalten hätte.
»Welche Gründe könntest du wohl haben, hier oben zu sein?«, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf. »Du zuerst.«
Ich will tief Luft holen, aber ich kann nicht. Noch nicht. Es ist, als wären mein Gehirn und meine Lunge der Ansicht, dass ich für die Anstrengung noch nicht bereit bin. »Ich will nur zu Atem kommen und Dinge herausfinden.«
»Okay, aber wieso?«, drängt sie.
»Das willst du nicht wissen, aber glaub mir, meine Gründe würden dir echt Gänsehaut machen. Wieso bist du hier oben? Ist dein Treuhandfonds nicht so groß, wie du dachtest? Oh, nein, lass mich raten, du hast einen Mercedes bekommen, und nicht den Tesla, den du dir zum Geburtstag gewünscht hast.«
»Wenn es doch nur so etwas wäre. Sagen wir nur, wenn ich jetzt springen würde, gibt es Gründe dafür, und niemand wäre überrascht darüber«, sagt sie. Dann holt sie tief Luft. »Ist wirklich schön hier oben, oder?«
»Ja, irgendwie schon«, stimme ich zu.
»Kannst du mir sagen, wieso? Macht mir nichts aus, wenn ich Gänsehaut bekomme«, meint sie, und ihre Stimme klingt flehend dabei, so als wäre sie nicht nur neugierig, sondern würde es aus irgendeinem Grund unbedingt erfahren müssen. »Hat es etwas damit zu tun, dass du aussiehst, als hättest du eine Erdnussallergie, hast dir aber trotzdem übers ganze Gesicht Erdnussbutter geschmiert?«
Da sie im Schatten sitzt, war mir gar nicht klar gewesen, dass sie mich so gut sehen kann. »Welche Rolle spielt das?«, frage ich.
»Ich weiß nicht«, antwortet sie aufrichtig. »Ich bin nicht sicher, aber es spielt eine.«
»Na schön. Es geht um Drogen«, lüge ich. Ich schütte doch nicht einer Fremden mein Herz aus, auch wenn diese hier noch so schön sein mag.
»Das ist eine Lüge. Versuch es noch mal.« Sie hebt einen nackten Fuß vom Sims und lässt ihn in der Luft hin und her baumeln, als würde sie den Wind auf ihrer Haut testen. Inzwischen hält sie sich nur noch an einem einzigen Stahlseil fest.
Ich knurre, als ich ihren neuen Wagemut sehe, aber was kümmert es mich, ob sie springt? Nur, es kümmert mich eben doch, auch wenn ich das gar nicht will.
Ich erzähle ihr eine schwer gekürzte Version meiner Geschichte. »Also gut, die Wahrheit ist, dass ich auf der Straße lebe. Ich war mein Leben lang im Pflegesystem und habe vor Kurzem herausgefunden, dass ich einen Bruder habe. Ich bin weggelaufen und habe mich auf die Suche nach ihm gemacht. Habe erfahren, dass er tot ist. Weil ich Geld brauchte, um irgendwo unterzukommen, habe ich heute Abend einen Trucker beklaut, aber der hat mit ein paar von seinen größeren und übleren Kumpels zurückgeschlagen, und die haben mich windelweich geprügelt.« Unter anderem.
Ich spüre brennende Reue und freudige Erleichterung, alles auf einmal.
»Ergibt Sinn«, sagt sie ohne eine Spur von Mitleid in der Stimme.
»Du bist dran«, sage ich. »Du sagtest, dass niemand überrascht wäre, wenn du dich umbringst. Wieso?« Was ich meine, ist: Welche Probleme könnte ein schönes und reiches Mädchen wie du haben, jetzt hier oben zu sein?
Sie seufzt tief. »Meine Eltern … sie sind gestorben. Heute. Sie sind heute gestorben.« Sie spricht die Worte aus, als würde sie gleichzeitig Schmerz und Unglaube empfinden.
Mir wird das Herz schwer.
Ich trinke noch einen Schluck und versuche ihr logisch zu antworten, so als würde mein Herz nicht um sie weinen. »Aber du musst etwa so alt sein wie ich, richtig? Siebzehn? Achtzehn? Du kannst die Dinge allein regeln.«
»Achtzehn«, sagt sie. »Ich bin achtzehn.«
Ein paar Sekunden lang herrscht Schweigen zwischen uns.
»Danke, dass du dich nicht entschuldigst. Alle, die wissen, was passiert ist, rufen immer wieder an und entschuldigen sich. Ich hasse es.«
Ich lache. »Wieso sollte ich mich denn entschuldigen? Ist ja nicht so, als hätte ich sie umgebracht.«
Zu meiner Überraschung lacht sie mit mir, und ihr Lachen ist das Beste, was ich heute Abend gehört habe, wenn nicht sogar überhaupt jemals.
»Weißt du, das ist das Tollste, das mir bisher jemand gesagt hat.« Der Schatten bewegt sich, und ich kann mehr von ihrem Gesicht erkennen. Ihre Augen blicken wild, und ihre Pupillen sind riesig, so als wäre sie high, aber ich weiß, wie high aussieht, und das hier ist etwas ganz anders, mehr so, als wäre sie total verrückt. Und als ich ihre blasse, makellose Haut und die dunkelrosa Lippen betrachte, beschließe ich, dass verrückt nicht zu ihr passt, denn sie ist mehr als das. Sie ist atemberaubend schön, aber das auf eine wirklich andere Art und Weise.
»Sag mir, Mädchen ohne Eltern, was wolltest du mit deinem Leben anfangen, bevor du beschlossen hast, hier raufzuklettern und über ein Ende dieses Lebens nachzudenken?«, frage ich.
Sie mustert mich mit Verwirrung, und ein kleines Lächeln spielt um ihre Lippen. »Ich bin noch nie jemandem wie dir begegnet. Du bist direkt. Es ist … erfrischend? Falls das das richtige Wort ist.«
»Ich weiß nicht, ob es das falsche Wort wäre, aber das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass mir jemand sagt, ich wäre erfrischend.«
Sie kaut auf ihrer Unterlippe und denkt nach. »Ich wollte immer Betreuerin werden. Du weißt schon, jemand, der für Kinder vor Gericht geht, die entweder nicht für sich selbst sprechen können oder zu viel Angst haben. Ich denke mir, wenn ich nur einem Kind das Gefühl geben könnte, nicht allein auf der Welt zu sein … das ist dumm, hm?«
»Nein«, sage ich, als ich endlich meine Stimme wiederfinde. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Ich brauchte so jemanden, und es gibt so viele Kinder da draußen, die jetzt so jemanden brauchen. »Ich denke, das könnte gerade das Beste sein, das ich je gehört habe.«
Sie wird rot. »Da gibt es noch etwas, das ich immer tun wollte, aber noch nie getan habe. Zu viel Angst, schätze ich.«
»Was?«, frage ich. Ich hänge an jedem ihrer Worte, fasziniert, was sie wohl als Nächstes sagt.
Aber auf das, was dann passiert, bin ich absolut nicht vorbereitet.
Sie rutscht näher zu mir und drückt ihren Oberschenkel an meine zerrissene Jeans. Sie nimmt mir die Flasche aus den Händen und trinkt, hustet und gibt mir die Flasche wieder. Dann wischt sie sich mit dem Handrücken über den Mund und räuspert sich.
Ich trinke einen Schluck, ohne Brennen und ohne Husten. Ich denke mir, dass dieser Wodka wohl kaputt ist.
»Ich … ich wollte immer …« Sie stößt frustriert die Luft aus und strubbelt sich durch die Haare. »Okay, ich meine, ich habe … ach Mann! Ich sage es jetzt einfach. Ich bin noch nie geküsst worden!«, platzt sie heraus.
Wie ist das denn nur möglich? Dann küsse ich dich.
»Wirklich?«, fragt sie, und ihr Gesicht leuchtet auf.
Ihre Antwort überrascht mich, denn mir war nicht bewusst gewesen, dass ich den Gedanken laut ausgesprochen habe.
»Ja, ich meine, klar«, sage ich schulterzuckend und versuche, dabei cool und lässig zu wirken.
Cool und lässig mit geschwollenem Gesicht und ohne Schuhe.
»Nur, wenn du nicht springst«, füge ich hinzu, denn ganz plötzlich muss ich sicher sein, dass dieses Mädchen weiterlebt.
Sie beißt sich auf die Lippe und nickt. »Dasselbe gilt für dich.«
»Abgemacht.«
Wir geben uns die Hand darauf. Ich mag das Gefühl ihrer kleinen Hand in meiner. Die Energie, die zwischen uns knistert, jagt mir den Arm hoch, und sie schnappt nach Luft, als sie dasselbe fühlt. Ihre Mundwinkel gehen hoch zu einem Lächeln, und ich schwöre zu Gott, zum ersten Mal im Leben setzt mein Herz doch tatsächlich einen Schlag lang aus.
»Also, wie machen wir das?«, fragt sie schüchtern. »Bei zehn?«
Sie ist niedlich. Achtzehn und benimmt sich wie ein Kind auf dem Schulhof beim Flaschendrehen. Es lässt mein Herz immer schneller schlagen.
»Zehn?«, frage ich. »Wieso zehn?«
Sie dreht den Kopf, sodass ihre Wange auf der Schulter liegt, und blickt von der Seite zu mir hoch. »Könnte sein, dass ich bei drei noch nicht so weit bin«, erklärt sie.
»Dann auf zehn«, meine ich und spüre meinen Herzschlag in der Brust pulsieren. Eine willkommene Abwechslung von dem Hämmern hinter meinem geschwollenen Auge.
Sie lehnt sich zu mir, und ich tue dasselbe. Wir sind nur noch Zentimeter voneinander entfernt. Ich kann ihr Parfum riechen, irgendwas Blumiges, gemischt mit frisch gewaschener Wäsche. Sie zählt langsam. Quälend langsam. »Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht …«
»Neun«, unterbreche ich sie und drücke meine Lippen auf ihre. Vorsichtig lege ich die freie Hand um ihren Hinterkopf und ziehe sie an mich, während ich uns beide so eng wie möglich an die Brücke gedrückt halte. Ihre Pfirsichlippen sind weicher, als ich mir vorgestellt habe. Ihre Zunge schmeckt nach Minze und süßem Tee. Ich bin ganz gefangen in Gedanken an sie. An ihre Lippen, ihre Haut. Ihre Wärme.
Wann immer ich ein Mädchen geküsst habe, hat mir das unerwünschte Erinnerungen an die Vergangenheit beschert. Aber nicht jetzt. Nicht bei ihr. Ich denke nur an diesen Augenblick und diesen Kuss. An ihren Duft. Ihren Geschmack. Ihre weiche Zunge.
Wie sie wohl nackt unter mir aussehen würde.
Falls ich je einen Grund zum Leben gebraucht habe, dann habe ich ihn gefunden, denn noch nie zuvor habe ich mich so verdammt lebendig gefühlt.
Sie löst sich von mir, und ich spüre sofort den Verlust ihrer Lippen auf meinen. Ich öffne die Augen und sehe sie schüchtern lächeln, und ein kleines Grübchen spielt auf ihrer Wange. »Ich glaube, du könntest genau das sein, was ich jetzt brauche«, flüstert sie, als könnte sie nicht glauben, was gerade passiert ist. »Glaubst du an Schicksal?«
»Habe ich noch nie.« Ich registriere, dass ihre Schultern leicht herabsinken vor Enttäuschung, bevor ich hinzufüge: »Aber jetzt schon.«
»Was hältst du davon, wenn wir von diesem Sims verschwinden und weiter ähmmm … reden und so, auf der anderen Seite?«
Gebongt. Reden und so. Mit ihr will ich das ganze Reden und so machen.
Ich nicke.
Sie drückt die Fingerspitzen auf ihre geschwollenen Lippen, als würde sie schon jetzt an die Erinnerung an einen Kuss denken, der erst vor Sekunden endete. Als sie mit der Zunge über ihre Unterlippe fährt, steht mein Schwanz stramm wie ein guter kleiner Soldat.
»Kannst du zuerst gehen und mir dann rüberhelfen?«, schlägt sie vor.
Ich klettere über das Geländer und ignoriere den Schmerz dabei, weil ich immer noch ganz high bin von der Lust und dem Versprechen, ihre Lippen wieder auf meinen zu spüren.
Sie steht auf, hält sich weiter an den Stahlseilen fest und sieht mich an. »Ich habe zehn gesagt. Du hast aber nur bis neun gewartet«, zieht sie mich auf, und ihre Füße scharren auf dem Sims.
»Du hast gesagt, dass du bei drei noch nicht so weit bist, aber zehn war viel zu lang«, antworte ich. Ich beobachte ihre Füße und sterbe bei jeder Bewegung von ihr tausend Tode.
Sie kichert, und das jagt mir direkt in den Leib. In mein Herz. In den Schwanz. Wer ist dieses Mädchen?
Ich kann es nicht erwarten, es herauszufinden.
»Nimm meine Hand«, sage ich, als sie nahe genug ist, um mich zu erreichen.
Sie hebt den Arm, aber in dem Moment öffnet sich der Verschluss ihrer Halskette. Das Ding fällt und verfängt sich in einem anderen Stahlseil nur Zentimeter unter ihren Füßen. »Meine Kette!«
»Mach dir keine Sorgen um deine Kette. Ich hole sie dir, wenn du auf dieser Seite bist. Nur nimm meine Hand.« Ich strecke den Arm aus, bis ich fast glaube, dass sie aus dem Gelenk springen wird.
Eine Sekunde lang denke ich, dass sie ihre Hand in meine legen wird, aber stattdessen bückt sie sich, um ihre Halskette wiederzuholen. Daran hängt ein Anhänger. Ein schwarzer Vogel mit ausgebreiteten Flügeln und roten Steinen als Augen, die im Vollmond glänzen. »Ich muss sie holen. Sie ist von meiner Mutter.«
Ich kenne nicht mal ihren Namen, aber in meinem Frust gebe ich ihr einen Spitznamen. »Poe, vergiss die Halskette. Nimm einfach meine Hand!«
»Poe.« Sie lächelt. »Das gefällt mir.« Sie spreizt die Finger, geht in die Knie und streckt den Arm aus, so weit es geht. »Weißt du, meine Mutter hat immer gesagt …« Sie verstummt, abgelenkt von ihren eigenen Gedanken und der wahrscheinlich tausendsten Erinnerung heute, dass ihre Mutter tot ist.
Alles wird langsamer. Zeit. Die Luft. Das Geräusch vorbeifahrender Autos. Mein eigener Herzschlag.
Ihr Fuß, der abrutscht. Ihre Arme, die wild in der Luft rudern und irgendwas zu fassen bekommen wollen, aber da ist nichts, nur Luft.
Ihr anderer Fuß, der vom Geländer rutscht. Das Entsetzen, das in ihr Gesicht tritt, als ihr klar wird, dass es von hier kein Zurück gibt.
»Neeeein!«, schreie ich, aber es ist zu spät.
Sie fällt schon.
Und ich kann nichts tun.
Ein leises Platschen unter mir.
Es ist vorbei.
Ich weiß nicht, wie lange ich dastehe und hinaus in die Dunkelheit starre, bis ich den Tumult hinter mir höre.
Ich drehe mich um und sehe mehrere geparkte Autos und Leute davor, die entsetzt aussehen. »Ich habe sie springen sehen«, sagt eine Frau.
»Polizei und Rettungswagen sind unterwegs«, sagt eine andere Stimme.
»Sie ist nicht gesprungen. Er hat sie geschubst. Ich habe es gesehen!«, ruft eine rauere Stimme. Ein Dutzend finstere Blicke und ausgestreckte Finger richten sich auf mich.
Die denken, ich hätte sie gestoßen?
Blaue und rote Blinklichter und Sirenengeheul durchdringen das Geschrei des Mobs.
Ein Polizist springt aus seinem Wagen und kommt direkt auf mich zu. Ich sitze in der Falle und bin verwundet.
Aus dem Augenwinkel sehe ich die glänzenden Augen des Vogelanhängers.
Ich klettere wieder auf die andere Seite des Geländers, hole die Kette und stecke sie tief in meine Tasche. Der Polizist blendet mich von oben mit seiner Taschenlampe. »Komm hier rüber, mein Sohn. Du willst das nicht tun.«
»Sie haben recht. Sie haben mich gerettet. Gut gemacht«, sage ich und applaudiere spöttisch. Dann klettere ich wieder über das Geländer zurück und werde sofort zu Boden geworfen und mit Handschellen gefesselt.
»Wieso nehmen Sie mich fest?«
»Die Leute sagen, sie hätten gesehen, wie du sie geschubst hast.«
»Ich habe sie nicht geschubst. Sie ist gefallen. Checken Sie die verdammten Kameras«, sage ich und schaue hinauf zu dem blinkenden roten Licht über der Brücke, in der inständigen Hoffnung, dass das Ding aufgezeichnet hat, was wirklich passiert ist.
»Machen wir. Bis dahin kommst du mit uns«, sagt er.
Ich winde mich aus seinem Griff, als er mich auf die Beine zieht und zum Auto drängt. »Wieso machen Sie sich Gedanken um mich? Sie sollten jemanden schicken, der nach ihr sucht. Nachsehen, ob sie noch lebt.«
Bitte sei am Leben. Bitte sei am Leben.
»Ich versichere dir, dass die Bergungseinheit schon unten ist, Junge.«
»Bergung? Was zum Teufel heißt Bergung?«, frage ich.
Er stößt mich ins Auto, steigt ein und steuert zwischen den geparkten Autos durch, bevor er antwortet. »Das hier ist keine Such- und Rettungsmission, Junge. Hier geht es um Bergung. Jedes Jahr springen Dutzende Leute von dieser Brücke, und das seit dem Tag, an dem sie fertiggebaut war, und ein paar sogar schon vorher. Willst du wissen, wie viele diesen Entschluss bereuen?« Er wartet keine Antwort ab. »Keine Ahnung. Wir können sie nicht fragen.« Sein Blick begegnet meinem im Rückspiegel. »Sie sind alle tot.«
»Ich habe sie nicht geschubst«, sage ich über den Schmerz meiner Hoffnung hinweg, die gerade zermalmt wird, als würde mir eine Müllpresse aufs Herz drücken.
»Was ist dann passiert?«
Sosehr ich mir auch eingeredet habe, dass ich nicht dort oben war, um mich umzubringen – die Wahrheit, die ich ignoriert habe, seit ich auf die Brücke gestiegen bin, trifft mich, und das hart.
Ich wollte springen.
Ich schaue hinauf zur Brücke, die jetzt in der Ferne liegt, eine Million Meilen weit weg.
»Sie … sie hat mir das Leben gerettet«, sage ich.
»Dann mach das Beste daraus, Junge«, antwortet der Bulle. »Wenn du aus dem Knast raus bist.«
Mach das Beste draus.
Ich habe eine zweite Chance, und sie nicht. Und das nur, weil sie etwas in mir geweckt hat, das entweder schon tot war oder in tiefem Schlaf lag.
Einen Willen zum Leben.
Ich schwöre mir: Ich werde mein Leben nicht mehr nur so dahinleben.
Ich werde für uns beide leben.
Oder bei dem verdammten Versuch draufgehen.
3
Kevin
Ein Jahr später …
Ich könnte den Rest meines Lebens leben, ohne mich daran zu erinnern, was mit mir passiert ist, während ich bewusstlos war und vergewaltigt oder missbraucht wurde. Aber das Beschissene am menschlichen Verstand ist, dass er fast nie das tut, was man will. Tatsächlich ist es so: Wenn man ihn bewusst darum bittet, irgendetwas zu unterdrücken, dann ist es so seine Art, »Leck mich« zu sagen und einem willkürlich Erinnerungsblitze von Dingen zu zeigen, die man nie sehen wollte. Für gewöhnlich ist es das schlimmste Zeug zur unpassendsten Zeit.
Zum Beispiel, wenn man gerade ein Mädchen vögelt.
Oder zumindest versucht, ein Mädchen zu vögeln.
Von allen beschissenen Auslösern scheint Sex der einzige Auslöser für diese Erinnerungen zu sein, sich in mein Hirn zu bohren. Immer, wenn ich kurz vorm Kommen bin, feuert mein Verstand eine Salve unerwünschte Erinnerungskugeln nach der anderen in meinen verdammten Schädel.
Genau das, was eben jetzt passiert.
Ich bin mit einem Mädchen zusammen. Sie ist ein paar Jahre älter als ich und auch einigermaßen hübsch. Ihre Hüften sind kurvig, und ihre Brüste sind voll und hüpfen, als sie tief Luft holt vor Verlangen und Vorfreude.
Sie spreizt die Beine, öffnet sie, um mich reinzulassen. Ich gehe in die Hocke und erstarre, als mir der Brustkorb eng wird. Hart wie Beton starre ich auf ihren Körper und will hinein, aber zugleich hasse ich das, was kommen wird, wenn ich es tue.
Sie schaut zu mir auf und lächelt. Sie hält mein Zögern für Nervosität. Sie streckt die Hand aus, greift mich am Schwanz und zieht mich zu sich. Ich sinke auf die Unterarme und schwebe über ihr. Sie streichelt meinen Schaft, auf und ab, und mein Körper wird unglaublich heiß. Nicht vor Begehren, sondern vor Angst. Schweiß.
Abneigung.
Mir ist schwindlig und ich zittere, aber ich will das.
Reiß dich gefälligst zusammen, Kevin.
»Fick mich«, flüstert sie, und ich schaudere, als meine Schwanz über ihre feuchten Schamlippen gleitet. Es fühlt sich gut an. Echt gut, aber zugleich tut es weh. Mein Brustkorb. Meine Muskeln. Ich bin gefangen in einem Kampf zwischen Körper und Geist, und ich will mir nur noch ein Messer durchs Ohr jagen. Sie stöhnt übertrieben lustvoll. »Dein Schwanz ist ja so riesig.«
Oh ja, gesegnet mit einem riesigen Ding und dazu der Unfähigkeit zu kommen, ohne danach zu kotzen. Die Vorstellung des Universums von einem echt kranken Witz.
Ihre Worte sollen verführerisch sein, fühlen sich aber überhaupt nicht so an. Mir dreht sich der Magen um, und ich drehe das Gesicht weg, schließe die Augen so fest ich kann und schlucke die Übelkeit runter, die mir in die Kehle steigt.
Du kannst das, sage ich mir. Sei kein Weichei. Mach es einfach. Es ist normal. Du bist normal. Krieg dich wieder ein. Schieb alle Gedanken weg. Lass sie nicht rein. Lass sie nicht …
Zu spät.
Die lautstarke Antwort des Universums ist ein Überfall der vielen verschiedenen Stimmen aus meiner Vergangenheit.
»Tu einfach, was ich will, und ich tu dir nicht weh. Er sieht eben gern zu«, warnt mich eine kratzige Frauenstimme.
»Ich bezahle dich. Lass mich zusehen, während du es dir machst«, kriecht eine gierige Männerstimme in meine Ohren.
»Na, siehst du, du bist gekommen. Ich habe dir ja gesagt, ich sorge dafür, dass du dich gut fühlst«, dröhnt ein tiefer Bariton, während ich auf den Teppich kotze.
»Siehst du? Der ist weggetreten. Wir können alles mit ihm machen, was wir wollen. Zieh ihm die Hose aus.«
»Nicht verkrampfen, Junge. Obwohl doch, mach. Ich mag es, wenn er sich zusammenzieht. Dann ist es so schön eng für mich«, grollt mir eine tiefe Männerstimme von hinten ins Ohr, als er sich in mich rammt.
Das war’s. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe genug. Von den Erinnerungen. Von dem hier. Von allem.
Aber wenn ich draußen bin, tut die heiße Nachtluft nichts, um meinen heißen Körper abzukühlen.
Und dann, aus dem Nichts, fällt mir Poe ein mit ihren traurigen Augen, und sie fällt, fällt, fällt.
Offenbar sind die schlimmen Gedanken nicht auf Sex beschränkt.
Meine Kehle wird trocken, und mir ist, als würde ich Sand hervorwürgen. Ich kriege keine verdammte Luft.
Ich springe vom Bett und ziehe meine Hose an. Dieses Mal bin ich sogar schon vor dem Orgasmus ausgeflippt.
Das ist selbst für mich ein neuer Tiefpunkt.
»Wo gehst du hin?«, fragt sie, aber ich antworte nicht. Ich kann nicht.
Erst als ich im Hof des beschissenen Apartments bin, das ich mir mit Pike teile, lege ich die Hände auf die Knie und kann endlich tief die Luft holen, die ich so dringend brauche. Die feuchte Luft öffnet meine Lungen, bis ich ruhig genug bin, um wieder geradeaus zu denken.
»Alles in Ordnung?«, fragt Pike, der gerade auf den Hof kommt. Als die Cops das Überwachungsvideo anschauten und mich von jedem Fehlverhalten in jener Nacht auf der Brücke freisprachen, war ich gerade auf dem Weg raus aus der Polizeiwache, als sie Pike wegen irgendeiner kleinen Drogensache reinschleppten. Seit er auf Kaution raus ist, schlafe ich hier bei ihm in Logan’s Beach.
»Alles gut«, antworte ich, stehe auf und fische meine Zigaretten aus der hinteren Jeanstasche.
»Was hast du angestellt, um das Mädchen so sauer zu machen?«, fragt er mit einem Lächeln. »Sie sah nicht gerade glücklich aus.«
»Das Übliche, schätze ich«, antworte ich und versuche es mit einem Schulterzucken abzutun.
Mein Handy summt.
Eine SMS von Fred.
Abgesehen von Pike sind Fred und Meryl für mich das, was Freunden am nächsten kommt. Meryl ist ein Südstaatler mit grauen Haaren und korrekter Stimme, der irgendwas mit Politik unten in Miami macht. Sein Lebensgefährte Fred ist mindestens zehn Jahre jünger und macht in … na ja, Meryl.
In der SMS steht, dass ich rüberkommen soll. Sie haben etwas zu essen auf dem Grill. Er bittet mich, unterwegs Zigaretten zu besorgen und ein wenig Gras mitzubringen. Ich zögere nicht. Ich kann die Ablenkung gebrauchen, und die zwei sind gut darin, mir welche zu verschaffen. Außerdem sind sie besser im Partymachen als die Typen in meinem Alter, können sich den besseren Stoff leisten und haben immer einen ordentlichen Vorrat zur Hand.
»Es ist Fred«, sage ich Pike. »Willst du mitkommen?«
»Ich habe ein Treffen mit einem neuen Lieferanten. Wenn ich fertig bin, texte ich dir und sehe, wo du bist.« Er zieht eine Augenbraue hoch. »Sicher, dass alles okay ist, Bruder?«
»Klar, Mann.«
Pike klopft mir auf den Rücken und geht.
Freds und Meryls aktuelles, modernes Haus ist vollkommen fehl am Platz unter den vielen Reihen heruntergekommener Hütten. Wie immer gehe ich rein, ohne zu klopfen. Sie würden mich sowieso nicht hören, denn sie sind immer draußen auf der hinteren Veranda, rauchen, trinken oder essen. Was wahrscheinlich die einzigen drei Dinge sind, die wir gemeinsam haben, aber das reicht ja auch. Sie sind gute Typen, und genau jetzt könnte ich ein wenig Ablenkung gebrauchen.