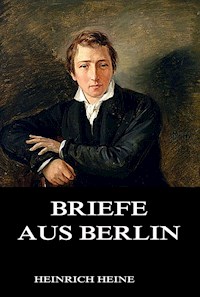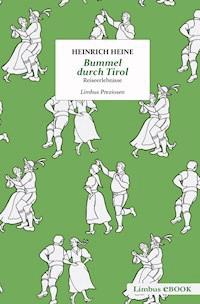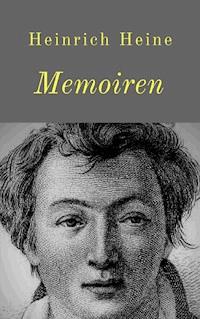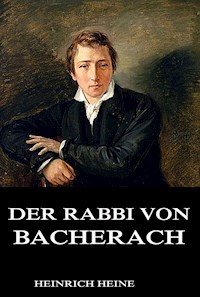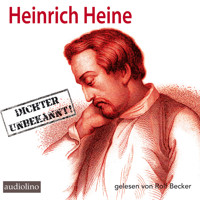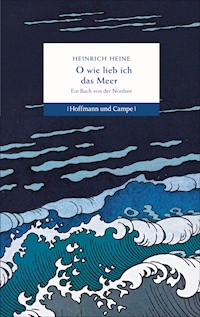
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich bewundere den Aufruhr der Natur, denn das bewegte Meer gleicht dem Leben." Heinrich Heine reiste viele Jahre zur Erholung an die See und war immer wieder tief berührt von diesem wilden Element. Dieser Band versammelt seine schönsten, vom Meer inspirierten Texte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Heinrich Heine
O wie lieb ich das Meer
Ein Buch von der Nordsee
Herausgegeben von Jan-Christoph Hauschild
Hoffmann und Campe Verlag
»Hofdichter der Nordsee«
Vorwort
Seit seiner Studentenzeit besuchte Heine, in erster Linie aus medizinisch-therapeutischen Gründen, regelmäßig Seebäder: in seiner deutschen Zeit, also vor 1831, Cuxhaven und Ritzebüttel (1823, 1826), Norderney (1825, 1826, 1827), Wangerooge (1827) und zuletzt das damals britische Helgoland (1829, 1830).
Im Sommer 1823 war er erstmals zu einer längeren Badekur an die Elbmündung gereist. Vom Meerwasserbaden und langen Strandspaziergängen versprach er sich eine heilende Wirkung auf sein schwaches Immunsystem. Nach bestandenem juristischem Examen »pro gradu doctoris iuris« durfte er sich im Sommer 1825 auf Kosten seines Hamburger Onkels Salomon Heine sechs Wochen lang auf Norderney erholen. Nachdem dort eine Spielbank errichtet worden war, entwickelte sich das ostfriesische Inselbad während der Saison zum Treffpunkt der vornehmen und extravaganten Welt. Bereits nach vier Wochen war das Geld fast ganz vertrödelt und verspielt, und Heine musste einen Jugendfreund anpumpen. Auch »mehrere Seefahrten« hat er unternommen und die ostfriesischen Nachbarinseln besucht, wie er dem Berliner Bekannten Friedrich Wilhelm Gubitz am 23. November berichtete.
Aufgrund eines Honorarvorschusses seines Hamburger Verlegers Julius Campe auf den zweiten Band der Reisebilder konnte sich Heine im Sommer 1826 erneut einen sechswöchigen Urlaub an der Nordsee leisten. Diesmal wagte er das Unerhörte und lernte schwimmen. »Das Meer«, schrieb er Campe am 29. Juli, »war so wild, dass ich oft zu versaufen glaubte. Aber dies wahlverwandte Element tut mir nichts Schlimmes. Es weiß recht gut, dass ich noch toller sein kann. Und dann, bin ich nicht der Hofdichter der Nordsee?«
Noch ein weiteres Mal, nämlich im Anschluss an seinen England-Aufenthalt Ende August 1827, kehrte Heine für ein paar Tage nach Norderney zurück, ehe er nach Wangerooge wechselte. Von dort aus hat er wohl auch Abstecher zu Sielhäfen gemacht, woran sein Text über die Totenfahrt nach der weißen Insel erinnert – eine ostfriesische »Tradition«, die er, wohl nach mündlichen Quellen, »so getreu als möglich« wiederzugeben suchte.
Die Sommerferien 1829 und 1830 verbrachte Heine dann auf Helgoland. Jahre später erfuhr der Schriftsteller Adolf Stahr von Heines einstigen Quartiersleuten, dass ihnen dieser als »ein sehr sonderbarer Mensch« vorgekommen sei: »Er konnte keine Uhr ticken hören, wir mussten unsere Hausuhr anhalten, solange er bei uns war!«
Sonst unterschieden sich Heines Beschäftigungen nicht wesentlich von denen anderer männlicher Badegäste: Er erkundete die nähere Umgebung, machte Bootsausflüge, schloss Bekanntschaften, ging in Bibliotheken, flirtete mit Damen der Hautevolee. Und er genoss den Anblick des Meeres, den Wechsel von Ebbe und Flut, die stürmische Brandung. »O wie lieb ich das Meer, ich bin mit diesem wilden Element so ganz herzinnig vertraut worden, und es ist mir wohl, wenn es tobt«, schrieb er am 14. Oktober 1826 an den Dichterfreund Karl Immermann. Der Schwester Charlotte Heine verriet er etwa zur selben Zeit: »Wenn der Wind heult und pfeift, wird mir wohl, und mir ist, als ob liebliche Stimmen mir Reime ins Ohr flüsterten … ich bewundere den Aufruhr der Natur; denn das bewegte Meer gleicht dem Leben, und nur dann schlägt mein Herz gesund, wenn die Wellen des Lebens recht hoch gehn!«
Bereits während seines ersten Cuxhaven-Aufenthalts oder unmittelbar im Anschluss verfasste Heine sieben kleine Seestücke, die er später dem Heimkehr-Zyklus des Buchs der Lieder einverleibte, wo sie die Nummern 7 bis 12 und 14 bilden. Zwei davon, »Du schönes Fischermädchen« und »Das Meer erglänzte weit hinaus«, sind insbesondere durch die Vertonungen Franz Schuberts weltweit bekannt geworden. In ihrer eher traditionellen Liedform weisen sie noch keineswegs voraus auf die Seebilder der beiden ersten Nordsee-Abteilungen in den Reisebildern, in denen Heine dann so überaus »neue Töne« anschlug und womit er, auch eigenem Bekunden von 1850 nach, zum Pionier der Nordsee-Poesie wurde: »Denn wer kannte damals in Deutschland das Meer? […] Damals schilderte man etwas der lesenden Menge völlig Unbekanntes, wenn man das Meer beschrieb, und das ist immer misslich. Ich musste mich, weil ich es obendrein in Versen beschrieb, an das Banalste halten. […] Wenn ich das alles damals hätte dichterisch behandeln wollen, hätte es keiner verstanden, eben weil es unbekannte Dinge waren.«
Zwar hatten auch schon die Romantiker Ludwig Tieck und Wilhelm Müller das Meer besungen, doch kein bedeutender deutschsprachiger Dichter vor Heine wählte die Nordsee als poetischen Gegenstand. Mit ihren freien Rhythmen, dem Verzicht auf Reimwirkung und einer Vielzahl kühner Wortneuschöpfungen dokumentieren die beiden Abteilungen der Nordsee einen lyrischen Neuanfang Heines. Mal in jubelndem Lobgesang, mal im Ton bitterster Enttäuschung, ernst und ironisch, feierlich und bizarr, erhaben und humoristisch, drastisch konkret und mythologisch überhöht, aggressiv und hochpoetisch beweist Heine seine formale und thematische Vielseitigkeit. Darüber hinaus zeugen seine Seebilder von den inneren Kämpfen, die er insbesondere 1825, im Jahr seiner großen, aber relativ folgenlosen konfessionellen und beruflichen Entscheidungen, mit sich austrug.
Im zweiten Band der Reisebilder erhielt die Nordsee noch eine dritte, prosaische Abteilung. Es handelt sich dabei nicht um einen geschlossenen Text, sondern um eine Aneinanderreihung von oft polemischen Essays, worin der Charakter der ursprünglich von Heine geplanten Serie fingierter Nordsee-Briefe bewahrt ist. Es sind allein die Themen, die den Text strukturieren: Geschickt arrangiert, versammelt die dritte Abteilung eine kunterbunte Abfolge von Mitteilungen über das armselige Leben und die dumpfe Mentalität der Insulaner und die verführerischen Wirkungen des Strand- und Badelebens, über Katholizismus, Goethe, seemännische Wundersagen und den hannoverschen Adel; über Seelenwanderung, Napoleon und seine Biographen, über Walter Scott und Lord Byron. Während die beiden lyrischen Zyklen vom grandiosen Naturerlebnis geprägt waren und sich oftmals in Herzensempfindungen und mythologischen Spielereien verloren, drängte sich in der erzählenden Prosa das Meer nur noch kulissenhaft in die Reflexionen des Erzählers: Vielmehr wandte sich dessen Blick der sozialen, kulturellen und auch politischen Gegenwart im zerstückelten Deutschland mit seinen zahlreichen Kleinfürsten zu, war doch insbesondere Norderney in der Saison Tummelplatz des Adels. Diese künstliche Welt der Badegäste, zu der er selbst gehörte, konfrontierte Heine mit dem Selbstbewusstsein der »guten Bürger Ostfrieslands«, eines Volkes, »flach und nüchtern […] wie der Boden, den es bewohnt«, geadelt jedoch durch ein besonderes Talent, womit es sich »über jene windige Dienstseelen erhebt, die allein edel zu sein wähnen« – das »Talent der Freiheit« nämlich.
Während seiner Nordsee-Aufenthalte lernte Heine wohl auch jene ostfriesische Überfahrts- oder Totensage kennen, die er in Übereinstimmung mit seinen mündlichen Quellen auf einer »weißen Insel« spielen lässt. Sie fand Jahre später Eingang in seine Götter im Exil, die vom Schicksal der alten Heidengottheiten und dem Weiterleben antiker Mythologien in der Neuzeit handeln. Dabei geht es einerseits um die christliche Vereinnahmung der antiken Mythologien, andererseits um die vom Christentum betriebene Verteufelung und Verfolgung heidnischer Glaubensvorstellungen, ein altes Lieblingsthema Heines, von dem schon »Die Götter Griechenlands« zeugt (ein 1826 entstandenes Gedicht aus dem zweiten Nordsee-Zyklus).
Heines zweiter Helgoland-Aufenthalt im Juli/August 1830 stand im Zeichen der politischen Zeitereignisse: Hier erfuhr er von einer Revolution in Paris, die zum Auftakt einer Serie von nationalen Befreiungs- und sozialen Protestbewegungen wurde und das System der Restauration, das die europäischen Mächte auf dem Wiener Kongress von 1815 beschlossen hatten, empfindlich erschütterte: Belgien erkämpfte seine Unabhängigkeit von den Niederlanden, in Polen brach ein Aufstand gegen die russische Oberherrschaft aus, Italien erhob sich gegen Österreich; Ende August erreichte die Woge des Aufruhrs auch Deutschland. Nach Jahren der politischen Restauration erging von Paris aus ein Signal an Europa, das 1789 begonnene Werk wiederaufzunehmen. Anstelle des letzten Bourbonenkönigs, der sich »von Gottes Gnaden König von Frankreich« hatte titulieren lassen, übernahm Louis-Philippe die Königswürde. Am 9. August 1830 leistete er als »König der Franzosen« seinen Eid auf die französische Verfassung; das »Julikönigtum« war geboren.
Dass Heines Briefe von Helgoland tatsächlich im Revolutionsjahr 1830 geschrieben wurden, gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Möglich ist immerhin, dass er auf Tagebuchnotizen zurückgreifen konnte, in denen er die politische Resignationsstimmung unmittelbar vor Ausbruch der Julirevolution festhielt. Ihre künstlerische Gestalt dürften die Briefe erst im Zusammenhang mit Heines Denkschrift über Ludwig Börne erhalten haben, deren Entstehung sich über drei Jahre hinzog: Zwischen 1838 und 1840 – und damit parallel zu Stabilisierungsversuchen seines Privatlebens (Konsolidierung der Finanzen, Lebensgemeinschaft mit Augustine »Mathilde« Mirat) – hielt Heine es für geraten, die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft, das Verhältnis von »Dichter« und »Tribun«, die Beziehung zwischen künstlerischer und ideologischer Motivation neu zu bestimmen. In der großen Auseinandersetzung mit Ludwig Börne, seinem republikanischen Antipoden und Weggefährten des Exils, versuchte er eine politische wie literarische Standortbestimmung. Durch die Einfügung der Helgoländer Briefe, die das zweite von fünf Kapiteln der Denkschrift bilden, sollte die persönliche Dimension der Schrift entschärft werden.
Weiterführende Literatur:
Michael Werner (Hrsg.): Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen,2 Bde., Hamburg 1973.
Jan-Christoph Hauschild/Michael Werner: »Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.« Heinrich Heine. Eine Biografie, Köln 1997.
Am Werfte zu Cuxhaven. Heinrich Heine, die Nordsee und Cuxhaven, Otterndorf 2000.
Michael Fleischer: Heinrich Heine. Dichter der Nordsee, Norderney 2001.
Eckhart Wallmann: Heinrich Heine auf Helgoland, Helgoland, 2. Aufl. 2002.
Theo Schuster (Hrsg.): Die Überfahrt zur Weißen Insel, Leer 2003.
Seebilder
Erster Zyklus
IKrönung
Ihr Lieder! Ihr meine guten Lieder!
Auf, auf! und wappnet euch!
Lasst die Trompeten klingen,
Und hebt mir auf den Schild
Dies junge Mädchen,
Das jetzt mein ganzes Herz
Beherrschen soll, als Königin.
Heil dir! du junge Königin!
Von der Sonne droben
Reiß ich das strahlend rote Gold,
Und webe draus ein Diadem
Für dein geweihtes Haupt.
Von der flatternd blauseidnen Himmelsdecke,
Worin die Nachtdiamanten blitzen,
Schneid ich ein kostbar Stück,
Und häng es dir, als Krönungsmantel,
Um deine königliche Schulter.
Ich gebe dir einen Hofstaat
Von steifgeputzten Sonetten,
Stolzen Terzinen und höflichen Stanzen;
Als Läufer diene dir mein Witz,
Als Hofnarr meine Phantasie,
Als Herold, die lachende Träne im Wappen,
Diene dir mein Humor.
Aber ich selber, Königin,
Ich knie vor dir nieder,
Und huldgend, auf rotem Sammetkissen,
Überreiche ich dir
Das bisschen Verstand,
Das mir aus Mitleid noch gelassen hat
Deine Vorgängerin im Reich.
IIAbenddämmerung
Am blassen Meeresstrande
Saß ich gedankenbekümmert und einsam.
Die Sonne neigte sich tiefer, und warf
Glührote Streifen auf das Wasser,
Und die weißen, weiten Wellen,
Von der Flut gedrängt,
Schäumten und rauschten näher und näher –
Ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen,
Ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Sausen,
Dazwischen ein wiegenliedheimliches Singen –
Mir war als hört ich verschollne Sagen,
Uralte, liebliche Märchen,
Die ich einst, als Knabe,
Von Nachbarskindern vernahm,
Wenn wir am Sommerabend,
Auf den Treppensteinen der Haustür,
Zum stillen Erzählen niederkauerten,
Mit kleinen, horchenden Herzen
Und neugierklugen Augen; –
Während die großen Mädchen,
Neben duftenden Blumentöpfen,
Gegenüber am Fenster saßen,
Rosengesichter,
Lächelnd und mondbeglänzt.
IIISonnenuntergang
Die glühend rote Sonne steigt
Hinab ins weitaufschauernde,
Silbergraue Weltenmeer;
Luftgebilde, rosig angehaucht,
Wallen ihr nach; und gegenüber,
Aus herbstlich dämmernden Wolkenschleiern,
Ein traurig todblasses Antlitz,
Bricht hervor der Mond,
Und hinter ihm, Lichtfünkchen,
Nebelweit, schimmern die Sterne.
Einst am Himmel glänzten,
Ehlich vereint,
Luna, die Göttin, und Sol, der Gott,
Und es wimmelten um sie her die Sterne,
Die kleinen, unschuldigen Kinder.
Doch böse Zungen zischelten Zwiespalt,
Und es trennte sich feindlich
Das hohe, leuchtende Ehpaar.
Jetzt am Tage, in einsamer Pracht,
Ergeht sich dort oben der Sonnengott,
Ob seiner Herrlichkeit
Angebetet und vielbesungen
Von stolzen, glückgehärteten Menschen.
Aber des Nachts,
Am Himmel, wandelt Luna,
Die arme Mutter
Mit ihren verwaisten Sternenkindern,
Und sie glänzt in stiller Wehmut,
Und liebende Mädchen und sanfte Dichter
Weihen ihr Tränen und Lieder.
Die weiche Luna! Weiblich gesinnt,
Liebt sie noch immer den schönen Gemahl.
Gegen Abend, zitternd und bleich,
Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölk,
Und schaut nach dem Scheidenden, schmerzlich,
Und möchte ihm ängstlich rufen: »Komm!
Komm! die Kinder verlangen nach dir –«
Aber der trotzige Sonnengott,
Bei dem Anblick der Gattin erglüht er
In doppeltem Purpur,
Vor Zorn und Schmerz,
Und unerbittlich eilt er hinab
In sein flutenkaltes Witwerbett.
Böse, zischelnde Zungen
Brachten also Schmerz und Verderben
Selbst über ewige Götter.
Und die armen Götter, oben am Himmel
Wandeln sie, qualvoll,
Trostlos unendliche Bahnen,
Und können nicht sterben,
Und schleppen mit sich
Ihr strahlendes Elend.
Ich aber, der Mensch,
Der niedriggepflanzte, der Tod-beglückte,
Ich klage nicht länger.
IVDie Nacht am Strande
Sternlos und kalt ist die Nacht,
Es gärt das Meer;
Und über dem Meer, platt auf dem Bauch,
Liegt der ungestaltete Nordwind,
Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme,
Wie ’n störriger Griesgram, der gutgelaunt wird,
Schwatzt er ins Wasser hinein,
Und erzählt viel tolle Geschichten,
Riesenmärchen, totschlaglaunig,
Uralte Sagen aus Norweg,
Und dazwischen, weit schallend, lacht er und heult er
Beschwörungslieder der Edda,
Auch Runensprüche,
So dunkeltrotzig und zaubergewaltig,
Dass die weißen Meerkinder
Hoch aufspringen und jauchzen,
Übermutberauscht.
Derweilen, am flachen Gestade,
Über den flutbefeuchteten Sand,
Schreitet ein Fremdling, mit einem Herzen,
Das wilder noch als Wind und Wellen.
Wo er hintritt,
Sprühen Funken und knistern die Muscheln;
Und er hüllt sich fest in den grauen Mantel,
Und schreitet rasch durch die wehende Nacht; –
Sicher geleitet vom kleinen Lichte,
Das lockend und lieblich schimmert
Aus einsamer Fischerhütte.
Vater und Bruder sind auf der See,
Und mutterseelallein blieb dort
In der Hütte die Fischertochter,
Die wunderschöne Fischertochter.
Am Herde sitzt sie,
Und horcht auf des Wasserkessels
Ahnungssüßes, heimliches Summen,
Und schüttet knisterndes Reisig ins Feuer,
Und bläst hinein,
Dass die flackernd roten Lichter
Zauberlieblich widerstrahlen
Auf das blühende Antlitz,
Auf die zarte, weiße Schulter,
Die rührend hervorlauscht
Aus dem groben, grauen Hemde,
Und auf die kleine, sorgsame Hand,
Die das Unterröckchen fester bindet
Um die feine Hüfte.
Aber plötzlich, die Tür springt auf,
Und es tritt herein der nächtige Fremdling;
Liebesicher ruht sein Auge
Auf dem weißen, schlanken Mädchen,
Das schauernd vor ihm steht,
Gleich einer erschrockenen Lilje;
Und er wirft den Mantel zur Erde,
Und lacht und spricht:
Siehst du, mein Kind, ich halte Wort,
Und ich komme, und mit mir kommt
Die alte Zeit, wo die Götter des Himmels
Niederstiegen zu Töchtern der Menschen,
Und die Töchter der Menschen umarmten,
Und mit ihnen zeugten
Zeptertragende Königsgeschlechter
Und Helden, Wunder der Welt.
Doch staune, mein Kind, nicht länger
Ob meiner Göttlichkeit,
Und ich bitte dich, koche mir Tee mit Rum,
Denn draußen wars kalt,
Und bei solcher Nachtluft
Frieren auch wir, wir ewigen Götter,
Und kriegen wir leicht den göttlichsten Schnupfen,
Und einen unsterblichen Husten.
VPoseidon
Die Sonnenlichter spielten
Über das weithin rollende Meer;
Fern auf der Reede glänzte das Schiff,
Das mich zur Heimat tragen sollte;
Aber es fehlte an gutem Fahrwind,
Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne,
Am einsamen Strand,
Und ich las das Lied vom Odysseus,
Das alte, das ewig junge Lied,
Aus dessen meerdurchrauschten Blättern
Mir freudig entgegenstieg
Der Atem der Götter,
Und der leuchtende Menschenfrühling,
Und der blühende Himmel von Hellas.
Mein edles Herz begleitete treulich
Den Sohn des Laertes, in Irrfahrt und Drangsal,
Setzte sich mit ihm, seelenbekümmert,
An gastliche Herde,
Wo Königinnen Purpur spinnen,
Und half ihm lügen und glücklich entrinnen
Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen,
Folgte ihm nach in kimmerische Nacht,
Und in Sturm und Schiffbruch,
Und duldete mit ihm unsägliches Elend.
Seufzend sprach ich: Du böser Poseidon,
Dein Zorn ist furchtbar,
Und mir selber bangt
Ob der eignen Heimkehr.
Kaum sprach ich die Worte,
Da schäumte das Meer,
Und aus den weißen Wellen stieg
Das schilfbekränzte Haupt des Meergotts,
Und höhnisch rief er:
Fürchte dich nicht, Poetlein!
Ich will nicht im Geringsten gefährden
Dein armes Schiffchen,
Und nicht dein liebes Leben beängstgen
Mit allzu bedenklichem Schaukeln.
Denn du, Poetlein, hast nie mich erzürnt,
Du hast kein einziges Türmchen verletzt
An Priamos’ heiliger Feste,
Kein einziges Härchen hast du versengt
Am Aug meines Sohns Polyphemos,
Und dich hat niemals ratend beschützt
Die Göttin der Klugheit, Pallas Athene.
Also rief Poseidon
Und tauchte zurück ins Meer;
Und über den groben Seemannswitz,
Lachten unter dem Wasser
Amphitrite, das plumpe Fischweib,
Und die dummen Töchter des Nereus.
VIErklärung
Herangedämmert kam der Abend,
Wilder toste die Flut,
Und ich saß am Strand, und schaute zu
Dem weißen Tanz der Wellen,
Und meine Brust schwoll auf wie das Meer,
Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh
Nach dir, du holdes Bild,
Das überall mich umschwebt,
Und überall mich ruft,
Überall, überall,
Im Sausen des Windes, im Brausen des Meers,
Und im Seufzen der eigenen Brust.