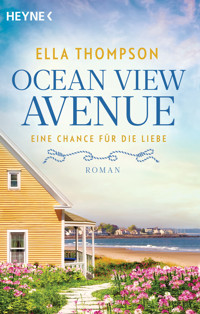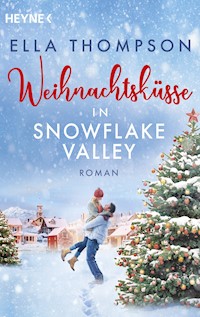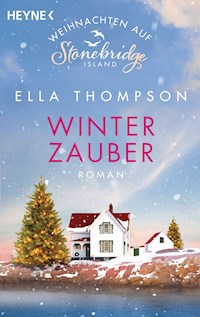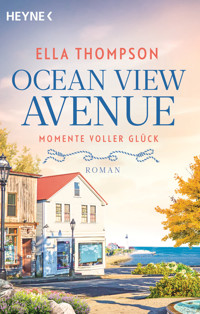
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Ocean View Avenue-Reihe
- Sprache: Deutsch
Manchmal ist das Glück näher, als du ahnst
Naya Clarkson ist Sozialarbeiterin mit Herz und Seele. Wie eine Löwin kämpft sie für die Jugendlichen ihres Wohnprojekts in Rhode Island, die ohne sie auf der Straße stehen würden – ein Schicksal, das Naya nur zu gut versteht, auch wenn inzwischen die Ocean View Avenue zu ihrer zweiten Heimat geworden ist. Als die Straftaten und der Vandalismus zunehmen, geraten ihre Schützlinge ins Visier von Carter Sloan, einem Polizisten, für den es nur Gut und Böse gibt, und der Nayas Einsatz für die Kids nicht versteht. Doch Naya lässt nicht locker und entdeckt hinter der Fassade des strengen Detectives ein weiches Herz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Naya unterdrückte wie immer ein genervtes Seufzen, als sie auf Detective Carter Sloan traf. Er blieb im Türrahmen stehen und ließ den Blick über den Frühstückstisch und Nayas Schützlinge gleiten. Er sah aus wie gewohnt. Unglaublich attraktiv, aber eine Laune wie Grumpy Cat. Er trug graue Chinos, dazu ein weißes Hemd. Die Haare militärisch kurz geschnitten und die Arme vor der Brust verschränkt. Unter seinen Augen lagen Schatten, und sein unrasiertes Kinn sprach dafür, dass er möglicherweise die ganze Nacht gearbeitet hatte. Für einen Moment entwickelte Naya fast so etwas wie Mitgefühl mit ihm. Fast. Denn was sie am stärksten wahrnahm, war sein Geruch nach Rauch.
»Es hat wieder gebrannt, letzte Nacht«, sagte Sloan prompt, was Naya befürchtet hatte.
Es brannte in letzter Zeit verdammt oft. Wütend machte es sie allerdings, dass dieser Detective immer als Erstes ihre Jungs verdächtigte.
Zur Autorin
Hinter dem Pseudonym Ella Thompson verbirgt sich die SPIEGEL-Bestsellerautorin Jana Lukas. Nach Möglichkeit verbringt sie jeden Sommer an der Ostküste der USA. Ihre persönlichen Lieblingsorte sind die malerischen New-England-Küstenstädtchen. An den endlosen Stränden genießt sie die Sonnenuntergänge über dem Atlantik – am liebsten mit einer Hundenase an ihrer Seite, die sich in den Wind reckt.
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 08/2024
© 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München unter Verwendung von © Getty Images/Peter Unger, FinePic®, München
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30362-4V003
www.heyne.de
Zuhause sind die Menschen, die in deinem Herzen sind.
Sprichwort
Für Sonja
»Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind.«
Victor Hugo
PROLOG
VOR 13 JAHREN
Naya Clarkson betrachtete ihr Gesicht im Spiegel über dem gesprungenen Waschbecken. Der Wasserdampf der Dusche, die sie immer erst so lange laufen lassen musste, bis der schmale Strahl aus dem Duschkopf endlich nicht mehr rostig braun war, ließ ihr Gesicht verschwimmen. Und doch konnte sie es erkennen, das aufgeregte Funkeln in ihren Augen. Matthew Jennings hatte sie gefragt, ob sie mit ihm ins Kino gehen wollte. Ein ganz klarer Code für Rumknutschen. Für Händchenhalten. Und vielleicht sogar für eine Einladung zum Homecoming-Ball.
Naya war sich nicht ganz sicher, warum Matthew ausgerechnet sie gefragt hatte. Sie war größer als die anderen Mädchen in ihrem Alter. Sie war dünn. Und da, wo ihre Mitschülerinnen Brüste hatten … musste sie hoffen. Andererseits war Matthew noch größer als sie, und falls das möglich war, noch dünner. Aber er hatte ein süßes Lächeln und warme Augen. Nayas Mom hatte immer gesagt, dass die Augen eines Menschen das Fenster zu seiner Seele waren. Naya stellte sich Matthews Seele weich und freundlich vor. Ohne jede Gemeinheit oder Schmerz.
Sie ließ die Hand zu dem Goldkettchen gleiten, das um ihren Hals lag. Mit den Fingerspitzen fuhr sie über die filigranen Kettenglieder und das zarte goldene Herz, das sie hielten. Diese Kette war in ihrer Familie Tradition. Sie wurde von Mutter zu Tochter weitergegeben. Am Tag ihrer Hochzeit. Naya blinzelte gegen die Tränen an, die in ihren Augen zu brennen begannen. Sie hatte die Kette vor ein paar Wochen bekommen. Zu ihrem sechzehnten Geburtstag – weil ihre Mutter nicht mehr leben würde, wenn sie irgendwann heirate. Oder bis dahin zumindest nicht mehr wissen würde, dass es ihre Tochter war, die da vor dem Altar stand.
Mit einer unwirschen Handbewegung rieb sie die Tränen unter ihren Augen weg, die es geschafft hatten, ihrem eisernen Willen, nicht zu weinen, zu entkommen. Behutsam öffnete sie den Verschluss der Kette und legte sie vorsichtig auf die Ablage über dem Waschbecken. Sie wollte stark sein. Sie wollte es wert sein, die Familienkette zu tragen. Denn sie war bald die einzige Generation, die noch am Leben sein würde. Sie hatte sich noch nicht an dieses Schmuckstück gewöhnt, das ihre Mutter so viele Jahre getragen hatte, weshalb sie es behandelte wie ein rohes Ei. Wie einen Schatz. Denn das war das kleine goldene Herz für ihre Familie immer gewesen.
Entschlossen, sich nicht in ihren traurigen Gedanken zu verlieren, löste sie das Handtuch, das sie um ihren Körper geschlungen hatte, und streckte die Hand unter den Wasserstrahl, der inzwischen rostfrei in die fleckige Badewanne lief.
Zwei Schreie ließen sie zusammenzucken. Einer wütend. Einer voller Angst und Schmerz. Ihre Pflegebrüder.
»Scheiße!« Naya wickelte sich das Handtuch wieder um den Körper, schloss die Badezimmertür auf und rannte in das Zimmer der Jungen. Wie befürchtet schlug Scott wieder einmal auf den zwei Jahre jüngeren, körperlich völlig unterlegenen Steven ein. Wahrscheinlich einfach nur, weil der ihn falsch angesehen hatte oder nicht bereit gewesen war, ihm einen Teil seiner Abendessen-Ration zu überlassen. »Auseinander!«, brüllte sie und warf sich zwischen die Kampfhähne.
Die anderen beiden Pflegejungen, die ebenfalls in diesem Zimmer wohnten, schauten dem Schauspiel von den sicheren Plätzen in ihren Stockbetten aus zu. Sie würden sich niemals gegen Scott wenden. Schließlich mussten sie mit ihm leben. Das musste Naya zwar auch, aber sie hasste nichts so sehr wie Ungerechtigkeit.
Scotts Ellenbogen traf sie in die Rippen und ließ sie für einen Moment Sterne sehen. Aber sie taumelte nicht zurück. Stattdessen kniff sie die Augen zusammen, weil sie eine der ekligsten Sachen tun musste, die sie sich vorstellen konnte: Sie griff mit Zeige- und Mittelfinger in seine Nasenlöcher und zog seinen Kopf zurück, bis er vor Schmerz schrie – ein Trick, der immer half.
»Lass Steven in Ruhe, du Arschloch«, zischte sie an seinem Ohr und wartete, bis der kleinere Junge sich aufgerappelt und in Sicherheit gebracht hatte. Erst dann ließ sie Scott los und brachte vorsichtshalber Abstand zwischen sich und ihn.
Scott war nicht nur größer als sie, er war auch deutlich massiger. Wenn er zuschlagen würde … »Verpiss dich, dumme Schlampe«, brachte er drohend heraus.
Naya wollte ihr Glück nicht auf die Probe stellen. Nur eine Sekunde später machte sie auf dem Absatz kehrt und rannte zurück ins Bad. Sie warf die Tür hinter sich zu und drehte das Schloss. Dann ließ sie sich gegen die Wand sinken, weil ihre Knie zitterten. Langsam atmete sie ein und aus, um ihr wild klopfendes Herz zu beruhigen.
Sie schloss die Augen. Und als sie sie wieder öffnete, fiel ihr Blick auf die Ablage über dem Waschbecken. Erschrocken keuchte sie auf und griff sich an den Hals. Nein. Sie trug ihre Kette nicht. Dabei konnte sie sich genau daran erinnern, wie sie sie gerade eben erst abgenommen und auf die Ablage gelegt hatte. Vorsichtig und voller trauriger Gedanken. Voller Einsamkeit. Auf die Ablage, die jetzt leer war.
Ihre Finger zitterten, als sie das Schloss wieder öffnete und aus dem Bad stürmte. Die Treppe hinunter, die mitleiderregend unter ihren Füßen knarrte.
Nayas Pflegemutter saß wie meistens in ihrem Fernsehsessel und schaute eine ihrer Daily Soaps. Sie hob nicht einmal den Blick, als Naya vor ihr stehen blieb. »Meine Kette …« Naya presste die Faust auf ihren Brustkorb, weil sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. »Meine Kette ist weg!«
Mit einer Bewegung wie in Zeitlupe hob ihre Pflegemutter den Blick. In ihren Augen glitzerten die Gemeinheit und das Böse, die Naya beide fürchtete. Diese Frau hatte die Macht. Sie bestimmte über Nayas Leben. Und in ihr war nicht ein Hauch dessen, was eine Mutter ausmachte. »Was habe ich dir gesagt, Schätzchen?« Die Pflegemutter zog die Augenbrauen hoch. »Wenn du etwas herumliegen lässt, muss du damit rechnen, dass es verschwindet.«
Ihre Aufmerksamkeit kehrte zum Fernseher zurück, und Naya stand mitten im Raum. In ein Handtuch gehüllt. Die Hände an ihren Seiten hilflos zu Fäusten geballt. Ihre Kette war weg. Die letzte Verbindung zu ihrer Mutter. Das kleine Familienerbstück der Clarkson-Frauen, das ihre Mom ihr anvertraut hatte. Naya hatte es nicht einmal geschafft, zwei Wochen lang darauf aufzupassen.
1
Der Sommer war dabei, sich zu verabschieden. Die Bäume krallten sich noch an ihr sattes Grün, aber die Nächte wurden bereits empfindlich kühl, und der erdige Geruch des Herbstes lag in der Luft. Viele Urlauber und Touristen hatten den Labor Day für einen letzten Ausflug nach Jamestown genutzt. Sie hatten am Strand gegrillt, Lagerfeuer entzündet und waren in den Ozean gesprungen, der zwar immer kalt war, inzwischen aber ganz eindeutig nicht mehr zum Baden einlud. Fand zumindest Naya.
Sie hatte sich bei ihrer Freundin Brooke untergehakt. Gemeinsam schlenderten sie über den dunklen Strand. Links von ihnen lag die Ocean View Avenue, die nach all dem Trubel, der hier heute geherrscht hatte, regelrecht verwaist wirkte.
Brookes Tochter Reeva und ihr Hund Lucky jagten vor ihnen her an der Wasserkante entlang. »Ich habe keine Ahnung, woher das Kind diese Energie hat«, seufzte Brooke.
Naya konnte das Lächeln hören, das in der Stimme ihrer Freundin lag. Sie blickte auf das Meer hinaus. Der Mond zeichnete eine silberne Straße auf das dunkle Wasser, und über ihnen funkelten Milliarden von Sternen. Es juckte Naya in den Fingern, dieses Szenario festzuhalten. Auf eine Leinwand zu bannen. Oder noch besser als großes Mural auf eine Hauswand. »Ich habe keine Ahnung«, beantwortete sie Brookes Frage.
»Ich kann mich nach diesem Barbecue jedenfalls kaum noch bewegen.« Brooke hielt sich mit einem theatralischen Stöhnen den Bauch.
Naya kicherte. »Stimmt. Die S’Mores hätten echt nicht mehr sein müssen.«
Das brachte Brooke dazu, ein ungläubiges »Tss« auszustoßen. »Eine Strandparty ohne Marshmallows über dem Feuer zu grillen, ist definitiv keine Strandparty.«
Sie hoben beide die Hand, um Brookes Nachbarin Coralee Miller zuzuwinken, die den Hund ihrer Schwester zu einer letzten Gassi-Runde ausführte.
»Ich habe es so genossen, dass wir alle zusammen den Labor Day gefeiert haben«, sagte Brooke. »In diesem Sommer ist unsere Familie so gewachsen, dass wir beim besten Willen nicht mehr alle auf unsere winzige Veranda quetschen können. Wir hatten definitiv das größte Lagerfeuer am Strand.«
Naya gab einen zustimmenden Laut von sich. In den vergangenen Monaten hatte sich die Dynamik in der kleinen Familie, zu der Brooke, ihre Schwester Harper und sie vor zehn Jahren zusammengewachsen waren, sehr verändert. »Wir sind inzwischen wirklich ein ganz schön großer Haufen. Ich freue mich so für dich und Harper. Wer hätte sich vor einem halben Jahr vorstellen können, dass der Lord of late Nights Harper mit Haut und Haaren verfällt«, dachte sie laut darüber nach, wie sich die Schwärmerei, die Harper jahrelang für ihren Boss gepflegt hatte, plötzlich ins Gegenteil verkehrt hatte.
Blake hatte ihre Freundin nicht nur erobert. Die beiden renovierten inzwischen ein wunderschönes Strandhaus und würden im Winter mit dem Baby, das sie erwarteten, ihre eigene Familie gründen.
Brooke lachte. »Und dass ich mir den brummigsten Webdesigner der Ostküste angele, hätte ich auch nicht geglaubt, wenn es mir jemand vor diesem Sommer prophezeit hätte.«
Naya stieß mit ihrer Schulter gegen Brookes. »Ihr tut euch unglaublich gut«, sprach sie das Offensichtliche aus. Ganz abgesehen von der Liebe, die den beiden ins Gesicht geschrieben stand, waren Brooke und Owen auch fantastische Eltern für ihre Tochter Reeva und seinen Sohn Theo.
»Jetzt fehlt nur noch ein schnuckeliger Typ für dich«, wiederholte Brooke leise lachend den Satz, den Naya in den letzten zwei Wochen bereits von Harper, der hundertjährigen Grandma Wilson und Mason Hill vom Jamestown Boatyard gehört hatte. Ach ja, Chester Elliot vom Narragansett Café und Coralee hatten ebenfalls die gleiche Floskel gebraucht. Genau wie die Mitglieder der Poker-Gang, die den ganzen Sommer über an einem Tisch am Strand an der Ocean View Avenue herumlungerten und arme Opfer zu einer Runde Poker überredeten.
»Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Interesse daran habe«, gab Naya ihr die gleiche Antwort, die auch alle anderen von ihr bekamen. »Der einzige Typ, der mir ständig über den Weg läuft, ist Detective Sloan. Und den möchte ich nun wirklich nicht näher kennenlernen.«
»Hm.« Brooke legte nachdenklich den Kopf ein wenig schräg. »Ein Hingucker ist dieser Kerl auf jeden Fall. Hast du mal auf seinen Hintern und diese breiten Schultern geachtet?«
»Nein, habe ich nicht.« Naya warf ihrer Freundin einen Seitenblick zu. »Was vermutlich daran liegt, dass ich immer an seinem Blick hängen bleibe, der die Hölle gefrieren lassen könnte, wenn er mich sieht.«
»Na ja, ein bisschen gucken hat ja noch niemandem geschadet. Wenn er das nächste Mal an dir vorbeigegangen ist, dreh dich …« Luckys aufgeregtes Bellen ließ sie verstummen und in Richtung ihrer Tochter blicken.
Im nächsten Moment hörten sie Reeva über den Strand brüllen: »Mommy, Naya, kommt schnell her!«
Viel konnte Naya in der Dunkelheit nicht erkennen. Aber das Mondlicht fiel über Reeva, die sich in den feuchten Sand kniete, während Lucky aufgeregt um sie herumsprang und weiterbellte.
Wie auf Kommando begannen Naya und Brooke zu rennen, bis sie die beiden erreichten – und das kleine Fellbündel, das winselnd im Sand hockte.
»Jemand hat ihn angebunden.« Reeva klang empört, und das Mondlicht ließ ihre Augen feucht schimmern, als sie den Blick zu ihnen hob.
Naya bemerkte den Strick – keine Leine, sondern ein verdammter Strick –, der um den Hals des kleinen Kerls geschlungen und unter einem Stein festgeklemmt war. Der Hund, der vermutlich kaum dem Welpenalter entwachsen war, fiepte jämmerlich und wich vor ihnen und Lucky, der ihn stürmisch beschnupperte, zurück.
»Lass ihm ein wenig Platz«, sagte Brooke zu Reeva und schnappte sich Luckys Halsband, um ihn ebenfalls davon abzuhalten, das Hündchen weiter in Panik zu versetzen. »Kannst du ihn nehmen, Naya?«
»Ist gut, Kleiner.« Naya hielt dem Hund ihre Hand hin, damit er sie kennenlernen konnte. Wahrscheinlich brachte das im Moment rein gar nichts. Er zitterte wie Espenlaub. Am besten wäre es, ihn erst einmal von hier wegzubringen. »Können wir ihn mit zu euch nehmen?« Sie blickte zu Brooke auf.
»Klar. Lass uns gehen.«
Naya löste den Strick von dem Stein und hob das winselnde Fellbündel auf ihre Arme. Sie strich über das sandige Fell, und nachdem dem Tier ein weiterer Schauer über den kleinen Körper gelaufen war, schmiegte es sich vorsichtig an Nayas Oberkörper.
»Wenn die Flut gekommen wäre …«, begann Reeva, sprach den Satz aber nicht zu Ende.
Sie hatte recht. Diejenigen, die diesen Hund direkt an der Wasserkante ausgesetzt hatten, hätten in Kauf genommen, dass er ertrunken wäre. »Jetzt ist er in Sicherheit«, beruhigte Naya sie. »Na komm, Buddy. Du bist jetzt in Sicherheit«, murmelte sie mit beruhigender Stimme und schlug die Richtung von Brookes und Harpers Haus ein, das nur ein paar Hundert Meter entfernt an der Ocean View Avenue lag.
Am nächsten Morgen nippte Naya an ihrem Kaffee, lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und lauschte dem Streit zwischen Caleb und Hector, der sich darum drehte, wem der Hoodie gehörte, der in ihrem Zimmer auf dem Boden zwischen ihren Betten gelegen hatte. Hector war zwar einen Kopf kleiner als Caleb, aber da die Klamotten zurzeit hauptsächlich übergroß sein mussten, um cool zu wirken, konnte man wirklich nicht mit Sicherheit sagen, wem das Kleidungsstück gehörte.
»Ich fand es von Anfang an scheiße, dass du die gleiche Farbe genommen hast«, beschwerte sich Hector bei Caleb.
»Schwarz ist die einzige Farbe, die geht, du Honk«, erwiderte Caleb, völlig mit sich im Reinen. Schließlich war er schneller gewesen und damit derjenige, der sich den Hoodie geschnappt hatte und ihn jetzt trug.
Trevor, der auf seinem Erdnussbutter-Jelly-Brot herumkaute, verdrehte genervt die Augen, und Miguel, Mica und Jasper waren so in ihre Handys vertieft, dass sie die Diskussion gar nicht mitbekamen.
»Ich habe einen Hoodie im Wäschekorb gesehen«, warf Naya ein, als sie fand, dass es Zeit war, den Streit zu schlichten. »Sobald er gewaschen ist, haben wir wieder zwei.«
»Fuck! Gewaschen!«, stöhnte Hector und ließ theatralisch den Kopf auf den Tisch fallen. »Ich will nicht warten, bis das Ding getrocknet ist. Ich will mich heute Nachmittag mit Trish treffen. Ich brauche den Hoodie!«
»Hm.« Naya versteckte ihr Lächeln hinter ihrer Kaffeetasse, als sie einen weiteren Schluck trank, und ließ das Herz ihrer Halskette durch ihre Finger gleiten. Hector war fünfzehn und definitiv die größte Dramaqueen in ihrer Wohngruppe. »Vermutlich wird Trish dich nicht verlassen, wenn du nicht genau diesen Hoodie trägst. Wahrscheinlich ist es also sinnvoller, etwas anderes anzuziehen, als sie in dem nach Teenager-Biber stinkenden Teil zu treffen.«
Hector drehte den Kopf auf der Tischplatte so, dass er Naya von unten anblinzeln konnte. »Was weißt du schon?«, brummte er. »Du bist alt. Du hast keine Ahnung, wie das ist.«
Jetzt konnte Naya ihr Lachen doch nicht mehr zurückhalten. Gespielt schockiert legte sie die Hand auf ihren Brustkorb. »Du brichst mir das Herz, Süßer.« Sie zwinkerte ihm zu. »Und weil ich sowieso schon alt bin und keine Ahnung habe, konzentrieren wir uns auf das, was ich weiß.« Sie warf einen demonstrativen Blick auf die Uhr auf ihrem Handydisplay. »Noch eine Viertelstunde, bis ihr in die Schule müsst.« Sie warf Hector einen Blick unter hochgezogenen Augenbrauen zu. »Falls du also nicht mit nacktem Oberkörper los willst, solltest du nach einer Alternative suchen.«
Mit einem weiteren theatralischen Seufzer richtete sich Hector wieder auf, schob geräuschvoll seinen Stuhl zurück und schlurfte in Richtung des Zimmers, das er sich mit Caleb teilte.
Naya ließ den Blick über ihre Schützlinge schweifen. Der ausgesetzte Hund, den sie am vergangenen Abend am Strand gefunden hatten, hatte die Nacht im Haus der McNallys in Jamestown verbracht, während Naya nach Hause gefahren war. Das Hündchen hatte gewinselt, als sie es bei Brooke zurückgelassen hatte, als hätten sie bereits eine Verbindung. Und es hatte ihr das Herz gebrochen. Ein kleines bisschen. Natürlich war der kleine Kerl bei ihren Freunden – und vor allem Reeva und Theo – in guten Händen. Andererseits hatte sie schon immer davon geträumt, einen Hund für ihre Wohngruppe anzuschaffen. Immer wenn sie Lucky für die McNallys hundegesittet hatte, waren ihre Jungs Feuer und Flamme gewesen. Ein Hund tat dem Sozialverhalten an sich gut. Bei Kids, die es nicht immer einfach gehabt hatten, konnte die bedingungslose, überschäumende Liebe so eines Tiers geradezu Wunder bewirken.
Aber ein Hund bedeutete natürlich auch viel Arbeit und Verantwortung. Deshalb war Naya erst einmal ohne ihn nach Newport zurückgekehrt.
Brooke hatte ihr allerdings einen wissenden Blick zugeworfen und geflüstert: »Ich sehe es in deinen Augen. Du wirst ihn zu dir nehmen. Nicht nur, weil du dir sowieso schon immer einen Hund gewünscht hast, sondern vor allem, weil du keiner ausgesetzten Seele widerstehen kannst. Egal ob Mensch oder Tier: Du sammelst sie alle ein«, hatte sie mit einem Zwinkern ergänzt, als Naya darüber nachgedacht hatte, ob sich vielleicht in Jamestown jemand fand, der den kleinen Kerl haben wollte. Sie musste sich eingestehen, dass Brooke da nicht unrecht hatte.
Ein Klopfen an der Tür holte Naya aus ihren Gedanken und ließ alle am Tisch aufhorchen. Selbst Mica, Jasper und Miguel hoben für einen Moment die Blicke von ihren Handys.
»Ich mach auf«, sagte Hector. Er änderte die Richtung und ging zur Tür der Wohngruppe. »Das Gesetz ist hier«, brüllte er mit der gleichen Abneigung, die Naya immer in ihre Stimme legte, wenn sie über ihn sprach: Über den Gesetzeshüter, der nicht mehr lange brauchen würde, bis er sie in die Irrenanstalt gebracht hatte.
Naya unterdrückte das genervte Seufzen, das in ihrem Hals feststeckte, wann immer sie auf diesen Mann traf. »Detective Sloan«, sagte sie und erhob sich mit einem zuckersüßen Lächeln von ihrem Platz. »Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich Ihnen einen Kaffee anbiete?«
Carter Sloan blieb im Türrahmen stehen und ließ den Blick über den Frühstückstisch, die bunten Wände und vor allem Nayas Schützlinge gleiten. Er sah aus wie immer. Unglaublich attraktiv, da hatte Brooke völlig recht, aber eine Laune wie Grumpy Cat. Er trug graue Chinos, dazu ein weißes Hemd, das er bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt hatte. Die Haare militärisch kurz geschnitten und die Arme vor der Brust verschränkt, was zu seinem schlecht gelaunten Gesichtsausdruck passte. Unter seinen Augen lagen Schatten, und sein unrasiertes Kinn sprach dafür, dass er möglicherweise die ganze Nacht gearbeitet hatte. Für einen Moment entwickelte sie fast so etwas wie Mitgefühl mit ihm. Fast. Denn was sie am stärksten wahrnahm, war sein Geruch nach Rauch. Er hing an ihm wie eine zweite Haut und breitete sich um ihn herum aus. Sie wusste plötzlich genau, was er hier wollte, und ihre Augen verengten sich zu Schlitzen, als sie ebenfalls die Hände vor der Brust verschränkte.
»Es hat wieder gebrannt, letzte Nacht«, sagte der Detective prompt, was Naya befürchtet hatte.
»Das tut mir wirklich leid, Detective. Ich hoffe sehr, dass niemand zu Schaden gekommen ist und die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Aber ehrlich gesagt«, sie hob die Arme zu einer unschuldigen Geste und legte sie dann an das Herz, das an ihrer Halskette baumelte, »hätte es mir auch gereicht, das aus den Nachrichten zu erfahren. Wenn sonst nichts weiter ist … wir frühstücken gerade. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« Mit entschlossenen Schritten ging sie auf ihn zu, um ihn aus der Wohnung zu werfen, bevor er ihr und den Jungs weiter auf die Nerven gehen konnte.
»Ich möchte wissen, wo folgende Personen sich vergangene Nacht aufgehalten haben:«, er zückte nicht einmal einen Notizblock, um die Namen abzulesen – er belästigte Naya und ihre Wohngruppe inzwischen schon so lange, dass er sie auswendig aufsagen konnte, »Caleb Adams, Hector Sanchez, Miguel Ramoz, Trevor Serano, Mica Forney und Jasper Brown.« Er hätte auch einfach nach ihren Jungs fragen können. Oder überhaupt nicht. Dieser Arsch. Detective Carter Sloan musste es natürlich auf die hochförmliche Tour machen.
Es brannte in letzter Zeit verdammt oft in Admiral Hill, dem Viertel, in dem Naya lebte und arbeitete. Bis jetzt war der Feuerteufel nicht geschnappt worden. Gebrannt hatten hauptsächlich alte Industriegebäude und Lagerhallen, die schon seit Jahrzehnten leer standen. Es war noch niemand zu Schaden gekommen. Trotzdem war dieses Szenario beängstigend. Irgendwann würde das diesem verrückten Zündler vielleicht nicht mehr reichen und er legte in einem Wohnhaus Feuer. Wütend machte es sie allerdings, dass dieser Detective immer als Erstes zu ihren Jungs kam.
Die natürlich auch sofort auf die unterschwellige Beschuldigung reagierten.
»Alter!«
»Was geht ab?«
»Wir haben nichts gemacht, Mann!«
Das Gebrüll ging weiter, und Naya ließ sie ihren Frust herausschreien. Es war immer besser, sich Luft zu machen, statt seinen Ärger herunterzuschlucken. Wenn die Jungs sich abreagiert hatten, konnten sie definitiv besser mit der Situation umgehen.
Der Detective blieb im Türrahmen stehen, die Arme immer noch vor der Brust verschränkt, und zog lediglich die Augenbrauen hoch.
Ja, das mochte unflätig klingen, aber Naya würde nicht den Moralapostel spielen. Sie fluchte selbst viel zu oft. Und für ihre Jungs war es nicht wichtig, sich gewählter auszudrücken, sondern dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, saubere Klamotten (weshalb sich Hectors Hoodie in der Wäsche befand) und dass sie zur Schule gingen. Es war wichtig, dass sie Naya vertrauten. Dass sie wussten, dass sie hinter ihnen stand. Weil sie die Erwachsene war, die für ihren Schutz und Rückhalt zuständig war. Ihr Vorgänger als Betreuer der Wohngruppe, Oscar Pearson, war ein Blödmann gewesen, der die Jungs kein bisschen verstanden hatte. Bei ihm war es verboten gewesen zu fluchen. Handys am Tisch? Nicht erlaubt und bestraft. Er hatte den Kids nicht vertraut. Und sie ihm nicht. Wenn ein Cop aufgetaucht war, hatte er erst einmal ihm geglaubt. Naya hatte verdammt hart arbeiten müssen, um sich den Respekt ihrer Jungs zu verdienen.
Naya blieb vor dem Detective stehen. Sie stieß mit dem Zeigefinger gegen seine Brust und schob ihn rückwärts über die Schwelle ins Treppenhaus. »Raus hier.«
Sloan ließ es geschehen, und sie folgte ihm und zog die Tür hinter sich zu. »Sie haben kein Recht, in mein Haus zu kommen und meine Jungs zu beschuldigen. Das habe ich Ihnen schon mindestens tausendmal gesagt, Detective.«
»Ich habe niemanden beschuldigt«, begann Sloan.
»Haarspaltereien«, unterbrach Naya ihn. »Sie klopfen immer als Erstes an unsere Tür, weil meine Jungs früher keine Engel waren und vielleicht auch jetzt hin und wieder Blödsinn anstellen. Aber meine Schützlinge sind keine Brandstifter. Kommen Sie wieder, wenn Sie Beweise haben.«
»Ich brauche …«, begann er abermals. Geduldig, als hätte er es mit einer besonders komplizierten Person zu tun.
»… ein Alibi? Ich war die ganze Nacht hier. Ich bin das Alibi für jeden einzelnen Jungen in dieser Wohngruppe. Verstehen Sie das?« Und das war nicht einmal gelogen. Naya hatte als Teenagerin auf der Straße gelebt. Das Überleben einer Obdachlosen hing unter anderem daran, wie hellhörig sie war. Nayas Schlaf war so leicht, dass sie es immer mitbekommen würde, wenn sich nachts jemand aus der Wohngruppe schleichen würde.
Sloan schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung, warum Sie diesen Jungs so bedingungslos vertrauen.«
»Wenn ich ihnen nicht vertraue, tut es keiner.« Naya griff hinter sich, drehte den Knauf und schob die Tür auf. Im nächsten Moment stand sie auf der anderen Seite der Schwelle und knallte dem Cop die Tür vor der Nase zu. Als sie sich umdrehte, starrten sie sechs neugierige Augenpaare an. »Was ist?«, fragte sie und stützte die Hände in die Hüften. »Ihr solltet euch doch für die Schule fertig machen.«
• • •
Die Tür krachte ins Schloss. Für einen Moment starrte Carter auf den abblätternden Lack des Türblattes. Diese Frau war so unverschämt. Er hatte es noch nie mit einer Sozialarbeiterin zu tun gehabt, die ihre Schützlinge so vehement verteidigte – und dabei so dreist war wie Naya Clarkson. Eine Löwenmutter mit scharfen Krallen.
Langsam schüttelte er den Kopf, so als müsse er die schlechten Vibes, die sie verbreitete, abschütteln. Dann drehte er sich um und stieg die knarzenden Treppen hinunter. Das Haus, in dem sich die Wohngruppe befand, hatte seine besten Zeiten schon seit vielen Jahren hinter sich. So wie viele Gebäude in Admiral Hill, dem schäbigsten Stadtteil von Newport, Rhode Island.
Die Haustür schlug hinter ihm zu. Er ging zu seinem Wagen und drehte sich noch einmal um, als er die Fahrertür des Impala erreichte. Da stand sie. An einem der Fenster der Wohngruppe und starrte zu ihm herunter. Die Haare mit der lächerlichen pinkfarbenen Strähne, ein T-Shirt mit dem Aufdruck Brains are the new tits und Jeans, die sich eng um ihre langen Beine schmiegten, aber definitiv schon bessere Zeiten gesehen hatten. Sie stand da, als wolle sie sichergehen, dass er auch wirklich verschwand. Diese Frau bedeutete noch immer Trouble. Purer Ärger.
Carter gab einen genervten Ton von sich, der die alte Dame, die zwei Pinscher Gassi führte, erschrocken zu ihm herumfahren ließ. Naya Clarkson bekam ihren Willen. Er würde sie in Ruhe lassen – aber er würde definitiv wiederkommen. Ständig wies bei den Straftaten im Viertel irgendwas auf Nayas Schützlinge hin. Er konnte ihnen nichts beweisen. Noch nicht. Aber früher oder später würde er sie erwischen.
Entschlossen zog er die Wagentür auf und knallte sie hinter sich zu, als er den Motor anließ. Mit der rechten Hand rieb er sich über das Gesicht, während er seinen Dienstwagen mit der Linken vom Straßenrand wegsteuerte. Er war genervt, ja. Aber vor allem war er völlig übermüdet. Wegen des verdammten Brandes war er die ganze Nacht im Einsatz gewesen. Zum Glück hatte die Feuerwehr den Brandherd dieses Mal schneller unter Kontrolle bekommen und verhindert, dass die ganze Lagerhalle abgefackelt war. Es gab keine Opfer zu beklagen, auch wenn es zwei Obdachlose erst im letzten Moment herausgeschafft hatten.
Er brauchte Schlaf. Eine heiße Dusche, korrigierte er seine Gedanken. Und dann Schlaf. So früh am Morgen war der Verkehr spärlich. Carters Gedanken wanderten zu Naya Clarksons herausfordernd vorgerecktem Kinn zurück. Diese Frau schien es wirklich drauf anzulegen, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Er hatte es ständig mit widerspenstigen, uneinsichtigen Menschen zu tun. Schließlich war er Polizist, und das war ganz eindeutig Teil seines Jobs. Er hatte keine Ahnung, warum ausgerechnet die Frau mit der albernen pinkfarbenen Haarsträhne und dem Goldkettchen um den Hals, an dem sie andauernd herumspielte, ihn ständig so auf die Palme brachte. Ihre Jungs waren keine Unschuldslämmer. Und das würde er ihr auch beweisen. Bald. Erst der Schlaf. Dann würde er weiterermitteln – und nicht lockerlassen.
VOR VIER MONATEN
»Sie sind der Neue?«
Carter hatte den Raum gerade erst betreten und war dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Die Ansprache ließ ihn auf die kleine Frau herunterblicken, die vor ihm stand und ihm die Hand entgegenstreckte.
»Ja, Detective Carter Sloan, Ma’am.« Er schüttelte die Hand.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Detective. Ich bin Bürgermeisterin Harris und freue mich, dass ich Sie für unseren runden Tisch gewinnen konnte. Wir können in Admiral Hill jede helfende Hand gebrauchen.« Sie breitete die Arme in einer einladenden Geste aus. »Suchen Sie sich einen Platz. Noch haben Sie die Wahl.«
»Danke, Ma’am.« Carter nickte ihr zu.
Er entdeckte ein paar seitlich aufgebaute Tische mit Erfrischungen und entschied, sich erst einen Kaffee zu holen und dann einen Platz zu suchen. Es war nicht gerade so, dass er freiwillig hier war. Er war erst vor ein paar Wochen aus Providence zum Newport PD gewechselt, weil … eigentlich hatte er keine Ahnung, warum er das gemacht hatte. Es war nicht gerade so, dass er mit dieser Stadt die besten Erinnerungen seines Lebens verband. Aber in irgendeiner völlig bescheuerten Übersprunghandlung hatte er sich auf die offene Detective-Stelle im Banden-Dezernat beworben. Jetzt war er hier. Außerdem hatte er sich noch von seinem Kollegen Art überreden lassen, an dem runden Tisch teilzunehmen, der sich um das Stadtviertel drehte, in dem sie den größten Ärger mit Gangs hatten – und offenbar auch sonst jede Menge Probleme: Admiral Hill. Normalerweise war das Arts Job. Aber der hatte die Chance genutzt, den Rookie zu schicken, und sah sich vermutlich gerade in seiner Lieblingskneipe das Knicks-Spiel an, während Carter dazu verdonnert war, sich die Beschwerden der Bürger des Viertels anzuhören.
Er suchte sich mit seinem Kaffee in der Hand einen Platz an der gegenüberliegenden Seite des Raumes, sodass er den Eingang im Blick hatte. Vielleicht lag das daran, dass er bei seinen Auslandseinsätzen für die Navy gelernt hatte, auf der Hut zu sein. Vielleicht war es seiner Cop-Natur geschuldet. Aber vielleicht war es auch einfach nur so, dass er gern wusste, wer hereinkam, ohne dass er das großartig hinterfragen musste und wollte.
So wie jetzt, als ein kleiner Menschenauflauf am Eingang entstand. Stadtrat Stanley Logan gab sich die Ehre, samt einer Entourage von vier Speichelleckern im Anzug. Logan war für Bauprojekte in Newport zuständig, durfte bei einem solchen Meeting also nicht fehlen.
Logan warf mit platten Floskeln um sich, verschwendete sein Politikerlächeln an jeden, der es ertragen konnte oder auch nicht. Er wandte sich um, ließ den Blick genauso durch den Raum schweifen wie zuvor Carter, um sich einen Überblick zu verschaffen. Seine Augen strichen an Carter vorbei, verharrten für den Bruchteil einer Sekunde und kehrten dann zurück. Für einen Augenblick, der so kurz war, dass ihn außer ihm vermutlich niemand bemerkte, spiegelte sich Unglaube im Blick des Politikers. Sein aufgesetztes Lächeln wurde von zusammengekniffenen Augen ersetzt. Seine Lippen bildeten eine schmale, gerade Linie. Na, immerhin war das ein ehrlicher Gesichtsausdruck. Carter hob den rechten Mundwinkel zu einem sarkastischen Lächeln und griff dann nach seiner Kaffeetasse, als interessiere ihn der Stadtrat kein bisschen. Einer von Logans Lackaffen flüsterte ihm etwas zu, und er setzte sofort wieder sein Lachen auf und drehte sich um.
Langsam füllte sich der Raum. Ladenbesitzer, Geschäftsleute, Vertreter des Rathauses und verschiedener sozialer Einrichtungen nahmen um den Tisch herum Platz. Zum Glück hatte sich Logan links von Carter und weit genug entfernt hingesetzt, sodass er ihn nicht ständig ansehen musste, auch wenn er in den ersten zehn Minuten des Meetings neben den Beschwerden der Bürgervertretung von Admiral Hill jede Menge leere Stadtrat-Floskeln zu hören bekam.
Logan war gerade wieder mitten in einem seiner ausschweifenden Monologe, der die Antwort auf die Frage einer Geschäftsfrau war, deren Ladenfenster in den vergangenen zwei Monaten dreimal eingeworfen worden waren. Carter war sich sicher, am Ende seiner kleinen Rede würde der Stadtrat absolut nichts gesagt haben, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und eine Frau hereinstürmte. Eine große Frau. Lange schwarze Haare, durch die sich eine pinkfarbene Strähne zog, wehten hinter ihr her. Sie trug zerschlissene Jeans, die sich um ihre ellenlangen Beine schmiegten, und einen hellblauen Hoodie.
»Oha, Naya Clarkson«, murmelte der Mann neben Carter. »Jetzt kann die Show ja losgehen.«
»Entschuldigung«, rief die Frau und schien sich nichts daraus zu machen, dass sie Logan gerade unterbrochen hatte. »Ich wurde im Rathaus aufgehalten, weil offenbar jemand ein Veto gegen mein neues Wandgemälde eingelegt hat.«
Sie ließ sich auf einen Platz Carter gegenüber fallen und tastete mit den Fingern nach der Halskette, die sie trug. Ihre Augenfarbe war Grau. Oder Grün, soweit Carter das beurteilen konnte, als sie einen wütenden Blick auf Logan abschoss.
»Miss Clarkson, schön, dass Sie uns auch noch beehren. Kann ich dann jetzt weitermachen?«, fuhr der Stadtrat sie unfreundlich an.
»Aber ja doch.« Die Frau richtete sich noch ein wenig gerader auf. Die beiden schien eine offene Feindschaft zu verbinden. »Fahren Sie fort. Ich bin schon ganz gespannt auf die heiße Luft, die aus Ihrem Mund kommt. Das ist sicher viel wichtiger, als wirklich etwas im Viertel zu bewegen.«
»Ihre Schmierereien tragen jedenfalls nichts dazu bei«, polterte der Stadtrat zurück. Sein Gesicht färbte sich rot. »Und diese unnützen Teenager, um die Sie sich kümmern, verursachen auch nur Probleme.«
»Lassen Sie meine Jungs da raus!« Die Frau sprang empört auf.
»Miss Clarkson. Stadtrat.« Die Bürgermeisterin hatte sich erhoben und setzte ein beruhigendes Lächeln auf. »Ich bitte Sie. Das hier soll die Beteiligten zusammenbringen. Unser Ziel ist es, nach Wegen für eine Verbesserung der Situation in Admiral Hill zu suchen. Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen uns nicht weiter. Also nehmen Sie bitte Platz und lassen Sie erst einmal die anderen Teilnehmer zu Wort kommen.«
Die Frau, Miss Clarkson, ließ sich langsam auf ihren Stuhl zurücksinken, konnte es sich aber offenbar nicht verkneifen, Logan noch einen Blick zuzuwerfen, der für sich sprach. Andere hielten den ausgestreckten Mittelfinger hoch – Naya Clarkson konnte das mit den Augen.
Fasziniert starrte Carter sie einen Moment an. Dann lehnte er sich zurück und nippte an seinem Kaffee. Interessant. Es gab also außer ihm noch jemanden, der den Stadtrat hasste.
Sie griff abermals nach ihrer Halskette, wickelte sie um ihren Zeigefinger und strich sich mit der anderen Hand die pinkfarbene Haarsträhne hinter das Ohr. Trouble, war das Wort, das Carter zu ihr einfiel. Diese Frau würde mit Sicherheit noch für jede Menge Ärger sorgen.
2
Carter bog gerade in die Straße ein, in der er wohnte, als sein Handy klingelte. Er sah eine unbekannte Nummer aufblinken und drückte den Freisprechbutton auf dem Display des Armaturenbrettes. »Sloan«, meldete er sich.
Als Antwort klang ein unterdrücktes Rülpsen durch den Freisprecher.
Angewidert verzog er das Gesicht. »Hallo?«, versuchte er denjenigen, der ihn angerufen hatte, zum Sprechen zu bewegen.
»Ich bin’s.« Die Stimme klang leise, verwaschen und über das Rauschen des Windes hinweg kaum zu verstehen.
»Willow?« Überrascht warf Carter noch einmal einen Blick auf das Display: Unbekannte Nummer.
»Wer sonst?«, nuschelte seine Schwester, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre, dass ausgerechnet sie ihn morgens um halb sieben lallend anrief.
Womit hatte er das hier eigentlich verdient?, fragte er sich seufzend. Erst eine Auseinandersetzung mit Naya Clarkson und jetzt auch noch dieser Anruf seiner Schwester Willow. Wie viele schwierige Frauen konnte ein Mann ertragen, nachdem er die Nacht durchgearbeitet hatte und nur noch ins Bett wollte? »Hast du getrunken?«, fragte Carter. Er ließ den Wagen vor seinem Haus ausrollen.
»N’ paar Bier.« Er konnte förmlich spüren, wie seine Schwester die Augen verdrehte. »Erzähl mir nich, du hättest mit siebzehn nich mal n’ paar Bier zu viel gehabt.«
Hatte er. Allerdings würde er Willow kein Wort davon erzählen. »Wo bist du?«, fragte er stattdessen.
»Second Beach.«
Das war nicht weit von der St. Georges School, der Privatschule, die Willow besuchte. »Und was für eine Handynummer ist das, von der du mich anrufst?«
»Von irgend so nem Typen. Mein Handy is weg. Irgendwie verloren.« Sie seufzte. »Kannst du mich holen und nach Hause fahren? Der Kerl, dem das Handy gehört, muss weg, und ich habe meinen Geldbeutel und … ach, alles irgendwie … verloren.«
An ihrer Stelle würde er auch nicht ihre Eltern anrufen wollen und beichten, dass sie am frühen Morgen besoffen an einem öffentlichen Strand saß. Wahrscheinlich hatten sie noch nicht einmal gemerkt, dass ihre Tochter nicht in ihrem Bett geschlafen hatte. »Hast du dich letzte Nacht aus dem Haus geschlichen?«, wollte er wissen.
Willow stieß noch einen Rülpser aus, der im Inneren seines Wagens widerhallte und so gar nicht zu seiner hübschen, kleinen Schwester passte. »Was denkst du denn? Dass sie mich mitten in der Woche zu einer Strandparty gehen lassen?«
Nein. Natürlich würden sie das nicht tun. Ganz im Gegenteil. Ihr Vater würde ausflippen, wenn sie auch nur diese Idee käme. Also sparte Carter sich eine Antwort auf die Frage, die sowieso nur rhetorisch gemeint war. »Bleib, wo du bist, okay? Ich bin gleich da. Steig so lange zu niemandem ins Auto.«
Carter konnte nur hoffen, dass seine Schwester nicht betrunken genug war, genau das zu tun. Er wendete und fuhr in Richtung Middletown.
Seine Schwester zu entdecken, war nicht schwer. Sie war die einzige Person, die wie ein Häufchen Elend auf der halbhohen Mauer am Parkplatz des Second Beaches hockte. Am Horizont konnte er einen Jogger ausmachen und zwei Frauen, die ihre Hunde am Wasser entlang ausführten. Aber auf dem Parkplatz war niemand außer Willow. In einem Bikini-Oberteil und Jeansshorts, die so kurz waren, dass er sich fragte, was der Sinn davon war, diese Dinger überhaupt zu tragen. Carter war sich zumindest sicher, was Willows Vater dazu zu sagen hätte.
»Hey«, grüßte Willow kläglich, als er neben ihr hielt.
Carter konnte schon vom Auto aus erkennen, wie sehr sie fror. Schließlich war es nicht nur früher Morgen am Meer, der Herbst begann sich bereits langsam auszubreiten. Er kramte einen Sport-Hoodie aus der Tasche, die er immer auf dem Rücksitz hatte, falls er spontan Lust hatte, ins Fitnessstudio zu gehen. »Hey«, antwortete er seiner Schwester und brachte sie dazu, ihre Arme zu heben, damit er ihr den Hoodie über den Kopf ziehen konnte. Er streifte ihr die Kapuze des Pullis nach hinten und hob mit Zeigefinger und Daumen sanft ihr Kinn an, um ihr in die blutunterlaufenen Augen zu schauen. Willow sah aus wie ein Waschbär mit all dem verlaufenen Make-up in ihrem Gesicht. Aber das sagte er ihr lieber nicht. »Hast du nur Alkohol getrunken?«, fragte Carter. »Oder hast du auch noch irgendwas anderes eingeworfen oder geraucht?«
Willow schüttelte leicht den Kopf, schloss dann aber stöhnend die Augen. Vermutlich, weil sich alles drehte und ihr Gehirn in Wodka schwamm. »Ich nehme keine Drogen«, nuschelte sie. »Hab nur was getrunken.«
Carter nickte und warf noch einmal einen Blick auf den nahezu menschenleeren Strand. »Wo sind deine Freunde, Willow? Ist noch jemand hier, den wir auch noch nach Hause bringen müssen?«
Seine Schwester zuckte die Achseln. »Alle weg. Wir waren da.« Sie wies auf eine graue Decke, die neben einem heruntergebrannten Lagerfeuer einsam im Sand lag. Dass an diesem Strand weder Alkohol noch Lagerfeuer erlaubt waren, verkniff sich Carter zu erwähnen. Auf dem Schild, neben dem Willow hockte, stand das Ganze schließlich deutlich lesbar und in Großbuchstaben. Abgesehen davon, dass sie nicht ganz unrecht hatte: Auch Carter hatte in seinen Teenagerjahren hin und wieder über die Stränge geschlagen. Aber hier ging es nicht um ihn, sondern um seine kleine Schwester.
»Okay.« Carter zog sie in eine stehende Position und wartete, bis sie aufhörte zu schwanken. »Kannst du dich schon mal in den Wagen setzen?«
»Hm.« Willow tappte mit vorsichtigen Schritten los, während Carter über die Mauer sprang und zu der Decke joggte.
Er überprüfte, ob das Lagerfeuer wirklich runtergebrannt war, schüttelte die Decke aus und rollte sie zusammen. Als er noch ein paar herumliegende blaue und rote Plastikbecher einsammelte, sah er etwas Pinkfarbenes im Sand glitzern. Es war fast vollständig verdeckt, also wischte er es frei und drehte es um. Auf dem Display leuchtete der Sperrbildschirm auf, der Willow lachend mit einer ganzen Clique Mädchen zeigte. Er hatte das Handy seiner Schwester gefunden. Damit würde er es definitiv in den Heldenstatus schaffen – wenn Willow wieder nüchtern war. Denn eigentlich war dieses Ding mit ihrer Hand verwachsen – wie bei allen anderen Teenagern auch. Carter hob es auf und tastete noch ein wenig weiter durch den Sand. Wo das Handy lag … »Bingo«, murmelte er, als er einen Geldbeutel fand, den er nach einem Blick auf den Inhalt ebenfalls als den seiner Schwester identifizierte. Er entsorgte die Plastikbecher im Mülleimer und kehrte zu seinem Dienstwagen zurück.
Willow kauerte, tief in seinem Hoodie versunken, auf dem Beifahrersitz. Er verstaute die Decke im Kofferraum und angelte noch eine Flasche Wasser aus seiner Sporttasche, die er öffnete und seiner Schwester hinhielt. Sie trank nur ein paar vorsichtige Schlucke, dann gab sie sie zurück.
»Schau mal, was ich am Strand gefunden habe.« Er legte ihr das Handy und ihren Geldbeutel in den Schoß und rutschte hinter das Lenkrad.
Willow blinzelte. »Oh …«, war alles, was sie herausbrachte. Aber ihre Finger glitten über das Display und wischten ein paar übrig gebliebene Sandkörnchen in den Beifahrerfußraum.
Carter könnte ihr eine Standpauke halten. Über Trinken als Minderjährige. Den Alkohol am Strand, an dem sie gar kein Feuer hätten machen dürfen. Es war fast ein Wunder, dass sie nicht entdeckt und auf die Wache der Middletown Police geschleppt worden waren. Das Schimpfen würde allerdings bei seiner starrköpfigen Schwester nicht viel bringen. Sie hatte sich bereits selbst sabotiert. Denn spätestens, wenn sie ihren Rausch ausgeschlafen hatte und sich hundeelend fühlen würde, hatte sie ihre Strafe für diese hirnlose Aktion.
Carter warf ihr einen Seitenblick zu und ließ das Beifahrerfenster herunter. »Wenn du kotzen musst, sag Bescheid, okay?«
»Hm«, antwortete Willow abermals und blickte konzentriert durch die Windschutzscheibe.
Carter fuhr vorsichtig an und schlug den Weg zu Willows Elternhaus ein. Elternvilla traf es wahrscheinlich besser. Der Palast, der auch einmal sein Zuhause gewesen war. Er schob den Gedanken zur Seite. »Wie kommt es, dass du mich vom Handy eines fremden Typen aus angerufen hast? Woher hattest du meine Nummer, wenn du dein Handy nicht mehr finden konntest?«, fragte er, um das Schweigen im Wagen zu überblenden.
»Wusste ich auswendig«, nuschelte seine Schwester, den Blick noch immer starr geradeaus.
»Du kennst meine Handynummer auswendig?« Carter warf ihr einen überraschten Seitenblick zu.
»Ja klar.« Sie sagte die Zahlenfolge auf, ein wenig verwaschen und langsam, was ihrem Zustand geschuldet sein dürfte. Dann schwieg sie wieder.
Seine Schwester wirkte so viel jünger und unschuldiger, wie sie da neben ihm saß. Und sie hatte seine Nummer im Kopf. Carters Magen zog sich zusammen. Er hätte bis zu diesem Morgen nicht gedacht, dass er ihr überhaupt genug bedeutete, um ihn im Notfall anzurufen. »Gut zu wissen.« Er räusperte sich, als er merkte, wie rau seine Stimme klang. »Vergiss sie nie, okay? Du kannst mich jederzeit anrufen.«
»Sicher«, murmelte sie.
Carter hörte zwischen den Buchstaben, dass sie ihm das nicht wirklich abnahm, auch wenn er ihr gerade das Gegenteil bewies.
Die Fahrt zu ihrem Elternhaus dauerte zum Glück nicht lange. Das Haus lag auf einer Anhöhe über den Klippen. Nicht an der Bellevue Avenue, an der die richtig großen Anwesen aus dem Gilded Age lagen. Aber auch dieses Haus verstand es definitiv, seine Gäste zu beeindrucken. Carter tippte den Code in die Schließanlage am Tor und wartete, bis die schmiedeeisernen, verschnörkelten Flügel aufglitten und er der geschwungenen Straße, gesäumt von Blumenrabatten und gemähtem Rasen, zum Haus folgen konnte.
»Ich parke am Nebeneingang«, schlug er vor. Hier gingen normalerweise nur die Service- und Haushaltskräfte ein und aus. »Wir schleichen uns rein, du gehst ins Bett und schläfst deinen Rausch aus. Am besten meldest du dich für heute in der Schule krank.«
»Klar, Bulle.« Willow hasste Befehle. Und diese Ansage nahm sie offenbar auch im besoffenen Zustand als solchen wahr.
Aus den Augenwinkeln sah Carter, wie sie versuchte, die Augen zu verdrehen. Was ihr aufgrund ihres Zustandes nicht wirklich gelang. Wenn die Tatsache, hier sein zu müssen, nicht wäre, hätte er jetzt wahrscheinlich gelacht. So aber bemühte er sich einfach, das unangenehme Prickeln in seinem Nacken abzuschütteln, und fuhr so nah wie möglich an die Tür heran. Rein. Raus. Weg. Er konnte in drei Minuten auf dem Heimweg sein. Höchstens.
Er half Willow aus dem Wagen. Sie versuchte dreimal, den Türcode einzugeben. Seine Handynummer konnte sie aufsagen, aber in ihr Zuhause schaffte sie es nicht. Carter schob ihre Hand sanft zur Seite und tippte die Zahlenkombination selbst ein. Dann legte er ihr den Arm um die Hüfte und bugsierte sie ins Haus.
Ihre Alkoholfahne mischte sich mit den typischen Gerüchen seiner Vergangenheit. Möbelpolitur und der Jasmin-Dufterfrischer, auf den ihre Mutter so stand.
»Frühstücken«, beschloss Willow und steuerte die Küche an.
»Nicht jetzt, Süße«, flüsterte Carter und zog seine Schwester zurück in Richtung der breiten, teppichausgekleideten Treppe. Im Moment war ihm Willows Promille-Atem sogar lieber als der Duft dieses Hauses. Solange er sich auf seine Schwester konzentrierte und darauf, nicht gemeinsam mit ihr rückwärts die Treppe hinunterzustürzen, musste er sich keine Gedanken darum machen, dass sich in diesem Haus nicht viel verändert hatte, seit er zum letzten Mal hier gewesen war. Wenn er in den Salon ging, fände er gerahmte Fotos auf einem Schränkchen und dem Kaminmantel arrangiert. Fotos von Willow und ihren Eltern. Seine Schwester mit einem Siegerpokal von einem Fußballturnier. Bei ihrer ersten Reitstunde. Und inzwischen sicher auch Fotos in einem schönen Kleid mit Ansteckstrauß von einem der letzten Schulbälle. Was sich unter all diesen Fotos nicht finden lassen würde, war ein Hinweis auf seine eigene Existenz, die in diesem Haus vor über zehn Jahren eliminiert worden war. Genau wie sich sein altes Reich inzwischen längst in ein komplett durchgestyltes Gästezimmer verwandelt hatte.
Carter schob die dunklen Gedanken beiseite, die ihn in diesen vier Wänden immer einkreisten und versuchten, ihm die Luft zum Atmen zu nehmen. Die Mastersuite lag im ersten Stock auf der rechten Seite. Er wandte sich auf dem Treppenabsatz nach links und öffnete die Tür zu Willows Zimmer. Erleichtert atmete er aus, als er sie leise hinter sich ins Schloss zog. Alles war ruhig. Niemand hatte sie erwischt.
Er ließ Willow auf ihr Bett kippen, zog ihr die Flip-Flops von den Füßen und wischte den Sand von ihren Beinen. Dann hob er ihre Füße auf die Matratze und breitete eine Decke über ihr aus.
»Weißt du noch, was du machen sollst?«, fragte er leise.
»Hm, ja, Bulle. Schlafen. Krankmelden«, murmelte sie.
»Sehr gut.« Der Bulle schien ihre neueste Version zu sein, ihn auf die Palme zu bringen. Pech, dass sie damit auf Granit biss. Carter richtete sich auf und ging in ihr Bad, wo er eine Trinkflasche fand, die sie vermutlich für den Sport benutzte. Er füllte sie mit Wasser und warf dann einen Blick in den Spiegelschrank. Dort entdeckte er einen ganzen Haufen Schminkzeug, Cremes und Parfum, aber keine Kopfschmerztabletten. Und die würde Willow auf jeden Fall brauchen, wenn sie aufwachte.
Im Bad der Mastersuite würde er Pillen für jeden Anlass finden. Von Schmerzmitteln über teure Vitaminpräparate bis hin zu Beruhigungs- und Schlafmitteln war in diesem Haushalt alles vorhanden. Aber an das Zeug kam er nicht ran.
Willow hatte sich inzwischen auf die Seite gedreht, die Kapuze seines Hoodies wieder über den Kopf gezogen und sich zusammengerollt. Sie schlief tief und fest, als er die Wasserflasche neben ihr Handy auf den Nachttisch stellte.
Carter öffnete ihre Zimmertür und schlich sich ins Erdgeschoss zurück. Der Medizinschrank in der Mastersuite war nicht der einzige im Haus. Im Gästebad fand er, was er suchte, schüttelte ein paar Advil aus dem Glas und kehrte lautlos ins Obergeschoss zurück. In Willows Zimmer legte er die Pillen neben die Wasserflasche. Einen Moment blieb er am Bett seiner Schwester stehen. Er strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich unter der Kapuze verselbstständigt hatte.
Willow seufzte im Schlaf, griff nach seiner Hand und drückte sie kurz, bevor sie sie wieder losließ.
Seit Carter vor vier Monaten nach Newport zurückgekehrt war, hatte er den Kontakt zu seiner Schwester auf Sparflamme gehalten. Schließlich hatten sie weder etwas gemeinsam, noch hatten sie sich viel zu sagen. Sie verkehrten nicht in den gleichen Kreisen, und er konnte mit Sicherheit sagen, dass sie nicht die gleichen Leute kannten. Und das nicht nur, weil zwischen ihnen zwölf Jahre Altersunterschied lagen. Und doch kannte Willow seine Handynummer auswendig.
Carter schluckte. Es wurde Zeit zu verschwinden und endlich in sein eigenes Bett zu kriechen. Er brauchte dringend Schlaf. In ein paar Stunden wurde er schon wieder auf der Dienststelle erwartete.
Leise öffnete er abermals Willows Tür und zog sie genauso lautlos wieder hinter sich zu, nachdem er in den Flur getreten war.
»Was zur Hölle tust du hier?«
Erschrocken zuckte Carter zusammen und fuhr herum, die Hände zum Kampf erhoben. »Stanley«, sagte er, als ihm bewusst wurde, wer ihm gegenüberstand. Wer sonst sollte auch um diese Uhrzeit in einem lächerlich karierten Pyjama und seidenem Morgenmantel im Flur stehen, wenn nicht der Ehemann von Carters Mutter – das Wort Stiefvater wollte er nicht einmal in Gedanken benutzen. Schließlich war das hier Stanleys Haus. Und Carter war hier nicht willkommen. Er wurde hier nicht geduldet. Langsam ließ er die kampfbereiten Hände sinken. »Du bist schon auf?«, fragte er stattdessen und verschränkte die Arme vor der Brust.
Stanley hob die Arme und wedelte mit seinem Handy vor Carters Nase herum. »Die Sicherheitsfirma hat mich angerufen, weil jemand ein paar Mal den falschen Türcode eingegeben hat, bevor er es richtig hinbekommen hat. Diese Firma ist verdammt gut. Sie haben mich informiert, um sicherzugehen, dass sich niemand unberechtigt Zutritt zum Haus verschafft hat.« Er ließ das Handy sinken und fixierte Carter unter arrogant hochgezogenen Augenbrauen. »Offenbar sind sie goldrichtig gelegen. Jemand hat sich unberechtigt Zutritt zu meinem Haus verschafft. Was mich noch einmal zu der Frage bringt: Was hast du hier verloren?«
Carter hätte gern die Gegenfrage gestellt, warum Stanley seit mindestens fünfzehn Jahren den Sicherheitscode nicht mehr geändert hatte. Aber das musste er nicht. Es war das Datum von Stanleys erster Ernennung zum Stadtrat, und er war viel zu eingebildet und selbstverliebt, um diesen für ihn so denkwürdigen Moment nicht mehr zu benutzen.
Aber wie sollte er selbst seine Anwesenheit im Haus begründen? Er könnte sagen, dass er aus sentimentalen Gründen auf der Suche nach seinem Football-Pokal aus Highschool-Zeiten gewesen sei. Aber auch wenn Stanley ein astreines Arschloch war, dumm war er nicht.
Ehe Carter sich etwas überlegen konnte, wurde die Tür der Mastersuite geöffnet. »Stanley, Honey, ist alles in Ordnung? Mit wem sprichst … Carter?«
»Mom.« Das Wort brannte wie Säure auf seiner Zunge. Seine Mutter Violet sah gut aus. Schön war wahrscheinlich das richtige Wort. Selbst jetzt, wo sie barfuß und mit verschlafenem Blick in den Flur tapste. Willow war wie ein junges Abziehbild von Violet. Carter hingegen kein bisschen.
Seine Mutter zog ihren Morgenmantel, der perfekt zu ihrem vermutlich sündhaft teuren Nachthemd passte, um ihren Körper zusammen und band den Gürtel zu. »Was machst du hier?«, stellte sie die gleiche Frage wie Stanley. Nur dass sie über sein Auftauchen eher verwirrt und überrascht wirkte, statt so bedrohlich zu klingen wie ihr Mann.
»Ich …« Es gab wirklich keinen Grund, hier zu sein, wurde ihm noch einmal bewusst. In diesem Haus. Und vor allem auf diesem Stockwerk. »Ich bin schon weg.« Carter versuchte sich an einem unschuldigen Lächeln und hob ergeben die Hände. Wenn Willow Glück hatte, schlossen ihre Eltern nicht von seinem Besuch auf ihr nächtliches Besäufnis. Dann war Stanley einfach nur stinksauer, weil er hier aufgetaucht war, und würde hoffentlich endlich seinen Türcode ändern. Was aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall eine gute Entscheidung war.
Doch offenbar hatte Willow beschlossen, ihr Glück selbst zu torpedieren. Resigniert ließ er den Kopf sinken, als er hörte, wie hinter ihm die Tür geöffnet wurde und seine Schwester nuschelte: »Du hast deinen Hoodie vergessen. Upsi, was’n hier los?«
Am entsetzten Gesichtsausdruck seiner Mutter konnte Carter erkennen, dass Willow kein bisschen besser aussah als vor ein paar Minuten. Minus den Hoodie. Was vermutlich bedeutete, dass ihr Outfit im Moment wieder aus den Jeansshorts und dem Bikinioberteil bestand, in dem er sie gefunden hatte. Carter griff nach seinem Hoodie, den sie ihm hinhielt, und murmelte ein »Geh wieder ins Bett« über seine Schulter.
»Moment, junge Dame«, grätschte Stanley dazwischen, bevor Carter sich umdrehen und Willow wieder in ihr Zimmer schieben konnte. »Hast du getrunken?«, donnerte seine Stimme durch das ansonsten viel zu stille Haus.
Willow kicherte und hakte sich bei Carter unter. Wie er befürchtet hatte, sah sie wirklich wieder genau so aus wie am Strand. »Klar«, erklärte sie breit grinsend. »Die ganze Nacht.«
Violet schnappte nach Luft. »Hast du sie etwa zu einem Saufgelage mitgenommen?«, fragte sie entsetzt.
Carter bemühte sich, nicht die Augen zu verdrehen. Wenn seine Mutter auch nur ein bisschen über ihn wüsste, wäre ihr klar, dass er so etwas nie machen würde und außerdem selbst nicht besonders darauf stand, sich mit irgendwelchen Leuten zu betrinken und die Kontrolle zu verlieren. Aber woher sollte diese Erkenntnis kommen? Dazu müsste sie sich ja für ihn oder sein Leben interessieren. »Ich habe Willow selbstverständlich nicht irgendwohin mitgenommen und zugelassen, dass sie Alkohol trinkt«, beantwortete er die Frage seiner Mutter statt der Worte, die er ihr wirklich gern an den Kopf werfen wollte.
»Aber du stinkst«, ließ Stanley ihn wissen und zog die Nase kraus. »Als hättest du irgendwo an einem Lagerfeuer gesessen und gesoffen.«
»Die Fahne kommt nicht von mir, sondern von Willow. Und ja, ich rieche nach Rauch. Weil ich die ganze Nacht in Admiral Hill war, um zu arbeiten. Dort hat nämlich schon wieder eine Lagerhalle gebrannt. Natürlich riecht ihr das. Jedenfalls hat Willow mich angerufen und gebeten, sie nach Hause zu fahren. Das habe ich gemacht. Ende der Geschichte. Ihr solltet euch jetzt alle hinlegen und weiterschlafen.«
»Es gab wieder ein Feuer?« Stanley setzte seinen Stadtratsblick auf und fixierte Carter.
»Ja. Und dieser Brand ist wie immer Gegenstand der Ermittlungen. Also«, er hob die Arme in einer entschuldigenden Geste, »kein Kommentar. Wie immer. Wenn du etwas wissen willst, wende dich an den Captain.«
»Du wirst ja wohl deiner Familie …«, begann Stanley.
Carter machte einen Satz nach vorn, bevor der Ältere seine Tirade beenden konnte. Willow, die nicht mit der Bewegung gerechnet hatte, kämpfte schwankend mit dem Gleichgewicht an seiner Seite und murrte irgendetwas Unverständliches. »Wir. Sind. Keine. Familie.«, sagte er mit Nachdruck. Seine Stimme klang kalt und emotionslos. Wie konnte Stanley es wagen? »Ich muss jetzt los«, ergänzte er und wandte sich zu seiner Schwester um. Sanft löste er Willows Hand aus seiner und lehnte sie mit der Schulter gegen die Wand. Er hatte versucht, ihr zu helfen, aber sie hatte sich selbst sabotiert. Jetzt konnte er nichts mehr für sie tun. Je länger er blieb, desto schlimmer machte er es vermutlich für sie. Also hob er die Hand zum Gruß und wandte sich zur Treppe um.
»So ist sie nur wegen dir«, zischte Stanley hinter ihm.
»Wie bitte?« Carter drehte sich noch einmal um.
»Das da.« Stanley wies mit einer ungehaltenen Bewegung auf Willows Outfit. »Sie läuft rum wie eine Nutte. Absolut billig. Sie ist völlig zugedröhnt. Das ist dein Einfluss.« Stanley war einen halben Kopf kleiner als Carter. Angst vor dessen finsterem Blick hatte er deshalb noch lange nicht. Dazu fühlte sich Stadtrat Stanley Logan grundsätzlich viel zu mächtig. »Halte dich von meinem Kind fern.«
»Na sicher.« Carter konnte sich den Sarkasmus in seiner Stimme nicht verkneifen, schließlich war er zwölf Jahre weg gewesen. Wenn hier irgendjemand keinen Einfluss auf Willow gehabt hatte, dann war er das gewesen. Er blickte zu seiner Mutter, die wie immer stumm und blass neben ihrem Mann stand, als heiße sie alles gut, was der Stadtrat sagte oder tat.
Mit einem leisen Kopfschütteln wandte sich Carter der Treppe zu. Seit er seine Sachen gepackt hatte und weggegangen war, hatte sich nichts, aber auch gar nichts zwischen ihnen geändert.
Er polterte die Stufen hinunter und ließ die Tür des Nebeneingangs hinter sich ins Schloss fallen. Die Sonne schob sich gerade über die Kante des Ozeans. Er roch das Meer. Hörte das Rauschen der Wellen unter der Klippe. Einen Moment atmete er tief durch. Spürte, wie sich sein Herzschlag langsam wieder beruhigte. Er würde jetzt nach Hause fahren. Und dann würde er schlafen. Über die Logans konnte er sich immer noch Gedanken machen, wenn er wieder wach war.
3
Nayas Arme vibrierten vor Anstrengung, als sie mit einem Cross gegen den Boxsack schlug, der vor ihr von der Decke baumelte. Sie spürte den Schweiß, der ihren Rücken hinunterrann, und boxte gleich noch einmal gegen das Leder, das träge vor ihr hin und her pendelte. Das alles machte sie nur, um fit zu bleiben. Fast. Boxen machte definitiv mehr Spaß, als zu joggen oder irgendetwas ähnlich Demoralisierendes. Und ja, sie hatte ein Bild des Detectives aus der Hölle (inklusive Teufelshörnern und Pferdefuß) vor ihrem inneren Auge an den Boxsack gepinnt.
Wie hatte dieser Kerl es schon wieder wagen können, in der Wohngruppe aufzutauchen und ihre Jungs unter Generalverdacht zu stellen? Wie konnte er es wagen, ständig bei ihnen auf der Matte zu stehen?
Natürlich bauten ihre Schützlinge Blödsinn – genau wie jeder andere in ihrem Alter. Sie tranken heimlich Alkohol, kifften hin und wieder. Und sicher beging der eine oder andere auch mal eine Straftat, Diebstahl oder Sachbeschädigung. Schließlich kamen die Jungs nicht unbedingt aus den besten Verhältnissen und mussten den einen oder anderen rechtlichen und moralischen Grundsatz erst noch lernen, weil sich bis jetzt niemand die Mühe gemacht hatte, ihnen das beizubringen.
Diese Kids wären definitiv ein größeres Problem, wenn sie nicht in ihrer Wohngruppe lebten, sondern noch immer auf der Straße – wo jeder Einzelne von ihnen herkam. Aus welchen Gründen auch immer sie dort gelandet waren. Wahrscheinlich wäre mindestens die Hälfte von ihnen Mitglied in irgendwelchen Gangs, und der eine oder andere hätte die Zeit als Obdachloser vielleicht gar nicht überstanden.
Naya hatte das Leben der Jungen niemals hinterfragt. Sie erzählten ihr nur von ihrer Vergangenheit, wenn sie das wirklich wollten.
Für diese verdammten Brände im Viertel waren sie jedenfalls nicht verantwortlich, nur weil sie weniger Chancen im Leben gehabt hatten als dieser schnöselige Cop.
Naya konnte einfach nicht anders. Wenn sie sich nicht hinter ihre Schützlinge stellte, tat das niemand. Wie es sich anfühlte, ganz auf sich allein gestellt zu sein, wusste sie nur zu gut. Das war etwas, das sie niemals vergessen würde. Und genau deshalb würde sie auch nie aufhören, ihre Kids zu beschützen.
Naya führte mit der linken Hand einen Job aus und schickte einen rechten Haken hinterher. Sie hasste es, dass dieser Mann die Macht hatte, sie zur Furie werden zu lassen. Schließlich reichte es bereits, dass sie sich ständig mit Typen wie diesem windigen Stadtrat Logan anlegen musste, der ihrem Viertel an den Kragen wollte. Auch wenn sie noch nicht herausgefunden hatte, wie. Ihr wäre es viel lieber, einen Verbündeten in den Reihen der Polizei zu haben, der die gleichen Ziele wie sie hatte. Aber das blieb wohl eine Illusion.
Ihr rechter Haken traf den Boxsack. Gefolgt von einem linken.
»Sie sieht echt gefährlich aus.«
»Das ist harmlos. Sie reagiert sich bloß ab. Manchmal braucht sie das, sagt meine Mom.«
»Wahrscheinlich braucht sie in Wirklichkeit einen meiner berühmten Magaritas. Aber die gibt es nur nach den Zumba-Kursen.«
Langsam drangen die Stimmen in Nayas Bewusstsein. Sie stoppte den hin und her schwingenden Boxsack, drehte sich schwer atmend um und wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn.
An der Bar, die heute nur Saft und Wasser für die Kinder ausschenken würde, lehnten Theo und Reeva, die nicht nur zu den Teilnehmern ihres Kurses »Selbstverteidigung für Mädchen« – der neulich in »Selbstverteidigung für Mädchen und Theo« umbenannt worden war – gehörten. Sie waren Familie.