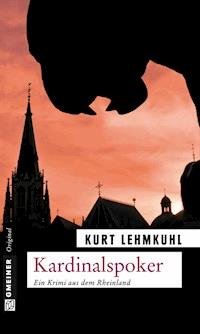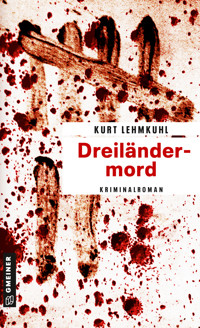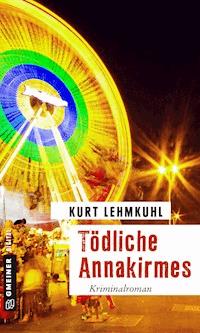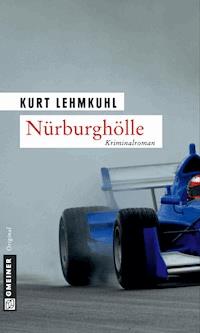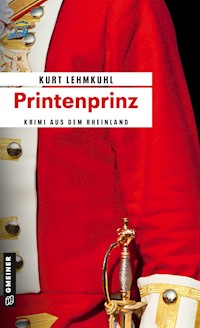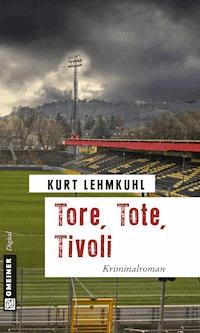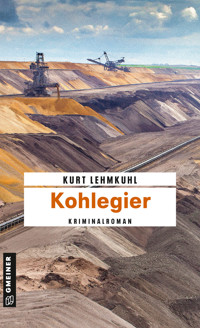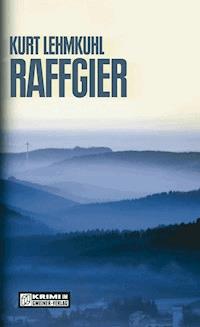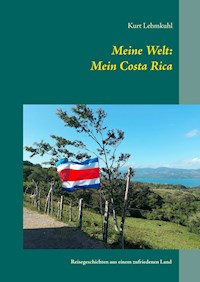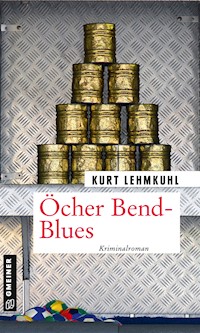
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Böhnke und Rechtsanwalt Grundler
- Sprache: Deutsch
Beim Öcher Frühjahrsbend beginnt eine Mordserie, die nach Taten auf dem Lambertusmarkt in Erkelenz, der Rheinkirmes in Düsseldorf, der Annakirmes in Düren und dem Pützchens Markt in Bonn-Beuel beim Sommerbend endet. Ein Bäcker aus Aachen, der wegen seiner verunreinigten Backwaren vor dem wirtschaftlichen Ruin steht, wird verdächtigt, die Morde aus Rache begangen zu haben. Niemand glaubt an seine Unschuld - bis auf der Kommissar außer Dienst Rudolf-Günther Böhnke und sein Freund, Rechtsanwalt Tobias Grundler …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Öcher Bend-Blues
Kriminalroman
Zum Buch
Poschweck bringt Tod Führt ein Aachener Bäcker einen Rachefeldzug gegen Schaustellergehilfen? Die Männer waren dringend verdächtig, im Vorjahr seine Tochter bedrängt zu haben, konnten aber nicht überführt werden. Nach den Morden auf dem Öcher Frühjahrsbend, dem Lambertusmarkt in Erkelenz, der Rheinkirmes in Düsseldorf, der Annakirmes in Düren und dem Pützchens Markt in Bonn-Beuel gibt es beim Sommerbend eindeutige Beweise gegen den Bäcker. Zugleich steht er vor dem Ruin. Seine Aachener Backspezialitäten, der Poschweck, das Streuselbrötchen und die Printen, sind durch Verunreinigungen ungenießbar geworden und gefährden Menschenleben. Die Behörden wollen die Großbäckerei deshalb schließen. In seiner Not wendet sich der Bäcker an den ehemaligen Kommissar Rudolf-Günter Böhnke und dessen Freund, Rechtsanwalt Tobias Grundler. Die Ermittlungen führen die beiden zu Aachener Backspezialitäten, hinter die Kulissen der großen Rummelplätze im Rheinland und zu einer Lösung, die sie niemals für möglich gehalten hätten …
Kurt Lehmkuhl, 1952 in der Nähe von Aachen geboren, war mehr als 30 Jahre lang als Redakteur im Zeitungsverlag Aachen tätig. Durch die Beschäftigung mit dem Strafrecht, im Rahmen seines Jurastudiums, hat er sehr früh damit begonnen Kriminalromane zu schreiben. Die Texte waren zunächst nur als Geschenke für Freunde gedacht. Zur ersten Veröffentlichung kam es eher zufällig. Inzwischen hat Kurt Lehmkuhl über 20 Romane veröffentlicht. „Öcher Bend-Blues“ ist sein zehnter Krimi rund um den Kommissar Rudolf-Günter Böhnke. Der Journalist und Schriftsteller ist auch als Volkshochschuldozent für kreatives Schreiben tätig.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Miss X / photocase.de
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6294-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
0
Dieses Frühjahr würde sein letztes sein. Er fühlte es. Er hatte eine Vorahnung, und auf seine Ahnungen hatte er sich immer verlassen können. Bald würde es so weit sein, würde sein irdisches Dasein ein Ende finden.
Nachdenklich zog er den kleinen Zettel aus seiner Jackentasche, auf den er die wenigen Sätze geschrieben hatte, die bald Wirklichkeit werden würden. Niemand kannte diese Notiz. Seine Liebste würde sie nach seinem Ableben finden. Bedächtig las er die Zeilen: »›Worauf wartest du eigentlich?‹, fragte mich der Mann, der sich auf der Bank auf dem Friedhof neben mich gesetzt hatte …«
Den Rest ersparte er sich. Er kannte den Text auswendig. Seufzend schob er den Zettel zurück in die Tasche.
Dem Text war nichts hinzuzufügen. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Er wusste, der würde ihn irgendwann unweigerlich aus dem Leben reißen. Nicht der Tod war das Übel, sondern das Sterben. Seine Krankheit war tückisch, eine Heilung ausgeschlossen. So genoss er die wenigen Tage oder Wochen, vielleicht Monate, die ihm noch blieben.
Er lächelte vor sich hin und blickte von seiner Bank durch die Grabreihen hinunter ins Tal. Die freie Fläche zwischen zwei grauen Grabsteinen war für ihn reserviert. Hier würde er noch in diesem Jahr seine letzte Ruhe finden. Da war er sich sicher. Es dauerte ihn nicht. Die Zeit war reif. Er hatte mehr Zeit verleben dürfen, als ihm die Mediziner zugebilligt hatten. Das war ein Geschenk, das er dankbar angenommen hatte.
Er spürte den leichten Windzug hinter sich. Ächzend erhob sich Böhnke und schaute sich um. Aber außer dem Rascheln des dichten Buschs hinter der Friedhofsbank nahm er nichts Ungewöhnliches wahr. Erst jetzt erblickte er die Frau, die ihm mit einer Gießkanne in der Hand auf dem Weg vom Eingangstor zu den Gräber entgegenkam. Winkend erwiderte er ihren Gruß. Dann erhob er sich und machte sich auf den Weg nach Hause. In ein paar Minuten würde ihn seine Liebste anrufen; wie immer zur gleichen Zeit.
So ein Mist, fluchte er vor sich hin. Hatte die Alte nicht eine Minute später kommen können? Dann hätte er längst dem Scheißkerl mit einer Drahtschlinge um den Hals den Garaus gemacht. Aber es war besser, rechtzeitig den Abflug zu machen, jegliches Risiko zu vermeiden und unentdeckt zu bleiben. Er würde eine zweite Gelegenheit bekommen, Böhnke zu töten. Hier auf dem Friedhof. Es war ein Spiel mit einem tödlichen Ausgang für den anderen Spielpartner.
Das war für ihn so sicher wie das Amen in der Kirche.
1. Aachen: Frühjahrsbend
»Bloß nicht. So einen Betriebsausflug mache ich nicht noch einmal mit«, maulte er ins Telefon und schüttelte mit dem Kopf, obwohl ihn niemand sehen konnte. »Ich komme nicht mit euch zum Öcher Bend.«
»Rudolf-Günther Böhnke, stell dich nicht so an wie ein sturer, alter Esel«, schallte die strenge Stimme seiner Lebensgefährtin in seinem Ohr.
»Lieselotte, erstens bin ich alt und zweitens nicht stur. Ich habe keinen Bock auf einen Bummel über den Rummel. Der letzte in Kornelimünster hat mir gereicht.«
»Erstens war das kein Rummel, sondern der Historische Jahrmarkt, und zweitens muss ja nicht jeder Betriebsausflug mit Mord und Totschlag verbunden sein«, entgegnete die Frau genauso entschlossen wie er. »Also, wir erwarten dich um 19 Uhr am Haupteingang zum Bendplatz an der Ecke Süsterfeldstraße und Kühlwetterstraße.«
»Nein.«
»Doch! Oder willst du etwa die Scheidung?«
»Geht nicht«, knurrte Böhnke.
»Na gut, dann eben nicht.« Lieselotte lachte herzlich. »Ich freue mich auf dich, Commissario. Und jetzt mach dich endlich vom Acker.«
»Wieso?«, fragte Böhnke verblüfft.
»Ich spüre doch, dass du schon auf dem Sprung zu deinem Spaziergang bist. Stimmt’s?«
»Stimmt.« In der Tat wollte Böhnke nach dem morgendlichen kleinen Hausputz seinen üblichen Gang durch Huppenbroich machen und wartete nur darauf, dass Lieselotte das Telefonat endlich beendete.
»Übrigens: Dein Freund Tobias hat einen neuen Auftrag für dich.«
»Was denn?«, fragte Böhnke spontan. Seit den letzten Einsätzen auf dem Historischen Jahrmarkt in Kornelimünster und bei einer Scheidungsangelegenheit waren etliche Monate und ein kalter Winter vergangen, da konnte er ein wenig Abwechslung gebrauchen.
»Worum es geht, wird er dir heute Abend sagen. Ich möchte dich nur bitten, Tobias behilflich zu sein.«
»Warum?«
»Weil es sich um eine unangenehme Angelegenheit handelt, in die ein Verwandter von mir verwickelt ist. Alles Weitere erfährst du heute Abend, mein Lieber.«
Ein Verwandter seiner Lebensgefährtin wurde von seinem Freund anwaltlich vertreten; da konnte er nicht ablehnen, da musste er helfen. Das stand für Böhnke außer Frage, als er nachdenklich durch Huppenbroich stapfte und sich über die erwachende Natur freute. Als er vor sechs, sieben Jahren nach seiner vorzeitigen Pensionierung aus Krankheitsgründen aus Aachen in den kleinen Ort in der Nordeifel gezogen war, hatte er gehofft, dort einen geruhsamen Lebensabend verbringen zu können, aus dem er jederzeit von seiner Krankheit gerissen werden konnte. Er bereute nicht, dass es anders gekommen war. Im Gegenteil: Mit jedem Verbrechen, das er aufklären konnte, hatte sich seine Lebenszeit zwangsläufig und glücklicherweise verlängert. Wenn’s denn half, würde er gerne bei dem Fall von Lieselottes Verwandten mitmischen, auch wenn er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, um wen es sich dabei handeln könnte. Selbst bei angestrengtem Nachdenken fielen ihm keine Menschen ein, mit denen Lieselotte verwandt war. In den über 30 Jahren ihres Zusammenseins hatte er vielleicht dreimal einen Menschen getroffen, den Lieselotte als entfernten Cousin oder als Tante über mehrere familiäre Ecken bezeichnete. Er kannte seine Partnerin als respektierte Apothekerin in Aachen, die hoffentlich bald zu ihm nach Huppenbroich zog. So hatten sie es vor ein paar Jahren ausgemacht, als er seine Wohnung in Aachen aufgegeben und in das Ferienhaus von Lieselotte gezogen war.
Der Gedanken an den ominösen Verwandten ließ Böhnke ebenso nicht los wie der Hinweis, dass Grundler ihn als Rechtsanwalt vertrat. Wenn er richtig überlegte, übernahm Tobias Grundler fast immer eigentlich hoffnungslose Fälle. In seiner Zeit als Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte im Polizeipräsidium Aachen hatte Böhnke etliche Fälle mit Grundler ausgefochten, und mehr als einmal war es dank ihrer Zusammenarbeit gelungen, Verbrechen aufzuklären und Unschuldige vor einer Haftstrafe zu bewahren. Der rund 20 Jahre jüngere Anwalt war sein Freund geworden, lange Zeit sogar sein einziger Freund gewesen; wenn er denn je einen Sohn gehabt hätte, dann wäre er wohl so wie Tobias gewesen. Für ihn ging er durchs Feuer, so wie es Tobias auch für ihn tun würde.
Kurz musste Böhnke sich orientieren, wohin ihn sein Spaziergang geführt hatte. Ohne auf den Weg zu achten, war er ins Tiefenbachtal gelaufen und von dort am Schullandheim vorbei durch den Wald. Langsam wurde es Zeit für den Rückweg. Er wollte noch zu Billas Haus, um dort Büroarbeiten für die Stiftungen zu erledigen, bevor er sich auf den Weg nach Aachen machte.
Die Geschichten um Billas Haus und die Stiftungen waren auch welche gewesen, die mit den aufgeklärten Verbrechen der letzten Jahre zu tun hatten. Seine Erfolgsprämien hatten unter anderem den Grundstock für die Stiftungen gelegt und den Hauskauf möglich gemacht.
»Kommst du auch noch mal? Wir hatten 19 Uhr ausgemacht, wenn ich mich nicht irre. Wir wollten schon eine Vermisstenmeldung aufgeben.« Was wie ein Vorwurf klang, war zärtlich gemeint. Lieselotte hatte mit ihren Begleitern am Eingang vor der Kontrolle gewartet und ihn liebevoll auf die Wange geküsst.
»Bedankt euch beim ÖPNV«, schimpfte Böhnke. »Die Einzigen, die an die Zeiten auf den Fahrplänen glauben, sind wohl die zahlenden Kunden. Für die Busse sind die nur unverbindliche Absichtserklärungen. Kein Anschluss passt. Von Simmerath bis hier habe ich über zwei Stunden gebraucht und dafür auch noch 5,40 Euro bezahlt.«
»Selbst schuld«, meinte Grundler lachend, als er Böhnke die Hand reichte. »Kauf dir endlich einen eGo, klein, fein, praktisch und nicht teuer. Der rechnet sich für dich, jetzt, da du die Solaranlage auf dem Dach hast, mit der du mehr Strom produzierst, als du je verbrauchen kannst. Quasi bezahlt dir die Sonne die Kosten für das Auto aus Aachener Produktion.« Grundler, groß und schlank wie Böhnke auch, sah ihm mit stahlblauen Augen freundlich ins Gesicht. Wie immer war er lässig-schlabbrig mit grauem Sweatshirt und Bluejeans bekleidet.
»Du wirst langsam alt, mein Freund«, meinte Böhnke musternd und vom Thema ablenkend. »Kann es sein, dass das Grau in deinen blonden Haaren langsam Überhand gewinnt?«
»Na und«, mischte sich Sabine ein, nicht nur berufliche, sondern auch private Partnerin von Grundler. »Grau macht sexy. Du bist da das große Vorbild.« Kurz kraulte sie durch Böhnkes kurzgeschnittenes Haar. »Lass dich umarmen, du alter, sexy Mann.«
»Dann können wir ja endlich unseren Rummelbummel hinter uns bringen«, meinte Böhnke mit gespielter Verlegenheit. Er mochte die lebhafte Frau mit den langen blonden Haaren, die auch mit 40 Jahren nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt hatte. »Oder warten wir noch auf jemanden?«
»Meinst du etwa mich, mein Freund?« Eine Stimme hatte sich in Böhnkes Rücken bemerkbar gemacht.
»Lennet, habe ich mir doch gedacht, dass ich vor dir nirgends sicher bin.« Böhnke drehte sich langsam um und umarmte den hochaufgeschossenen, hageren Mann mit den schütteren langen schwarzen Haaren.
»Und ich hatte gedacht, du hättest Sehnsucht nach mir«, entgegnete die spindeldürre Gestalt, die nur aus Haut und Knochen zu bestehen schien und ganz in Schwarz gekleidet war. Der Mann wirkte wie ein Abbild des sagenumwobenen Aachener Originals Lennet Kann, was ihm zwangsläufig den Spitznamen eingebracht hatte. Inzwischen waren sogar schon einige Karnevalsgesellschaften auf die Idee gekommen, ihn bei Veranstaltungen als Kultfigur über die Bühnen, das Liedchen vom Lennet Kann singend, tanzen zu lassen. Joachim Herbst hatte tatsächlich, zu Böhnkes Verwunderung, zugestimmt. Doch als die Veranstalter seine Honorarforderung hörten, hatten die Sitzungsgestalter der Karnevalisten und auch das Fernsehen als Produzent der Gala anlässlich des Ordens wider den tierischen Ernst abgewinkt, nachdem Herbst die Summe von 5.000 Euro für einen Auftritt wie selbstverständlich und als angemessen erachtet hatte. Er wollte das Geld nicht für sich, es sollte in eine der Stiftungen fließen, die Sabine, Grundler und Böhnke gegründet hatten und die in Billas Haus in Huppenbroich ihre Bleibe hatte. Viele Honorare und Spenden waren darin schon eingezahlt worden. Der Stiftungsrat konnte einige prominente Namen aufweisen wie den des Kölner Oberbürgermeisters oder den eines Aachener Printenbarons sowie den einer steinreichen Immobilienbesitzerin aus der Kaiserstadt. Die wenigsten in Aachen wussten, dass Herbst Staatsanwalt in Koblenz gewesen war, der nach seiner aufgezwungenen Pensionierung in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Bei seinem letzten Fall als Staatsanwalt hatte er Böhnke kennengelernt. Gemeinsam hatten sie das dubiose Geschehen um einen Arzt und Klinikbetreiber aufklären können und sich dabei angefreundet. Nunmehr bildeten Böhnke, Grundler und Herbst ein Trio, das vor einigen Monaten gemeinsam einen perfiden Mord aufgeklärt und einer Frau die Freiheit verschafft hatte.
»Auf dein Honorar für uns warten wir immer noch«, feixte Herbst, als er sich mit den anderen auf den Weg über den Bend machte. »Ich habe übrigens meine Zulassung als Rechtsanwalt beantragt, damit ich dich deswegen verklagen und mich selbst vertreten kann, Tobias.«
»Greif mal einem nackten Mann in die Tasche«, entgegnete Grundler lässig, »aber vielleicht springt ja für dich und den Commissario bei meinem neuen Mandat etwas raus.«
»Worum geht es denn?«, wollte Böhnke wissen. Er hatte Mühe, in der Menschenmenge den Anschluss zu halten.
»Erzähl ich euch gleich. Ich habe in einer Bierbude einen Tisch für uns reservieren lassen«, antwortete Grundler.
Böhnke war froh, als sie sich in dem großräumigen Holzhaus, das mit der Bezeichnung »Bierbude« von Grundler nur unzureichend beschrieben worden war, in einer ruhigen Nische niederlassen konnten. Das Geschubse und Gedränge auf dem Weg entlang der Buden und Fahrgeschäfte, die lauten Rufe der Losverkäufer, die schrille Musik, das Schreien und Kreischen der Menschen, das Rumpeln und Grollen von den Fahrgeschäften, diese Mischung ging ihm auf die Nerven. Schon der Einlass hatte ihn verärgert. Sich von einem jungen Schnösel abtatschen zu lassen, der in einer schwarzen Uniform als Sicherheitsdienst fungierte, ging ihn gehörig auf den Nerv. Stand es so schlecht um die Sicherheit, dass sich jeder Kirmesbesucher von jedem Hinz und Kunz in Uniform begrapschen lassen musste? Nach dem Anschlag auf das Oktoberfest in München vor etlichen Jahren waren die Einlasskontrollen eingeführt und im Laufe der Jahre sogar noch verstärkt worden. Böhnke brauchte diesen Unfug nicht, den er einigen wenigen Dummbacken zu verdanken hatte. Und das war nur der Anfang vom Rummel gewesen. Er brauchte weder Achterbahn noch Wikingerschiffsschaukel, weder den grellgrünen, plastikflauschigen Riesenteddy von der Losbude noch die unnötige Papierrose aus der Schießbude, und ein unsägliches Lebkuchenherz würde er seiner Liebsten niemals kaufen.
Aber ehe er überhaupt dazu Gelegenheit haben könnte, musste er sich zunächst durch eine Budengasse schieben lassen, in der nur Zeug zum Kauf angeboten wurde, das nach seiner Vorstellung nichts mit einer Kirmes zu tun hatte. Gürtel, Schuhe, Taschen, Kleider oder Sonnenhüte und Brillen waren etwas für einen Trödelmarkt, aber doch nichts für eine Kirmes!
»Du bist zu alt für den Rummel«, meinte Lieselotte zu ihm. Sie hatte sich bei ihm untergehakt, nachdem sie seinen Unmut bemerkt hatte. »Wenn du willst, fahre ich dich heute noch zurück zum Hühnerstall. Du kannst aber auch gerne bei mir übernachten. Ich lass dir dann garantiert deine Ruhe.«
»Wie kann ich bei einer so schönen Frau wie dir Ruhe finden?« Böhnke freute sich, dass Lieselotte erkannt hatte, wie unwohl er sich in dieser hektischen und lärmenden Umgebung fühlte. Ohne sie wäre er wohl nicht so alt geworden. Wie sehr er sie brauchte und wie sehr sie miteinander verwoben waren, hatten sie spätestens dann gemerkt, als sie beide mit dem Tod gerungen und sie nur dank Grundlers Hilfe überlebt hatten.
Nach dem Zwischenfall gestern Nachmittag auf dem Friedhof hatte er eigentlich das Gefühl, er müsse mit ihr darüber sprechen. Er fühlte sich nach der merkwürdigen Begegnung unwohl. Doch er schob seine Absicht beiseite. Später war auch noch Zeit dafür.
»Unsinn. Ich bin eine alte Pappschachtel«, widersprach Lieselotte vergnügt und unterbrach seine Gedanken. »Fast im Ruhestand, grau, schwerhörig und Brillenschlange.«
»Genau das, was ich mir wünsche«, brummte Böhnke. »Ich freue mich auf die Zeit mit dir in Huppenbroich.« Mit Lieselotte eng an seiner Seite ließ sich der Gang über den Bend leichter ertragen. Wenn da nur nicht diese Duftmischung gewesen wäre, bei der mal Reibekuchen, dann Bier, mal Bratwürstchen, dann Wein die Oberhand behielten.
»Wir sind halt nicht wie in Huppenbroich im Buchenwald«, bemerkte Lieselotte dazu nur.
»Und so was nennt sich nun Betriebsausflug«, knurrte Böhnke. »Das sagt Tobias doch nur, damit er die Kosten für unsere Bewirtung bei seiner Steuererklärung absetzen kann.«
»Wenn’s weiter nichts wäre«, erwiderte der Anwalt gelassen. »Aber wir sind nicht zum Vergnügen hier.« Er schaute sich suchend um. »Wir treffen uns mit einem Mandanten. Der kann euch dann berichten, in was für eine unangenehme Sache er hineingeraten ist.«
»Dem Verwandten von Lieselotte?« Böhnke wusste nicht, ob er irritiert sein oder sich über die kirmesuntypische Gesprächsrunde freuen sollte.
»Ich wusste gar nicht, dass Werner Kühlbrenner mit dir verwandt ist«, sagte Grundler, an Lieselotte gewandt, staunend.
»Ist das der Bäckermeister?«, fragte Böhnke verwundert. »Warum hast du mir das nicht gesagt? Seit wann bist du mit dem verwandt?«
»Kühlbrenner ist wie ich alter Öcher Adel. Und deshalb sind wir verwandt«, antwortete Lieselotte lächelnd.
»Dann sind wir ja auch verwandt«, mischte sich Herbst ein, bevor sich Böhnke die passende Entgegnung ausdenken konnte. »Meine Familie stammt ebenfalls seit Generationen aus Aachen.«
»Und wenn ihr in euren Stammbäumen bis zum Jahr 800 zurückblickt, werdet ihr mit Sicherheit feststellen, dass Karl der Große irgendwie in der Verästelung des familiären Wurzelwerks seine Spuren hinterlassen hatte.« Böhnke stöhnte theatralisch. Die Aachener und ihr Selbstverständnis hatten ihn immer schon gestört. Die erachteten sich auch heutzutage noch als Nachfolger und Statthalter von Kaiser Karl. Das war wie eine Blutsbrüderschaft oder ein Band, das alle miteinander verknüpfte, die seit Generationen in dieser Stadt beheimatet waren. Er als Zugezogener konnte und wollte diese Verbundenheit nicht verstehen. Lieselotte und Herbst machten mit ihrer Aachen-Manie keine Ausnahme.
»Dann ist das quasi ein Familientreffen, bei dem wir als Zugezogene gerade einmal geduldet sind.« Böhnke grinste. »Ihr beiden könnt euch ja mit eurem Verwandten Kühlbrenner unterhalten, während wir euren Familieninterna lauschen.«
»Spiel nicht die beleidigte Leberwurst«, ließ sich Herbst vernehmen. Er richtete seinen Blick auf Grundler. »Ist das der Kühlbrenner, der überall in Aachen seine Filialen individuell gestaltet hat mit Gemälden aus der jeweiligen Umgebung?«
»Genau der«, bestätigte der Anwalt. »Aber er ist nicht der Einzige, der das macht. Das macht die Bäckerei Moss ebenfalls und zwar mit sehr großem Erfolg.«
»Was hat der Kühlbrenner getan? Hat der in einer Filiale den Aachener Dom mit einem Wetterhahn versehen und damit den Bischof beleidigt?«
»Commissario, wenn das der Fall wäre, würde ich dich und Lennet nicht behelligen. Dann hätte ich einen Kunstmaler beauftragt, das Gemälde zu überarbeiten. Aber lasst euch von Kühlbrenner selbst erzählen, was Sache ist.« Grundler hatte sich erhoben und machte ein paar Schritte in den Gang, um einen Mann zu begrüßen und zum Tisch zu geleiten.
Der Händedruck war kräftig, der Blick offen und freundlich, stellte Böhnke fest, als Kühlbrenner ihn bei der Vorstellungsrunde begrüßte. Der stämmige Mann, den er auf Mitte 40 schätzte, wirkte sympathisch auf ihn. Böhnke erinnerte sich an einen Zeitungsartikel vor wenigen Wochen, in dem über eine millionenschwere Investition von Kühlbrenner berichtet wurde. Der Bäckermeister hatte in einem Gewerbegebiet in Verlautenheide seine Backfabrik von Grund auf modernisiert. Ob er sich damit finanziell verhoben hatte, mutmaßte Böhnke, und brauchte deshalb die Unterstützung von Grundler? Er verwarf den Gedanken als abwegig. Kühlbrenner vermittelte nicht den Eindruck, als stünde er knapp vor einer Insolvenz. Der Bäcker trat souverän auf, nicht wie ein Bittsteller und auch nicht wie jemand, der etwas auf dem Kerbholz hatte.
»Poschweck«, sagte Herbst unvermittelt, womit er Böhnke aus seinen Gedanken weckte. »Stimmt’s?«
»Stimmt«, antwortete Kühlbrenner grinsend.
»Wie? Was? Wo?« Böhnke fühlte sich aus seinem eigenen Film gerissen und in einen anderen versetzt. Er dachte noch über Kühlbrenner nach, derweil Herbst ein anderes Thema aufbrachte.
»Du kriegst auch nichts mit da hinten in der tiefsten Eifel«, lästerte Lieselotte. »Herr Kühlbrenner hat in der Osterzeit eine uralte Aachener Tradition aufleben lassen. Nicht wahr?« Sie munterte den Mann mit einem freundlichen Nicken auf fortzufahren.
»So ist es. Früher, bis ins 18. Jahrhundert, war es üblich, dass die Bäcker in Aachen zur Osterzeit ein sogenanntes Osterbrot, den Poschweck, an die Bürger verschenkten. Dann kam die Tradition zum Erliegen, weil die Geschenke den Bäckern zu teuer wurden. Erst als die Öcher protestierten und sogar in den Streik traten, wurde der Poschweck wieder gebacken, dann aber günstig verkauft. Ich habe jetzt die Tradition wieder aufgenommen, um zur Osterzeit den Poschweck an Altenheime und an die Aachener Tafel zu verschenken. Das hat mir durchaus Aufmerksamkeit gebracht. Die Werbewirksamkeit war enorm …«
»… und hat Ihre Konkurrenten auf den Plan gerufen. Die sind jetzt beleidigt«, unterbrach Lieselotte.
»Mitnichten, meine liebe Frau Kleinereich. Die finden die Idee so gut, dass sie im nächsten Jahr mitmachen wollen. Dann wird es in vielen Aachener Bäckereien statt Ostereier einen Poschweck als Geschenk geben.«
»Und was ist jetzt ein Poschweck?«, fragte Böhnke. Seine Stimme klang verärgert, obwohl er sachlich bleiben wollte. Aber er mochte es nicht, wenn jemand seine Lieselotte vertraulich mit dem Namen ansprach.
»Commissario, man merkt, dass du kein Öcher bist und niemals ein Öcher werden wirst«, meinte Lieselotte vergnügt. »Ich kenne noch Werners Vater. Die Familie Kühlbrenner ist schon seit Generationen Kunde meiner Apotheke.«
»Die du schon seit der Zeit von Kaiser Karl betreibst«, lästerte Böhnke.
»Blödmann. Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Meine Eltern und meine Großeltern haben schon Medikamente gemixt und verkauft.«
»Sag ich doch: seit der Zeit von Kaiser Karl.« Böhnke winkte ab. »Sagt mir doch endlich, was ein Poschweck ist.«
»Ein Poschweck ist ein Brot, das es nur in Aachen gibt und das ursprünglich, wie gesagt, nur um die Wochen rund um Ostern gebacken wurde. Daher auch die Bezeichnung ›Osterbrot‹«, erklärte Kühlbrenner. »Inzwischen wird es das ganze Jahr über verkauft. Im Prinzip ist es ein weißes Kastenbrot mit einer Besonderheit: Auf den Teig werden Zuckerstückchen gelegt, die beim Backen zum Teil schmelzen und in den Teig fließen und zum Teil oben auf der Kruste bleiben.«
»Einfach lecker«, meinte Lieselotte zuckersüß mit Blick auf Böhnke, »aber du bist ja eher der salzige Typ, mein Lieber.«
»Deshalb gibt es ja auch Salzstreuer hier auf dem Tisch und keine Zuckerdose«, entgegnete er. »Ich hoffe nur, du hast für heute Abend nicht Poschweck für alle als Essen bestellt, Tobias.«
»Und warum erzählen Sie uns das mit dem Poschweck, Herr Kühlbrenner? Beziehungsweise warum sind Sie Mandant meines Freundes Grundler in einer Angelegenheit, die so misslich ist, dass ich und mein Freund Herbst bei ihrer Bewältigung mitmachen sollen?«
»Du hättest Anwalt werden können«, meinte Lieselotte lästernd, »so wie du dich ausdrückst. Frag doch einfach, was können wir für Sie tun, Herr Kühlbrenner?« Sie lächelte den Bäcker aufmunternd an, der nickend mit einer Serviette den Mund abtupfte.
»Also, um es kurz zu machen: Es geht tatsächlich um den Poschweck, besser gesagt, um meinen Poschweck. Deshalb habe ich das Ordnungsamt, das Gewerbeaufsichtsamt und die Staatsanwaltschaft an der Backe.«
»Warum?«, fragte Herbst.
»Mehrmals wurden in Poschwecks aus meiner Backstube Glassplitter gefunden. Das ist nicht nur unappetitlich, das ist auch lebensgefährlich. Gott sei Dank ist noch nichts Schlimmeres passiert. Kunden haben rechtzeitig bemerkt, dass die Brote nicht in Ordnung waren. Einige haben mich informiert, andere sind sofort zur Polizei gegangen.« Kühlbrenner zuckte mit den Schultern. »Jetzt habe ich den Ärger.«
Herbst räusperte sich. »Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt? Sie sagten ja, dass mehrmals in Poschwecks aus Ihrer Backstube die Glassplitter gefunden wurden.«
Kühlbrenner nickte. »Richtig. Insgesamt bei vier Backvorgängen in zwei Wochen.«
»Die betroffenen Poschwecks wurden immer in derselben Filiale verkauft?«
»Nein«, antwortete der Bäcker betrübt. »In vier verschiedenen Verkaufsstellen im Stadtgebiet, in Eilendorf, in Vaalserquartier, in Laurensberg und in Haaren. Von dort jedenfalls haben wir Rückmeldungen erhalten.«
»Und seit wann gibt es diese Zwischenfälle?«
»Seit rund um Ostern bis vor vier Wochen.«
»Und seitdem haben Sie nichts mehr gehört?« An seiner Angewohnheit, die meisten seiner Fragen mit einem »und« zu beginnen, störte sich Böhnke nicht mehr.
Kühlbrenner lächelte gequält. »Seitdem habe ich tatsächlich nichts mehr gehört. Das liegt aber daran, dass ich seitdem keine Poschwecks mehr backe. Nicht weil ich nicht möchte, sondern weil niemand mehr die Ware bei mir kaufen will.«
»Treibt Sie das in den finanziellen Ruin?«, fragte Herbst unverblümt.
»Das gerade nicht. Aber es schadet meinem guten Ruf.«
»Zufall oder Absicht?« Herbst stellte die Frage, über die Böhnke gerade nachdachte.
»Keine Ahnung.« Kühlbrenner streckte die Arme, als wolle er sich ergeben. »Meine Leute und ich haben den Betrieb auf den Kopf gestellt. Wir finden keine Erklärung und keine Ursache.«
»Dafür haben wir ja die Herren Böhnke und Herbst.« Grundler mischte sich in das Gespräch ein. »Deine Zustimmung voraussetzend, habe ich meine beiden Freunde ins Boot geholt. Die werden eine Erklärung und die Ursache herausfinden.« Er grinste. »Wenn wir beweisen können, dass die Verunreinigungen der Poschwecks nicht bei Arbeitsschritten in deinem Unternehmen verursacht wurden, haben wir schon gewonnen. Dann kann dir keine Behörde etwas.«
»Nur mein Ruf, der bleibt angeknackst. Was da abgeht, ist Geschäftsschädigung und Sabotage.«
»Das legt sich wieder«, beschwichtigte Grundler den erzürnten Mann. »Ich weiß, wovon ich rede.« Sein Ruf hatte gelitten, als ihm eine Staatsanwältin sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte. Herbst hatte die Haltlosigkeit der Behauptung herausgefunden. Obwohl sich die Anwältin offiziell und auf allen Kanälen bei Grundler entschuldigt hatte, hatte es Monate gedauert, bis das leidige Thema aus den Köpfen der Menschen war. Bei Kühlbrenner würde es nicht anders sein. Irgendwann würde er seinen Poschweck wieder backen können und die Menschen würden ihn unbesorgt kaufen und verzehren, wenn stimmte, was Kühlbrenner ihnen berichtet hatte. Böhnke und Herbst würden herausfinden, was tatsächlich in der Backstube und in den Filialen passiert war. »Lass das mal unsere Sorge sein, Werner«, meinte der Anwalt beruhigend, »wir holen dich aus dem Schlamassel heraus.«
»Wenn der Poschweck meine einzige Sorge wäre, dann ginge es mir gut«, sagte Kühlbrenner grüblerisch. »Familiär mache ich mir viel mehr Sorgen. Aber das ist privat und braucht euch nicht zu belasten.« Er lächelte. »Hat ja auch nichts mit meinem Poschweck zu tun.« Er schlug in die Hände, als wolle er Zuversicht herbeiklatschen. »Wir sin nich op der Bend um Trübsal ze blose. Lot jonn. Ich lade euch zu einem Bummel ein. Und wehe, ihr geht nicht mit mir aufs Riesenrad!«
Böhnke wusste nicht, wie er den Abend voller Rummel auf dem Bend überstanden hatte. Die flackernden Lichter, die grellen Töne, die undefinierbare Duftwolke, die Raserei auf der Achterbahn, der Trubel, die zunehmende Ausgelassenheit der Besucher mit steigendem Alkoholgenuss waren zu viel für ihn gewesen. Er war froh, als Kühlbrenner sich von ihnen verabschiedete und er mit Lieselotte den Heimweg vom Bendplatz zur Elisabethstraße antreten konnte.
Im Traum erschien ihm die Kirmes wieder mit all ihren Farben, Düften und Geräuschen und auch mit dem Blaulicht der Polizeiwagen und dem Martinshorn des Rettungsdienstes.
*
Böhnke hatte am Mittag gerade den Linienbus nach Simmerath bestiegen, als der Radetzkymarsch erklang, mit dem sich das Handy in seiner Hosentasche meldete.
»Ich höre.« Nicht einmal ein Dutzend Menschen kannte seine Rufnummer.
»Commissario, du musst in die Kanzlei kommen«, sagte Sabine mit dringlicher Stimme. »Am besten sofort.«
»Und warum?«
»Kühlbrenner hat sich zu einem Gespräch angemeldet!«
»Hat er jemanden umgebracht?«
»Er nicht, aber vielleicht sein zukünftiger Schwiegersohn. Der jedenfalls wurde heute Morgen unter Mordverdacht festgenommen. Jetzt soll Tobias ihn verteidigen.« Mehr könne sie nicht sagen, meinte Sabine. Aber es könne sich um eine heftige Sache handeln. »Ich suche dir alles raus, was ich finden kann.« Sie hustete kurz. »Lennet habe ich nicht erreichen können. Der hat wohl wieder Putztag.«
»Ich bin schon unterwegs.« Kurzerhand stieg Böhnke an der nächsten Haltestelle wieder aus dem Omnibus. Dann würde er halt ohne Herbst bei Grundler auftauchen. Immer wenn der ehemalige Staatsanwalt unerreichbar war, legte er nach ihrer Lesart einen Putztag ein, so umschrieben sie den Umstand, dass sich Herbst wahrscheinlich mit seiner Putzfrau einen vergnüglichen Tag machte. Nach kurzem Nachdenken über die beste Strecke machte Böhnke sich zu Fuß auf den Weg zur Kanzlei an der Theaterstraße. Schneller wäre er mit dem Bus oder einem Taxi in der Innenstadt auch nicht.
Grundler sei noch in der JVA. Er versuche, Paul Mertens aus der Untersuchungshaft loszueisen, erklärte Sabine. »Das ist der Schwiegersohn in spe von Kühlbrenner.« Sie zauderte. »Aber ich bin skeptisch, ob die Freilassung gelingen wird. Tobias kann es dir genauer erklären, wenn er zurück ist.« Sie gab Böhnke eine Handakte, in der sich ein Stapel Papiere befand. »Inzwischen kannst du dich über das Wespennest informieren, in das wir gerade hineintreten.«
»Ich bin Schlimmeres gewöhnt.« Bepackt mit den Papieren, machte Böhnke es sich an Grundlers Schreibtisch bequem. Unordnung konnte er darauf nicht verbreiten. Abgesehen von einem zugeklappten Laptop war die Glasscheibe leer.
Schon nach dem Lesen der ersten Zeilen eines Polizeiberichts wusste Böhnke, was Sabine gemeint hatte und was Kühlbrenner hatte sagen wollen, als er von seinen familiären Sorgen sprach. Während des letztjährigen Frühjahrsbends war seine Tochter Franziska verschleppt und brutal vergewaltigt worden. Die 18-Jährige war nach einem Treffen mit Freundinnen verschwunden und wurde erst zwei Tage später schwer verletzt von Spaziergängern im Aachener Wald aufgefunden. Ihre Peiniger hatten sie dort unter modrigem Laub in einem Grabloch verscharrt, wohl in der Erwartung, sie würde dort krepieren. Erst nach einwöchiger ärztlicher Behandlung war die junge Frau in der Lage gewesen, über ihr Martyrium Aussagen machen zu können. Vermutlich war ihr letztes Getränk an einer Cocktailbar mit K.-o.-Tropfen versetzt worden, die auf dem Nachhauseweg wirksam wurden. Franziska hatte sich von ihren Freundinnen verabschiedet und sich alleine davongemacht. Die Verabschiedung am Tor zum Bendplatz an der Kühlwetterstraße, von dem es geradeaus in die Kruppstraße ging, war auf einem Überwachungsvideo ebenso deutlich zu erkennen wie die Gruppe von vier Männern, die ihr folgte. Wie die Freundinnen und eine Bedienung übereinstimmend aussagten, hatten die vier schon an der Bar versucht, mit den Frauen und insbesondere mit Franziska in Kontakt zu treten, waren aber abgeblitzt. Wie genau die lähmenden Tropfen in das Getränk gelangen konnten, konnte ebenso wenig geklärt werden wie die Identität der anderen Gäste.
Bei den vier Männern, die durch ihr großes Interesse an Franziska aufgefallen waren, handelte es sich um Mitarbeiter eines Schaustellers aus Köln. Schon seit Jahren waren sie beim Aufbau, dem Betrieb, dem Abbau und dem Transport der Geisterbahn dabei, mit der der Eigentümer viele Kirmessen im Rheinland und darüber hinaus bespielte. Ihre Vernehmung erfolgte erst Wochen später, nachdem ihre Identität geklärt war. Die vier stritten die Tat ab. Sie bestätigten, dass sie zwar die Absicht gehabt hatten, mit den Frauen zu flirten, hätten aber schnell eingesehen, dass sie keinen Erfolg haben würden. Es stimme, dass sie hinter den Frauen den Bendplatz in Richtung Kruppstraße verlassen hätten, sie wären ihnen aber nicht gefolgt, sondern seien über den Pontwall und am Ponttor vorbei an der Pontstraße in eine Kneipe gegangen. An deren Namen konnten sie sich nicht erinnern. In den von der Polizei aufgesuchten Gaststätten im Vergnügungsviertel hatten die Männern offenbar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Man konnte weder bestätigen noch abstreiten, dass sie dort gewesen waren oder gewesen sein wollten. Bereitwillig hatten die Männer Speichelproben abgegeben, deren Auswertung ergebnislos blieb. Ihre DNA waren nicht auf der Kleidung und dem Körper von Franziska vorhanden. Auch die von ihnen zugestandene Durchsuchung ihres Wohnwagens brachte keinen Treffer. Die mögliche Hoffnung, dort das Fläschchen mit den K.-o.-Tropfen oder Hinweise darauf zu finden, erfüllte sich nicht.
Die Erinnerung von Franziska an das Verbrechen war und blieb äußerst lückenhaft. Ob das von ihr zu Protokoll Gegebene dem tatsächlichen Geschehen oder ihrer Vorstellung entsprach, war nach Auffassung der Polizei nicht eindeutig auseinanderzuhalten. Franziskas Widersprüche erklärten sie mit ihrem psychischen und körperlichen Zustand. Bei ihrer ersten Vernehmung konnte sich Franziska an nichts mehr erinnern, nicht einmal an den Kirmesbummel mit ihren Freundinnen und an das letzte Getränk an der Cocktailbar. Nach dem Betrachten des Überwachungsvideos glaubte sie, die vier Männer wiedererkannt zu haben. Was auf ihrem Weg nach Hause geschah, wusste sie zunächst nicht, dann meinte sie, die vier hätten sie angesprochen, dann verwarf sie die Aussage wieder, um später zu sagen, die vier hätten sie mitgeschleppt. Auf Fotografien glaubte sie zunächst, alle wiederzuerkennen, bei der nächsten Vernehmung war sie sich nur bei zweien sicher, bei der dritten erkannte sie alle vier erneut.
Polizei und Staatsanwalt stimmten schließlich darin überein, kein Verfahren einzuleiten. Selbst wenn unterstellt würde, die vier Männer hätten Kontakt zu Franziska aufgenommen, war nicht zu beweisen, dass sie die Frau verschleppt, missbraucht und hilflos zurückgelassen hätten. Es gab zum einen die widersprüchliche Aussage des Missbrauchsopfers, zum anderen die eindeutigen Beteuerungen der Männer und ihre uneingeschränkte Bereitschaft zur DNA-Probe und der Untersuchung ihres Wohnwagens. Beweise für ihre Täterschaft lagen nicht vor. Die Ermittlungen verliefen im Sande.
Kein Gericht der Welt hätte die Kirmeshelfer verurteilen können, das war für Böhnke nach der Lektüre der Protokolle offensichtlich. Ein wenig wunderte er sich darüber, dass das Verbrechen mit keinem Wort in den Zeitungen erwähnt worden war; anderenfalls hätte Sabine sicherlich die entsprechenden Artikel der Handakte beigefügt.
Das energische Klopfen an der Bürotür beendete Böhnkes Überlegungen. Werner Kühlbrenner betrat den Raum. Er wirkte bei Weitem nicht mehr so souverän und selbstsicher wie am Vorabend. Er sah erschöpft und niedergeschlagen aus, als er sich in dem Sessel vor dem Schreibtisch niederließ.
»Was für ein Tag, Herr Böhnke«, sagte er leise. »Da stürmt die Polizei um fünf Uhr unseren Betrieb und verhaftet kurzerhand Paul. Keiner von uns wusste, was das soll, und die Polizisten hatten es nicht für nötig gehalten, uns den Sinn ihrer Aktion zu erklären. Die haben Paul einkassiert, haben, ohne mich zu fragen, seinen Spind leergeräumt und sind mit ihm weggefahren.« Kühlbrenner schüttelte immer noch fassungslos den Kopf. »Ich konnte nichts tun.«
»Und dann haben Sie Grundler angerufen, nicht wahr?«
Der Bäcker nickte. »Was blieb mir denn anderes übrig? Ich weiß doch nicht, was man machen kann. Tobias holt Paul hoffentlich raus.«
Böhnke wollte keine falschen Hoffnungen wecken. »Warten wir ab«, sagte er ausweichend, »mehr können wir nicht tun.« Er deutete auf die Papiere auf der Glasplatte. »Ich habe mir die Unterlagen über das Verbrechen an Ihrer Tochter durchgelesen. Wie geht es ihr?«
»Beschissen.« Kühlbrenner funkelte Böhnke an. »Das ist nicht mehr meine Franziska, die sie früher war. Sie ist traumatisiert und in Therapie. Wenn ein Mann sie anspricht, verfällt sie in Panik, bekommt Schreikrämpfe und will weglaufen.« Er schluckte schwer. »Selbst ich darf sie nicht umarmen. Ich darf ihr höchstens die Hand geben. Sie lässt nur ihre Mutter an sich ran. Körperlich ist sie in Ordnung, aber ihre Seele ist kaputt. Es wird noch lange dauern, bis sie über das Verbrechen hinweg ist. Die Schweine haben sie kaputt gemacht.«
»Welche Schweine?«
»Na, die vier.« Kühlbrenner deutete auf die Polizeiberichte. »Die können so viel leugnen, wie sie wollen. Die haben Franziska auf dem Gewissen.«
»Die Polizei sieht das anders«, gab Böhnke zu bedenken.
»Nein«, widersprach Kühlbrenner heftig. »Die Polizei hat nur nicht die Beweise, um sie zu überführen. Ich weiß, dass die vier mein Mädchen zerstört haben.«
»Und die geplante Ehe von Franziska mit Paul Mertens ebenfalls?« Böhnke wollte sich auf eine unergiebige Diskussion über das Untersuchungsergebnis der Ermittlungsbehörden nicht einlassen. Kühlbrenner würde sich nicht von seiner Überzeugung abbringen lassen.
»So sieht es aus. Dabei hätte alles so schön werden können. Paul ist seit der Lehre bei uns, ist inzwischen unser bester Mann und kann den Betrieb alleine regeln. Ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Da ist es für mich ein Glücksfall gewesen, dass sich Franziska und Paul ineinander verliebt haben. Die beiden hätten die Bäckerei als nächste Generation übernehmen können. Nach ihrer Heirat wären sie gleichberechtigte Geschäftsführer neben mir und meiner Frau geworden. Aber so«, Kühlbrenner zuckte resignierend mit den Schultern. »Franziska duldet im Moment Paul nicht einmal in ihrer Nähe und sie hat Probleme damit, dass er mit bei uns am Mittagstisch sitzt und er in unserem Haus ein- und ausgeht. Für mich ist er wie ein Sohn und wird es immer bleiben. Er kümmert sich fürsorglich um Franziska, auch wenn sie es nicht bemerkt oder es nicht zulassen will. Er bedrängt sie nicht, macht aber alles für sie.« Kühlbrenner sah Böhnke durchdringend an. »Sie werden verstehen, dass sein Hass auf die vier nicht weniger groß ist als meiner?«
Böhnke sah keinen Grund, auf die als Frage gemeinte Anmerkung zu antworten. »Lassen Sie mich einen anderen Aspekt aufgreifen. Mich wundert, dass die Zeitungen nichts über das Verbrechen geschrieben haben.«
»Weil sie nichts davon mitbekommen haben. Die Polizei hat auf unsere Bitte nichts darüber gemeldet. Wir hatten schon Leid genug und wollten nicht auch noch, dass darüber in der Öffentlichkeit geredet wird. Die Polizei hatte auch keine Hoffnung, durch einen öffentlichen Aufruf sachdienliche Hinweise zu erhalten. Die haben mit Hochdruck gearbeitet und sogar eine Sonderkommission gebildet. Aber es ist nichts herausgekommen.« Kühlbrenner schluckte. »Wir haben dann einen Privatdetektiv eingeschaltet. Für den galt aber: Außer Spesen nichts gewesen. Als alle Ermittlungen im Nichts endeten, war es zu spät, die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten. Wer würde sich noch nach Monaten an den Frühjahrsbend erinnern, wenn der nächste Spätbend quasi schon vor der Tür steht? Wohl niemand.«
»Und so hat Ihr Quasi-Schwiegersohn zur Selbstjustiz gegriffen?«
»Warum sollte er?«
»Warum sollte ihn die Polizei sonst verhaftet haben? Er steht unter Mordverdacht. So viel hat Grundler schon mitgeteilt. Wussten Sie das nicht?«
»Nein.« Kühlbrenner wirkte verblüfft. »Sie meinen, er wurde verhaftet, weil er eines der vier Schweine gekillt hat?«
»Ich weiß es nicht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er des Mordes an einem der Kirmeshelfer verdächtigt wird. Das würde passen, zumal ja ein Motiv auf der Hand liegt.«
»Welches?«
»Rache.«
»Nein, Gerechtigkeit.« Kühlbrenner leistete sich einen Augenblick der Zufriedenheit. »Wenn Paul tatsächlich einen der Männer getötet haben sollte, hat er das Richtige getan und meine unverbrüchliche Unterstützung.«
Nur wenige Minuten später erhielt Böhnke die Bestätigung für seine Annahme.
»Paul Mertens steht unter dringendem Mordverdacht, Fritz Poschner getötet zu haben«, verkündete Grundler, der ins Büro gestürmt war. Poschner sei einer aus dem Quartett der Kirmeshelfer, gegen die im Vorjahr wegen der Vergewaltigung von Franziska Kühlbrenner Ermittlungen vorgenommen worden waren.
Böhnke fühlte sich an seinen Traum erinnert. Oder hatte er es tatsächlich miterlebt? Das Blaulicht, den Rettungswagen am späten Abend auf dem Bend? Wie Grundler berichtete, sei Poschner bewusstlos in der Geisterbahn, in der er arbeitete, von einem Kollegen aufgefunden worden. Dieser hatte dann sofort den Notarzt alarmiert. Der hatte Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Poschner noch ins Klinikum bringen wollen. Auf dem Transport dorthin war Poschner verstorben, dem ersten Anschein nach wurde er vergiftet.
»Und was hat Paul damit zu tun?«
»Verdammt viel«, antwortete Grundler. Er hatte sich neben Kühlbrenner auf den zweiten Besuchersessel gesetzt und kramte aus seiner Aktentasche zwei Blätter hervor. »Das ist die Kopie eines Schreibens, das die Polizei bei dem Giftopfer gefunden hat.«
Konnte er nach dem Lesen noch Zweifel haben? Böhnke verneinte die Frage für sich, nachdem Grundler auch noch einen zweiten Aspekt vorgetragen hatte. In ungelenker Handschrift hatte Poschner bestätigt, an der Vergewaltigung von Franziska Kühlbrenner beteiligt gewesen zu sein. Datiert war das Bekennerschreiben auf den gestrigen Tag. »Damit nicht genug«, meinte Grundler. »Auf dem Papier gibt es Fingerabdrücke von Poschner und Mertens. Außerdem ist Mertens gestern Abend dabei beobachtet worden, wie er mit Poschner heftig auf der Geisterbahn gestritten hat.«
»Damit gibst du dich zufrieden?« Böhnke wunderte sich über die scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der Grundler den Sachverhalt als richtig hinstellte.
»Natürlich nicht«, antwortete der Anwalt. »Ich habe mehr Fragen als Antworten und ich habe …«, er legte eine bewusste Pause ein, »… einen Mandanten, der die Tat vehement bestreitet.«
»Warum sollte er?«, fragte Kühlbrenner. »Ich bin stolz auf Paul.«
»Werner! Auf einen Mörder kann man nicht stolz sein!«, fuhr Grundler den Mann zornig an. »Ein Mord ist durch nichts zu rechtfertigen.« Ruhig fuhr er fort: »Selbstverständlich hat es den Anschein, als habe die Polizei alle Trümpfe in der Hand, auch gibt es ein eindeutiges, nachvollziehbares Motiv.«
»Rache.«
»Richtig«, bestätigte Grundler. Er richtete seinen Blick auf Böhnke. »Du weißt, was du zu tun hast?«
»Ich soll Antworten finden auf Fragen, die du dir stellst und die du mir jetzt nennst.«
»Wer hat die beiden gestern gesehen? Worüber haben sie gestritten? Wo hat Poschner den Brief geschrieben? Wie konnte er vergiftet werden?«
»Alles kein Problem«, meinte Böhnke lässig. »Die wichtigste Frage bleibt aber noch ungestellt.«
»Welche?«, fragte Kühlbrenner verwundert.
»Die Frage, warum sich Poschner zu der Vergewaltigung deiner Tochter bekennt, in dem Schreiben aber nicht die Namen seiner Mittäter nennt.« Grundler deutete auf die Papiere vor Böhnke. »Poschner hätte doch die bekannten Namen seiner vermeintlichen Mittäter nennen und sie so auch beschuldigen können. Warum hat er das nicht getan?« Fragend schaute Grundler in die Runde, ehe er fortfuhr. »Dass Poschner nicht Alleintäter gewesen war, haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Es waren mindestens zwei Personen beteiligt.«
»Ich denke, wir reden von vier Verbrechern«, protestierte Kühlbrenner heftig.
»Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es zwei waren«, belehrte ihn Grundler in sachlichem Tonfall. »Ich habe nur aus der Polizeiakte zitiert, in der von mindestens zwei Tätern ausgegangen wird. Es können auch drei oder vier gewesen sein.«
»Die vier, die die Polizei hat laufen lassen«, sagte Kühlbrenner beharrlich.
»Die vier, die von jedem Gericht der Welt in einem Prozess freigesprochen worden wären, Werner.« Grundler sprang auf. »Und jetzt macht Platz an meinem Schreibtisch. Ich muss arbeiten und ihr stört mich dabei nur.« Er reichte Kühlbrenner die Rechte zum Abschiedsgruß. »Tut mir leid, dass ich deinen Schwiegersohn heute nicht rauspauken konnte. Aber vielleicht haben wir ja morgen mehr in der Hand.«
Kühlbrenner wandte sich schon zur Tür, als Grundler ihn noch einmal ansprach. »Werner, könnte es vielleicht sein, dass zwischen der Sabotage wegen deines Poschwecks und dem Mord an dem Kirmeshelfer ein Zusammenhang besteht?«
»Blödsinn!«, fauchte Kühlbrenner beim Hinausgehen.
*
Wenn er noch eine Nacht mit ihr in ihrem Bett verbringen würde, müsste er sie heiraten, hatte Lieselotte am Morgen beim Frühstück gemeint. »Kannst du mir verraten, warum ich meinen Hühnerstall in Huppenbroich für viel Geld zu einem Ferienhaus umgebaut habe, wenn du mir doch nicht von der Seite weichst?«
»Nur, damit du dich von mir scheiden lassen kannst?« Eine Heirat kam für Böhnke nicht infrage, da war er sich mit seiner Liebsten einig. Die letzten gemeinsamen Jahre ihres Lebens würden sie auch ohne Trauschein überstehen; er in Huppenbroich, sie in Aachen, selbst wenn sie davon sprach, nach ihrer Berufstätigkeit zu ihm in die Eifel zu ziehen. Lieselotte würde es nie länger als drei Tage in dem 400-Seelen-Ort aushalten, dann trieb es sie unweigerlich zurück in den Schatten des Aachener Doms, so wie es ihn nach einigen Tagen in der Großstadt zurück in die Eifel zog.
Spätestens am Abend würde er nach Huppenbroich fahren, hatte er Lieselotte gesagt und sie hatte erleichtert aufgeatmet. »Da komme ich ja noch einmal um eine Hochzeit herum. Was für ein Glück!«
Die heitere Stimmung hielt nicht lange an. Beim Blick in die Zeitung kamen Entsetzen und Betroffenheit auf. Der Mord auf dem Bend war dem Blatt der Aufmacher auf der ersten Seite und zwei weitere Artikel auf der Reportageseite wert.
»Die wissen auch nicht mehr als wie du«, kommentierte Lieselotte nach der Lektüre mit dem typisch Öcher Komparativ. »Oder hast du mir gestern bei deiner Gute-Nacht-Geschichte nicht alles verraten?«