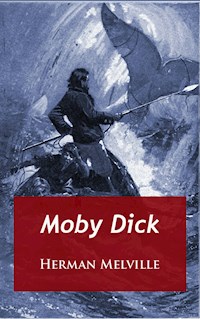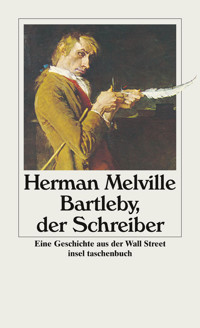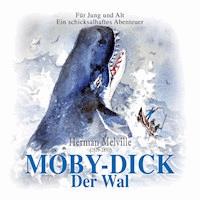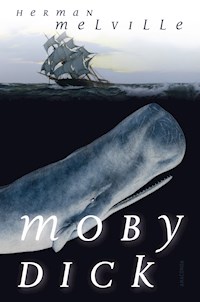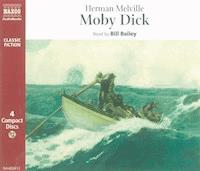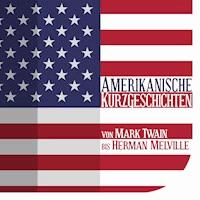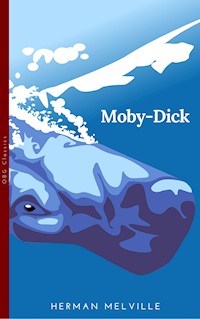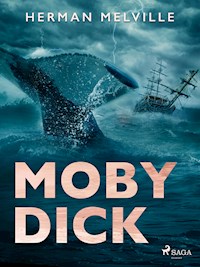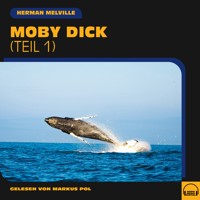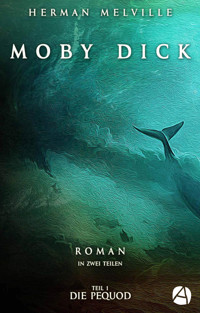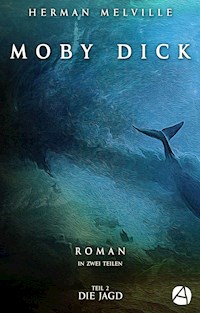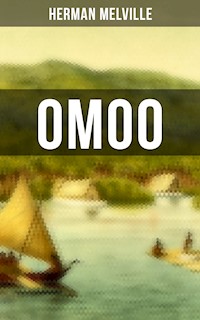
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herman Melvilles Buch 'Omoo' entführt den Leser in die Welt des Abenteuers und der Seefahrt im 19. Jahrhundert. Das Buch erzählt die Geschichte von Tommo, einem Matrosen, der auf Tahiti strandet und dort unerwartete Abenteuer erlebt. Melvilles beeindruckender literarischer Stil zeichnet sich durch detaillierte Beschreibungen der exotischen Landschaften und der Konflikte der Charaktere aus. Das Werk ist ein weiteres Meisterwerk des Autors, das nach dem Erfolg seines früheren Romans 'Typen' veröffentlicht wurde und Melvilles Ruf als einflussreicher Schriftsteller zementiert. Herman Melville war selbst ein ehemaliger Seemann, der seine Erfahrungen auf See nutzte, um seine Romane mit lebendigen Details und realistischen Darstellungen zu füllen. Sein Verständnis für die Seefahrt und sein Interesse an fremden Kulturen spiegeln sich deutlich in 'Omoo' wider. Melville wollte mit dem Buch das Leben auf See und die Begegnungen mit anderen Kulturen authentisch darstellen und zugleich die menschliche Natur erforschen. 'Omoo' ist ein faszinierendes Buch, das Leser ansprechen wird, die sich für Abenteuergeschichten, historische Romane und die Erforschung der menschlichen Natur interessieren. Melvilles tiefgründige Darstellung der Charaktere und sein bildhafter Schreibstil machen das Buch zu einem unvergesslichen Lesevergnügen für Liebhaber klassischer Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Omoo
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Nirgends ist das eigentümliche Leben der Seeleute so wild und abenteuerlich wie in der Südsee. Die Schiffe in diesen fernen Wassern betreiben zumeist die Jagd auf Pottwale; ein Geschäft, das die wüstesten und waghalsigsten Seeleute aller Nationen anzieht und sie noch zügelloser macht. Die Fahrten dauern ungewöhnlich lange und sind gefährlich; die einzigen erreichbaren Häfen liegen auf wilden oder halbzivilisierten Inseln Polynesiens oder an der Westküste Amerikas, an der gleichfalls Gesetzlosigkeit herrscht. Daher kommt es, daß auf den Schiffen im Stillen Ozean, auch abgesehen von den Gefahren der Walfischjagd, die merkwürdigsten Dinge sich ereignen.
Nicht diese Jagden sollen hier geschildert werden, sondern das Leben auf den Schiffen, und zwar sollen des Autors eigene Erlebnisse erzählt werden.
Im Sommer 1842 kam er, als einfacher Vordergast auf einem amerikanischen Südseefahrer, nach den Marquesas-Inseln. Auf der Insel Nukuhiva verließ er sein Schiff, das später ohne ihn absegelte, und kam auf der Wanderung durch die Insel in das Tal von Taïpi, in dem ein wilder Stamm im Urzustand lebt. Einem Schiffskameraden, der ihn begleitete, gelang es, bald aus dem Tal zu entfliehen. Der Autor wurde etwa vier Monate in milder Gefangenschaft gehalten; dann entkam auch er in einem Boot, das in die Bucht eingefahren war. Diese Ereignisse sind in dem Buche »Taïpi« geschildert.
Das Boot gehörte zu einem Schiff, das Not an Mannschaft hatte und kürzlich in einen benachbarten Hafen auf der gleichen Insel eingelaufen war. Dort hatte der Kapitän gehört, daß der Autor in Taïpi gefangengehalten wurde, war um die Insel herum nach der Bucht gesegelt und lag auf der Höhe der Einfahrt »beigedreht«. Da die Taïpi als ein feindlicher Stamm galten, wurde das Boot mit Eingeborenen aus einem anderen Hafen, die »tabu«, also unverletzlich, waren, bemannt, und mit einem Dolmetscher, der die Freilassung des Autors erwirken sollte, ans Ufer gesandt. Das Ziel wurde nicht ohne Gefahr für alle Beteiligten schließlich erreicht. Zur Zeit seiner Flucht war der Autor leidend und an einem Bein gelähmt. Als das Boot die offene See erreichte, wurde das Schiff in der Entfernung sichtbar. Damit beginnt die vorliegende Erzählung, die dort anfängt, wo »Taïpi« aufhört.
Der Autor hat auf seinen Wanderungen und Fahrten in der Südsee kein Tagebuch geführt, so daß ihm, als er daran ging, seine Erlebnisse niederzuschreiben, eine vollkommene Genauigkeit in den Daten nicht möglich war. Er berichtet aus der Erinnerung; er hat indessen alles so oft mündlich erzählt, daß die Ereignisse sich ihm sehr scharf ins Gedächtnis geprägt haben.
Außer dem Leben auf einem Walfischfänger wünscht der Autor auch eine intime Darstellung der Lage der christlichen Polynesier zu geben, wie sie durch den mannigfachen Verkehr mit Europäern und durch das Wirken der Missionare sich gestaltet hat. Als umherstreifender Seemann verbrachte der Autor ungefähr drei Monate in verschiedenen Gegenden der Inseln Taheiti und Imio, und unter Umständen, die ihm sehr eingehende Beobachtungen gestatteten. Bei allem, was über das Wirken der Missionare gesagt wird, hat der Autor sich gewissenhaft an die Tatsachen gehalten und gelegentlich die Bemerkungen früherer Reisender herangezogen, die seine Beobachtungen bestätigen. Nur der ernste Wunsch, die Wahrheit festzustellen und das Gute zu fördern, veranlaßt ihn, das Thema zu berühren; und wenn er keinen Weg angibt, die üblen Zustände, die er schildert, zu bessern, so geschieht es in der Meinung, daß, wenn die Tatsachen einmal bekannt sind, andere hierzu fähiger und berufener sein dürften. Wenn Eigenheiten der Taheitier oft scherzhaft dargestellt sind, so geschieht es doch nicht aus Spottlust: die Dinge sind einfach so geschildert, wie sie in ihrer fast unglaublichen Seltsamkeit dem unvoreingenommenen Beobachter erschienen.
Von den unvollständigen Wörterbüchern der polynesischen Dialekte, die bisher veröffentlicht sein sollen, hat der Autor keines zu Gesicht bekommen. Worte der Eingeborenensprache sind daher rein nach dem Klang wiedergegeben. Über die Geschichte Taheitis und verschiedene ältere Gebräuche hat der Autor auch in den frühesten Reiseberichten sowie in Ellis' »Polynesischen Forschungen« Belehrung gesucht.
Der Titel des Buches »Omu« ist der Sprache der Marquesas-Inseln entnommen, wo das Wort unter anderem »Herumstreicher« bedeutet, oder eigentlich einen Menschen, der von einer Insel zur anderen zieht, wie dies manche Eingeborene tun, die unter ihren Landsleuten als »tabu kanakas« bekannt sind.
Erstes Kapitel
Unsere Flucht aus der Bai gelang an einem leuchtenden tropischen Nachmittag. Das Schiff, nach dem wir ruderten, lag mit knatterndem Großmarssegel etwa eine Meile vorn Land; es war der einzige Gegenstand, der auf der weiten Fläche des Ozeans sichtbar war.
Als wir näher kamen, erwies es sich als ein kleines, schäbig aussehendes Fahrzeug; der Rumpf und die Spieren von einem schmutzigen Schwarz, die Takelung überall locker und ausgebleicht; alles zeigte, daß es an Bord nicht gut stand. An den vier Booten, die an den Seiten üben Bord hingen, erkannte ich den Walfischfänger. Über die Reling lehnten nachlässig die Matrosen, wilde, hohlwangige Burschen in schottischen Mützen und verfärbten blauen Jacken; an Stelle des kraftvollen tiefen Brauns, das die Gesichtsfarbe eines gesunden Seemanns in den Tropen sein soll, zeigten viele jene fleckige Bronzefarbe, die Krankheit verrät.
Am Achterdeck stand einer, den ich für den ersten Steuermann hielt. Er trug einen breiten Panamahut und. hatte sein Fernglas auf uns gerichtet.
Leise Rufe erschollen an Deck, als wir längsschiffs kamen, und alle Augen sahen uns forschend an. Sie hatten Grund dazu. Unsere wilden Ruderer keuchten und glühten vor Aufregung und konnten sich an Reden und Gebärden nicht genugtun; auch mein seltsames Aussehen mußte alle neugierig machen. Über den Schultern trug ich ein Kleid aus dem Stoff, den die Eingeborenen herstellen; Haar und Bart waren wild gewachsen, und auch sonst sah man mir meine letzten Erlebnisse an. Sowie ich auf Deck kam, wurde ich von allen Seiten so mit Fragen bestürmt, daß man mir kaum Zeit zum Antworten ließ.
Einer jener merkwürdigen Zufälle, die sich im Leben des Seemanns so oft ereignen, wollte, daß ich sogleich zwei bekannte Gesichter sah. Einer der Mannschaft war früher Matrose auf einem Kriegsschiff gewesen, und ich hatte ihn bei meiner Ausfahrt in Rio de Janeiro kennengelernt. Der andere war ein junger Mann, den ich vier Jahre früher oft in einer Matrosenpension in Liverpool getroffen hatte. Ich konnte mich noch gut erinnern, wie ich mich am Eingang zum Prince's Dock, in einem Gedränge von Polizisten, Stauern, Rollkutschern, Bettlern und anderem Volk von ihm verabschiedet hatte. Jahre waren vorübergegangen, viele Meilen des Ozeans hatten wir durchschifft, da führte uns das Schicksal unter den seltsamsten Umständen wieder zusammen.
Einige Augenblicke später wurde ich in die Kajüte des Kapitäns gerufen. Es war ein ganz junger Mann, bleich und schmal, der mehr wie ein kränklicher Kontorist als wie ein derber Schiffskapitän aussah. Er hieß mich Platz nehmen und befahl dem Steward, mir ein Glas Pisco1 zu bringen. Ich war noch heftig erregt; dieses Reizmittel steigerte meine Aufregung fast zum Delirium, so daß ich kaum mehr ein Wort von dem weiß, was ich damals von meinem Aufenthalt auf der Insel erzählte. Er fragte mich, ob ich mich anmustern lassen wollte; ich bejahte es natürlich, unter der Bedingung, daß ich mich nur für eine Fahrt zu verpflichten hätte und er mich auf meinen Wunsch im nächsten Hafen entlassen müßte. Auf Walfischfängern in der Südsee werden die Leute oft zu solchen Bedingungen angemustert. Der Kapitän war einverstanden, und ich unterschrieb die Schiffsartikel.
Der Steuermann wurde nach unten gerufen und erhielt den Auftrag, einen »wolen Mann« aus mir zu machen; nicht daß der Kapitän etwa besonderes Mitleid mit mir gefühlt hätte; er wollte nur, daß ich bald, dienstfähig wurde.
Der Steuermann half mir an Deck, ich streckte mich auf dem Ankerspill aus, und er begann mein Bein zu untersuchen; dann verarztete er es mit irgendeinem Zeuge, das er aus dem Arzneischrank nahm, und wickelte es in ein Stück alten Segeltuchs; ich muß, als mein Fuß so auf dem Ankerspill ruhte, wie ein Matrose ausgesehen haben, der die Gicht hat. Gleichzeitig nahm mir jemand meinen Tappamantel ab und bekleidete mich mit einer blauen Jacke; ein anderer, der offenbar gleichfalls bemüht war, mich wieder zu einem zivilisierten Menschen zu machen, schwang eine riesige Schafschere über meinem Haupt, brachte meine Ohren in große Gefahr und machte jedenfalls meinem Bart und meinem wallenden Haar den Garaus.
Der Tag ging zu Ende; das Ufer schwand aus dem Gesicht, und ich fühlte die ungeheure Veränderung. Solange war es mein tägliches Gebet gewesen, wieder sicher an Bord eines Schiffes zu sein, auf die Heimkehr und das Wiedersehen mit den Meinen hoffen zu dürfen; und nun, da es soweit war, empfand ich. nur bittere Traurigkeit. Die Eingeborenen hatten mich auf der Insel gefangengehalten, aber sie hatten mir so viel Liebes erwiesen, und ich sollte sie nie wiedersehen!
Meine Flucht war so unerwartet und plötzlich, ich selbst den ganzen Tag in solcher Aufregung gewesen, der Gegensatz des wilden Lärms und der Bewegung des dahinsegelnden Schiffes zu der sonnigen Ruhe des Tales war so groß, daß mir alles wie ein sonderbarer Traum vorkam; so unglaublich schien es, daß dieselbe Sonne, die jetzt über der weiten Wasserwüste sank, am Morgen dieses Tages über den Bergen von Taïpi aufgegangen war und mit ihrem stillen Schein zur Türe des Bambushauses, in dem ich auf der Matte lag, hereingeguckt hatte.
Sowie es dunkel war, ging ich am Vordeck nach unten und wurde zu einer elenden Koje, die über einer anderen lag, gewiesen. Über die schon recht hinfällig aussehenden Bretter waren mehrere Decken gebreitet. Man reichte mir eine verbeulte Zinnkanne mit einem Gebräu, das man nur aus Höflichkeit als Tee ansprechen konnte. Auch ein Würfel von eingesalzenem Rindfleisch wurde mir auf einem harten runden Stück Schiffszwieback, das als Teller diente, gereicht; ich sagte kein Wort und aß; nach den babylonischen Mahlzeiten des Tales war der Salzgeschmack einfach köstlich.
Gerade unter mir saß ein alter Matrose auf einer Kiste und paffte Wolken von Tabakrauch um sich. Als ich mit meinem Abendbrot fertig war, wischte er das rußige Mundstück der Pfeife am Ärmel seiner Jacke ab und reichte sie mir; es war eine richtige Seemannshöflichkeit; wer jemals Vordergast gewesen ist, der ist nicht heikel; ich tat also ein paar kräftige Züge, dann drehte ich mich zur Wand und versuchte zu schlafen. Es war umsonst. Statt von vorn nach hinten, wie es in Ordnung gewesen wäre, stand mein Bett querschiffs, senkrecht zum Kiel; und das Schiff, das vor dem Winde lief, schlingerte derart, daß ich jedesmal, wenn meine Fersen in die Höhe stiegen und mein Kopf nach unten sank, fürchten mußte, einen Purzelbaum zu schlagen. Es gab indessen noch schlimmere Störungen: von Zeit zu Zeit kam ein Spritzer durch das offene Luk, daß mir der Schaum ins Gesicht flog.
Zweimal hörte ich den mitleidlosen Ruf der Wache. Endlich, nach einer schlaflosen Nacht, drang ein Schimmer des Tageslichts von oben zu mir, und gleichzeitig kam jemand herein. Es war mein alter Freund mit der Pfeife.
»Hier, Maat,« sagte ich, »hilf mir einmal da heraus und an Deck!«
»Hallo, wer krächzt denn da?« war die Antwort; er spähte in die dunkle Koje, wo ich lag. »Ah ja, Taïpi, der Kannibalenfürst – bist du's? Aber, wie geht's denn mit deinem Rundholz, mein Junge? Der Steuermann sagt: verteufelt; er hat den Steward gestern abend gleich die Handsäge schleifen lassen; hoffe, man wird dich nicht zerlegen müssen.«
Lange vor Tagesanbruch waren wir auf der Höhe von Nukuhiva gewesen; bis zum Morgen kreuzten wir kurz auf, dann fuhren wir ein und schickten ein Boot mit den Eingeborenen, die mich an Bord gebracht hatten, an Land. Sobald es zurück war, hielten wir wieder ab und entfernten uns von der Insel. Es wehte eine frische Brise, und die kühle Morgenluft auf dem Meer war so anregend, daß ich mich trotz der schlechten Nacht sogleich wohler fühlte. Den größten Teil des Tages saß ich auf dem Ankerspill, schwatzte mit den Leuten und erfuhr die Geschichte ihrer bisherigen Fahrt und alles sonst über das Schiff, und wie es auf ihm stand.
Fußnote
1 Dieses geistige Getränk hat seinen Namen von einer Stadt in Peru, in der es massenhaft hergestellt wird. Es ist an der ganzen Westküste Südamerikas wohlbekannt, wird auch nach Australien exportiert und ist sehr billig.
Zweites Kapitel
Die »Julia« oder »Klein-Julchen«, wie die Matrosen sie nannten, war eine kleine Bark von zweihundert Tonnen amerikanischer Bauart, und zwar wundervoll gebaut, aber schon recht alt. Während des Krieges von 1812 war sie als Kaperschiff aus einem neuenglischen Hafen ausgelaufen und auf hoher See von einem englischen Kreuzer weggenommen worden. Seither wurde sie in jeder erdenklichen Art verwendet, zuletzt als Regierungspostschiff in den Australischen Meeren. Vor etwa zwei Jahren ausrangiert, war sie von einer Firma in Sydney ersteigert und nach unbeträchtlichen Reparaturen auf ihre gegenwärtige Fahrt geschickt worden.
Sie befand sich in einem elenden Zustand. Die Masten, sagten die Leute, waren nicht mehr sicher; das stehende Tauwerk war abgenutzt, selbst die Verschanzung an vielen Stellen faul. Trotzdem hielt sie noch ziemlich dicht; ein mäßiges Pumpen am Morgen genügte, sie lenz zu halten.
Aber all das tat ihrer Segelfähigkeit keinen Eintrag. Wie es auch blasen mochte, eine sanfte Brise oder Sturm, sie war immer bereit; wenn sie die Wogen schäumend teilte und über das Meer nur so hintanzte und sprang, dann vergaß man ihre geflickten Segel und ihren schadhaften Rumpf. Wie das behende Ding vor dem Winde lief! Ja, gewiß, sie rollte hie und da, aber das war mehr Spaß! Und kein Windstoß konnte ihr etwas anhaben, wenn sie luvte: mit steifen Spieren steckte sie die Nase in den Wind und schoß durch die Wellen.
Trotzdem konnte man ihr nicht trauen. Gerade, weil sie so lebhaft und zu Scherzen geneigt war. So wie ein munterer Greis eines Tages hinfällig wird, so konnte sie in einer dunkeln Nacht leck laufen und mit uns allen auf den Grund sinken. Übrigens hat sie uns diesen häßlichen Streich nicht gespielt, und so tue ich ihr vielleicht Unrecht. Nach ihren Schiffspapieren konnte sie fahren, wohin sie wollte, auf Walfisch-, auf Robbenjagd oder was immer sonst; sie jagte hauptsächlich auf Pottwale; wenn auch bis dahin nur zwei Fische längsschiffs gebracht worden waren.
Am Tag, an dem sie Sydney verließ, hatte die Mannschaft alles in allem zweiunddreißig Seelen gezählt; jetzt waren es kaum zwanzig; die anderen waren ausgerissen. Selbst die drei Untermaaten, die die Walfischboote geführt hatten, waren fort; und von den vier Harpunieren war nur noch einer übrig, und der war ein Maori, ein wilder Neuseeländer. Mehr als die Hälfte der Leute war krank infolge eines längeren Aufenthalts in einer liederlichen Hafenstadt. Einige waren vollkommen dienstunfähig, ein oder zwei gefährlich krank; die übrigen konnten gerade noch ihre Wache durchhalten, aber sonst nicht viel leisten.
Der Kapitän war ein junges Londoner Stadtkind, vor zwei Jahren nach Australien ausgewandert, und hatte durch Protektion das Kommando bekommen, dem er in keiner Weise gewachsen war. Er war nicht ohne Bildung, aber zum Seemann geeignet wie ein Friseur. Alles machte sich über ihn lustig. Er hieß der »Kajütenjunge« oder »Schreiberhans« und hatte noch ein halbes Dutzend ähnlicher Spitznamen. Die Mannschaft verhöhnte ihn ganz offen. Der schmächtige Herr wußte es und trat dementsprechend bescheiden auf. Er suchte so wenig als möglich mit den Leuten in Berührung zu kommen und überließ alles dem ersten Steuermann. Scheinbar hielt er sich vollkommen zurück, hatte aber doch mehr Einfluß, als die Leute glaubten. Während er aussah, als könne er nicht bis zwei zählen, war er, bei aller Ängstlichkeit, ganz schlau, und der derbe Steuermann wurde oft von ihm geschoben, während er zu schieben glaubte; niemand ahnte, daß gewisse gehässige Maßnahmen, die er trotz allem Murren der Leute durchsetzte, eigentlich dem eleganten kleinen Herrn in der Nankingjacke und den weißen Segeltuchschuhen zu danken waren. Meistens allerdings tat der Steuermann, was er wollte, und der Kapitän hatte sichtlich Angst vor ihm.
Was Mut, Seebefahrenheit und eine natürliche Fähigkeit, unbotmäßiges wüstes Gesindel in Schach zu halten, betraf, so war niemand für seinen Beruf besser geeignet als John Jermin. Er war ein vollendetes Exemplar jener kurzen, stämmigen, untersetzten Leute, die oft so ungewöhnlich tüchtig sind. Das krause Haar wuchs in kleinen eisengrauen Löckchen um den kugelrunden Kopf, das Gesicht war von Blatternarben zerrissen, mit dem einen Auge schielte er ein wenig, was ihm ein verwegenes Aussehen gab; die Nase stand ihm schief im Gesicht, und der breite Mund mit den großen weißen Zähnen sah, wenn er lachte, geradezu haifischmäßig aus. Niemand hatte Lust, mit ihm anzubinden. Und trotzdem, so gefährlich er aussah, er hatte ein großes Herz, und auch das merkte man auf den ersten Blick.
Er hatte nur einen Fehler: seine Liebe zu starkem Getränk; und er trank zu allen Zeiten. Mäßig genommen, glaube ich, tat es einem Mann, wie ihm, gut, machte seine Augen leuchten, wärmte ihm das Blut und vertrieb die schlechte Laune. Das Schlimme war, daß er manchmal zuviel trank, und dann wurde er streitsüchtig. Aber selbst die Leute, die er verprügelte, liebten ihn; er schlug sie so gemütlich zu Boden, daß keiner es ihm ernstlich nachtrug. Das war unser wackerer Steuermann, der kleine Jermin.
Nach dem Gesetz muß jeder englische Walfischfänger einen Arzt mitführen; dieser ist ein »Herr« und wohnt in der Kajüte; er hat keine anderen Pflichten als die seines Berufes, gelegentlich trinkt er mit dem Kapitän heißen Punsch und spielt Karten mit ihm. Auch auf der »Julia« war ein Schiffsarzt; aber er wohnte merkwürdigerweise im Vorderkastell mit der Mannschaft. Und das kam so.
Seine Vorgeschichte war gleich der vieler Helden in Dunkel gehüllt, obwohl er manchmal Andeutungen auf ein väterliches Erbe und einen steinreichen Onkel machte sowie auf eine unglückliche Geschichte, die ihn zu seinem Wanderleben gezwungen hatte. Fest stand, daß er als Assistenzarzt auf einem Auswandererschiff nach Sydney gekommen und ins innere Australien gezogen war. Einige Monate später war er ohne einen Pfennig Geld nach Sydney zurückgekehrt und Schiffsarzt an Bord der »Julia« geworden.
Anfangs hatten der Doktor und der Kapitän auf freundlichstem Fuß gestanden. Sie hatten manche Bowle miteinander geleert; beide waren belesen, der eine weitgereist, daher konnten sie endlos erzählen. Aber einmal waren sie über einen politischen Streit in Wut geraten; der Doktor hatte seine Fäuste als Argumente gebraucht, bis der Kapitän, in jedem Sinne geschlagen, am Boden lag. Dafür bekam er zehn Tage Arrest in seiner Kabine und wurde auf Wasser und Brot gesetzt. Tief gekränkt verließ er das Schiff bald darauf heimlich auf einer Insel, wurde aber wieder eingefangen, schimpflich an Bord geschleppt und wiederum eingesperrt. Darauf schwor er, mit dem Kapitän nicht mehr zu verkehren, und zog mit seinem ganzen Gepäck zur Mannschaft, die ihn als guten Kameraden, dem Unrecht geschehen war, mit offenen Armen aufnahm.
Er war eine auffällige Erscheinung, über sechs Fuß hoch, ein türmendes Knochengerüst ohne Fleisch, mit vollkommen fahler Hautfarbe, blondem Haar und hellen, unbekümmerten grauen Augen, die recht boshaft zwinkern konnten. Bei der Mannschaft hieß er der lange Doktor oder noch öfter das lange Gespenst. Woher er auch kommen mochte, er hatte sicher einmal Geld gehabt, Burgunder getrunken und in der guten Gesellschaft verkehrt. Er zitierte Virgil, redete über Philosophie und deklamierte mitunter lange Reihen von Versen englischer Dichter. Er hatte viel von der Welt gesehen, konnte so nebenbei eine Liebesgeschichte, die er in Palermo erlebt hatte, oder eine Löwenjagd in Südafrika erzählen oder erklären, was für Kaffee man in Maskat trinkt. Er wußte Hunderte von Anekdoten und sang die wunderbarsten alten Lieder mit so voller und reicher Stimme, daß es eine Wonne war, ihn zu hören. Wie solche Töne aus seinem dürren Leibe kommen konnten, blieb ein Rätsel.
Jedenfalls war das lange Gespenst ein höchst unterhaltender Reisegefährte und auf der »Julia« für mich eine wahre Gottesgabe.
Drittes Kapitel
Von einer regelrechten Disziplin an Bord war keine Rede; auf dem Schiff herrschte ein Tohuwabohu. Der Kapitän war in letzter Zeit krank gewesen und ließ sich nur selten sehen. Um so mehr hörte man den Steuermann, der zu allen Stunden an Deck war. Bembo, der neuseeländische Harpunier, blieb meist für sich und redete fast nur mit dem Steuermann, der seine Sprache verstand und ihm darin antworten konnte. Oft saß er auf dem Bugspriet und fischte mit einer Knochenangel nach Thunfischen; und manchmal, in dunkeln Nächten, begann er plötzlich allein auf dem Vordeck irgendeinen kannibalischen Fandango zu tanzen und weckte alle Leute damit auf. Im ganzen verhielt er sich sehr still, wenn auch etwas in seinem Auge verriet, daß er keineswegs harmlos war.
Der Doktor hatte schriftlich seine Entlassung als Schiffsarzt eingereicht; er erklärte, als Passagier nach Sydney zu fahren und nahm das Leben leicht. Was die Mannschaft betrifft, so waren die Kranken merkwürdig zufrieden; die übrigen, denen die allgemeine Zügellosigkeit an Bord wohlgefiel, machten sich keine Gedanken über die Zukunft.
Die Lebensmittelvorräte der »Julia« waren armselig. Das Schweinefleisch in den Fässern sah aus wie in Eisenrost konserviert und roch wie abgestandenes Ragout. Das Rindfleisch war noch übler, eine mahagonifarbene Fasersubstanz, so zäh und ohne Geschmack, daß ich beinahe des Kochs Versicherung glaubte, man hätte einen Pferdehuf mitsamt dem Eisen in einem der Fässer gefunden. Der Zwieback war auch nicht viel besser; er war größtenteils zu steinharten Krümeln zerbröckelt und vollkommen durchlöchert, als ob die Würmer, die in den Tropen den Zwieback heimsuchen, ihn verzweifelt auf der anderen Seite wieder verlassen hätten, ohne Nahrung zu finden. Konserven hatten wir wenig; Tee dafür in Menge; nur glaube ich nicht, daß er aus China kam. Außerdem hatten wir jeden zweiten Tag »Schrotsuppe«, wie die englischen Seeleute sagen: große runde Erbsen, die wie Kieselsteine in lauem Wasser rollten. Ich ließ mir später erzählen, daß die Eigentümer des Schiffes verdorbene und ausrangierte Vorräte der Kriegsmarine auf einer Auktion in Sydney erstanden hatten.
Aber wie wässerig die Suppe, wie salzig Rind- und Schweinefleisch schmecken mochten, wir Matrosen wären schließlich damit zufrieden gewesen, wäre nur irgend etwas Zugemüse an Bord zu haben gewesen, ein paar Kartoffeln oder Yamswurzeln oder Wegerich; aber es gab nichts. Dafür gab's etwas anderes, das in der Schätzung der Mannschaft alle Mängel gutmachte: eine tägliche Ration Pisco.
Vielleicht wundert man sich, daß der Kapitän bei solchen Zuständen mit dem Schiff auf See blieb. Der Grund war der: wenn er im Hafen lag, lief er Gefahr, daß auch der Rest der Mannschaft desertierte; auch so fürchtete er, daß, wenn er nur in eine fremde Bucht einlief, er eines Tages vor Anker liegen könnte, ohne Leute, die Anker wieder einzuhieven.
Auf See können vernünftige Offiziere auch die schlimmsten Leute einigermaßen in Schach halten; aber sowie man eine Kabellänge vom Land liegt, ist's damit aus. Darum gehen viele Walfischfänger in der Südsee oft achtzehn, ja zwanzig Monate nicht vor Anker. Die Mannschaften solcher Fahrzeuge sind zum größten Teil der Abschaum aller Völker und Rassen; in den gesetzlosen Häfen des Spanischen Meeres oder unter den Wilden der Südsee angeworben. Wie Galeerensklaven, kann man sie nur mit Kette und Peitsche regieren. Die Offiziere gehen stets mit Messer und Pistole bewaffnet, sie tragen sie in der Tasche, aber immer zur Hand oder schußbereit.
In unserer Mannschaft waren nicht wenige von dieser Gattung; aber wie wüst sie gelegentlich sein mochten, die derbe, trunkene Energie Jermins war das richtige, sie grollend niederzuhalten. Wenn es nötig war, stürzte er unter sie, teilte nach rechts und links Schläge und Püffe aus, so daß sie nach allen Seiten wichen. Diese Autorität der rohen Faust ertrugen sie, wie ich schon sagte, mit sehr guter Laune. Ein ruhiger, nüchterner Offizier, der seine Haltung bewahrte, hätte nichts gegen sie ausgerichtet; sie hätten ihn mitsamt seiner Haltung über Bord geworfen.
So blieb nichts übrig, als das Schiff auf See zu halten. Der Kapitän hoffte immer, die Kranken würden sich bald erholen, und er selbst gleichfalls, und dann konnte man schließlich mit der Jagd Glück haben. Als ich an Bord kam, hieß es jedenfalls, Kapitän Guy sei willens, das Versäumnis nachzuholen und das Schiff in kürzester Zeit mit Walrat zu füllen.
In dieser Absicht nahmen wir Kurs auf Heitihu, ein Dorf auf der Insel Santa Christina – gleichfalls eine der Marquesas, der Mendana ihren Namen gegeben hat –, um acht Matrosen wiederzukriegen, die vor ein paar Wochen die »Julia« dort verlassen hatten. Der Kapitän nahm an, daß sie sich indessen hinreichend erholt hatten und froh sein würden, zu ihrer Pflicht zurückzukehren.
So rollten wir denn auf Heitihu zu, alle Segel beigesetzt, mit den warmen, brisigen Passatwinden scherzend, und glitten über die langen, langsamen Seen auf und nieder, während die Thunfische um das Schiff spielten.
Viertes Kapitel
Ich war noch nicht vierundzwanzig Stunden an Bord, als ich Zeuge eines Vorfalls wurde, der für die Zustände auf dem Schiff kennzeichnend war.
Unter der Mannschaft war einer, der Schiffszimmermann, so unglaublich häßlich, daß er den ironischen Spitznamen »Schönheit« erhalten hatte. Manchmal wurde er auch, mehr beruflich, »Sägspan« genannt. Er war nicht eigentlich entstellt, sondern von Natur regelrecht häßlich. Auch sein Wesen war weder angenehm noch liebenswürdig, und das Verhältnis zwischen ihm und Jermin war zu allen Zeiten gespannt. Schönheit war nämlich der einzige auf dem Schiff, den der Steuermann nie wirklich untergekriegt hatte, daher sein Groll. Schönheit wiederum tat sich etwas darauf zugute, daß er dem Steuermann keine Antwort schuldig blieb.
Gegen Abend war irgend etwas an Deck zu tun, und der Zimmermann, der zur Wache gehörte, fehlte. »Wo ist denn der Drückeberger, der Sägspan?« schrie Jermin durch das Luk hinab.
»Ruht aus, hier unten auf einer Kiste, wenn Sie's wissen wollen!« antwortete der Edle, die Pfeife aus dem Munde nehmend. Diese Frechheit brachte den hitzigen kleinen Steuermann in Wut; aber Schönheit sagte kein Wort und paffte ruhig weiter. Nun wird kein vernünftiger Offizier, und wenn er noch so gereizt wäre, im Streit mit einem von der Mannschaft das Logis betreten. Wenn der Betreffende sich weigert, es zu verlassen und an Deck zu kommen, so bleibt dem Offizier nichts übrig, als geduldig zu warten, bis der andere sich dazu entschließt. Denn unten ist's dunkel, und nichts ist leichter, als dem, der hinunterkommt, eins über den Schädel zu hauen, ehe er recht weiß, wo er ist, und nichts schwerer, als festzustellen, wer der Täter war.
Jermin wußte dies sehr genau, daher begnügte er sich damit, durch das Luk hinunterzuschimpfen. Schönheit antwortete so kühl und gelassen, daß er ihn zur Raserei brachte.
»An Deck!« brüllte er. »Herauf mit dir, oder ich komm' hinunter und mach' dir Beine!«
Der Zimmermann bat ihn, nur zu kommen.
Gesagt, getan: Jermin vergaß alle Vorsicht, sprang die Leiter hinab und hatte den anderen bei der Kehle, ohne ihn noch recht zu sehen. Einer der Leute wollte sich auf ihn stürzen, aber die übrigen rissen ihn zurück: die beiden sollten es miteinander abmachen.
»Und jetzt kommst du an Deck!« schrie der Steuermann und suchte den Zimmermann im Griff zu behalten.
»Schaff mich nur hinauf!« war die trotzige Antwort. Schönheit wand sich wie eine Boa Constrictor. Der Steuermann suchte ihn vollends zu packen, dabei bekam Schönheit seine Arme frei und warf ihn rücklings nieder. Aber Jermin sprang sogleich wieder auf, und eine Zeitlang zerrten sie einander unten hin und her, stießen sich die Köpfe an den vorspringenden Balken wund und schlugen aufeinander los, wo sie treffen konnten. Da glitt Jermin aus und fiel; sofort setzte sein Feind sich ihm auf die Brust und hielt ihn fest. Das ist eine der Situationen, in der der oben Sitzende seine Meinung nach Lust aussprechen kann, und Schönheit nahm die Gelegenheit wahr. Der Steuermann antwortete nicht; er schäumte vor Wut und suchte sich zu befreien.
Da tönte eine dünne Stimme von oben. Der Kapitän war zufällig aufs Achterdeck gekommen, als die Rauferei anfing; er wäre gerne wieder in die Kajüte zurückgekehrt, wenn er nicht gefürchtet hätte, sich vollends lächerlich zu machen. Er lehnte über die Reling, und als der Lärm zunahm, und es klar wurde, daß es seinem ersten Offizier schlecht ging, erschien er auf dem Vorderkastell und wollte die Sache als Bagatelle behandeln. »Nun, nun!« sagte er möglichst schnell und in ärgerlichem Ton, »was ist denn da los? Herr Jermin, Herr Jermin! – Zimmermann, Zimmermann! So hören Sie doch! Was tun Sie denn da unten? Kommen Sie doch an Deck!«
Worauf das lange Gespenst, der Doktor, in Fisteltönen rief: »Ach, Fräulein Guy, sind Sie das? Bitte, meine Liebe, gehen Sie rasch fort – es könnte Ihnen etwas zustoßen!«
»Eh, lassen Sie mich in Ruh'! Wer sind Sie denn, Herr? Ich habe mit Ihnen nicht gesprochen; hören Sie also mit Ihrem Unsinn auf! Herr Jermin, mit Ihnen spreche ich! Haben Sie die Güte, an Deck zu kommen; ich habe mit Ihnen zu reden!«
»Und wie, zum Teufel, soll ich denn hinaufkommen?« schrie der Steuermann. »Kommen Sie doch runter, Kapitän Guy, und seien Sie ein Mann! Lassen Sie mich los, Sie, Sägspan! Loslassen, sag' ich! Sie werden mir das noch büßen! So kommen Sie doch, Kapitän!«
Der arme Mann bekam beinahe Krämpfe. »Pfui, pfui, Zimmermann!« rief er, »lassen Sie ihn herauf, lassen Sie ihn los! Hören Sie? Sie sollen Herrn Jermin an Deck lassen!«
»Scheren Sie sich fort, Schreiberhans!« erwiderte Schönheit, »das geht nur mich und den Steuermann an; gehen Sie also nach achtern, wohin Sie gehören!«
Als der Kapitän den Kopf noch einmal durch das Luk steckte, flog ihm, von unsichtbarer Hand geschleudert, eine feuchte Masse von aufgeweichtem Zwieback und Teeblättern, der Inhalt einer Zinnkanne, ins Gesicht. Der Doktor war gerade nicht weit entfernt. Nach dieser Schlappe zog sich der elegante junge Mann, beide Hände vor dem triefenden Antlitz, ohne auf mehr zu warten, endgültig zurück. Einige Augenblicke später kam auch Jermin, der sich zu einem Vergleich hatte herbeilassen müssen, mit zerrissener Jacke und zerschundenem Gesicht ihm nach, und beide blieben etwa eine Viertelstunde in der Kabine. Die rauhe Stimme des Steuermanns überschrie die dünne und sanfte Rede des Kapitäns. Es war der erste Konflikt mit der Mannschaft, in dem Jermin den kürzeren gezogen, hatte, und er war entsprechend in Wut. Wie der Steward uns später berichtete, hatte er dem Kapitän gesagt, er möge sich in Zukunft gefälligst selber um sein Schiff kümmern, wenn er seine Offiziere so behandeln lasse; er für sein Teil habe genug davon. Noch manches scharfe Wort fiel, aber schließlich versicherte ihm der Kapitän, daß der Zimmermann bei der ersten Gelegenheit gründlich ausgepeitscht werden sollte, obschon dies, wie die Dinge lagen, ein gewagtes Experiment schien. Daraufhin willigte Jermin widerstrebend ein, die Sache vorläufig auf sich beruhen zu lassen, und bald ertränkte er sein ganzes Denken in einer Bowle von heißem Punsch, die der Kapitän klüglicherweise schon vorher beim Steward bestellt hatte.
Dabei blieb es, und die Sache hatte keinerlei weitere Folgen.
Fünftes Kapitel
Weniger als achtundvierzig Stunden, nachdem wir Nukuhiva verlassen hatten, stieg die blaue Insel Santa Christina am Horizont auf. Als wir uns dem Ufer näherten, wurden die dräuenden schwarzen Spieren und der wespenartige Rumpf eines kleinen Kriegsschiffs sichtbar; Masten und Rahen zeichneten sich deutlich gegen den Himmel ab. Es war eine französische Korvette, die in der Bucht vor Anker lag. Unser Kapitän war darüber sehr erfreut, er kam an Deck und betrachtete sie von den Besanswanten aus durch sein Glas. Er hatte ursprünglich keinen Anker auswerfen wollen; nun aber änderte er seinen Plan und ging längsseits der Korvette vor Anker. Sobald ein Boot zu Wasser gelassen werden konnte, fuhr er hinüber, dem Kommandeur seine Aufwartung zu machen, vornehmlich aber, wie wir vermuteten, die nötigen Schritte mit ihm zu besprechen.
Nach zwanzig Minuten kam er zurück und brachte zwei Offiziere in Interimsuniform mit schönen Backenbärten sowie drei oder vier lärmende und betrunkene alte Häuptlinge mit. Der eine hatte die Beine durch die Armlöcher einer scharlachfarbenen Weste gesteckt, der andere trug ein paar Sporen an den Fersen und der dritte einen Federhut; sonst waren sie in der gewöhnlichen Tracht der Eingeborenen: mit einem Tuch um die Lenden bekleidet. So unpassend ihre Aufführung war, die Edlen waren, wie sich herausstellte, eine Abordnung der Geistlichkeit, und sie kamen, um unser Schiff mit einem strengen »Tabu« zu belegen. Die Eingeborenen, Männer wie Weiber, sollten dadurch verhindert werden, an Bord zu kommen, damit nicht wieder jene liederliche Unordnung einreiße, die Desertionen erleichterte. Es wurden nicht viel Umstände gemacht. Die Priester traten einen Augenblick beiseite, steckten ihre geschorenen alten Köpfe zusammen und machten ihren Hokuspokus. Dann riß der oberste unter ihnen einen Streifen von seinem weißen Tappagürtel und reichte ihn einem der französischen Offiziere, der ihn Jermin gab und ihm erklärte, was er damit zu tun hätte. Der Steuermann begab sich sogleich ans Ende des Außenklüverbaums und befestigte das mystische Zeichen des Banns daran. Es verscheuchte sogleich ein paar Mädchen, die eben auf uns zugeschwommen kamen, aber jetzt ihre Arme schwangen, sich im Wasser herumwarfen, wie Delphine, daß es aufschäumte, und unter lauten Rufen »Tabu! Tabu!« ans Ufer zurückschwammen. In der Nacht nach unserer Ankunft sollten nur der Steuermann und der Maori die beiden Wachen halten und einander nach je vier Stunden ablösen; die Mannschaft, wie das manchmal üblich ist, wenn ein Schiff vor Anker liegt, erhielt Erlaubnis, die ganze Nacht in der Koje zu bleiben. Diesmal geschah es, weil man den Leuten nicht traute.
Als die Glocke gegen Mitternacht acht Glasen schlug und Jermins erste Wache kam, stieg er an Deck, in der einen Hand eine Branntweinflasche, die andere bereit, auf das erste Gesicht loszuschlagen, das aus dem Luk an der Back auftauchen würde. Er hatte offenbar die Absicht, wach zu bleiben; aber er schlief schon nach kurzer Zeit ein und so fest, daß er vermutlich selbst mit seinem Schnarchen die Leute weckte, die uns in dieser Nacht verließen. Er schnarchte aber auch mit seinem schiefen Kriegshorn, daß es eine Art hatte. Als er zu sich kam, dämmerte es gerade, immerhin, war Licht genug, um zu sehen, daß zwei Boote fehlten. Er wußte sofort, was geschehen war, zerrte den Maori aus einem alten Segel heraus, in dem er schlummerte, befahl ihm, ein anderes Boot klarzumachen und stürzte in die Kajüte, dem Kapitän die Mitteilung zu bringen. Schon war er wieder an Deck und rannte ins Logis hinab, ein paar Ruderer zu holen, als wir einen lauten Schrei hörten und das Wasser an der Schiffswand klatschend aufspritzte. Der Maori und das Boot rollten im Wasser übereinander. Das Boot war am Abend an seinen Platz über Steuerbord geheißt worden; und jemand hatte die Taljen, in denen es hing, so durchschnitten, daß sie bei einer mäßigen Belastung reißen mußten. Die Täter schienen Bembos spezifisches Gewicht ausgerechnet zu haben, so sicher war die Wirkung eingetreten, als er hineingesprungen war. Es war nur noch ein Boot übrig; man untersuchte es zunächst, und das war gut: im Boden war ein Loch, groß genug, daß man ein Faß hätte durchstecken können.
Jermin war außer sich. Er schleuderte seinen Hut aufs Deck und wollte bereits über Bord springen, zur Korvette hinüberschwimmen und um einen Kutter bitten, als Kapitän Guy erschien und ihn dazubleiben ersuchte. Der wachhabende Offizier an Bord des Franzosen hatte die Bewegung bei uns bemerkt und rief uns an, um zu hören, was geschehen war. Guy erklärte es ihm durch sein Sprachrohr und bekam sogleich Hilfe zugesagt. Man hörte eine Bootsmannspfeife, ein oder zwei Kommandos, dann pullte ein großer Kutter vom Achterende des Kriegsschiffes ab und kam nach ein paar Ruderschlägen längsschiffs. Der Steuermann sprang hinein, und sie pullten rasch dem Ufer zu. Ein zweiter Kutter mit bewaffneter Mannschaft folgte.
Nach einer Stunde kehrte der erste zurück und schleppte die beiden Walfischboote nach, die kieloben wie Schildkröten am Strande gelegen hatten.
Es wurde Mittag, ohne daß man von den Ausreißern etwas gehört hätte. Der Doktor und ich lungerten herum, machten nähere Bekanntschaft und erfreuten uns am Anblick der Uferlandschaft. Die Bucht lag totenstill; die Sonne stand hoch und heiß am Himmel; dann und wann glitt ein Kanu lautlos hinter der Landzunge hervor und schoß durch das Wasser.
Den ganzen Vormittag humpelten unsere Kranken an Deck umher und warfen sehnsüchtige Blicke ans Land, wo die Palmen mit nickenden Blätterkronen sie in ihren wohltuenden Schatten lockten. Die armen invaliden Halunken! Wie erholsam wären die stillen Haine für ihre erschütterte Gesundheit gewesen! Aber Jermin blieb hart und versicherte mit einem Fluch, daß sie keinen Fuß an Land setzen würden.
Gegen Sonnenuntergang sah man einen Haufen Menschen zum Meer herabkommen. Ganz vorn schritten die Flüchtlinge, barhaupt; Jacken und Hosen hingen in Fetzen herab, ihre Gesichter waren mit Blut und Staub bedeckt und ihre Arme mit grünen Baststricken auf dem Rücken gefesselt. Hinter ihnen kam eine johlende Schar Eingeborener, die sie mit den Spitzen ihrer langen Speere vorwärtstrieben, während die Leute von der Korvette sie in der Flanke mit ihren bloßen Messern bedrohten. Da man dem König der Bucht eine Muskete und für jeden eingebrachten Deserteur einen Becher voll Schießpulver versprochen hatte, war die ganze Bevölkerung hinter ihnen her gewesen; und die Jagd war so erfolgreich, daß nicht nur die Ausreißer von heute nacht, sondern auch noch fünf von denen, die beim vorhergehenden Besuch zurückgeblieben waren, eingebracht wurden. Die Eingeborenen hatten nur die Hunde gespielt, die das Wild aus seinem Versteck aufgetrieben hatten, das Greifen überließen sie den Franzosen. Zu einem Handgemenge mit verzweifelten Seeleuten haben die Eingeborenen nirgend Lust.
Die Ausreißer wurden sogleich an Bord gebracht, und obschon sie erst finster dreinsahen, lenkten sie bald ein und behandelten die ganze Sache als ein scherzhaftes Abenteuer.
Sechstes Kapitel
Kapitän Guy hatte keine Lust, noch eine Nacht in Heitihu zu verbringen, sondern ließ das Schiff bei Anbruch der Nacht unter Segel gehen. Aber am nächsten Morgen, als wir bereits alle glaubten, eine lange Kreuzerfahrt vor uns zu haben, änderten wir plötzlich den Kurs und hielten auf La Dominica oder Heivarhu zu, eine Insel, die gerade nördlich von Heitihu lag. Der Kapitän wollte ein paar englische Matrosen an Bord nehmen, die, wie der Kommandeur der Korvette ihm erzählt hatte, kürzlich dort von einem amerikanischen Walfischfänger ausgerissen waren und sich nur auf einem heimatlichen Fahrzeug verdingen wollten.
Wir sichteten das Land am Nachmittag; vor uns lag eine Bucht, die tief ins Land einschnitt, und ein schattiges Tal, das in engen, grünen, sich windenden Schluchten zuletzt dem Blick entschwand. »An die Luv-Großbrassen!« brüllte der Steuermann, auf die Verschanzung springend, und einen Augenblick später stand die »Julia«, in voller Fahrt angehalten, wie ein in die Zäume beißendes Pferd, das plötzlich zurückgenommen wird, still, während der Gischt in weißen Flocken unter ihrem Bug aufspritzte.
Hier sollten wir die neuen Matrosen bekommen, und ein Boot wurde klargemacht. Es mußte aber mit sicheren Leuten bemannt werden, das heißt mit solchen, von denen nicht zu erwarten stand, daß sie selbst durchgehen würden. Nach längerer Beratung zwischen Kapitän und Steuermann wurden vier als die vertrauenswürdigsten oder richtiger als die mindest verdächtigen ausgewählt. Auch der kranke Kapitän ließ sich über Bord schaffen; er wollte sich offenbar einmal auszeichnen. Die Eingeborenen sollten bösartig sein. Die Männer wurden mit Messern bis an die Zähne bewaffnet; der Kapitän schnallte außerdem noch einen alten Entergürtel um, in den er ein paar Pistolen steckte. Dann stießen sie ab.
Mein Freund, das lange Gespenst, hatte unter anderem Gepäck, das nicht gerade ins Vorderkastell paßte, ein großartiges Fernglas. Durch dieses Glas konnten wir das Boot, das für das bloße Auge längst unsichtbar war, am Eingang der Bucht deutlich wahrnehmen; es sah nicht größer aus als eine Eierschale, und die Leute darin wie Däumlinge. Wir sahen das winzige Ding auf einer langen Schaumflocke unter einem Funkenregen an den Strand schießen. Am Ufer war keine Seele zu erblicken. Sie ließen einen Mann als Wache beim Boot, die anderen stiegen ans Land und schritten vorsichtig auf den dichten Hain zu, der wenige Schritte vom Wasser begann. Nochmals blieben sie stehen und lauschten, die Hand am Ohr, und spähten in das grüne Dickicht. Niemand kam, und alles schien still wie das Grab. Endlich betraten sie, der eine mit seiner Pistole, die anderen ihre Pfriemen schwingend, den Wald und waren verschwunden. Sie blieben indessen nicht lange drin; offenbar fürchteten sie in einen Hinterhalt zu fallen, wenn sie tiefer in die Schlucht eindrangen.
Sie schifften sich auch sogleich wieder ein, und wir sahen sie über die Wogen gleiten, als der Kapitän plötzlich aufsprang; das Boot machte kehrt und hielt wieder auf den Strand zu. Zwanzig oder dreißig Eingeborene, mit Speeren bewaffnet, die durch das Glas wie Halme aussahen, waren aus dem Hain zum Vorschein gekommen und schienen etwas zu rufen. Unsere Leute mißtrauten ihnen offenbar, denn sie blieben etwa eine Bootslänge vom Ufer, der Kapitän stand auf und hielt eine Ansprache in Gebärden, worauf einer der Eingeborenen vortrat und erwiderte; er schien die Fremden einzuladen, ans Land zu kommen. Der Kapitän lehnte dies mit Armgebärden ab, und irgend etwas in seiner Haltung veranlaßte die Wilden, ihre Speere zu schütteln, worauf der Kapitän sogleich feuerte und alle davonliefen. Ein armer kleiner Kerl ließ seinen Speer fallen, griff mit der Hand nach rückwärts und hinkte fort; und mich juckte es, dem Kapitän dafür eins aufzubrennen.
Derart überflüssige Grausamkeiten sind beim Landen auf unbekannten Inseln nichts Ungewöhnliches. Sogar auf der Paumotugruppe, die nur eine Tagesfahrt von Taheiti entfernt ist, wurden Eingeborene, die an den Strand kamen, mehrmals von vorüberfahrenden Handelsschonern, die die schmalen Kanäle passierten, angeschossen; nur weil die Schufte sich belustigen wollten. Es ist unglaublich, aber viele Seeleute halten diese nackten Heiden kaum für Menschen. Je unwissender und je mehr herabgekommen der Mensch ist, desto mehr sieht er auf die herunter, die er nicht für seinesgleichen hält.
Das Boot kehrte zum Schiff zurück.
Auf der anderen Seite der Insel befand sich die große und bevölkerte Bucht von Hannamenu, wo wir die Leute vielleicht noch finden mochten, die wir suchten. Da die Sonne bereits im Sinken war, als das Boot längsseits kam, so wurden die Steuerbordbrassen eingeholt, und wir liefen in die offene See hinaus. Bei Tagesanbruch wendeten wir und liefen landwärts;, als die Sonne hell schien, fuhren wir in den langen engen Kanal zwischen den Inseln La Dominica und Santa Christina ein. Auf der einen Seite lagen steile, grüne, mehrere hundert Fuß hohe Felswände; die weißen Hütten der Eingeborenen saßen wie Vogelnester in tiefen Spalten, aus denen der üppige Pflanzenwuchs quoll. Jenseits des Wassers lagen warme wogende Hügel, die im Sonnenlicht zu atmen schienen. Wir aber glitten an schroffen Felsen und Hainen, an bewaldeten Tälern und düsteren Schluchten vorüber, in denen fern wilde Wasserfälle aufblitzten. Die frische Landbrise füllte unsere Segel, die umbuchteten Wasser lagen still wie ein See, und die Wogen brachen sich wie mit leichtem Klingen an den Kupferplatten des Bugs. Am Ende des Kanals fuhren wir um eine Landspitze und waren in der Bucht von Hannamenu. Es ist der einzige Hafen von einiger Bedeutung auf der Insel, verdient aber gleichfalls kaum den Namen, so wenig sicher ist der Ankergrund.
Bei der Einfahrt ereignete sich ein Vorfall, der einen Begriff von der Stimmung der Mannschaft geben mag. Sobald wir dem Ufer so nahe waren, als man vorsichtigerweise herankommen durfte, stoppten wir die Fahrt und erwarteten die Ankunft eines Kanus, das aus der Bai herauskam. Plötzlich gerieten wir in eine starke Strömung, die uns mit großer Schnelligkeit auf ein felsiges Vorgebirge zu riß, das die eine Seite des Hafens bildete. Der Wind war völlig abgeflaut; es wurden daher sogleich zwei Boote zu Wasser gelassen, die das Vorderende des Schiffes herumschleppen sollten. Aber ehe dies noch ausgeführt werden konnte, waren wir schon mitten in der wirbelnden Brandung, und der Felsen so nah, daß es aussah, als ob man aus den Toppen auf ihn hinüberspringen könnte. Trotz dem sprachlosen Schrecken des Kapitäns und dem heiseren Schreien des unerschrockenen Jermin, gingen die Leute mit dem Tauwerk so bedächtig als möglich um; die einen kicherten bei der Aussicht, ans Ufer zu kommen, die anderen wünschten so sehr, daß das Schiff aufrennen sollte, daß sie sich kaum beherrschen konnten. Aber ganz unerwartet kam uns eine Gegenströmung zugute, und mit Hilfe der Boote waren wir bald außer Gefahr.
Welche Enttäuschung für die Mannschaft! All ihre Hoffnungen, von dem Wrack ans Ufer zu schwimmen und es sich Zeit ihres Lebens gut gehen zu lassen, waren im Keim erstickt.
Bald darauf kam das Kanu längsseits. Es brachte acht oder zehn Eingeborene, hübsche lebhafte junge Leute, die unendliche Gebärden und viel Geschrei machten; die roten Federn in ihrem Kopfschmuck nickten beständig. Mit ihnen kam ein Fremder, ein Renegat – ein weißer Mann mit dem Südseelendentuch und tätowiertem Antlitz. Ein breiter blauer Streifen zog sich quer über sein Gesicht von einem Ohr zum anderen, und auf seiner Stirn war ein blauer Haifisch eingezeichnet, nichts als Schuppen vom Kopf bis zur Schwanzspitze. Manche von uns betrachteten den Mann mit Abscheu, um so mehr, als wir erfuhren, daß er sich dieser Verschönerung freiwillig unterzogen hatte. Es war schlimmer als ein Kainszeichen. Er war ein Engländer, Lern Hardy hieß er, und war von einer Brigg desertiert, die vor etwa zehn Jahren nach der Insel gekommen war, um Holz und Wasser einzunehmen. Mit einer Muskete und einem Sack Munition war er als souveräne kriegführende Macht ans Land gestiegen. In breiten Tälern herrschten die Könige feindlicher Stämme. Mit einem davon, der sich zuerst an ihn wandte, hatte er ein Bündnis geschlossen und wurde der militärische Führer des Stammes und Kriegsherr der ganzen Insel. In einem einzigen nächtlichen Angriff hatte er mit seiner unbesiegbaren Muskete, auf die leichte Infanterie mit ihren Speeren und Wurfspeeren gestützt, zwei Stämme besiegt, und schon am nächsten Morgen auch die beiden übrigen zu Füßen seines königlichen Verbündeten gezwungen.
Auch der Aufstieg seines persönlichen Vermögens war nicht weniger napoleonisch: drei Tage nach seiner Landung wurde ihm die fein tätowierte Hand einer Prinzessin zuteil, und zugleich mit der jungen Dame erhielt er als Mitgift tausend Faden feinen Tappas, fünfzig doppeltgeflochtene Matten aus geschlitztem Gras, vierhundert Schweine, zehn Häuser in verschiedenen Teilen des Tals und den Schutz eines besonderen Tabus, das seine Person für immer unverletzbar machte. Damit hatte er seine Lebensstellung, war vollkommen zufrieden und fühlte nicht den geringsten Wunsch, nach seiner Heimat zurückzukehren. Freunde hatte er nicht. Er erzählte mir seine Geschichte: er war ein Findelkind, ohne eine Ahnung, wer sein Vater gewesen; eines Tages war er noch als Junge aus dem Gemeindearbeitshause entlaufen und zur See gegangen. Mehrere Jahre hatte er das Hundeleben eines Vordergasten geführt, das er dann für immer aufgab.
Das sind die Leute, deren man viele unter den Seeleuten findet; sie kennen keine Seele, die nach ihnen fragen würde, und gleichgültig und ohne Bande, wie sie sind, finden sie gelegentlich unter den Wilden der Südsee eine neue Heimat. Und wenn man ihr hartes Los im eigenen Vaterland bedenkt, kann man sich über ihre Wahl wundern?
Nach der Versicherung des Renegaten befand sich kein anderer weißer Mann auf der Insel; und da kein Grund vorlag anzunehmen, daß er uns betrügen wollte, so schloß der Kapitän, daß die Franzosen sich geirrt hatten. Als indessen die anderen Eingeborenen erfuhren, weswegen wir gekommen waren, erbot sich einer von ihnen, ein schöner kräftiger Bursche, mit großen Augen und ausdrucksvollem Gesicht, eine Fahrt mitzumachen. Die ganze Heuer, die er verlangte, bestand aus einem Hut, einem roten Hemd und einem Paar Hosen, die er sogleich anlegen wollte, in einer Schnitte Tabak und einer Pfeife. Der Handel wurde auf der Stelle geschlossen; aber Weimontu kam mit einem nachträglichen Zusatz: ein Freund von ihm, der mit ihm gekommen war, sollte zehn Stück Schiffszwieback, ohne Bruch oder sonstige Fehler, zwanzig neue und vollkommen gerade Nägel und ein großes Bordmesser bekommen. Auch das wurde bewilligt, die Sachen wurden sofort übergeben; der Eingeborene nahm sie mit großer Gier, und da er sie sonst nirgends hinstecken konnte, steckte er die Nägel in den Mund. Nur zwei davon benützte er sogleich als Ohrschmuck, an Stelle merkwürdig geschnitzter Gehänge aus weißem Holz, die er herausnahm.
Der Seewind kam jetzt kräftig herein, und wir hatten keine Zeit zu verlieren, wenn wir vom Land abkommen wollten. Unser neuer Schiffsgenoß und seine Landsleute nahmen daher mit liebevollem Nasenreiben Abschied, und wir segelten mit ihm ab. Zu unserem Erstaunen hörte er die Abschiedsrufe aus dem Kanu, während wir unter vollen Oberbramsegeln dahinschossen, vollkommen unbewegt an. Aber das dauerte nicht lange. Noch am selben Abend, als das dunkle Blau seiner heimischen Berge am Horizont versank, lehnte der arme Wilde über der Reling, ließ den Kopf auf die Brust sinken und seinen Gefühlen freien Lauf. Das Schiff stampfte tüchtig, und Weimontu war zu seinen seelischen Leiden noch schwer seekrank.
Siebentes Kapitel
Hardy hatte mir manche interessante Mitteilung gemacht. Er hatte so lange auf der Insel gelebt und war mit den Sitten der Eingeborenen vollkommen vertraut; ich bedauerte nur, daß er bei der Kürze unseres Aufenthalts mir nicht mehr hatte sagen können. Immerhin hatte ich zu meiner Überraschung erfahren, daß die Leute von Heivarhu, obschon die Insel zur gleichen Gruppe gehörte, sich von meinen tropischen Freunden im Taïpital beträchtlich unterschieden. Da seine Tätowierung solches Aufsehen erregte, hatte Hardy uns viel davon erzählt, wie die Kunst auf der Insel ausgeübt wurde. Die Tätowierer von Heivarhu sind auf der ganzen Gruppe berühmt. Ihr Beruf war ein ehrenvoller, und wie vornehme Schneider nahmen sie die höchsten Preise, so daß nur die reicheren und höhergestellten Wilden sich an sie wenden konnten. Daher war die Eleganz der Tätowierung fast immer ein sicheres Zeichen einer vornehmen Geburt und eines bedeutenden Vermögens.
Professoren, die eine große Praxis hatten, lebten in geräumigen Häusern, die durch Tappavorhänge in zahlreiche kleine Gemächer abgeteilt waren, in denen die Klienten einzeln bedient wurden. Denn ein sonderbares Tabu schrieb jedermann, hoch oder niedrig, die strengste Abgeschiedenheit vor, solange er sich in der Behandlung des Tatöwierers befand. Jeder Verkehr ist ihm untersagt; die wenige Nahrung, die er zu sich nehmen darf, wird von einer unsichtbaren Hand unter dem Vorhang hereingeschoben. Denn die Nahrungsaufnahme ist beschränkt, um die Entzündung, die auf die Stiche und die Einführung des Farbstoffs folgt, möglichst abzuschwächen. Immerhin braucht sie ihre Zeit, um zu heilen, so daß die Isolierung oft wochenlang dauert. Wenn alles abgeheilt ist, kann der Mann gehen, muß aber bald wiederkommen; denn der Schmerz ist so heftig, daß immer nur eine kleine Fläche auf einmal behandelt werden kann, und da der ganze Körper in langsamem Verfahren mehr oder minder verschönert werden soll, so stehen die Ateliers niemals leer. Viele verbringen keinen geringen Teil ihres Lebens damit, sich tätowieren zu lassen. Man fängt gewöhnlich in jungen Jahren an, sucht einen hervorragenden Künstler aus, der zunächst einen Gesamtplan entwirft. Manche Tätowierer, die die höchste Vollkommenheit anstreben, haben ein oder zwei Leute niedrigsten Standes, die aber einen hohen Lohn erhalten, im Dienst, an denen sie ihre neuen Muster zunächst versuchen und sich sonst in Übung erhalten. Wenn ihre Rücken gänzlich verbraucht sind, werden sie entlassen; die Leute, die sich dazu hergeben, sind allgemein verachtet.