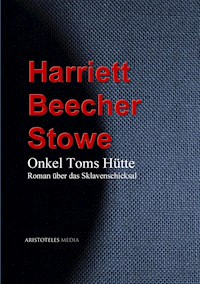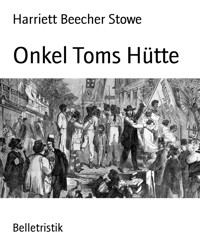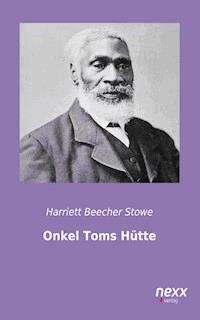Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Harriet Beecher-Stowe veröffentlichte 1852 den Roman Onkel Toms Hütte, in dem sie Lebenssituation und Schicksal einiger afroamerikanischer Sklaven in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts beschrieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Kapitel - Ein Menschenfreund
Kapitel - Der Gatte und Vater
Kapitel - Ein Abend in Onkel Toms Hütte
Kapitel - Die Empfindungen lebendiger Ware, …
Kapitel - Die Entdeckung
Kapitel - Der Kampf der Mutter
Kapitel - Ein würdiges Trio
Kapitel - Ein Senator ist auch nur ein Mensch
Kapitel - Die Ware wird fortgeschafft
Kapitel - Ungehörige Aufregung
Kapitel - Das Quäkerdorf
Kapitel - Evangeline
Kapitel - Toms neuer Herr
Kapitel - Toms Herrin und ihre Ansichten
Kapitel - Des freien Mannes Verteidigung
Kapitel - Miß Ophelias Erfahrungen und Meinungen
Kapitel - Topsy
Kapitel – Henrique
Kapitel – Vorboten
Kapitel - Der kleine Evangelist
Kapitel - Der Tod
Kapitel - Das Letzte auf Erden
Kapitel - Wieder vereint
Kapitel - Die Schutzlosen
Kapitel - Der Sklavenspeicher
Kapitel - Die Überfahrt
Kapitel - Düstere Bilder
1. Kapitel
Ein Menschenfreund
Spät nachmittags an einem kalten Februartage saßen zwei Gentlemen in einem gut ausmöblierten Speisesaal in der Stadt P. in Kentucky bei ihrem Weine. Bediente waren nicht anwesend, und die beiden Herren schienen mit dicht aneinander gerückten Stühlen etwas mit großem Interesse zu besprechen.
Wir haben bisher, um nicht umständlich zu sein, gesagt, zwei Gentlemen. Eine der beiden Personen schien jedoch bei genauerer Prüfung strenggenommen nicht unter diese Kategorie zu gehören. Es war ein kleiner, untersetzter Mann mit groben, nichtssagenden Zügen und dem prahlerischen und anspruchsvollen Wesen, das einem Niedrigstehenden eigen ist, der sich in der Welt emporzuarbeiten versucht. Er war sehr herausgeputzt und trug eine grell bunte Weste, ein blaues Halstuch mit großen gelben Tupfen und zu einer renommistischen Schleife geschlungen, die zu dem ganzen Aussehen des Mannes vortrefflich paßte. Die großen und gemeinen Hände waren reichlich mit Ringen besteckt, und mit einer schweren, goldenen Uhrkette mit einem ganzen Bündel großer Petschafte von allen möglichen Farben pflegte er im Eifer der Unterhaltung mit offenbarem Behagen zu spielen und zu klappern. In seiner Rede bot er ungeniert und mutvoll der Grammatik Trotz und verbrämte sie in geeigneten Zwischenräumen mit passenden Flüchen, welche niederzuschreiben uns selbst nicht der Wunsch, graphisch zu sein, vermögen wird.
Der andere, Mr. Shelby, hatte das Äußere eines Gentlemans, und die Anordnungen des Hauses und seine wirtschaftliche Einrichtung machten den Eindruck von Wohlhabenheit und sogar Reichtum. Wie wir schon vorhin sagten, beide waren in ein ernstes Gespräch vertieft.
»So würde ich die Sache abmachen«, sagte Mr. Shelby.
»Auf diese Weise kann ich das Geschäft nicht abschließen – es ist rein unmöglich, Mr. Shelby«, sagte der andere und hielt ein Glas Wein gegen das Licht.
»Ich sage Ihnen, Haley, Tom ist ein ganz ungewöhnlicher Kerl; er ist gewiß diese Summe überall wert – er ist ordentlich, ehrlich, geschickt und verwaltet meine Farm wie eine Uhr.«
»Sie meinen so ehrlich, wie Nigger sind«, sagte Haley und schenkte sich ein Glas Branntwein ein.
»Nein, ich meine wirklich, Tom ist ein guter, ordentlicher, verständiger, frommer Bursche. Er lernte seine Religion vor vier Jahren bei einem Camp-Meeting; und ich glaube, er hat sie wirklich gelernt. Ich habe ihm seitdem alles, was ich habe, anvertraut – Geld, Haus, Pferde, und habe ihn frei im Lande herumgehen lassen und habe ihn stets treu und ordentlich gefunden.«
»Manche Leute glauben nicht, daß es fromme Nigger gibt, Shelby«, sagte Haley, »aber ich glaube es. Ich hatte einen Burschen in der letzten Partie, die ich nach Orleans brachte, den beten zu hören, war wahrhaftig so gut, als ob man in einem Meeting wäre; und er war ganz ruhig und sanft. Er brachte mir auch ein gut Stück Geld ein; denn ich kaufte ihn billig von einem Manne, der losschlagen mußte, und ich kriegte 600 für ihn. Ja, ich betrachte Religion für eine wertvolle Sache bei einem Nigger, wenn sie wirklich echt ist.«
»Nun, bei Tom ist sie echt, wenn sie jemals echt war«, war die Antwort. »Letzten Herbst ließ ich ihn allein nach Cincinnati gehen, um für mich Geschäfte abzumachen und 500 Dollar zurückzubringen. ›Tom‹, sagte ich zu ihm, ›ich traue dir, weil ich glaube, du bist ein Christ – ich weiß, du wirst mich nicht hintergehen.‹ Und Tom kommt auch wirklich zurück – ich wußte, daß er das tun würde. Einige schlechte Kerle, hörte ich, sagten zu ihm: ›Tom, warum machst du dich nicht nach Kanada auf die Beine?‹ – ›Ach, Master hat mir Vertrauen geschenkt, und ich könnte es nicht!‹ Man hat mir alles erzählt. Es tut mir leid, Tom zu verkaufen, das gestehe ich. Sie sollten mit ihm den ganzen Rest der Schuld getilgt sein lassen; und Sie würden es, Haley, wenn Sie nur einen Funken Gewissen hätten.«
»Nun, ich habe genausoviel Gewissen, als ein Geschäftsmann vertragen kann – ein klein wenig, um darauf zu schwören, wissen Sie«, sagte der Handelsmann scherzend, »und dann bin ich bereit, alles, was man verständigerweise erlangen kann, zu tun, um Freunden gefällig zu sein; aber das hier ist ein bißchen zu viel verlangt – ein bißchen zu viel.«
Der Handelsmann seufzte nachdenklich und schenkte sich noch ein Glas Branntwein ein.
»Nun, Haley, was machen Sie denn für einen Vorschlag?« sagte Mr. Shelby nach einer gelegenen Pause im Gespräch.
»Können Sie denn nicht noch einen Jungen oder ein Mädchen zu Tom zugeben?«
»Hm! – Ich könnte keinen gut entbehren, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, nur die äußerste Not bringt mich dazu, überhaupt zu verkaufen. Ich gebe ungern einen meiner Leute hin, das ist die Sache.«
Hier ging die Tür auf, und ein kleiner Quadroonknabe, zwischen 4 und 5 Jahre alt, trat ins Zimmer. Es lag in seiner Erscheinung etwas merkwürdig Schönes und Gewinnendes. Das schwarze, seidenweiche Haar wallte in glänzenden Locken um das runde Gesicht mit Grübchen in Kinn und Wangen, während ein paar große dunkle Augen voll Feuer und Sanftheit unter den vollen, langen Wimpern hervorsahen, wie er neugierig in das Zimmer lugte. Eine bunte, rot und gelb karierte Kutte, sorgfältig gearbeitet und hübsch gemacht, hob den dunklen und reichen Stil seiner Schönheit noch mehr hervor, und eine gewisse komische Miene von Sicherheit mit Verschämtheit verbunden zeigte, daß es ihm nicht ungewohnt war, von seinem Herrn gehätschelt und beachtet zu werden.
»Heda! Jim Crow!« sagte Mr. Shelby, indem er dem Knaben pfiff und ihm eine Weintraube zuwarf. »Hier nimm das!«
Mit aller Kraft seiner kleinen Beine lief das Kind nach der Traube, während sein Herr lachte.
»Komm zu mir, Jim Crow«, sagte er.
Das Kind kam zu ihm, und der Herr streichelte den Lockenkopf und griff ihm unter das Kinn.
»Nun, Jim, zeige diesem Herrn, wie du tanzen und singen kannst.«
Der Knabe fing an, eines der unter Negern üblichen wilden und grotesken Lieder mit einer vollen klaren Stimme zu singen und begleitete den Gesang mit vielen komischen Bewegungen der Hände, der Füße und des ganzen Körpers, wobei er mit der Musik auf das strengste Takt hielt.
»Bravo!« sagte Haley und warf ihm das Viertel einer Orange zu.
»Nun, Jim, zeige uns einmal, wie der alte Onkel Cudjoe geht, wenn er die Gicht hat«, sagte sein Herr.
Auf der Stelle nahmen die biegsamen Glieder des Kindes den Anschein von Gebrechlichkeit und Verkrüppelung an, wie es mit gekrümmtem Rücken und den Stock des Herrn mit der Hand im Zimmer herumhumpelte, das kindische Gesicht in kläglichem Jammer verzogen, und bald rechts, bald links spuckend, ganz wie ein alter Mann.
Beide Herren lachten hell auf.
»Nun, Jim«, sagte sein Herr, »zeige uns, wie der alte Älteste Robbins den Psalm vorsingt.«
Der Knabe zog sein rundes Gesichtchen zu einer schrecklichen Länge und fing an, eine Psalmenmelodie mit unzerstörbarem Ernst durch die Nase zu singen.
»Hurra! Bravo! Was für ein Blitzkerlchen!« sagte Haley. »Das Bürschchen ist ja prächtig. Ich will Ihnen was sagen«, sagte er und schlug Mr. Shelby auf die Schulter, »geben Sie das Kerlchen zu, und das Geschäft soll abgemacht sein. Das ist doch gewiß anständig, nicht wahr?«
In diesem Augenblick wurde die Tür leise geöffnet, und ein junges Quadroonweib, dem Anschein nach ungefähr 25 Jahre alt, trat ins Zimmer.
Man brauchte bloß das Kind und sie anzusehen, um in ihr sogleich die Mutter zu erkennen. Dasselbe große, volle, schwarze Auge mit den langen Wimpern, dasselbe seidenweiche, schwarze, lockige Haar. Ihre braunen Wangen röteten sich merklich, und die Glut wurde noch tiefer, als sie den Blick des Fremden in kecker und unverhohlener Bewunderung auf sich ruhen sah. Ihr Kleid saß wie angegossen und hob die schönen Verhältnisse ihrer Gestalt vortrefflich hervor. Eine kleine, schön geformte Hand und ein zierlicher Fuß waren Einzelheiten, welche dem raschen Auge des Handelsmannes, der gewöhnt war, mit einem Blick die Schönheiten einer vortrefflichen weiblichen Ware abzuschätzen, nicht entgingen.
»Nun, Elisa?« sagte ihr Herr, als sie stehen blieb und ihn zögernd anblickte.
»Ich suchte Harry, Sir, wenn Sie erlauben«, und der Knabe sprang auf sie zu und zeigte ihr die geschenkten Früchte, die er im Schoß seiner Kutte trug.
»Nun, so nimm ihn mit«, sagte Mr. Shelby, und sie entfernte sich rasch, das Kind auf dem Arm tragend.
»Beim Jupiter!« sagte der Handelsmann und wendete sich voll Bewunderung gegen ihn. »Das ist ein Stück Ware! Mit dem Mädchen können Sie jeden Tag in Orleans zum reichen Mann werden. Ich habe zu meiner Zeit mehr als tausend Dollar für Mädchen zahlen sehen, die nicht ein bißchen hübscher waren.«
»Ich mag an ihr nicht zum reichen Mann werden«, sagte Mr. Shelby trocken und entkorkte eine frische Flasche Wein, indem er den andern frug, wie das Getränk ihm schmecke, um dem Gespräch eine andere Richtung zu geben.
»Vortrefflich, Sir – prima Ware!« sagte der Handelsmann; dann schlug er wieder Shelby vertraulich auf die Schulter und setzte hinzu: »Wollen wir ein Geschäft mit dem Mädchen machen? Was soll ich dafür bieten? Was wollen Sie haben?«
»Mr. Haley, sie ist nicht zu verkaufen«, sagte Shelby, »meine
Frau würde sie nicht für ihr Gewicht in Gold hingeben.«
»Ja, ja, das sagen die Weiber immer, weil sie nichts vom Rechnen verstehen. Man zeige ihnen nur, wieviel Uhren, Federn und Schmucksachen man für jemandes Gewicht in Gold kaufen kann, und das würde die Sache gleich anders machen, rechne ich.«
»Ich sage Ihnen, Haley, es kann nicht davon die Rede sein. Ich sage nein, und ich meine nein«, sagte Shelby mit Entschiedenheit. »Nun, dann bekomme ich aber den Knaben, nicht wahr?« sagte der Handelsmann. »Sie müssen gestehen, daß ich ziemlich anständig für ihn geboten habe.«
»Aber was wollen Sie denn mit dem Kinde machen?« sagte Shelby.
»Nun, ich habe einen Freund, der sein Geschäft beginnen will und hübsche Knaben kaufen möchte, um sie für den Markt aufzuziehen. Ganz und gar ein Modeartikel – man verkauft sie als Bediente usw. an reiche Kerle, die hübsche Kerle bezahlen können. Es putzt ein großes vornehmes Haus, wenn so ein wirklich schöner Bursche die Tür öffnet und aufwartet. Sie werden gut bezahlt; und der kleine Teufel ist ein so komisches, musikalisches Kerlchen, daß er vortrefflich passen würde.«
»Ich möchte ihn lieber nicht verkaufen«, sagte Mr. Shelby gedankenvoll. »Die Sache ist, Sir, ich bin ein menschlicher Mann und kann es nicht über mich bringen, den Knaben seiner Mutter zu nehmen.«
»O wirklich – hm! Ja – das ist so eine Sache. Ich verstehe vollkommen.
Es ist manchmal verwünscht eklig, mit Weibern durchzukommen. Wenn sie erst zu schreien und zu heulen anfangen, kann ich es nicht ausstehen. Das ist verwünscht eklig; aber wie ich die Sache einrichte, vermeide ich das gewöhnlich, Sir. Wenn Sie nun das Mädchen auf einen Tag oder eine Woche fortschickten? Da läßt sich die Sache ganz ruhig abmachen – und alles ist vorbei, wenn sie wiederkommt. Ihre Frau schenkt ihr dann noch ein Paar Ohrringe oder ein neues Kleid oder so was zur Entschädigung.«
»Ich fürchte, das geht nicht.«
»Ich sage Ihnen, es geht! Diese Leute sind nicht wie die Weißen, müssen Sie wissen; sie halten es aus, wenn man es nur recht anfängt. Sehen Sie«, sagte Haley und nahm eine aufrichtige und vertrauliche Miene an, »die Leute sagen, diese Art Handel mache die Menschen hartherzig; aber ich habe das nie gefunden. Die Sache ist, daß ich mich nie dazu bringen konnte, das Ding anzugreifen, wie es manche Burschen tun. Ich habe gesehen, wie einer Frau das Kind aus den Armen gerissen und verauktioniert wurde, während sie die ganze Zeit über jammerte und schrie wie verrückt; – sehr schlechte Politik – macht sie manchmal ganz untauglich zum Verkauf. Ich weiß von einem wirklich schönen Mädchen in Orleans, das durch so ein Verfahren ganz und gar ruiniert wurde. Der Mann, der das Weib kaufen wollte, wollte ihr Kind nicht haben, und sie war eine von der rechten, stürmischen Art, wenn ihr Blut einmal in der Hitze war. Ich sage Ihnen, sie drückte das Kind an ihre Brust und schwatzte und machte einen grauenhaften Lärm. Die Haut schauert mir noch, wenn ich daran denke; und als sie das Kind wegnahmen und sie einsperrten, wurde sie verrückt und starb in acht Tagen. Ein reiner Verlust von 1000 Dollar, Sir, bloß durch solche Behandlung. – Das ist die Sache. Es ist immer das beste, die Sache menschlich zu machen, so ist meine Erfahrung.«
Und der Handelsmann lehnte sich mit einer Miene tugendhafter Entschiedenheit in den Stuhl zurück und schlug die Arme über der Brust zusammen. Offenbar hielt er sich für einen zweiten Wilberforce.
Der Gegenstand schien den Herrn besonders zu interessieren, denn während Mr. Shelby nachdenklich eine Orange schälte, fing Haley mit schicklicher Bescheidenheit, aber als zwänge ihn die Macht der Wahrheit, noch ein paar Worte zu sagen, von neuem an:
»Es nimmt sich nicht gut aus, wenn sich ein Mann selber lobt; aber ich sage es nur, weil es die Wahrheit ist. Ich glaube, ich stehe in dem Ruf, die schönsten Herden Neger auf den Markt zu bringen – wenigstens hat man mir es gesagt, und gibt man es mir einmal zu, so muß es für alle hundertmal gelten –, und stets in gutem Zustand – dick und ansehnlich –, und es gehen mir so wenig zugrunde, als jedem andern Kaufmann in dem Geschäft, und ich schreibe das alles meiner Behandlung zu, Sir, und Menschlichkeit, Sir, möchte ich sagen, ist der große Pfeiler meiner Behandlung.«
Mr. Shelby wußte nicht, was er sagen sollte, und warf daher bloß ein »So?« ein.
»Man hatte mich wegen meiner Ideen ausgelacht und deshalb beredet. Sie sind nicht populär, und sie sind nicht gewöhnlich; aber ich habe an ihnen festgehalten, Sir, ich habe an ihnen festgehalten und habe mich wohl dabei befunden; ja, Sir, sie haben ihre Fahrt bezahlt, kann ich wohl sagen.« Und der Handelsmann lachte über seinen Witz.
Diese Beispiele von Menschlichkeit hatten etwas so Pikantes und Originelles, daß Mr. Shelby nicht umhin konnte, zur Gesellschaft mitzulachen. Vielleicht lachst Du auch, lieber Leser, aber Du weißt, daß heutzutage die Menschlichkeit in einer großen Verschiedenartigkeit seltsamer Gestalten erscheint, und daß menschliche Leute nie müde werden, Sonderbares zu sagen und zu tun.
Mr. Shelbys Lachen ermutigte den Handelsmann, fortzufahren.
»Es ist merkwürdig, aber ich könnte es niemals andern Leuten begreiflich machen. Da war der Tom Loker, mein alter Kompagnon in Natchez unten; der war ein gescheiter Kerl, der Tom, aber ein wahrer Teufel mit den Negern – aus Prinzip müssen Sie wissen, denn ein gutherzigerer Bursche ist nie geboren worden; es war sein System, Sir. Ich habe oft Tom Vorstellungen darüber gemacht. ›Aber, Tom‹, habe ich zu ihm gesagt, ›wenn deine Mädchen schreien und heulen, was nutzt es denn, wenn du ihnen eins über den Kopf gibst und mit der Peitsche unter ihnen herumfährst? 's ist lächerlich‹, sage ich, ›und nützt zu nichts. Ich sehe nicht ein, was ihr Heulen schaden soll?‹ sage ich. ›Es ist Natur, und wenn die Natur sich nicht auf die eine Weise Luft machen kann, so tut sie es auf eine andere; außerdem, Tom‹, sage ich, ›verdirbst du deine Mädchen damit; sie werden kränklich und melancholisch, und manchmal werden sie häßlich, vorzüglich gelbe Mädchen. Warum heiterst du sie nicht lieber auf und sprichst freundlich mit ihnen? Verlaß dich darauf, Tom, ein wenig Menschlichkeit bei passender Gelegenheit reicht viel weiter, als all dein Schimpfen und Prügeln, und es lohnt sich besser‹, sage ich, ›verlaß dich drauf.‹ Aber Tom konnte sich nicht daran gewöhnen, und er verdarb mir so viele Mädchen, daß ich mich von ihm trennen mußte, obgleich er ein gutherziger Kerl und ein tüchtiger Geschäftsmann war.«
»Und finden Sie, daß Ihre Art und Weise, das Geschäft zu machen, bessern Erfolg hat als die Toms?« fragte Mr. Shelby.
»Gewiß, Sir. Sehen Sie, wenn ich irgend kann, nehme ich mich mit den unangenehmen Auftritten, wie mit dem Verkaufen von Kindern und so, ein bißchen in acht, schicke die Mädchen aus dem Wege – aus den Augen, aus dem Sinn, wissen Sie ja –, und wenn es geschehen ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, gewöhnen sie sich natürlich daran. Es ist nicht wie bei den weißen Leuten, die von Haus aus gewöhnt sind, zu erwarten, daß sie ihre Kinder und ihre Weiber behalten werden. Nigger, wissen Sie ja, die ordentlich erzogen sind, erwarten so etwas ganz und gar nicht; darum vertragen sie so etwas leichter.«
»Ich fürchte dann, die meinigen sind nicht ordentlich erzogen«, sagte Mr. Shelby.
»Wohl möglich. Hier in Kentucky verzieht man die Nigger. Sie meinen es gut mit ihnen, aber es ist im Grunde keine wirkliche Güte. Sehen Sie, gegen einen Nigger, der in der Welt herumgestoßen und an Tom und Dick und Gott weiß wen verkauft wird, ist es keine Güte, ihm Ideen und große Erwartungen beizubringen und ihn gut zu erziehen; denn er fühlt das Herumstoßen hernach nur um so tiefer. Ich will darauf wetten, Ihre Nigger würden ganz melancholisch sein an einem Ort, wo ein echter Neger aus den Plantagen singen und jauchzen würde, als wäre er besessen. Natürlich hält jedermann seine Verfahrensweise für die beste, Mr. Shelby, und ich glaube, ich behandle die Neger genausogut, als es der Mühe wert ist, sie zu behandeln.«
»Wohl dem, der mit sich zufrieden ist«, sagte Mr. Shelby mit einem leichten Achselzucken und einigen Empfindungen unangenehmer Art.
»Nun, was meinen Sie?« sagte Haley, nachdem sie beide eine Weile lang schweigend Nüsse gegessen hatten.
»Ich will mir die Sache überlegen und mit meiner Frau sprechen«, sagte Mr. Shelby. »Unterdessen, Haley, wenn Sie die Sache ruhig abgemacht wissen wollen, so ist es das beste, Sie lassen hier herum nicht bekannt werden, weshalb Sie da sind. Es wird sonst unter meinen Burschen ruchbar, und es wird dann nicht besonders leicht sein, einen meiner Kerle fortzuschaffen, das versichere ich Ihnen.«
»O gewiß werde ich mir nichts merken lassen. Aber ich sage Ihnen, ich habe verwünscht wenig Zeit und möchte so bald als möglich wissen, worauf ich mich verlassen kann«, sagte er, indem er aufstand und den Überrock anzog.
»Nun, so kommen Sie diesen Abend zwischen 6 und 7 wieder her, und Sie sollen Antwort haben«, sagte Mr. Shelby, und der Handelsmann entfernte sich grüßend.
»Ich wollte, ich hätte den Kerl die Treppe hinunterwerfen können mit seiner unverschämten Zuversicht«, sagte Mr. Shelby zu sich, als die Tür ordentlich zu war, »aber er weiß, wie sehr er mich in der Hand hat. Wenn mir jemand jemals gesagt hätte, daß ich Tom unten nach dem Süden an einen dieser Kerle verkaufen würde, so hätte ich gesagt: ›Ist dein Diener ein Hund, daß er das tun sollte?‹
Und jetzt muß es geschehn, soweit ich sehen kann. Und auch Elisas Kind! Ich weiß, ich werde darüber einigen Trödel mit meiner Frau haben, und auch wegen Tom. Das kommt von den Schulden – o weh! Der Kerl kennt seinen Vorteil und benutzt ihn aufs äußerste.«
Das Sklavenwesen in seiner mildesten Form ist wahrscheinlich im Staat Kentucky zu finden. Das allgemeine Vorherrschen von Kultursystemen von ruhiger und allmählicher Art, ohne das periodisch eintretende Bedürfnis, die Leute übermäßig zu beschäftigen, welches der landwirtschaftlichen Industrie der südlichen Distrikte eigen ist, macht die Arbeit des Negers zu einer gesunderen oder vernünftigeren, während der Herr, mit einem allmählicheren Erwerb zufrieden, nicht der Versuchung zur Hartherzigkeit ausgesetzt ist, welcher die schwache Menschennatur oft unterliegt, wo der Aussicht auf plötzlichen und raschen Gewinn kein schwereres Gewicht die Waage hält, als die Interessen der Hilflosen und Unbeschützten.
Mr. Shelby war ein Mann, wie man sie oft und stets gern findet, gutherzig und liebevoll und geneigt, seine ganze Umgebung mit freundlicher Nachsicht zu behandeln, und er hatte es nie an etwas fehlen lassen, was zum physischen Wohlsein der Neger auf seiner Besitzung beitragen konnte. Er hatte jedoch stark und unüberlegt spekuliert, war tief verschuldet, und auf ihn laufende Wechsel auf bedeutende Summen waren Haley in die Hände gekommen. Dies wird genügen, um das eben erzählte Gespräch zu erklären. Elisa hatte, während sie sich der Tür näherte, genug von der Unterhaltung gehört, um zu wissen, daß ein Handelsmann ihrem Herrn für jemanden ein Gebot mache.
Sie wäre gern an der Tür stehengeblieben, um zu horchen, als sie draußen war; aber ihre Herrin rief sie gerade, und sie mußte forteilen. Dennoch glaubte sie, den Handelsmann auf ihr Kind bieten gehört zu haben, konnte sie sich geirrt haben? Ihr Herz schwoll und bebte, und sie drückte den Kleinen unwillkürlich so fest an sich, daß er sie erstaunt ansah.
»Elisa, was fehlt dir heute?« sagte ihre Herrin, als sie den Wasserkrug und den Stickrahmen umgeworfen und ihrer Herrin zerstreut einen langen Nachtmantel anstatt des seidenen Kleides, das sie hatte holen sollen, dargereicht hatte.
Elisa schrak auf. »Ach, Missis!« sagte sie und erhob die Augen; dann stürzten ihre Tränen hervor und sie setzte sich auf einen Stuhl und fing an zu schluchzen.
»Aber Elisa, Kind! Was hast du?« sagte ihre Herrin.
»Ach, Missis, Missis!« sagte Elisa. »Ein Handelsmann spricht mit dem Herrn im Speisezimmer! Ich habe es gehört.«
»Nun, was schadet das, Närrchen?«
»Ach, Missis, glauben Sie wohl, daß der Herr meinen Harry verkaufen würde?« Und das arme Mädchen warf sich in einen Stuhl und schluchzte krampfhaft.
»Ihn verkaufen! Nein, du törichtes Mädchen! Du weißt, daß dein Herr niemals mit diesen Handelsleuten aus dem Süden Geschäfte macht und keinen seiner Leute verkauft, solange sie sich gut aufführen. Und wer soll denn deinen Harry kaufen? Meinst du denn, alle Welt ist so vernarrt in ihn wie du? Komm, beruhige dich und hake mir das Kleid zu. So, nun flechte mir das Haar in den hübschen Zopf, den du neulich gelernt hast, und horche nicht mehr an den Türen.«
»Also, Missis, Sie würden niemals Ihre Einwilligung geben, daß . . .«
»Unsinn, Kind! Natürlich würde ich es nicht. Warum sprichst du so? Ebensogut würde ich eins meiner Kinder verkaufen lassen. Aber wahrhaftig, Elisa, du wirst viel zu stolz auf den kleinen Burschen. Es darf nur einer die Nase zur Tür hereinstecken, so glaubst du gleich, er müsse ihn kaufen wollen.«
Wieder beruhigt durch den zuversichtlichen Ton ihrer Herrin setzte Elisa rasch und geschickt ihre Toilettendienste fort und lachte sich selbst aus wegen ihrer Furcht.
Mrs. Shelby war eine Frau von hoher geistiger und sittlicher Bildung. Neben der natürlichen Großmut und dem Edelsinn, welche oft die Frauen von Kentucky auszeichnen, besaß sie ein lebhaftes, sittliches, ein religiöses Gefühl und Grundsätze, die sie mit großer Energie und Geschicklichkeit in praktische Ausübung brachte. Ihr Gatte, der keine besondere Religiosität beanspruchte, hatte doch große Ehrfurcht vor der Konsequenz ihrer religiösen Überzeugung und hatte vielleicht ein wenig Scheu vor ihrer Meinung. Jedenfalls ließ er ihr ganz freie Hand in ihren wohlwollenden Bemühungen um das Wohlbehagen, den Unterricht und die Erziehung ihrer Leute, obgleich er selbst keinen tätigen Anteil daran nahm. Obgleich er nicht gerade an die Lehre von den überflüssigen guten Werken der Heiligen glaubte, so schien er doch im Grunde auf eine oder die andere Weise zu denken, daß seine Frau Frömmigkeit und Wohlwollen genug für zwei habe, und sich mit einer dunklen Hoffnung zu schmeicheln, durch ihren Einfluß an Eigenschaften, auf die er keinen besonderen Anspruch machte, in den Himmel zu gelangen.
Die schwerste Last auf seiner Seele nach seiner Unterredung mit dem Handelsmann war die unvermeidliche Notwendigkeit, seiner Gattin das besprochene Arrangement mitzuteilen und den Vorstellungen und dem Widerstand die Spitze zu bieten, die er schon voraussetzen konnte.
Mrs. Shelby, die von ihres Gatten Geldverlegenheit nicht das mindeste wußte und die nur die allgemeine Gutherzigkeit seines Charakters kannte, war in der vollständigen Ungläubigkeit, mit der sie Elisas Befürchtung aufnahm, ganz aufrichtig gewesen. Wirklich schenkte sie der ganzen Frage keinen einzigen Gedanken mehr; und da sie mit den Vorbereitungen zu einem Abendbesuch beschäftigt war, hatte sie die Sache bald vergessen.
2. Kapitel
Der Gatte und Vater
Mrs. Shelby war zum Besuch ausgefahren, und Elisa stand in der Veranda und sah etwas niedergeschlagen dem verschwindenden Wagen nach, als sie eine Hand auf ihrer Schulter fühlte. Sie drehte sich um, und ein helles Lächeln glänzte sofort in ihren schönen Augen.
»Georg, du bist's? Wie du mich erschreckt hast! Nun, es freut mich, daß du da bist! Missis ist für den Nachmittag ausgefahren: So komm mit in mein Stübchen, wir wollen den ganzen Nachmittag miteinander verbringen.«
Mit diesen Worten zog sie ihren Mann in ein nettes Zimmerchen, das auf die Veranda hinausging, und wo sie gewöhnlich im Bereich der Stimme ihrer Herrin mit Nähen beschäftigt saß.
»Wie froh ich bin! – Warum lächelst du nicht? – Und sieh nur Harry – wie er wächst!« Der Knabe blickte durch seine Locken scheu den Vater an und hielt sich am Rock seiner Mutter fest. »Ist er nicht wunderschön!« sagte Elisa, indem sie ihm die Locken aus dem Gesicht strich und ihn küßte.
»Ich wollte, er wäre nie geboren worden!« sagte George bitter. »Ich wollte, ich wäre selbst nie geboren worden!«
Überrascht und erschrocken setzte sich Elisa hin, legte ihren Kopf auf ihres Gatten Schultern und brach in Tränen aus.
»Ach, Elisa, es ist zu schlecht von mir, dir so weh zu tun, armes Mädchen!« sagte er zärtlich. »Es ist zu schlecht! O wie ich wünsche, ich hätte dich nie gesehen – du hättest glücklich sein können.«
»George, George! Wie kannst du so reden? Was ist Schreckliches geschehen, oder was soll geschehen? Gewiß sind wir sehr glücklich gewesen bis vor ganz kurzem.«
»Jawohl, liebes Weib«, sagte George. Dann nahm er sein Kind auf die Knie, blickte ihm in die schönen, dunklen Augen und fuhr mit der Hand durch seine langen Locken.
»Ganz dein Gesicht, Elisa, und du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe, und die beste, die ich zu sehen wünsche; aber ach ich wünschte, ich hätte dich nie gesehen, und du nie mich!«
»Aber George, wie kannst du so sprechen!«
»Ja, Elisa, es ist alles Jammer, Jammer, Jammer! Mein Leben ist bitter wie Wermut; die Lebenskraft zehrt sich selbst auf in mir. Ich bin ein armes, elendes, unglückliches Packholz: Ich werde dich nur mit mir zu Boden ziehen, weiter nichts. Was nützt es, zu versuchen, etwas zu tun, etwas zu wissen, etwas zu werden? Was nützt es, zu leben? Ich wollte, ich wäre tot!«
»Aber das ist wirklich gottlos, lieber George! Ich weiß, wie dir der Verlust deiner Stelle in der Fabrik zu Herzen geht, und du hast einen harten Herrn; aber bitte, habe Geduld, und vielleicht kann etwas –«
»Geduld!« unterbrach er sie. »Habe ich nicht Geduld gehabt? Habe ich ein Wort gesagt, als er kam und ohne den geringsten Grund mich von einem Platze wegnahm, wo mich jedermann gut behandelte! Ich habe ihm jeden Cent meines Verdienstes gewissenhaft bezahlt, und alle sagen, daß ich ein tüchtiger Arbeiter war.«
»Ja, es ist schrecklich«, sagte Elisa, »aber trotz alledem ist er dein Herr, weißt du.«
»Mein Herr! Und wer hat ihn zu meinem Herrn gemacht? Das ist's, was ich wissen möchte – welches Recht hat er auf mich? Ich bin ein Mensch, so gut wie er; ich bin ein besserer Mensch als er; ich verstehe mehr als er; ich wirtschafte besser als er; ich kann besser lesen als er; ich schreibe eine bessere Hand; und ich habe das alles von selbst gelernt und schulde ihm keinen Dank – ich habe es wider seinen Willen gelernt; und welches Recht hat er nun, aus mir ein Packholz zu machen? – Mich von einer Arbeit zu entfernen, die ich verrichten kann, und zwar besser als er, und mich bei einer anzustellen, die jedes Stück Vieh verrichten kann? Er versucht es und sagt, er will meinen Stolz brechen und mich demütigen, und er gibt mir mit Absicht die gröbste und schlechteste und schmutzigste Arbeit.«
»Ach, George – George, du erschreckst mich! Ich habe dich noch nie so sprechen hören; ich fürchte, du gehst mit etwas Schrecklichem um. Ich wundere mich durchaus nicht über deine Empfindungen; aber ach, sei vorsichtig – sei es um meinetwillen, sei es um Harrys willen!«
»Ich bin vorsichtig gewesen und habe Geduld gehabt; aber es wird schlimmer und schlimmer – Fleisch und Blut können es nicht länger tragen. Er ergreift jede Gelegenheit, um mich zu beschimpfen und zu quälen.
Ich glaubte, ich würde meine Arbeit verrichten und mich ruhig halten und einige Zeit übrigbehalten können, um außer den Arbeitsstunden zu lesen und zu lernen; aber je mehr er sieht, daß ich arbeiten kann, desto mehr bürdet er mir auf. Er sagt, obgleich ich nichts äußere, sehe er doch, daß ich den Teufel im Leib habe, und er wolle ihn mir austreiben; und zu seiner Zeit wird er herauskommen in einer Weise, die ihm nicht gefallen wird, oder ich irre mich gewaltig.«
»O Gott, was sollen wir anfangen?« sagte Elisa trauervoll.
»Erst gestern«, sagte George, »als ich eben Steine in einen Karren lud, stand der junge Master Tom da und klatschte mit der Peitsche so nahe beim Pferde, daß es scheute. Ich bat ihn, so freundlich ich konnte, es sein zu lassen, aber nun fing er erst recht an. Ich bat ihn noch einmal, und dann wendete er sich gegen mich und schlug mich. Ich hielt seine Hand fest, und dann schrie er und strampelte und lief zum Vater und sagte, ich hätte ihn geschlagen. Der kam voller Wut herbei und sagte, er wolle mir zeigen, wer der Herr sei; und er band mich an einen Baum und schnitt Ruten für den jungen Herrn ab und sagte ihm, er sollte mich schlagen, bis er müde sei; und er hat es getan. Wenn ich ihm dafür nicht noch einmal ein Denkzeichen gebe!« Und die Stirn des Jünglings verfinsterte sich, und in seinen Augen brannte eine Flamme, welche seine junge Gattin zittern machte. »Wer hat diesen Mann zu meinem Herrn gemacht – das will ich wissen«, sagte er.
»Ach«, sagte Elisa traurig, »ich habe immer geglaubt, ich müßte meinem Herrn und meiner Herrin gehorchen, sonst wäre ich keine gute Christin.«
»In deinem Fall ist doch noch einige Vernunft darin; sie haben dich auferzogen wie ein Kind – haben dich ernährt, gekleidet, gepflegt und unterrichtet, so daß du eine gute Erziehung hast – so haben sie doch Grund zu einem Anspruch auf dich. Aber mich haben sie geschlagen und gestoßen und beschimpft und im besten Falle mir selber überlassen; und was bin ich schuldig? Ich habe für meine Unterhaltung schon mehr als hundertmal bezahlt. Ich ertrage es nicht länger – nein gewiß nicht!« sagte er und ballte mit wilder Gebärde die Faust. Elisa zitterte und schwieg. Sie hatte ihren Gatten früher nie in dieser Stimmung gesehen; und ihre sanften Begriffe von Pflicht schienen sich vor einem solchen Sturm der Leidenschaft wie Binsen zu biegen.
»Du kennst ja den kleinen Carlo, den du mir geschenkt hast«, fuhr George fort. »Er war fast mein einziger Trost. Er schlief des Nachts bei mir und ging mir des Tags auf Schritt und Tritt nach und sah mich an, als ob er wüßte, wie es mir ums Herz war. Nun, neulich gab ich ihm ein paar Abfälle, die ich an der Küchentür aufgelesen hatte, und der Herr kam dazu und sagte, ich fütterte ihn auf seine Kosten, und er hätte das Geld nicht dazu, daß jeder Nigger sich seinen Hund halten könne, und befahl mir, ihm einen Stein an den Hals zu binden und ihn in den Teich zu werfen.«
»Aber George, das hast du doch nicht getan?«
»Ich – nein; aber er. Der Herr und Tom steinigten das arme Tier, wie es im Teiche zappelte. Das arme Tier! Es sah mich so traurig an, als wunderte es sich, daß ich es nicht rettete! Ich mußte mich auspeitschen lassen, weil ich es nicht selbst tun wollte, 's ist mir gleich; Master wird schon entdecken, daß ich nicht einer von denen bin, die das Auspeitschen zahm macht. Auch meine Zeit wird kommen, ehe er sich's versieht.«
»Was hast du im Sinn? Ach George! Tue nichts, was unrecht ist. Wenn du nur Gott vertraust und suchst recht zu tun, so wird er dich erlösen.«
»Ich bin nicht Christ wie du, Elisa; mein Herz ist voller Haß; ich kann nicht auf Gott vertraun. Warum läßt er es so sein?«
»Ach George, wir müssen glauben und vertrauen! Meine Herrin sagt, wenn alles mit uns schlechtgeht, so müssen wir glauben, daß Gott es zum allerbesten lenkt.«
»Das können wohl Leute sagen, die auf ihrem Sofa sitzen und in ihren Kutschen fahren; aber sie sollten nur in meiner Lage sein, und es würde ihnen härter ankommen. Ich wollte, ich könnte gut sein; aber mein Herz brennt und kann sich nicht mehr fügen. Du könntest es auch nicht an meiner Stelle; du wirst es jetzt nicht können, wenn ich dir alles sage, was ich zu sagen habe. Du weißt noch nicht alles.«
»Was hast du noch?«
»Nun, neulich hat Master gesagt, er sei ein Narr gewesen, daß er mich habe von der Plantage wegheiraten lassen; er hasse Mr. Shelby und sein ganzes Geschlecht, weil sie stolz sind und über ihn hinwegsehen, und ich wäre durch dich stolz geworden; und er sagt, er wolle mich nicht mehr hierher gehen lassen, sondern ich solle auf seiner Plantage ein Weib nehmen und dort wohnen.
Anfangs schalt er und brummte das vor sich hin; aber gestern sagte er, ich müsse Mina heiraten und mit ihr in eine Hütte ziehen, sonst wolle er mich nach dem Süden verkaufen.«
»Aber du bist mir doch durch den Pfarrer angetraut, so gut, als ob du ein Weißer gewesen wärest!« sagte Elisa.
»Weißt du nicht, daß ein Sklave nicht heiraten kann? Dazu haben wir kein Gesetz hierzulande; ich kann dich nicht als Frau behalten, wenn es ihm einfällt, uns voneinander zu trennen. Deshalb wünsche ich, ich hätte dich nie gesehen; deshalb wünsche ich, ich wäre nie geboren; es wäre besser für uns beide – es wäre besser für dieses arme Kind, wenn es nicht geboren worden wäre. Alles, alles kann ihm noch widerfahren!«
»Ach! Aber Master ist so gut!«
»Ja, aber wer weiß – er kann sterben, und dann kann er an wer weiß wen verkauft werden. Was nützt es, daß er schön und gescheit und klug ist? Ich sage dir, Elisa, für jede gute und angenehme Eigenschaft, die unser Kind hat, wird dir ein Schwert durch das Herz fahren – sie wird es viel zu wertvoll machen, als daß du es behalten könntest.«
Diese Worte trafen Elisas Herz schwer; das Bild des Handelsmannes trat ihr vor die Augen, und als ob sie jemand tödlich getroffen hätte, wurde sie blaß und schnappte nach Atem. Unruhig blickte sie auf die Veranda, wohin sich der Knabe, von dem ernsten Gespräch gelangweilt, zurückgezogen hatte und wo er frohlockend auf Mr. Shelbys Spazierstock galoppierte. Sie wollte ihrem Gatten ihre Befürchtungen mitteilen, besann sich aber eines andern.
»Nein, nein, der Arme hat genug zu tragen!« dachte sie. »Nein, ich will es ihm nicht sagen; außerdem ist es auch nicht wahr; Missis belügt uns nie.«
»Also, Elisa, bleib standhaft«, sagte der Neger traurig, »und leb wohl; denn ich gehe fort.«
»Du gehst fort, George – wohin?«
»Nach Kanada«, sagte er und richtete sich gerade in die Höhe; »und wenn ich dort bin, will ich dich loskaufen – das ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben. Du hast einen guten Herrn, der es nicht verweigern wird, dich loszugeben. Ich kaufe dich und das Kind – Gott helfe mir – ich tue es.«
»Ach schrecklich! – Wenn man dich fängt!«
»Ich lasse mich nicht fangen, Elisa – eher sterbe ich! Ich will frei sein oder sterben!«
»Du willst dich doch nicht selbst töten!«
»Das braucht's nicht; sie selber werden mich schon rasch genug totschlagen; den Fluß hinab sollen sie mich nicht lebendig bekommen.«
»Ach George, um meinetwillen sei vorsichtig! Tue nichts Schlechtes; tue dir nichts zuleide und andern auch nicht. Du bist zu großen Versuchungen ausgesetzt – viel zu großen; aber bitte – fort mußt du – aber sei vorsichtig und klug; bitte Gott, daß er dir helfen möge.«
»So höre denn meinen Plan, Elisa. Master fiel es ein, mich mit einem Briefe an Mr. Symmes, der eine Meile weiter wohnt, hier diesen Weg zu schicken. Ich glaube, er erwartete, daß ich hierher gehen würde, um dir zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Er würde sich freuen, wenn er glaubte, es würde ›Shelbys Leute‹ ärgern, wie er sie nennt. Du mußt wissen, ich gehe ganz ruhig nach Hause, als ob alles vorbei sei. Ich habe Vorbereitungen getroffen und habe Leute, die mir helfen; und so nach einer Woche oder so wird man mich suchen, sage ich dir. Bete für mich, Elisa, vielleicht wird der gute Gott dich erhören.«
»Ach George, bete du selbst und vertraue auf ihn; dann wirst du nichts Schlechtes tun.«
»So lebe denn recht wohl«, sagte George und ergriff Elisas Hände und sah ihr ohne sich zu bewegen in die Augen. Stumm standen sie da; dann hörte man noch letzte Worte und Schluchzen und bitteres Weinen – einen Abschied, wie diejenigen nehmen, deren Hoffnungen, sich wiederzusehen, an einem bloßen Faden hängen; und Mann und Weib schieden voneinander.
3. Kapitel
Ein Abend in Onkel Toms Hütte
Onkel Toms Hütte war ein kleines Blockhaus, dicht neben dem »Hause«, wie der Neger die Herrenwohnung par excellence nennt. Davor war ein hübscher Gartenfleck, wo jeden Sommer Erdbeeren, Himbeeren und viele andere Früchte und Gemüse unter sorgfältiger Pflege gediehen.
Die ganze Vorderseite war von einer großen roten Begonie und einer einheimischen Multiflora-rose bedeckt, die sich ineinander verschlangen und kaum ein Fleckchen der rohen Balken erblicken ließen. Hier fanden auch im Sommer verschiedene lebhaft gefärbte Blumen wie Ringelblumen, Petunien und andere eine Stelle, wo sie ihren Glanz zeigen konnten, und waren die Freude und der Stolz von Tante Chloes Herzen.
Wir wollen einmal in das Haus eintreten. Das Abendessen im Herrenhause ist vorbei, und Tante Chloe, die seiner Bereitung als erste Köchin vorstand, hat anderen in der Küche das Geschäft überlassen, das Geschirr wegzuräumen und zu waschen, und ist nun unter ihrem eigenen gemütlichen Dache, um für ihren Alten das Abendessen zu bereiten. Deshalb könnt Ihr Euch sicher darauf verlassen, daß sie vor dem Feuer steht und mit gespanntem Interesse gewisse brodelnde Sachen in einem Kasserol überwacht und dann und wann mit ernster Überlegung den Deckel eines Schmorkessels abhebt, aus welchem ein Dampf emporsteigt, der unzweifelhaft etwas Gutes erraten läßt. Sie hat ein rundes, schwarzes, glänzendes Gesicht, so glänzend, daß man fast glauben könnte, sie wäre mit Eiweiß lackiert, wie eins ihrer eigenen Teebrote. Ihr ganzes dickes Gesicht strahlt unter ihrem gut gestärkten karierten Turban von Selbstgenügsamkeit und Zufriedenheit, nicht unvermischt, müssen wir gestehen, mit dem Selbstbewußtsein, welches der ersten Kochkünstlerin der ganzen Umgegend zukommt, wofür Tante Chloe allgemein gehalten wird.
Eine Köchin war sie gewiß bis zum innersten Kern ihrer Seele. Jede Henne, Truthenne oder Ente auf dem Hofe wurde ernsthaft, wenn sie Tante Chloe nahen sah, und schien bange an ihren letzten Augenblick zu denken; denn gewiß war ihr Kopf immer so sehr mit Schlachten, Füllen und Braten beschäftigt, daß jedes einsichtsvolle Huhn, das noch lebte, darüber erschrecken konnte. Ihr Maiskuchen in allen seinen zahllosen Varietäten war ein erhabenes Geheimnis für alle weniger geübten Bäcker, und ihr fetter Bauch wackelte ihr von ehrlichem Stolz und Freude, wenn sie die fruchtlosen Anstrengungen einer oder der andern Nebenbuhlerin erzählte, die danach gestrebt hatte, ihren hohen Standpunkt zu erreichen.
Die Ankunft von Gesellschaft im Herrenhause, das Anordnen von Staatsdiners und Soupers,
riefen die ganze Energie ihrer Seele wach, und kein Anblick war ihr angenehmer, als ein ganzer Haufen von Reisekoffern in der Veranda; dann sah sie neue Anstrengungen und neue Siege vor sich.
Jetzt gerade blickt jedoch Tante Chloe in die Schmorpfanne, bei welcher angenehmen Beschäftigung wir sie lassen wollen, bis wir mit unserer Schilderung der Hütte fertig sind.
In einer Ecke derselben stand ein Bett, sauber mit einer schneeweißen Decke zugedeckt, und vor demselben lag ein Stück Teppich von nicht unbeträchtlicher Größe. Auf dieses Stück Teppich bildete sich Tante Chloe etwas ein, weil es ganz entschieden vornehm war, und dasselbe und das Bett, vor dem es lag, und die ganze Ecke wurde mit ausgezeichneter Rücksicht behandelt und soweit möglich vor den plündernden Einfällen und Entheiligungen des Kleinen bewahrt. Eigentlich war diese Ecke der Salon des Hauses. In der andern Ecke stand ein Bett von viel bescheideneren Ansprüchen und offenbar zum Gebrauch bestimmt. Über dem Kamin hingen ein paar sehr bunte Bilder aus der Heiligen Schrift und ein Porträt des Generals Washington von einer Zeichnung und einem Kolorit, welche gewiß diesen großen Mann in Erstaunen gesetzt hätten, wenn sie ihm zu Gesicht gekommen wären.
Auf einer Bretterbank in der Ecke waren ein paar Knaben mit Wollköpfen und funkelnden schwarzen Augen beschäftigt, die ersten Gehübungen eines kleinen Kindes zu beaufsichtigen, die, wie es gewöhnlich der Fall ist, darin bestanden, daß es auf die Füße zu stehen kam, einen Augenblick das Gleichgewicht suchte und dann wieder niederfiel. Natürlich wurde jeder fehlgeschlagene Versuch mit lebhaftem Beifall begrüßt, als wäre er ganz entschieden gelungen.
Ein in seinen Beinen etwas gichtischer Tisch war vor das Fenster gerückt und mit einem Tischtuch bedeckt; verschiedenes Geschirr von sehr lebhaftem Muster stand darauf wie Anzeichen einer bevorstehenden Mahlzeit. An diesem Tisch saß Onkel Tom, Mr. Shelbys bester Mann.
Er war ein großer, breitschultriger, kräftig gebauter Mann von tiefem glänzendem Schwarz und einem Gesicht, dessen echt afrikanische Züge ein Ausdruck von ernster und tüchtiger Verständigkeit, mit Freundlichkeit und Wohlwollen verbunden, auszeichnete.
In seiner ganzen Physiognomie lag etwas von Selbstachtung und Würde, die jedoch mit einer vertrauenden und bescheidenen Einfachheit verbunden waren.
Er hatte gerade sehr viel mit einer vor ihm liegenden Schiefertafel zu tun, auf welcher er vorsichtig und langsam bemüht war, einige Buchstaben nachzumalen, wobei ihn der junge Master George, ein lebhafter, hübscher Knabe von 13 Jahren, beaufsichtigte, der die Würde seiner Stellung als Lehrer ganz zu fühlen schien.
»Nicht auf die Seite, Onkel Tom – nicht auf die Seite«, sagte er munter, als Onkel Tom mit großer Mühe den Schwanz eines g auf der falschen Seite in die Höhe zog. »Das wird ein q, sieh her.«
»So, so, wirklich«, sagte Onkel Tom und sah mit einem ehrerbietigen, bewundernden Gesicht zu, während sein junger Lehrer zu seiner Erbauung unzählbare q und g auf die Tafel machte; darauf nahm er den Schieferstift zwischen seine groben schweren Finger und fing geduldig von vorn an.
»Wie leicht den weißen Leuten alles wird!« sagte Tante Chloe, indem sie einen Augenblick von der Kuchenform aufsah, die sie mit einem auf die Gabel aufgespießten Stück Speck bestrich, und den jungen Master George stolz anblickte. »Wie er jetzt schreiben kann! Und lesen! Und abends hierher zu kommen und seine Lektionen uns vorzulesen – das ist gewaltig interessant!«
»Aber, Tante Chloe, ich werde gewaltig hungrig«, sagte George.
»Ist denn der Kuchen in der Pfanne dort bald fertig?«
»Beinahe gut, Master George«, sagte Tante Chloe, indem sie den Deckel ein wenig in die Höhe hob und hineinguckte; »wird schön braun – wunderschön braun. Ach das überlaßt mir! Missis ließ neulich Sally versuchen, Kuchen zu backen, nur damit sie's lerne, sagte sie. ›Ach gehen Sie, Missis!‹ sagte ich. ›Es tut einem ordentlich das Herz weh, gute Speisen so verderben zu sehen! Der Kuchen hebt sich nur auf einer Seite, kriegt keine Form, so wenig wie mein Schuh – geht mir!‹« Und mit dieser letzten Abfertigung der Uneingeweihtheit Sallys nahm Tante Chloe den Deckel von der Backpfanne und zeigte den Augen einen schön gebackenen Pfundkuchen, dessen sich kein Konditor in der Stadt hätte zu schämen brauchen. Da dies offenbar der Mittel- und Hauptpunkt des Festes war, so fing jetzt Tante Chloe an, sich ernstlich mit dem Anrichten des Abendessens zu beschäftigen.
»Ihr da, Mose und Pete, geht aus dem Wege, ihr Nigger!
Fort hier, Polly, mein Schätzchen, Mutter wird dir hernach schon was geben. Und Sie, Master George, nehmen Sie jetzt die Bücher weg und setzen Sie sich hin mit meinem Alten, und ich will die Würste anrichten und Ihnen die erste Form voll Waffeln vorsetzen, ehe Sie sich umsehen können.«
»Sie wollten, ich solle zum Abendbrot nach Hause kommen«, sagte George; »aber ich wußte zu gut, was besser ist, Tante Chloe.«
»Gewiß, gewiß, Goldkind«, sagte Tante Chloe und häufte ihm den Teller voll dampfender Waffeln. »Sie wußten, daß Ihr altes Tantchen das Beste für Sie aufhebt. O das überlaßt Ihr, geht mir!« Und dabei gab Tante Chloe George einen freundlichen Stoß in die Seite, der über die Maßen spaßhaft sein sollte, und wendete sich wieder mit großem Eifer zu ihrer Kuchenform.
»Nun den Kuchen her«, sagte Master George, als er in der Beschäftigung mit den Waffeln ein wenig nachgelassen hatte, und damit schwenkte der junge Bursche ein großes Messer über den fraglichen Gegenstand.
»Ums Himmels willen, Master George!« sagte Tante Chloe mit großem Ernste und ergriff ihn beim Arme. »Sie werden ihn doch nicht mit dem großen Messer schneiden? Sie verderben ihn ganz und gar – zerbrechen die schöne, gewölbte Decke? Hier ist ein dünnes, altes Messer, das ich bloß dazu geschärft habe. So, so – geht so leicht auseinander wie eine Feder! Nun essen Sie – was Besseres, als das, kriegen Sie nicht.«
»Tom Lincoln sagt«, entgegnete George mit vollem Munde, »daß ihre Jinny besser kochen kann als du!«
»Die Lincolns haben nicht viel zu bedeuten, gar nicht!« sagte Tante Chloe geringschätzig. »Ich meine im Vergleich mit unsern Leuten. Es sind ganz achtbare Leute in bescheidener einfacher Weise; aber etwas Vornehmes zuwege zu bringen, davon haben sie auch gar keinen Begriff. Stellen Sie einmal Master Lincoln neben Master Shelby! O Gott! Und Mistreß Lincoln, kann sie so in das Zimmer hereinrauschen, wie meine Missis – so recht vornehm, wißt Ihr! O geht mir! Sprecht mir nicht von den Lincolns!« Und Tante Chloe warf den Kopf zurück wie eine Person, die da vermeint, sie kenne die Welt etwas.
»Nun, ich habe dich aber doch sagen hören«, sagte George, »daß Jinny eine leidliche Köchin sei.«
»Das habe ich gesagt«, sagte Tante Chloe, »das kann ich sagen. Eine gute, einfache, gewöhnliche Küche, die kann Jinny besorgen; kann ein gutes Laib Brot backen – ihre Kartoffeln ziemlich kochen – ihre Maiskuchen sind nicht besonders, nicht besonders sind sie, aber doch sind sie leidlich – aber Gott, wenn man zu den höhern Zweigen kommt, was kann sie da? Nun ja, sie macht Pasteten – jawohl; aber mit was für einer Rinde? Kann sie den echten, geschmeidigen Teig backen, der im Munde zerschmilzt und in die Höhe steigt, wie ein Eiderbett? Nun, ich war drüben bei Miß Marys Hochzeit, und Jinny zeigte mir die Hochzeitkuchen. Jinny und ich sind gute Freundinnen, wissen Sie. Ich sagte kein Wort; aber gehen Sie mir, Master George! Wahrhaftig, ich könnte eine ganze Woche lang kein Auge zutun, wenn ich solche Kuchen gemacht hätte. Gott, sie taugten auch gar nichts!«
»Und wahrscheinlich bildet sich Jinny was Besonderes darauf ein«, sagte George.
»Gewiß, gewiß! Ich sehe sie noch, wie sie mir sie zeigte, so unschuldig ja sehen Sie, das ist es eben, Jinny weiß es nicht besser. Gott, die Familie ist nichts! Man kann es nicht verlangen, daß sie es weiß! Das ist nicht ihr Fehler. Ach, Master George, Sie kennen nicht die Hälfte Ihrer Privilegien in Ihrer Familie und Erziehung.« Hier seufzte Tante Chloe und verdrehte vor Bewegung die Augen.
»O gewiß, Tante Chloe, ich kenne alle meine Pasteten- und Pudding-Privilegien«, sagte George. »Frag Tom Lincoln, ob ich nicht jedesmal über ihn krähe, wenn ich ihn sehe.«
Tante Chloe lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und brach über diesen Witz ihres jungen Herrn in ein so herzliches Lachen aus, daß ihr die Tränen über die glänzenden schwarzen Backen herabrollten, wobei sie scherzend Master George schlug und puffte und ihm sagte, er sollte gehen, und er sei so ein Mensch – und er sei imstande, sie tot zu machen; und zwischen jeder dieser Todesprophezeiungen brach sie wieder in ein Gelächter aus, das stets länger und lauter als das vorige war, bis George wirklich zu glauben anfing, er sei ein ganz gefährlich witziger Kerl, und er müsse sich wohl in acht nehmen, nicht gar zu drollig zu sein.
»Und das sagten Sie Tom wirklich! O Gott! Was die jungen Leute nicht alles tun! Sie kräheten über Tom, o Gott! Master George, Sie können ja einen Holzbock zu lachen machen.«
»Ja«, sagte George, »ich sagte zu ihm: ›Tom, du solltest einen Kuchen von Tante Chloe sehen; das sind die wahren‹«, sagte ich.
»'s ist wirklich schade, daß es Tom nicht gekonnt hat«, sagte Tante Chloe, auf deren wohlwollendes Herz der Gedanke an Toms umnachteten Seelenzustand einen starken Eindruck zu machen schien. »Sie sollten ihn eigentlich nächster Tage einmal hierher zum Essen einladen, Master George«, setzte sie hinzu; »das würde sich ganz hübsch von Ihnen ausnehmen. Sehen Sie, Master George, Sie dürfen auf niemand herabsehen wegen Ihrer Privilegien, weil unsere Privilegien uns von Gott gegeben sind, – wir sollten das niemals vergessen«, sagte Tante Chloe und machte ein ganz andächtiges Gesicht.
»Gut, ich werde nächste Woche Tom einmal hierher einladen«, sagte George; »und du tust dein Bestes, Tante Chloe, und er soll Augen machen! Er soll essen, daß er es vierzehn Tage lang nicht verwinden kann; nicht wahr?«
»Ja, ja, gewiß«, sagte Tante Chloe voll Freude, »das sollen Sie sehen. Gott, wenn man an manche unserer Diners denkt! Erinnern Sie sich noch an die große Hühnerpastete, die ich machte, als wir General Knox das Diner gaben? Ich und Missis hätten uns fast wegen der Pastetenrinde gezankt. Ich möchte wissen, was Ladies manchmal in den Kopf kommt, aber manchmal, wenn jemand die schwerste Verantwortlichkeit auf sich hat und sozusagen das Herz ganz voll hat von seinem Geschäft, da wählen sie gerade die Zeit, nur um um einen herumzustehen und hineinzureden! Missis nun wollte, ich sollte dieses so machen und jenes anders machen; und zuletzt wurde ich ordentlich giftig und sagte: ›Aber Missis, sehen Sie doch einmal Ihre schönen weißen Hände an mit den langen Fingern, die alle von Ringen funkeln wie meine weißen Lilien, wenn der Tau dran hängt; und sehen Sie dann meine großen, schwarzen, plumpen Hände an. Meinen Sie nun nicht, daß der Herr mich geschaffen hat, um den Pastetenteig zu backen, und Sie, um im Gesellschaftszimmer zu bleiben?‹ Ja, ich war wirklich giftig, Master George.«
»Und was sagte die Mutter?« sagte George.
»Was sie sagte? – Nun, man sah es, ihre Augen lachten – ihre großen schönen Augen; und sie sagte: ›Tante Chloe, ich glaube wirklich, du hast darin ziemlich recht‹ sagte sie; und sie ging hinein ins Gesellschaftszimmer.
Sie hätte mir eigentlich eins über den Kopf geben sollen, weil ich so giftig war; aber 's ist einmal so – mit Damen in der Küche kann ich nichts machen!«
»Ja, du hast dich mit diesem Diner hervorgetan – ich erinnere mich noch, daß jeder das sagte«, sagte George.
»Nicht wahr? Und stand ich nicht an demselben Tage hinter der Tür des Speisezimmers, und sah ich nicht, wie der General sich noch dreimal von meiner Pastete geben ließ, und hörte ich nicht, wie er sagte: ›Sie müssen eine ganz besonders gute Köchin haben, Mrs. Shelby.‹ Gott! Ich wäre fast geplatzt!«
»Und der General weiß, was gut kochen heißt«, sagte Tante Chloe und richtete sich selbstbewußt in die Höhe. »Sehr hübscher Mann, der General! Stammt aus einer unserer allerbesten Familien von Altvirginien! Er weiß, wo Barthel Most holt, der General – so gut wie ich. Sie müssen wissen, Master George, jede Art Pastete hat ihre Feinheiten; aber nicht jedermann weiß, was sie sind oder worin sie bestehen sollten. Aber der General weiß es; das spürte ich gleich in seinen Bemerkungen. Ja, er weiß, wo die Feinheiten sind!«
Mittlerweile hatte Master George den Zustand erreicht, den selbst ein Knabe erreichen kann (unter ungewöhnlichen Verhältnissen), wo er auch nicht einen Bissen mehr essen konnte, und daher hatte er jetzt Muße, den Haufen von wolligen Köpfen und glänzenden Augen zu bemerken, welche ihnen aus der anderen Ecke hungrig zusahen.
»Hier Mose, Pete«, sagte er, indem er große Bissen abbrach und sie ihnen zuwarf; »ihr wollt auch was haben, nicht? Tante Chloe, backe ihnen ein paar Waffeln.«
Und George und Tom rückten auf einen gemütlichen Platz in die Kaminecke, während Tante Chloe, nachdem sie einen ansehnlichen Haufen Waffeln gebacken, das Kleinste auf den Schoß nahm und anfing, abwechselnd den Mund der Kinder und ihren eigenen zu füllen und Mose und Pete ebenfalls zu bedenken, welche vorzuziehen schienen, ihre Portionen zu verzehren, während sie unter dem Tische auf dem Erdboden herumkollerten, sich gegenseitig kitzelten und gelegentlich das Kleinste an den Zehen zupften.
»Wart, still da!« sagte die Mutter und stieß dann und wann ziemlich aufs Geratewohl mit dem Fuße unter den Tisch, wenn der Lärm gar zu arg wurde.
»Könnt ihr euch nicht anständig benehmen, wenn euch weiße Herrschaften besuchen? Wollt ihr gleich ruhig sein! Nehmt euch in acht, sonst nehme ich euch ein Knopfloch tiefer vor, wenn Master George fort ist!«
Was diese schreckliche Drohung besagen sollte, ist schwer zu deuten; aber gewiß ist, daß ihre grauenhafte Unbestimmtheit auf die jungen Sünder, denen sie galt, sehr wenig Eindruck machte.
»Ach, sie sind noch so voller Lachen, daß sie sich nicht benehmen können«, sagte Onkel Tom.
Hier kamen die Jungen unter dem Tisch hervor und fingen mit tüchtig mit Sirup bekleisterten Händen und Gesicht das Kleine lebhaft zu küssen an.
»Marsch, fort mit euch!« sagte die Mutter und stieß ihre wolligen Köpfe beiseite. »Ihr klebt alle zusammen und kommt nicht wieder los voneinander, wenn ihr es so macht. Geht an den Brunnen und wascht euch!« sagte sie und unterstützte ihre Ermahnungen mit einem Klaps, der sehr derb klang, aber nur noch mehr Gelächter aus den Jungen hervorzulocken schien, wie sie übereinander weg zur Türe hinauspurzelten, wo sie vor lauter Lust hell aufkreischten.
»Hat man schon so ungezogene Rangen gesehen?« sagte Tante Chloe etwas selbstgefällig, wie sie ein für solche Gelegenheiten aufgespanntes, altes Handtuch hervorbrachte, etwas Wasser aus der gesprungenen Teekanne darauf goß und nun den Sirup von dem Gesicht und den Händen des Kleinsten abwusch; wie es dann poliert war, bis es glänzte, setzte sie es Tom auf den Schoß, während sie sich mit dem Abräumen des Tisches beschäftigte. Das Kleinste benutzte die Zwischenzeit, um Tom an der Nase zu zupfen, ihn im Gesichte zu kratzen und mit seinen dicken runden Händen in dem wolligen Haar herumzuwühlen, welches ihm ganz besonderes Vergnügen zu machen schien.
»Ist es nicht ein munteres Kerlchen?« sagte Tom und hielt das Kind auf Armlänge vor sich hin, um es ordentlich zu besehen; dann stand er auf, setzte es auf seine breite Schulter und fing an, mit ihm herumzuspringen und zu tanzen, während Master George mit dem Taschentuch nach ihm schlug, und Mose und Pete, die wieder hereingekommen waren, hinterherbrüllten wie Bären, bis Tante Chloe erklärte, daß es zum Kopfabreißen sei.
Da nach ihrer eigenen Aussage diese chirurgische Operation in der Hütte täglich vorkam, so wurde dadurch die Lust nicht im mindesten vermindert, bis sich jedermann wieder in einen Zustand der Fassung gebrüllt, gesprungen und getanzt hatte.
»Nun, ich hoffe, ihr seid nun fertig«, sagte Tante Chloe, die aus einem roh gearbeiteten Kasten geschäftig ein Rollbett hervorgeholt hatte.
»Und jetzt kriecht da hinein, du Mose und du Pete, denn jetzt geht das Meeting an.«
»Ach, Mutter, wir wollen noch nicht schlafen. Wir wollen aufbleiben zum Meeting – Meeting ist so hübsch. Es gefällt uns.« »Ach, Tante Chloe, schieb' es wieder drunter und lasse sie aufbleiben«, sagte Master George in entschiedenem Tone und gab dem Bette einen Stoß.
Tante Chloe schien, nachdem sie auf diese Weise den Schein gerettet, recht gern das Bett wieder hinunterzuschieben und sagte dabei: »Nun, vielleicht profitieren sie was davon.«
Das Haus trat nun zu einer Komiteesitzung zusammen, um die zu treffenden Anordnungen zum Meeting in Erwägung zu ziehen.
»Wie wir mit den Stühlen auskommen sollen, weiß ich wahrhaftig nicht!« sagte Tante Chloe. Da man das Meeting schon seit unvordenklicher Zeit beim Onkel Tom gehalten hatte, ohne mehr Stühle zu besitzen, so schien einige Berechtigung zu der Hoffnung vorhanden zu sein, daß sich wohl auch diesmal ein Weg finden werde.
»Der alte Onkel Peter hat vorige Woche beide Beine aus dem ältesten Stuhle dort herausgesungen«, meinte Mose.
»Wart du! Ich will wetten, du hast sie selbst herausgezogen; 's ist einer von deinen Streichen«, sagte Tante Chloe.
»Nun, er steht schon, wenn wir ihn nur recht fest an die Wand rücken«, sagte Mose.
»Dann darf Onkel Peter nicht drauf sitzen, weil er immer rutscht, wenn er zu singen anfängt. Neulich abends ist er fast durch das ganze Zimmer gerutscht«, sagte Pete.
»O Gott! Dann laßt ihn drauf sitzen«, sagte Mose, »und dann fängt er an: ›Ihr Heiligen und ihr Sünder alle‹ und plauz! liegt er unten.« – Und Mose ahmte die Nasentöne des Alten ganz genau nach und platzte auf den Erdboden nieder, um die eingebildete Katastrophe vor Augen zu bringen.
»Wollt ihr nicht ungezogen sein!« sagte Tante Chloe. »Schämt ihr euch nicht?«
Master George lachte jedoch mit dem Sünder und erklärte mit Entschiedenheit, daß Mose ein Blitzkerl sei. Daher schien die mütterliche Ermahnung nicht allzuviel Erfolg zu haben.
»Nun, Alter«, sagte Tante Chloe, »dann mußt du wohl die Fässer hereinrollen.«
»Mutters Fässer sind wie die der Witwe, von der Master George in dem guten Buch vorlas – sie sind immer sicher«, sagte Mose beiseite zu Pete.
»Eins gab doch nach vorige Woche«, sagte Pete, »daß alle mitten im Singen zusammenpurzelten; das war doch nicht so sicher, nicht?«
Während dieses leisen Zwiegespräches zwischen Mose und Pete hatte Onkel Tom zwei leere Fässer in die Hütte gerollt und sie mit ein paar Steinen an jeder Seite an ihre Stelle befestigt. Nun legte man Bretter darüber; kehrte dann noch verschiedene Butten und Eimer um, stellte die wackeligen Stühle an ihren Platz und war nun mit der Vorbereitung zum Meeting fertig.
»Master George liest so schön, daß er gewiß gern dableibt und für uns liest«, sagte Tante Chloe; »gewiß ist das viel hübscher.«
George gab bereitwillig seine Beistimmung, denn ein Knabe ist zu allem bereit, was ihm eine Wichtigkeit gibt.
Das Zimmer füllte sich bald mit einer sehr gemischten Gesellschaft von den alten grauköpfigen Patriarchen von achtzig bis zu den jungen Mädchen und Burschen von 15 Jahren. Man begann mit einem harmlosen Klatschen über verschiedene Gegenstände, wie z. B. wo die alte Tante Sally ihr neues rotes Kopftuch her habe, und wie Missis der Lissy das geblümte Mousselinkleid schenken wolle, sowie ihre neuen Sachen fertig wären, und wie Master Shelby eine neue Rotfuchsstute kaufen wolle, die eine große Vermehrung der Herrlichkeiten des Gutes sein werde. Einige der Andächtigen gehörten benachbarten Familien, die ihnen erlaubt hatten, dem Meeting beizuwohnen. Sie hatten mancherlei Pikantes von dem, was im Hause und auf dem Gute geschah, zu erzählen, und diese kleine Münze der Unterhaltung ging ebenso rasch von Hand zu Hand, wie dieselbe Münzsorte in vornehmen Kreisen.
Nach einer Weile fing zur offenbaren Freude aller Anwesenden das Singen an.
Nicht einmal der Nachteil der näselnden Intonierung konnte die Wirkung der von Natur schönen Stimmen in diesen wilden und lebhaften Melodien beeinträchtigen. Der Text bestand zuweilen aus den wohlbekannten und gewöhnlichen Kirchenhymnen, trug aber auch manchmal einen wilden und unbestimmten Charakter, der von Camp-Meetings herstammte.
Verschiedene Ermahnungen oder Erzählungen aus dem eigenen Leben folgten und unterbrachen zuweilen das Singen.