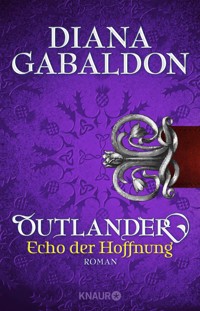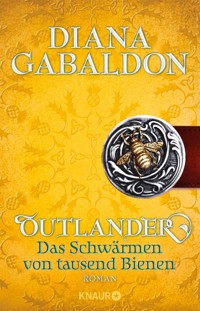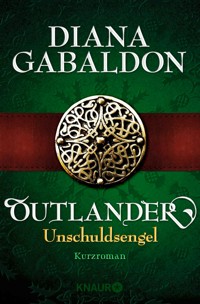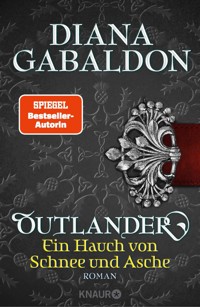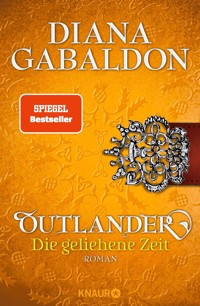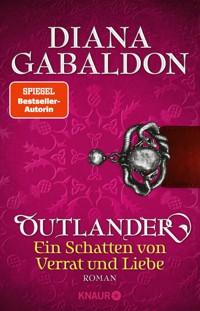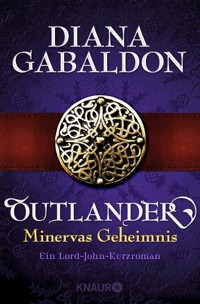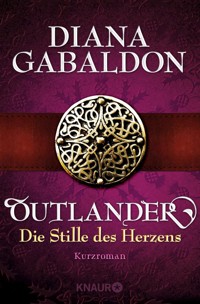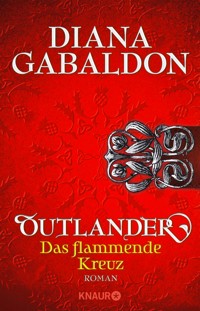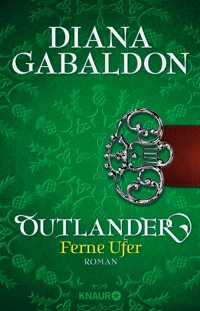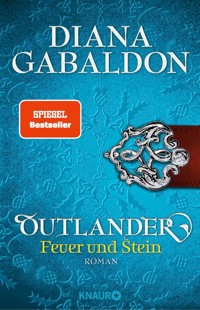
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Outlander-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Welterfolg erstmals in ungekürzter Neuübersetzung Schottland 1946: Die englische Krankenschwester Claire Randall ist in den zweiten Flitterwochen, als sie neugierig einen alten Steinkreis betritt und darin auf einmal ohnmächtig wird. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich im Jahr 1743 – und ist von jetzt auf gleich eine Fremde, ein »Outlander«. »Prall, üppig, lustvoll, kühn, historisch korrekt – und absolut süchtig machend!« Berliner Zeitung »Packend und herzerwärmend! Dieser Roman erweckt Schottland und seine Geschichte auf einzigartige Weise zum Leben.« Publishers Weekly Die historischen Romane der Outlander-Saga von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Outlander – Feuer und Stein - Outlander – Die geliehene Zeit - Outlander – Ferne Ufer - Outlander – Der Ruf der Trommel - Outlander – Das flammende Kreuz - Outlander – Ein Hauch von Schnee und Asche - Outlander – Echo der Hoffnung - Outlander – Ein Schatten von Verrat und Liebe - Outlander – Das Schwärmen von tausend Bienen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1554
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander – Feuer und Stein
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Welterfolg erstmals in ungekürzter Neuübersetzung
Schottland, 1946: Die englische Krankenschwester Claire Randall ist in den zweiten Flitterwochen, als sie neugierig einen alten Steinkreis betritt und darin auf einmal ohnmächtig wird. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich im Jahr 1743 – und ist von jetzt auf gleich eine Fremde, ein »Outlander«.
»Prall, üppig, lustvoll, kühn, historisch korrekt - und absolut süchtig machend!«
Berliner Zeitung
»Packend und herzerwärmend! Dieser Roman erweckt Schottland und seine Geschichte auf einzigartige Weise zum Leben.«
Publishers Weekly
In Erinnerung an meine Mutter, die mir das Lesen beigebracht hat – Jacqueline Sykes Gabaldon
Liebe Leser,
ich bin Barbara Schnell 1992 begegnet. Diese Begegnung fand online statt, im CompuServe Literary Forum, meiner elektronischen »Stammkneipe«. Barbara war/ist Fotografin und Journalistin, und im Rahmen der Recherche für einen Artikel hat sie gefragt, ob es im Forum Leute gab, die elektronische Medien professionell benutzten, entweder bei der Recherche für ihre Texte oder zu ihrer Vermarktung.
Ich habe mit »Ja« geantwortet, und es folgte ein interessantes Gespräch über Bücher, über das Schreiben und über den möglichen Nutzen dessen, was man damals noch nicht »soziale Medien« nannte. Barbara wurde neugierig auf meine Bücher und hat die ersten beiden Bände – mehr gab es damals noch nicht – auf Englisch gelesen. Woraufhin sie mir geschrieben hat: »Ich würde alles tun, um deine Bücher zu übersetzen.«
Ich kann zwar Deutsch lesen – ich habe es an der Uni gelernt, um wissenschaftliche Fachartikel verstehen zu können –, aber nur sehr langsam, und ich kann weder die Grammatik noch den Stil eines Textes beurteilen. Aus diesen Gründen habe ich auch nie versucht, die Übersetzungen meiner Romane zu lesen.
Doch dann wollte ich es genauer wissen und habe einige befreundete Zweisprachler gefragt, ob sie die deutschen Übersetzungen gelesen hätten und was sie davon hielten. Die Antwort lautete generell, dass die Story zwar immer noch packend war, dass man sie an manchen Stellen aber gekürzt hatte und dass der Einsatz von Übersetzerteams (statt eines einzelnen Übersetzers) wohl zwangsweise dazu geführt hatte, dass Erzählton und Stil flach waren.
Inzwischen waren Barbara und ich gute Freundinnen geworden; ich hatte einige ihrer eigenen Texte gelesen, und die Kompetenz und emotionale Tiefe ihrer englischen Arbeiten hatten mich sehr beeindruckt. Als ich also mein viertes Buch, »Der Ruf der Trommel«, fertig geschrieben hatte, habe ich meinem internationalen Agenten gesagt, dass ich gern wieder mit demselben Verlag zusammenarbeiten würde, dass ich aber vor allem gern Barbara als meine Übersetzerin hätte. Es folgten sechs Monate reger Verhandlungen, aber am Ende … war Barbara meine Übersetzerin, und sie ist es geblieben.
Wir wünschen uns beide schon seit Jahren eine neue Übersetzung der ersten drei Bände, damit die deutschen Leser die Geschichte in ihrer ganzen und nicht gekürzten Fülle erleben können – und ich bin überglücklich, dass die Zeit für »Feuer und Stein« endlich gekommen ist! Ich hoffe, dass Sie genauso viel Freude an diesem neuen Lese-Erlebnis haben werden wie ich.
Herzlich
Diana Gabaldon
Menschen verschwinden jeden Tag. Fragen Sie nur einen Polizisten. Oder besser noch, fragen Sie einen Journalisten. Verschwundene sind das täglich’ Brot der Journalisten.
Teenager laufen von zu Hause fort. Eltern verlieren ihre Kinder aus den Augen, und diese tauchen nie wieder auf. Ehefrauen gelangen ans Ende ihres Geduldsfadens, plündern die Haushaltskasse und nehmen sich ein Taxi zum Bahnhof. Internationale Finanzhaie wechseln den Namen und lösen sich im Rauch importierter Zigarren auf.
Viele der Verschollenen werden irgendwann gefunden, tot oder lebendig. Es gibt schließlich Erklärungen für solche Fälle.
Normalerweise.
Erster Teil
Inverness 1946
Kapitel 1
Ein neuer Anfang
Es war kein Ort, an dem man damit gerechnet hätte, verlorenzugehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Mrs. Bairds Bed and Breakfast unterschied sich in nichts von tausend anderen Highland-Pensionen im Jahr 1946; sauber und ruhig mit blasser Blümchentapete, glänzenden Fußböden und einem münzbetriebenen Heißwassergerät im Bad. Mrs. Baird selbst war eine kräftige, freundliche Frau, die keine Einwände äußerte, als sich Frank mit den Dutzenden Büchern und Papieren, die ihn stets auf Reisen begleiteten, in ihrem winzigen, rosengemusterten Salon einrichtete.
Ich begegnete Mrs. Baird auf meinem Weg ins Freie im Eingangsflur. Sie legte mir ihre Pummelhand auf den Arm, um mich aufzuhalten, und betätschelte mein Haar.
»Großer Gott, Mrs. Randall, so können Sie doch nicht unter die Leute gehen! Augenblick, ich stecke Ihnen das fest. So. Das ist besser. Meine Cousine hat mir neulich von dieser neuen Dauerwelle erzählt, sieht hübsch aus und hält traumhaft; vielleicht sollten Sie die beim nächsten Mal probieren.«
Ich brachte es nicht übers Herz, ihr zu erzählen, dass das Eigenleben meiner hellbraunen Locken einzig und allein die Schuld der Natur und nicht dem Versäumnis eines Dauerwellenherstellers zuzuschreiben war. Ihren strikt ondulierten Wellen dagegen konnte man derartige Perversitäten nicht nachsagen.
»Ja, das mache ich, Mrs. Baird«, log ich. »Ich gehe jetzt nur in den Ort, um mich mit Frank zu treffen. Wir kommen zum Tee zurück.« Ich duckte mich zur Tür hinaus und machte mich auf den Weg, ehe sie weitere Defekte an meiner undisziplinierten Erscheinung ausmachen konnte. Nach vier Jahren als Krankenschwester der Royal Army kannte ich keine größere Freude, als den Uniformen und den rationierten Materialien zu entfliehen und in bunt bedruckten Baumwollkleidern zu schwelgen, die für Wanderungen durch die rauhe Heide total ungeeignet waren.
Nicht dass ich das eigentlich im Übermaß vorgehabt hatte; meine Vorstellungen waren eher in die Richtung gegangen, morgens auszuschlafen und lange, genüssliche Nachmittage im Bett mit Frank zu verbringen – ohne zu schlafen. Allerdings war es schwierig, in der richtigen Stimmung für zärtliche Romantik zu bleiben, während Mrs. Baird geschäftig vor unserer Tür staubsaugte.
»Das muss das schmutzigste Stück Teppich in den ganzen schottischen Highlands sein«, hatte Frank an diesem Morgen festgestellt, während wir im Bett lagen und dem grimmigen Dröhnen des Staubsaugers im Flur lauschten.
»Fast so schmutzig wie die Phantasie unserer Gastwirtin«, pflichtete ich ihm bei. »Vielleicht wären wir doch besser nach Brighton gefahren.« Wir hatten die Highlands als Urlaubsort ausgewählt, ehe Frank seine Stellung als Geschichtsprofessor in Oxford antreten würde, weil das Grauen des Krieges Schottland weniger getroffen hatte als den Rest Britanniens und weil hier weniger von der frenetischen Nachkriegsfröhlichkeit zu spüren war, die die beliebteren Ferienziele befallen hatte.
Und ohne es direkt anzusprechen, hatten wir wohl beide das Gefühl, dass es ein symbolischer Ort war, um unsere Ehe wieder aufleben zu lassen; wir hatten kurz vor Kriegsausbruch in den Highlands geheiratet und unsere zweitägigen Flitterwochen dort verbracht. Ein friedvoller Rückzugsort, an dem wir einander wieder kennenlernen konnten, dachten wir, ohne uns darüber klar zu sein, dass Golf und Angeln möglicherweise Schottlands beliebteste Freiluftsportarten sein mochten, Tratschen jedoch die eindeutig beliebteste Sportart in geschlossenen Räumen war. Und wenn es so viel regnet wie in Schottland, verbringen die Leute reichlich Zeit in geschlossenen Räumen.
»Wohin willst du?«, fragte ich, als Frank die Füße aus dem Bett schwang.
»Es wäre doch schade, wenn wir die alte Schachtel enttäuschen würden«, antwortete er. Er setzte sich auf die Kante des betagten Bettes und hüpfte sacht auf und ab, was ein durchdringendes rhythmisches Quietschen zur Folge hatte. Der Hoover im Flur verstummte abrupt. Nach ein oder zwei Minuten Auf und Ab stieß er ein lautes, theatralisches Stöhnen aus und ließ sich zurückfallen, so dass die Bettfedern scheppernd protestierten. Ich kicherte hilflos in ein Kissen, um die atemlose Stille vor der Tür nicht zu stören.
Frank sah mich an und wackelte mit den Augenbrauen. »Du solltest eigentlich ekstatisch stöhnen, nicht kichern«, ermahnte er mich flüsternd. »Sonst denkt sie noch, ich bin kein guter Liebhaber.«
»Du musst schon länger durchhalten, wenn du ekstatisches Stöhnen erwartest«, gluckste ich. »Zwei Minuten sind nicht mehr als ein Kichern wert.«
»Rücksichtsloses kleines Weibsbild. Ich wollte mich hier ausruhen, schon vergessen?«
»Faulpelz. Du wirst den nächsten Spross an deinem Stammbaum nie zuwege bringen, wenn du nicht ein bisschen mehr Einsatz zeigst.«
Franks Leidenschaft für die Ahnenforschung war ein weiterer Grund, warum wir die Highlands ausgesucht hatten. Einem der gammeligen Zettel zufolge, die er mit sich herumschleppte, hatte irgendeiner seiner nervtötenden Vorväter Mitte des achtzehnten Jahrhunderts – oder war es das siebzehnte? – in dieser Gegend irgendetwas mit irgendwem oder irgendwas anderem zu tun gehabt.
»Wenn ich als kinderloser Stumpf an meinem Stammbaum ende, wird es mit Sicherheit die Schuld unserer unermüdlichen Wirtin da draußen sein. Wir sind schließlich seit sieben Jahren verheiratet. Der kleine Frank junior wird absolut legitim sein, auch wenn seine Empfängnis nicht unter Zeugen stattfindet.«
»Wenn sie überhaupt stattfindet«, sagte ich pessimistisch. In der Woche vor dem Aufbruch in unsere Highlandferien waren wir wieder einmal enttäuscht worden.
»Bei so viel frischer Luft und gesundem Essen? Wie sollten wir es da nicht zuwege bringen?« Zum Abendessen hatte es gestern Hering gegeben, gebraten. Zum Mittagessen Hering, eingelegt. Und der kräftige Geruch, der jetzt die Treppe heraufkam, deutete sehr darauf hin, dass es zum Frühstück Hering in Milch geben würde.
»Falls du keine Zugabe zu Mrs. Bairds Erbauung im Sinn hast«, schlug ich vor, »solltest du dich besser anziehen. Triffst du dich nicht um zehn mit diesem Pfaffen?« Reverend Reginald Wakefield, Vikar der hiesigen Pfarre, würde Frank Einsicht in einige unfassbar faszinierende Taufregister gewähren, ganz zu schweigen von der glamourösen Aussicht, dass er möglicherweise ein paar halb vermoderte Armeedepeschen ausgegraben hatte, die den berüchtigten Vorfahren erwähnten.
»Wie heißt dein Urururgroßvater noch einmal«, fragte ich, »also der, der hier während einem dieser Aufstände sein Unwesen getrieben hat? Ich weiß nicht mehr, ob es Willy oder Walter war.«
»Eigentlich hieß er Jonathan.« Frank trug mein absolutes Desinteresse an jeder Art von Familiengeschichte zwar mit Fassung, war aber ständig in Habachtstellung, um selbst die kleinste Nachfrage meinerseits zum Anlass zu nehmen, mir sämtliche bis dato bekannten Fakten über die frühen Randalls und ihre Verbindungen mitzuteilen. Sein Blick nahm das fanatische Glühen des passionierten Dozenten an, während er sich das Hemd zuknöpfte.
»Jonathan Wolverton Randall – Wolverton nach dem Onkel seiner Mutter, einem unbedeutenden Ritter aus Sussex. Er persönlich war allerdings unter dem schneidigen Spitznamen ›Black Jack‹ bekannt, den er sich in der Armee zugelegt hat, vermutlich während seiner Stationierung in den Highlands.« Ich ließ mich mit dem Gesicht auf das Bett fallen und stellte mich schnarchend. Frank ließ sich nicht davon stören und fuhr mit seinen wissenschaftlichen Ausführungen fort.
»Er hat sein Patent Mitte der dreißiger Jahre erworben – natürlich des achtzehnten Jahrhunderts – und als Dragonerhauptmann gedient. Diesen alten Briefen zufolge, die mir meine Cousine May geschickt hat, hat er sich beim Militär sehr profiliert. Gute Wahl für einen Zweitgeborenen; sein jüngerer Bruder ist ebenfalls der Tradition gefolgt und Geistlicher geworden, aber ich habe noch nicht viel über ihn herausgefunden. Jedenfalls stand Jack Randall aufgrund seines Diensteifers vor und während des 45er-Aufstandes hoch in der Gunst des Herzogs von Sandringham – du weißt schon, der zweite Jakobitenaufstand«, betonte er im Interesse seiner uninformierten Zuhörer, verkörpert durch meine Person. »Also, Bonnie Prince Charlie und Konsorten?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher, ob den Schotten klar ist, dass sie den verloren haben«, unterbrach ich. Ich setzte mich und versuchte, mein Haar zu bezähmen. »Ich habe ganz deutlich gehört, wie uns der Barmann gestern Abend als Sassenachs bezeichnet hat.«
»Nun ja, warum auch nicht?«, sagte Frank gleichmütig. »Es bedeutet ja schließlich nur ›Engländer‹ oder schlimmstenfalls ›Fremdlinge‹, und wir sind halt beides.«
»Ich weiß, was es bedeutet. Es war der Ton, der mir nicht gefallen hat.«
Frank suchte in der Kommodenschublade nach einem Gürtel. »Er hat sich nur geärgert, weil ich ihm gesagt habe, dass sein Bier nach nichts schmeckt. Ich habe ihm gesagt, dass man für ein richtiges Highlandgebräu einen alten Schuh mit ins Fass legen muss und man das fertige Produkt durch eine ordentlich getragene Unterhose abseihen muss.«
»Ah, das erklärt dann auch den Betrag auf unserer Rechnung.«
»Nun, ein bisschen taktvoller habe ich es schon formuliert, aber nur, weil es in der gälischen Sprache kein spezifisches Wort für Unterhose gibt.«
Fasziniert griff ich nach meiner eigenen Unterwäsche. »Warum nicht? Haben die alten Kelten etwa keine Unterwäsche getragen?«
Frank warf mir einen anzüglichen Blick zu. »Hast du etwa noch nie dieses alte Lied gehört, was ein Schotte unter seinem Kilt trägt?«
»Vermutlich keine knielangen Herrenschlüpfer«, erwiderte ich trocken. »Vielleicht mache ich mich ja auf die Suche nach einem hiesigen Kiltträger, während du dich mit dem Reverend amüsierst, und frage ihn.«
»Es wäre nur schön, wenn man dich nicht verhaften würde, Claire. Das würde dem Dekan des St. Giles College wirklich nicht gefallen.«
Doch es gab keine Kiltträger, die sich auf dem Rathausplatz herumdrückten oder in den umliegenden Läden einkauften. Allerdings waren diverse andere Leute unterwegs, zum Großteil Hausfrauen wie Mrs. Baird, die ihre täglichen Einkäufe erledigten. Sie waren gesellig und gesprächig, und ihre bodenständigen, in bedruckte Stoffe gekleideten Gestalten erfüllten die Läden mit einer gemütlichen Wärme; eine Festung gegen den kalten Morgennebel im Freien.
Da ich selbst noch keinen Haushalt hatte, gab es auch nicht viel, was ich hätte kaufen müssen. Doch ich hatte auch so meine Freude daran, einfach nur die frisch gefüllten Regale zu durchstöbern. So vieles war schon so lange rationiert, so lange waren wir ohne die einfachen Dinge wie Seife oder Eier ausgekommen, länger noch ohne den einen oder anderen kleinen Luxus wie mein Parfum, L’Heure Bleue.
Mein Blick blieb an einem Schaufenster mit Haushaltsgegenständen hängen – bestickten Küchenhandtüchern und Teewärmern, Krügen und Gläsern, einem Stapel ganz normaler Kuchenbleche und drei zueinander passenden Vasen.
Ich hatte in meinem Leben noch keine Vase besessen. Während der Kriegsjahre hatte ich natürlich in spartanischen Schwesternquartieren gewohnt, zuerst in Pembroke, später im Feld in Frankreich. Doch auch vorher hatten wir nie lange genug an einem Ort gelebt, um den Kauf eines solchen Gegenstandes zu rechtfertigen. Hätte ich als Kind eine Vase gehabt, hätte Onkel Lamb sie längst mit Tonscherben gefüllt, bevor ich dazu gekommen wäre, mich ihr mit einem Strauß Gänseblümchen überhaupt nur zu nähern. Quentin Lambert Beauchamp. »Q« für seine Archäologiestudenten und seine Freunde. »Dr. Beauchamp« für die akademischen Kreise, in denen er sich bewegte, in denen er lehrte und lebte. Doch für mich immer Onkel Lamb.
Er war der einzige Bruder meines Vaters, und er war mein einziger lebender Verwandter gewesen, als ich mit fünf Jahren meine Eltern durch einen Autounfall verlor und er mich plötzlich am Hals gehabt hatte. Er hatte damals unmittelbar vor der Abreise in den Nahen Osten gestanden und gerade so lange mit seinen Vorbereitungen innegehalten, wie er benötigte, um die Beerdigung zu organisieren, den Besitz meiner Eltern zu verflüssigen und mich in einem anständigen Mädcheninternat anzumelden. Welches zu besuchen ich mich strikt geweigert hatte.
Mit der Notwendigkeit konfrontiert, meine runden Fingerchen mit Gewalt von seiner Autotür zu lösen und mich die Schultreppe hinaufzuzerren, hatte Onkel Lamb, der jede persönliche Auseinandersetzung hasste, entnervt aufgeseufzt und schließlich schulterzuckend seine Vernunft gemeinsam mit meinem funkelnagelneuen, internatstauglichen Strohhut aus dem Fenster geworfen.
»Dämliches Ding«, brummte er, als er ihn im Rückspiegel fröhlich davonrollen sah, während wir mit durchgetretenem Gaspedal über die Auffahrt dröhnten. »Konnte Frauen mit Hüten sowieso noch nie leiden.« Er hatte auf mich hinuntergeblickt und mich streng angesehen.
»Eines nur«, sagte er in furchterregendem Ton. »Du wirst nicht mit meinen persischen Grabfiguren Puppen spielen. Alles, aber das nicht! Verstanden?«
Ich hatte zufrieden genickt. Und hatte ihn in den Nahen Osten begleitet, nach Südamerika, zu Dutzenden von Studienstätten auf der ganzen Welt. Hatte mit Hilfe seiner Entwürfe für Magazinartikel lesen und schreiben gelernt, hatte gelernt, Latrinen zu graben und mein Wasser abzukochen und eine ganze Reihe anderer Dinge zu tun, die sich für eine junge Dame von anständiger Herkunft nicht gehörten – bis ich dem eleganten, dunkelhaarigen Historiker begegnet war, der Onkel Lamb aufsuchte, um ihn zu einer Frage zu konsultieren, die sich mit einer möglichen Verbindung zwischen französischer Philosophie und ägyptischen Religionspraktiken befasste.
Auch nach unserer Hochzeit hatten Frank und ich das Nomadendasein eines Fakultätsmitglieds geführt, das sich zwischen Kontinentalkonferenzen und vorübergehenden Mietwohnungen bewegte – bis der Ausbruch des Krieges ihn in die Offiziersausbildung und zum MI6 verschlug und mich in die Schwesternausbildung. Obwohl wir schon sieben Jahre verheiratet waren, würde das neue Haus in Oxford unser erstes richtiges Zuhause sein.
Ich klemmte mir fest die Handtasche unter den Arm, marschierte in den Laden und kaufte die Vasen.
Ich begegnete Frank an der Kreuzung der High Street und der Gereside Road, in die wir dann zusammen einbogen. Angesichts meiner Einkäufe zog er die Augenbrauen hoch.
»Vasen?« Er lächelte. »Wunderbar. Vielleicht hörst du ja dann auf, mir Blumen in meine Bücher zu stecken.«
»Das sind keine Blumen, das sind Forschungsobjekte. Du warst es doch, der vorgeschlagen hat, dass ich mich mit Botanik befasse. Um mich zu beschäftigen, nachdem ich mich ja nicht mehr um Kranke und Verletzte kümmern muss«, rief ich ihm ins Gedächtnis.
»Stimmt.« Er lächelte amüsiert. »Aber mir war nicht klar, dass mir daraufhin jedes Mal Grünzeug in den Schoß fallen würde, wenn ich ein Referenzbuch aufschlage. Was war denn dieses fürchterliche braune Krümelzeug, das du in den Tuscum und Banks gelegt hast?«
»Giersch. Gut gegen Hämorrhoiden.«
»Du triffst wohl schon Vorbereitungen für mein unmittelbar bevorstehendes Greisenalter. Wie fürsorglich von dir, Claire.«
Wir schoben uns lachend durch die Vorgartentür, und Frank blieb stehen, um mich zuerst auf die schmale Eingangstreppe zu lassen.
Plötzlich ergriff er meinen Arm. »Pass auf! Tritt lieber nicht darauf.«
Ich stoppte und hob meinen Fuß vorsichtig über einen großen, bräunlich roten Fleck auf der oberen Stufe.
»Wie komisch«, sagte ich. »Mrs. Baird schrubbt die Stufen doch jeden Morgen sauber; ich habe sie schon dabei gesehen. Was meinst du, was das sein kann?«
Frank beugte sich über die Stufe und roch vorsichtig daran.
»Spontan würde ich sagen, es ist Blut.«
»Blut!« Ich hüpfte einen Schritt auf den Eingangsweg zurück. »Wessen Blut denn?« Ich warf einen nervösen Blick ins Haus. »Meinst du, Mrs. Baird ist etwas zugestoßen?« Ich konnte mir nicht vorstellen, dass unsere porentief reine Gastwirtin auf ihrer Türschwelle Blutflecken trocknen ließ, wenn nicht etwas ganz Furchtbares passiert war, und ich fragte mich flüchtig, ob das Wohnzimmer womöglich einen irren Axtmörder beherbergte, der sich just in diesem Moment bereit machte, sich mit markerschütterndem Geschrei auf uns zu stürzen.
Frank schüttelte den Kopf. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Hecke in den Nachbargarten zu spähen.
»Ich glaube nicht. Die Collins haben den gleichen Fleck auf ihrer Schwelle.«
»Wirklich?« Ich trat dichter an Frank heran, sowohl um einen Blick über die Hecke zu werfen als auch um mir moralische Unterstützung zu holen. Es schien mir zwar nicht wahrscheinlich, in den Highlands einem Massenmörder zu begegnen, aber ich bezweifelte gleichzeitig, dass sich solche Personen ihre Tatorte nach logischen Kriterien aussuchten. »Das ist ja … widerlich«, stellte ich erschauernd fest. Aus dem Nachbarhaus drang kein Lebenszeichen. »Was meinst du, was passiert ist?«
Frank runzelte die Stirn und überlegte, dann kam ihm offensichtlich eine Idee, und er schlug sich mit der Hand ans Hosenbein.
»Ich glaube, ich weiß es! Warte kurz hier.« Er eilte zum Törchen hinaus und trabte die Straße entlang, während ich mit einem mulmigen Gefühl verloren an der Eingangstreppe zurückblieb.
Er war schnell zurück und strahlte, weil er anscheinend seine Bestätigung hatte.
»Ja, das ist es, das muss es sein. Jedes Haus an der Straße hat es.«
»Hat was? Besuch von einem irren Mörder?«, fragte ich etwas scharf, denn ich war immer noch nervös, weil er mich so abrupt in Gesellschaft eines Blutflecks allein gelassen hatte.
Frank lachte. »Nein, ein rituelles Opfer. Faszinierend!« Er hockte auf Händen und Knien im Gras und betrachtete den Flecken neugierig.
Das alles klang für mich allerdings kaum besser als ein irrer Mörder. Ich hockte mich neben ihn und verzog die Nase über den Geruch. Es war zwar noch zu früh für Fliegen, aber ein paar große Highlandmücken zogen bereits langsam ihre Kreise um den Fleck.
»Was meinst du mit ›ein rituelles Opfer‹?«, wollte ich wissen. »Mrs. Baird ist eine gewissenhafte Kirchgängerin, genau wie ihre Nachbarn. Wir sind doch hier nicht auf einem Druidenhügel.«
Er stand auf und strich sich die Grashälmchen von der Hose. »Das denkst aber auch nur du, mein Schatz«, sagte er. »Es gibt auf der ganzen Welt keinen Ort, an dem der Alltag so sehr mit altem Aberglauben und Magie verwoben ist wie in den schottischen Highlands. Kirche oder nicht, Mrs. Baird glaubt an das Alte Volk, und ihre Nachbarn tun es genauso.« Er zeigte mit der polierten Schuhspitze auf den Blutfleck. »Das Blut eines schwarzen Hahns«, erklärte er mit zufriedener Miene. »Die Häuser sind noch nicht besonders alt.«
Ich warf ihm einen kalten Blick zu. »Wenn du den Eindruck hast, dass das die ganze Geschichte erklärt, bist du schwer auf dem Holzweg. Was für eine Rolle spielt es denn, wie alt die Häuser sind? Und wo in aller Welt sind die ganzen Leute?«
»Im Pub, nehme ich an. Wie wär’s, wenn wir nachsehen?« Er nahm meinen Arm, schob mich durch das Törchen und ging mit mir die Gereside Road entlang.
»In grauer Vorzeit«, erklärte er im Gehen, »und auch in weniger grauer Vorzeit war es beim Bau eines Hauses Sitte, etwas zu töten und es unter dem Fundament zu begraben, um die ortsansässigen Erdgeister versöhnlich zu stimmen. Du weißt schon: ›Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen ersten Sohn, und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn.‹ Ist so alt wie die Welt.«
Das Zitat jagte mir einen Schauder über den Rücken. »Dann ist es wohl ziemlich modern und aufgeklärt von ihnen, wenn sie stattdessen Hühner nehmen. Du meinst also, da die Häuser noch nicht alt sind, hat man nichts darunter begraben, und die Bewohner holen dieses Versäumnis jetzt auf diese Weise nach?«
»Ja, genau.« Frank schien erfreut über meine Fortschritte zu sein und klopfte mir anerkennend auf den Rücken. »Der Reverend sagt, viele Menschen hier meinen, dass der Krieg zum Teil dadurch verursacht wurde, dass sich die Leute von ihren Wurzeln abgewandt und es versäumt haben, anständig vorzusorgen, indem sie zum Beispiel ein Opfer unter dem Fundament vergraben oder Fischgräten im Kaminfeuer verbrennen – ausgenommen Schellfisch natürlich«, fügte er glücklich zerstreut hinzu. »Wusstest du, dass man die Gräten eines Schellfischs nicht verbrennt, weil man sonst nie wieder einen fängt? Schellfischgräten muss man immer vergraben.«
»Ich werde es beherzigen«, versprach ich. »Sag mir, was man tun muss, um nie wieder einen Hering zu sehen, und ich bin sofort dabei.«
Er schüttelte den Kopf – gedankenverloren auf dem Gipfel seiner Konzentration, in einer jener kurzen Anwandlungen wissenschaftlicher Verzückung, in denen er den Kontakt mit der Welt ringsum verlor und vollständig damit beschäftigt war, alle Quellen seines Wissens anzuzapfen.
»Wie es mit Heringen geht, weiß ich nicht«, sagte er geistesabwesend. »Aber gegen Mäuse hängt man Zittergrasbüschel auf – ›Hast du Zittergras im Haus, siehst nie wieder eine Maus‹. Das ist mit Leichen unter dem Fundament anders – daher kommen nämlich viele der hiesigen Gespenster. Erinnerst du dich an Mountgerald, das große Haus am Ende der High Street? Da spukt ein Arbeiter herum, den sie als Opfer für das Fundament umgebracht haben. Irgendwann im achtzehnten Jahrhundert, das ist noch gar nicht so lange her«, fügte er nachdenklich hinzu.
»Es heißt, dass auf Anordnung des Hausbesitzers erst eine Wand errichtet wurde, dann haben sie von oben einen Steinblock auf einen der Arbeiter fallen gelassen – vermutlich haben sie einen ausgesucht, den niemand leiden konnte – und ihn dann im Keller begraben und das restliche Haus über ihm errichtet. Er sucht den Keller heim, in dem er ermordet wurde, außer am Jahrestag seines Todes und an den vier Alten Tagen.«
»Alte Tage?«
»Die alten Feste«, erklärte er, mit den Gedanken immer noch bei den Notizen in seinem Kopf. »Hogmanay, das ist Neujahr. Dann das Maifest. Danach Beltane, das ist der Sommeranfang oder anders ausgedrückt der Mittsommer. Und zuletzt Allerheiligen. Die Druiden, die alten Pikten, sie alle haben die Sonnenfeste und die Feuerfeste begangen, soweit wir das wissen. Wie dem auch sei, die Geister sind frei an diesen Tagen und können umherwandern, wie es ihnen beliebt, und Böses oder Gutes tun.« Er rieb sich nachdenklich das Kinn. »Nicht mehr lange bis Beltane. Pass lieber auf, wenn du das nächste Mal am Kirchhof vorbeikommst.« Seine Augen glitzerten, und ich begriff, dass die Trance vorüber war.
Ich lachte. »Gibt es denn hier besonders berühmte Gespenster?«
Er zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Wir fragen Mr. Wakefield, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, ja?«
Es dauerte nicht lange, bis wir Mr. Wakefield sahen. Er saß gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Anwohnern der Nachbarschaft im Pub und trank ein Bier zur Feier der Häuserweihe.
Er schien ziemlich verlegen zu sein, weil wir ihn auf frischer Tat dabei ertappten, dass er heidnischen Bräuchen seinen Segen gab, doch wir taten das Ganze einfach als historisch eingefärbten lokalen Brauch ab, ähnlich wie den St. Patrick’s Day.
»Eigentlich ausgesprochen faszinierend, wissen Sie«, gestand er uns, und mit einem innerlichen Seufzer erkannte ich den Gesang des Akademikers, so unverwechselbar wie das Trrrruitt einer Drossel. Frank horchte auf, als er den Ruf eines Seelenverwandten erkannte, und begann alsbald mit dem Paarungstanz des Akademikers. Schon bald steckten sie bis über beide Ohren in Archetypen und den Parallelen zwischen althergebrachtem Aberglauben und moderner Religion. Ich zuckte mit den Schultern und bahnte mir selbst den Weg zur Bar und zurück, in jeder Hand einen großen Brandy mit Soda.
Da ich aus Erfahrung wusste, wie schwierig es war, Frank von einer solchen Diskussion abzulenken, ergriff ich einfach seine Hand, schlang seine Finger um den Glasstiel und überließ ihn sich selbst.
Ich fand Mrs. Baird auf einer Bank am Fenster, wo sie vergnügt ein Bier mit einem älteren Herrn trank, den sie mir als Mr. Crook vorstellte.
»Das ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe, Mrs. Randall«, sagte sie, und ihre Augen leuchteten vom Alkohol und aus Freude an der Gesellschaft. »Der sich so gut mit Pflanzen auskennt. Mrs. Randall interessiert sich nämlich sehr für Blumen«, vertraute sie ihrem Begleiter an, der ihr den Kopf zuneigte, halb aus Höflichkeit, halb, weil er schwerhörig war. »Presst sie in Büchern und so.«
»Ach wirklich?«, fragte Mr. Crook und zog neugierig eine seiner buschigen weißen Augenbrauen hoch. »Ich habe ein paar Pressen – also, richtige Pressen – für Pflanzen und Ähnliches. Habe sie von meinem Neffen, als er in den Semesterferien hier war. Er hat sie extra für mich organisiert, und ich hab’s nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass ich so etwas nicht benutze. Kräuter hängt man auf, oder vielleicht trocknet man sie auf einem Rahmen und steckt sie dann in einen Gazebeutel oder ein Glas, aber ich habe keine Ahnung, warum man die armen Dinger plattquetschen sollte.«
»Tja, vielleicht, um sie sich anzusehen«, wandte Mrs. Baird eifrig ein. »Mrs. Randall hat ein paar hübsche Arrangements aus Malvenblüten und Veilchen gemacht; man könnte sie auch einrahmen und an die Wand hängen.«
»Mmmpfm.« Mr. Crooks zerfurchtes Gesicht schien skeptisch einzuräumen, dass das eventuell möglich war. »Nun, wenn Sie sie brauchen können, Mrs. Randall, können Sie die Pressen gerne haben. Ich möchte sie nicht wegwerfen, aber ich habe wirklich keine Verwendung dafür.«
Ich versicherte Mr. Crook, dass es mich freuen würde, die Pflanzenpressen zu benutzen, und dass es mich noch mehr freuen würde, wenn er mir zeigen würde, wo einige der selteneren Pflanzen der Gegend zu finden waren. Er warf mir einen scharfen Blick zu, den Kopf zur Seite gelegt wie ein betagter Turmfalke, schien aber dann zu beschließen, dass mein Interesse ernsthaft war. Wir einigten uns darauf, dass wir uns am nächsten Morgen zu einer Führung durch das hiesige Gebüsch treffen würden. Ich wusste, dass Frank vorhatte, den Tag in Inverness zu verbringen, um das Archiv im Rathaus zu konsultieren, und ich war froh, eine Entschuldigung zu haben und ihn nicht begleiten zu müssen. Was mich betraf, sah ein Taufregister wie das andere aus.
Kurz darauf riss sich Frank von Mr. Wakefield los, und wir gingen in Begleitung von Mrs. Baird nach Hause. Ich selbst zögerte zwar, das Hühnerblut auf der Türschwelle anzusprechen, doch Frank waren solche Hemmungen fremd, und er befragte sie neugierig nach den Hintergründen dieses Brauchs.
»Dann ist er wohl schon sehr alt?«, fragte er und schwenkte einen Stock durch die Blumen am Straßenrand. Gänsefuß und Fingerkraut blühten schon, und ich konnte die Ginsterknospen schwellen sehen, noch eine Woche, und sie würden ebenfalls blühen.
»Och, aye.« Mrs. Baird watschelte im Eiltempo voraus und kannte kein Erbarmen mit unseren jüngeren Beinen. »So alt, dass es niemand weiß, Mr. Randall. Sogar noch aus der Zeit vor den Riesen.«
»Riesen?«, fragte ich verständnislos.
»Aye. Fionn und Feinn.«
»Gälische Sagen«, merkte Frank interessiert an. »Heldensagen. Wahrscheinlich altnordischen Ursprungs. Es gibt hier und an der ganzen Westküste viele altnordische Einflüsse. Einige Orte haben altnordische Namen, keine gälischen.«
Ich verdrehte innerlich die Augen, weil ich den nächsten Ausbruch ahnte, doch Mrs. Baird lächelte freundlich und ermunterte ihn noch, indem sie sagte, dass das stimmte, sie wäre selbst schon oben im Norden gewesen und hätte den Stein der Zwei Brüder gesehen, und der wäre doch altnordisch, nicht wahr?
»Die Nordmänner sind zwischen dem sechsten und dem vierzehnten Jahrhundert immer wieder an dieser Küste gelandet«, sagte Frank und blickte verträumt zum Horizont, wo er ganz bestimmt Drachenschiffe in den windgepeitschten Wolken sah. »Wikinger, weißt du? Und sie haben viele ihrer eigenen Mythen mitgebracht. Es ist ein gutes Land für Mythen. So etwas scheint hier Wurzeln zu schlagen.«
Das glaubte ich gern. Die Dämmerung brach jetzt herein, und mit ihr zog ein Sturm herauf. Im gespenstischen Licht unter den Wolken sahen selbst die modernen Häuser an der Straße genauso alt und unheilvoll aus wie der verwitterte Piktenstein, der dreißig Meter weiter stand und die Kreuzung bewachte, die er schon seit tausend Jahren markierte. Es schien ein Abend zu werden, den man besser hinter geschlossenen Fensterläden verbrachte.
Doch statt gemütlich in Mrs. Bairds guter Stube zu bleiben und sich den Hafen von Perth im Stereoptikon anzuschauen, beschloss Frank, die Verabredung zum Sherry einzuhalten, die er mit Mr. Bainbridge getroffen hatte, einem Anwalt, der sich für historische Dokumente interessierte. Da ich meine erste Begegnung mit Mr. Bainbridge nicht vergessen hatte, blieb ich lieber mit dem Hafen von Perth zu Hause.
»Versuch zurück zu sein, ehe der Sturm ausbricht«, sagte ich und gab Frank einen Abschiedskuss. »Und grüße Mr. Bainbridge von mir.«
»Ääh, ja. Ja, natürlich.« Frank, der meinem Blick sorgfältig auswich, schlüpfte in seinen Mantel und ging, nachdem er sich einen Schirm aus dem Ständer an der Tür genommen hatte.
Ich schloss die Tür hinter ihm, verriegelte sie aber nicht, damit er wieder hereinkonnte. Auf dem Rückweg ins Wohnzimmer dachte ich, dass Frank mit Sicherheit so tun würde, als hätte er gar keine Frau – und Mr. Bainbridge dabei mit Freuden mitspielen würde. Was ich ihm eigentlich nicht verdenken konnte.
Zuerst war unser Besuch bei Mr. Bainbridge am gestrigen Nachmittag bestens verlaufen. Ich war zurückhaltend, wohlerzogen, intelligent, aber bescheiden, gut frisiert und elegant gekleidet gewesen – ganz die perfekte Professorengattin. Bis der Tee serviert wurde.
Ich drehte meine rechte Hand um und untersuchte stirnrunzelnd eine große Blase, die sich über den Ansatz aller vier Finger erstreckte. Es war schließlich nicht meine Schuld, dass Mr. Bainbridge, ein Witwer, keine ordentliche Porzellankanne hatte, sondern sich mit einer billigen Blechkanne begnügte. Oder dass der Anwalt mich gebeten hatte, den Tee einzuschenken, weil er wohl höflich sein wollte. Oder dass der Topflappen, den er mir gereicht hatte, eine zerschlissene Stelle hatte, durch die der glühend heiße Griff der Kanne in direkten Kontakt mit meiner Hand gekommen war, als ich danach griff.
Nein, beschloss ich und schob damit die letzten noch vorhandenen leichten Gewissensbisse endgültig beiseite. Die Teekanne fallen zu lassen war eine völlig normale Reaktion. Sie Mr. Bainbridge auf den Schoß fallen zu lassen war nur ein unglücklicher Zufall; irgendwohin musste ich sie ja fallen lassen. Es war die Tatsache, dass ich so laut »Ach du verdammte Scheiße!« gerufen hatte, dass es selbst Mr. Bainbridges Aufschrei übertönte, die dazu geführt hatte, dass mich Frank über das Gebäck hinweg finster angesehen hatte.
Nachdem die Kanne bei Mr. Bainbridge keinen nachhaltigen Schaden angerichtet und er sich von seinem Schreck erholt hatte, hatte er sich überaus ritterlich verhalten, sich um meine Hand gekümmert und Franks Versuche ignoriert, meine Ausdrucksweise damit zu entschuldigen, dass ich fast zwei Jahre lang in einem Feldlazarett stationiert gewesen war. »Ich fürchte, meine Frau hat da bei den Yankees ein paar lustige Kraftausdrücke aufgeschnappt«, meinte Frank und lächelte nervös.
»Das stimmt«, sagte ich und wickelte mir mit zusammengebissenen Zähnen eine nasse Serviette um die Hand. »Männer sind nun einmal ›lustig‹, wenn man Schrapnellsplitter aus ihnen herauspickt.«
Mr. Bainbridge hatte taktvoll versucht, das Gespräch auf neutrales historisches Terrain zu lenken, indem er sagte, er hätte sich schon immer für die linguistische Entwicklung des Fluchens interessiert.
»Keinen Zucker, danke, Claire«, wehrte Frank ab, der dankbar auf das Ablenkungsmanöver einging, und ließ sich seine unakademische Stirnlocke ins Gesicht fallen. Automatisch schob er sie zurück. »Interessant«, meinte er, »die Evolution der Kraftausdrücke.«
»Ja, und sie schreitet immer noch voran«, informierte ich ihn und klemmte vorsichtig ein Zuckerstück mit der Zange fest.
»Oh?«, fragte Mr. Bainbridge höflich. »Sind Ihnen denn im Lauf Ihrer, äh, Kriegserlebnisse besonders interessante Variationen untergekommen?«
»Oh, ja«, antwortete ich. »Meinen Lieblingsausdruck habe ich von einem Yankee. Ein Mann namens Williamson, aus New York, glaube ich. Er hat es jedes Mal gesagt, wenn ich seinen Verband gewechselt habe.«
»Was war es denn?«
»Jesus. H. Roosevelt Christ«, sagte ich und ließ das Zuckerstück zielsicher in Franks Kaffee fallen.
Nachdem ich eine Weile in aller Seelenruhe mit Mrs. Baird zusammengesessen hatte, ging ich nach oben, um mich zurechtzumachen, ehe Frank nach Hause kam. Ich wusste, dass er nie mehr als zwei Gläser Sherry trank, also erwartete ich ihn bald zurück.
Der Wind wurde jetzt stärker, und die ganze Luft im Schlafzimmer prickelte elektrisch. Ich zog mir die Bürste durch das Haar, und meine Locken knisterten vor lauter Statik und verknoteten sich aufgebracht. Mein Haar würde heute Abend ohne seine hundert Bürstenstriche auskommen müssen, entschied ich. Bei diesem Wetter würde ich mir lieber nur die Zähne bürsten. Haarsträhnen hefteten sich elektrisch aufgeladen an meine Wangen und blieben hartnäckig dort kleben, selbst als ich versuchte, sie zurückzustreichen.
Kein Wasser im Krug; Frank hatte es aufgebraucht, als er sich frisch machte, ehe er zu seinem Besuch bei Mr. Bainbridge aufbrach, und ich hatte mich nicht der Mühe unterzogen, ihn am Wasserhahn im Bad nachzufüllen. Ich griff nach der Flasche L’Heure Bleue und goss mir einen ordentlichen Spritzer in die Hand. Energisch verrieb ich die Flüssigkeit zwischen den Händen, ehe sich der Duft verflüchtigen konnte, und fuhr mir rasch damit durch das Haar. Dann verteilte ich zwei weitere Tropfen auf der Bürste und strich mir damit die Locken hinter die Ohren.
So. Das war schon deutlich besser, dachte ich, während ich den Kopf hin und her drehte, um das Ergebnis in dem fleckigen Spiegel zu betrachten. Durch die Feuchtigkeit war die statische Elektrizität in meinem Haar verflogen, und es schwebte mir in schweren, glänzenden Wellen um das Gesicht. Zugleich hatte der verdunstende Alkohol einen sehr angenehmen Duft zurückgelassen. Das würde Frank gefallen, dachte ich. L’Heure Bleue war sein Lieblingsduft.
Plötzlich blitzte es ganz in der Nähe, unmittelbar gefolgt von einem Donnerschlag, und sämtliche Lichter gingen aus. Ich fluchte leise vor mich hin und tastete in den Schubladen umher.
Irgendwo hatte ich Kerzen und Streichhölzer gesehen; Stromausfälle kamen in den Highlands so häufig vor, dass Kerzen zur Grundausstattung jedes Pensions- oder Hotelzimmers gehörten. Selbst in den elegantesten Hotelzimmern hatte ich Kerzen entdeckt, die dort allerdings nach Jelängerjelieber dufteten und in Kerzenhaltern aus Milchglas steckten, an denen glitzernde Glastropfen baumelten.
Mrs. Bairds Kerzen waren um einiges gewöhnlicher – schlichte weiße Haushaltskerzen –, aber es gab reichlich davon, dazu drei Heftchen mit Streichhölzern. In Zeiten wie diesen hatte ich nicht vor, in Stilfragen wählerisch zu sein.
Im Licht des nächsten Blitzes steckte ich eine Kerze in den blauen Keramikhalter auf der Kommode, dann ging ich durch das Zimmer und zündete weitere Kerzen an, bis das ganze Zimmer von einem sanften, flackernden Schimmer erfüllt war. Sehr romantisch, dachte ich zufrieden und drückte geistesgegenwärtig auf den Lichtschalter, damit die Stimmung nicht durch eine plötzliche Wiederkehr des Stroms ruiniert wurde.
Die Kerzen waren nicht weiter als einen Zentimeter heruntergebrannt, als sich die Tür öffnete und Frank hereingeweht kam. Buchstäblich, denn der Luftzug, der ihm die Treppe herauf folgte, löschte drei der Kerzen mit einem Schlag aus.
Die Tür schloss sich mit einem Knall hinter ihm, der drei weitere Flammen auspustete, und er blinzelte in das unvermittelte Zwielicht und fuhr sich mit einer Hand durch das zerzauste Haar. Ich stand auf, zündete die Kerzen wieder an und spöttelte dabei über seine Art, ein Zimmer zu betreten. Erst als ich fertig war und mich umdrehte, um ihn zu fragen, ob er etwas trinken wollte, sah ich, dass er käsebleich und bestürzt wirkte.
»Was ist los?«, wollte ich nun leicht besorgt wissen. »Hast du ein Gespenst gesehen?«
»Weißt du«, antwortete er langsam, »ich bin mir nicht sicher, ob es nicht tatsächlich so gewesen ist.« Geistesabwesend griff er nach meiner Bürste, um sich das Haar zu glätten. Als ihm ein eindringlicher Hauch L’Heure Bleue in die Nase stieg, verzog er das Gesicht, legte die Bürste hin und begnügte sich stattdessen mit seinem Taschenkamm.
Ich blickte zum Fenster hinaus, wo die Ulmen hin und her wedelten wie aufgeregte Dreschflegel. Auf der anderen Seite des Hauses klapperte ein offener Fensterladen, und mir kam der Gedanke, dass wir die unseren vielleicht schließen sollten, obwohl es aufregend war, dem Toben des Sturms draußen zuzusehen.
»Bisschen zu windig für ein Gespenst, würde ich meinen«, zog ich ihn auf. »Haben Gespenster nicht lieber stille, nebelige Abende auf Friedhöfen?«
Frank lachte ein bisschen verlegen. »Tja, am Ende sind es bestimmt nur Bainbridges Geschichten und etwas mehr Sherry, als ich eigentlich trinken wollte. Wahrscheinlich war es wirklich nichts.«
Jetzt war meine Neugier geweckt. »Was genau hast du denn gesehen?«, fragte ich und ließ mich auf dem Sitz der Ankleide nieder. Ich zeigte mit halb hochgezogener Augenbraue auf die Whiskyflasche, und Frank ging sofort hinüber, um uns etwas einzuschenken.
»Tja, eigentlich nur einen Mann«, fing er an und maß einen Fingerbreit für sich ab und zwei für mich. »Er stand draußen auf der Straße.«
»Was, vor diesem Haus?« Ich lachte. »Dann kann es ja nur ein Gespenst gewesen sein; ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch an einem solchen Abend freiwillig dort herumstehen würde.«
Frank neigte den Wasserkrug über sein Glas und sah mich vorwurfsvoll an, als kein Wasser herauskam.
»Mich brauchst du gar nicht so anzusehen«, protestierte ich. »Du hast das ganze Wasser aufgebraucht. Ich trinke ihn aber auch gerne pur.« Zur Demonstration nippte ich an meinem Glas.
Frank sah zwar aus, als sei er versucht, ins Bad zu laufen und Wasser zu holen, verwarf die Idee dann aber und fuhr mit seiner Geschichte fort, während er so vorsichtig an seinem Glas nippte, als enthielte es Vitriol, nicht den besten Glenfiddich.
»Ja, er stand hier unten neben dem Gartenzaun. Ich hatte das Gefühl …« Er zögerte und senkte den Blick in sein Glas. »Ich hatte eindeutig das Gefühl, dass er zu deinem Fenster hinaufgeschaut hat.«
»Mein Fenster? Wie bemerkenswert!« Ich konnte einen kleinen Schauder nicht unterdrücken und ging nun doch zum Fenster, um die Läden zu schließen, obwohl es jetzt ein bisschen spät dafür zu sein schien. Frank folgte mir und redete dabei weiter.
»Ja, ich konnte dich ja selbst deutlich von unten sehen. Du hast dir das Haar gebürstet und ein bisschen geflucht, weil es dir zu Berge stand. Und dann ging das Licht aus, und du hast Kerzen angezündet.«
»Na, dann hatte der Mann ja wenigstens etwas zu lachen«, erwiderte ich leicht genervt. Frank schüttelte den Kopf, lächelte aber und strich mir mit den Händen über das Haar.
»Nein, er hat überhaupt nicht gelacht. Er schien sogar furchtbar unglücklich über irgendetwas zu sein. Nicht dass ich sein Gesicht gut sehen konnte; es war nur etwas an der Art, wie er dastand. Ich bin von hinten näher gekommen, und als er sich nicht bewegt hat, habe ich höflich gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen könnte. Zuerst hat er sich so verhalten, als hätte er mich nicht gehört, und ich dachte, er hätte es vielleicht tatsächlich nicht, weil der Wind so laut war. Also habe ich meine Frage wiederholt und die Hand ausgestreckt, um ihm auf die Schulter zu tippen und ihn auf mich aufmerksam zu machen. Aber ehe ich ihn berühren konnte, hat er plötzlich auf dem Absatz kehrtgemacht und ist an mir vorbei und davonspaziert.«
»Klingt ein bisschen unhöflich, aber nicht sehr gespenstisch«, sagte ich und leerte mein Glas. »Wie hat er denn ausgesehen?«
»Ziemlich groß«, antwortete Frank und runzelte nachdenklich die Stirn. »Und Schotte, in kompletter Highland-Aufmachung, inklusive Sporran und einer herrlichen Brosche mit einem Hirschmotiv an seinem Plaid. Ich hätte ihn gern gefragt, woher er sie hatte, aber er war auf und davon, ehe ich noch etwas sagen konnte.«
Ich ging zum Sekretär und goss mir noch einen Whisky ein. »Nun ja, das ist für diese Gegend aber nicht ungewöhnlich, oder? Wir haben doch im Ort auch schon Männer gesehen, die sich so anziehen.«
»Nein …« Frank klang skeptisch. »Nein, es war nicht seine Kleidung, die merkwürdig war. Aber ich könnte schwören, dass er so dicht an mir vorbeigegangen ist, dass ich hätte spüren müssen, wie er meinen Ärmel streift – aber das habe ich nicht. Er ist über die Gereside Road gegangen, aber als er fast an der Ecke war, ist er … verschwunden. Das war der Moment, an dem mir ein bisschen kalt im Rücken wurde.«
»Vielleicht warst du nur kurz abgelenkt, und er ist einfach in den Schatten getreten«, meinte ich. »An der Ecke stehen ja viele Bäume.«
»Ich könnte schwören, dass ich ihn nicht einen Moment aus den Augen gelassen habe«, murmelte Frank. Plötzlich blickte er auf. »Ich weiß es! Jetzt fällt es mir wieder ein, warum ich ihn so seltsam fand, auch wenn es mir in dem Moment nicht klar war.«
»Was?« Allmählich hatte ich genug von dem Gespenst und wäre gern zu interessanteren Dingen übergegangen, zum Beispiel unserem Bett.
»Es hat höllisch gestürmt, aber seine Kleider – sein Kilt und sein Plaid – haben sich überhaupt nicht bewegt, außer im Rhythmus seiner Schritte.«
Wir sahen einander an. »Tja«, sagte ich schließlich, »das ist jetzt tatsächlich ein bisschen gruselig.«
Frank zuckte mit den Schultern und lächelte auf einmal. »Wenigstens habe ich jetzt Mr. Wakefield etwas zu erzählen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Womöglich ist es ja ein ortsbekannter Geist, und er kann mir eine blutige Geschichte dazu erzählen.« Er blickte auf seine Armbanduhr. »Aber jetzt ist es wirklich dringend Zeit fürs Bett.«
»Das ist es«, murmelte ich.
Ich beobachtete im Spiegel, wie er sein Hemd auszog und nach einem Kleiderbügel griff. Plötzlich hielt er inne.
»Hattest du viele Schotten in deiner Obhut, Claire?«, fragte er abrupt. »Im Lazarett oder in Pembroke?«
»Natürlich«, erwiderte ich leicht verwundert. »Wir hatten viele Seaforths und Camerons und nach Caen auch jede Menge aus den Gordon-Regimentern. Die meisten waren recht nett. Im Allgemeinen ziemlich stoisch, aber ausgewachsene Feiglinge, wenn man mit einer Nadel ankam.« Ich lächelte, weil ich an einen Mann ganz besonders denken musste.
»Wir hatten einen – schon ein älterer Kerl, ein Dudelsackspieler aus dem Dritten Seaforth-Regiment – , der es nicht ertragen konnte, gepikst zu werden, vor allem nicht in den Po. Er hat lieber stundenlang fürchterlich gelitten, statt jemanden mit einer Nadel an sich heranzulassen. Und selbst dann hat er noch versucht, uns zu überreden, ihm die Injektion in den Arm zu geben, obwohl sie intramuskulär sein musste.« Ich lachte bei dem Gedanken an Korporal Chrisholm. »Er hat zu mir gesagt: ›Wenn ich mit nacktem Hintern auf dem Bauch liegen soll, dann will ich das Mädchen doch unter mir haben, nicht hinter mir mit einer Hutnadel!‹«
Frank lächelte zwar, doch er sah reichlich beklommen aus, wie oft bei meinen weniger delikaten Kriegserzählungen. »Keine Sorge«, versicherte ich ihm, als ich seinen Blick auffing. »Das erzähle ich nicht im Aufenthaltsraum der Fakultät.«
Sein Lächeln wurde breiter, und er trat hinter mich an den Sitz der Ankleide. Er drückte mir einen Kuss auf den Scheitel.
»Mach dir keine Gedanken«, versicherte er. »Sie werden dort begeistert von dir sein, egal, was für Geschichten du ihnen erzählst. Mmmm. Dein Haar duftet herrlich.«
»Ja, gefällt es dir?« Als Antwort glitten mir seine Hände über die Schultern und umfassten meine Brüste in dem dünnen Nachthemd. Ich konnte seinen Kopf über dem meinen im Spiegel sehen, und sein Kinn ruhte auf meinem Scheitel.
»Mir gefällt alles an dir«, sagte er heiser. »Du bist wunderschön im Kerzenlicht. Deine Augen sind wie Sherry in Kristall, und deine Haut schimmert wie Elfenbein. Eine Kerzenscheinhexe bist du. Vielleicht sollte ich elektrische Lampen für immer abschaffen.«
»Dann wäre es aber schwer, im Bett zu lesen«, wandte ich ein, und mein Herzschlag beschleunigte sich.
»Mir fallen weitaus bessere Beschäftigungen fürs Bett ein«, murmelte er.
»Ach ja?«, fragte ich wissbegierig. Ich erhob mich, drehte mich um und legte ihm die Arme um den Hals. »Zum Beispiel?«
Als wir einige Zeit später hinter geschlossenen Läden dicht aneinandergekuschelt dalagen, hob ich den Kopf und sagte: »Warum hast du mich das vorhin gefragt? Ob ich mit Schotten zu tun hatte, meine ich. Du musst doch wissen, dass es so war; es landen schließlich alle möglichen Männer in den Lazaretten.«
Er bewegte sich und fuhr mir sanft mit der Hand über den Rücken.
»Mmm. Oh, eigentlich nichts. Nur, als ich den Kerl da draußen gesehen habe, dachte ich, es wäre womöglich jemand, den du gepflegt hattest … hat vielleicht gehört, dass du hier wohnst, und wollte dich sehen … etwas in der Art.«
»Wenn das so war«, wandte ich pragmatisch ein, »warum ist er dann nicht hereingekommen und hat nach mir gefragt?«
»Na ja.« Franks Ton war betont beiläufig. »Es kann ja sein, dass er mir nicht über den Weg laufen wollte.«
Ich stützte mich auf meinen Ellbogen und starrte ihn an. Wir hatten eine Kerze brennen lassen, und ich konnte ihn gut sehen. Er hatte den Kopf abgewandt, und sein Blick war ach so harmlos auf die Farblithografie von Bonnie Prince Charlie gerichtet, mit der Mrs. Baird unsere Wand dekoriert hatte.
Ich fasste ihn beim Kinn und drehte seinen Kopf zu mir um. Seine Augen weiteten sich in gespielter Überraschung.
»Willst du damit andeuten«, wollte ich wissen, »dass der Mann, den du draußen gesehen hast, eine, eine Art …« Ich zögerte und suchte nach dem richtigen Wort.
»Verhältnis?«, schlug er hilfsbereit vor.
»… romantische Verbindung meinerseits war?«, beendete ich den Satz.
»Nein, nein, natürlich nicht«, sagte er eine Spur zu hastig. Er nahm meine Hände aus seinem Gesicht und versuchte, mich zu küssen, doch jetzt war es an mir, den Kopf abzuwenden. Stattdessen drückte er mich aber auf das Bett, so dass ich wieder neben ihm lag.
»Es ist nur …«, begann er. »Nun ja, weißt du, Claire, es waren sechs Jahre, die wir getrennt waren. Und wir haben uns lediglich dreimal kurz gesehen, beim letzten Mal nur diesen einen Tag. Es wäre doch nicht ungewöhnlich, wenn … Ich meine, jeder weiß doch, unter was für einem Druck Ärzte und Schwestern im Einsatz stehen, und … na ja, ich … Es ist nur, dass … Also, ich würde es verstehen, wenn irgendetwas Spontanes …«
Ich unterbrach seinen stotternden Wortschwall, indem ich mich losriss und wie eine explodierende Rakete aus dem Bett schoss.
»Glaubst du etwa, ich bin dir untreu gewesen?«, fragte ich und sah ihn herausfordernd an. »Ja? Denn wenn das so ist, kannst du dieses Zimmer auf der Stelle verlassen. Am besten auch gleich das Haus! Wie kannst du es wagen, so etwas überhaupt nur anzudeuten?« Ich kochte vor Wut, und Frank setzte sich auf und streckte die Hand aus, um mich zu beruhigen.
»Fass mich nicht an!«, fuhr ich ihn an. »Sag mir einfach – glaubst du wirklich, basierend auf der Tatsache, dass ein Fremder zufällig zu meinem Fenster hochgeschaut hat, dass ich eine flammende Affäre mit einem meiner Patienten hatte?«
Frank stieg aus dem Bett, kam zu mir und schlang die Arme um mich. Ich blieb stocksteif stehen wie Lots Gemahlin, doch er ließ sich nicht entmutigen und liebkoste mein Haar und massierte mir die Schultern so, wie er wusste, dass ich es gern hatte.
»Nein, ich glaube nichts dergleichen«, antwortete er entschlossen. Er zog mich dichter an sich, und ich entspannte mich ein wenig, wenn ich auch nicht so weit ging, die Arme um ihn zu legen.
Nach einer langen Weile flüsterte er mir ins Haar: »Nein, ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest. Ich wollte nur sagen, selbst wenn … Claire, es würde nichts ändern. Ich liebe dich so. Nichts, was du je tust, könnte meiner Liebe ein Ende setzen.« Er nahm mein Gesicht in seine Hände – er war nur zehn Zentimeter größer als ich und konnte mir problemlos direkt in die Augen sehen – und sagte leise: »Verzeihst du mir?« Sein Atem mit dem leichten Hauch von Glenfiddich wehte warm über mein Gesicht, und seine vollen, einladenden Lippen waren verstörend nah.
Draußen verkündete ein weiterer Blitz das plötzliche Hereinbrechen des Gewitters, und strömender Regen trommelte auf die Dachschindeln.
Ich legte ihm langsam die Arme um die Taille.
»›Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang‹«, zitierte ich. »›Sie fällt vom Himmel wie der sanfte Tau …‹«
Frank lachte und hob dann den Blick; die ineinanderlaufenden Flecken an der Decke verhießen nichts Gutes für eine Nacht im Trockenen.
»Wenn das ein Beispiel für deine Gnade ist«, sagte er, »möchte ich es nicht erleben, wenn du Rache übst.« Wie als Antwort auf seine Feststellung brach der Donner wie eine Mörserattacke los, und wir lachten beide, und der Bann war gebrochen.
Erst als ich später seiner regelmäßigen tiefen Atmung neben mir lauschte, kamen mir die Fragen. Wie ich gesagt hatte, gab es nicht den geringsten Hinweis darauf, dass ich ihm untreu gewesen war. So weit zu mir. Aber wie er gesagt hatte, waren sechs Jahre wahrhaftig eine lange Zeit …
Kapitel 2
Druidensteine
Mr. Crook holte mich wie besprochen am nächsten Morgen pünktlich um sieben ab.
»Damit wir den Tau auf den Butterblumen noch erwischen, nicht wahr?«, sagte er, und die Ritterlichkeit zwinkerte ihm aus den betagten Augen. Er hatte ein Motorrad dabei, das circa aus demselben Jahrgang stammte wie er selbst und das uns aufs Land transportieren sollte. Wir schnallten die Pflanzenpressen an den Seiten der enormen Maschine fest wie Fender an einem Schleppdampfer. Es war eine gemütliche Tour durch die stille Landschaft, die im Kontrast noch stiller erschien, als das donnernde Dröhnen von Mr. Crooks Motorrad plötzlich abgedrosselt wurde. Wie sich herausstellte, kannte sich der alte Mann in der Tat mit den Pflanzen der Gegend aus. Er wusste nicht nur, wo sie zu finden waren, sondern auch, welchen medizinischen Nutzen sie hatten und wie man sie zubereitete. Ich wünschte, ich hätte ein Notizbuch mitgebracht, um mir alles aufzuschreiben, doch ich lauschte der brüchigen alten Stimme gebannt und gab mir Mühe, mir das Gehörte einzuprägen, während ich unsere Fundstücke in den schweren Pflanzenpressen verstaute.
Wir hielten am Fuß eines seltsamen Hügels mit einer flachen Kuppe an, um uns unseren Lunchpaketen zu widmen. Er war so grün wie die meisten seiner Nachbarn, mit den gleichen Felsvorsprüngen und Spalten, aber etwas war anders: Auf der einen Seite führte ein ausgetretener Pfad bergauf und verschwand hinter einer Granitklippe.
»Was ist denn dort oben?«, fragte ich und deutete mit einem Schinkensandwich auf den Pfad. »Kommt mir zum Picknicken etwas umständlich vor.«
»Ah.« Mr. Crook richtete den Blick auf den Hügel. »Das ist Craigh na Dun. Ich wollte es Ihnen nach dem Essen zeigen.«
»Ach ja? Gibt es da etwas Besonderes?«
»Oh, aye«, antwortete er, weigerte sich aber, das Thema weiter auszuführen und sagte nur, dass ich »es« schon sehen würde.
Ich hatte zwar leichte Bedenken, was seine Fähigkeit betraf, so einen steilen Weg zu erklimmen, doch diese verflogen, als ich wenig später in seinem Kielwasser bergauf keuchte. Schließlich streckte mir Mr. Crook seine knorrige Hand entgegen und zog mich über die Kante des Hügels.
»Da ist es.« Er schwenkte mit einer Art Besitzergeste die Hand.
»Oh, das ist ein Steinkreis!«, röchelte ich entzückt. »Stonehenge in klein!«
Aufgrund des Krieges war es mehrere Jahre her, dass ich zuletzt auf der Ebene von Salisbury gewesen war, aber Frank und ich waren kurz nach unserer Hochzeit in Stonehenge gewesen. Genau wie die anderen Touristen, die beeindruckt zwischen den riesigen Menhiren umherwanderten, hatten wir mit offenen Mündern vor dem Altarstein gestanden (›… wo die Druidenpriester der Vorzeit ihre grauenvollen Menschenopfer vollzogen‹, wie der sonore Cockney-Führer einer Busladung italienischer Touristen verkündete, die den ziemlich gewöhnlich aussehenden Steinblock pflichtschuldigst fotografierten).
Mit derselben Leidenschaft für Genauigkeit, die Frank dazu trieb, seine Krawatten auf dem Kleiderbügel so zu arrangieren, dass die Enden exakt auf gleicher Höhe hingen, waren wir sogar um den ganzen Kreis herumgewandert, hatten gemessen, wie viele Schritte zwischen den Z-Löchern und den Y-Löchern lagen, und die Stürze auf dem Sarsenkreis gezählt, dem äußeren Ring der monströsen Menhire.
Drei Stunden später wussten wir, wie viele Y- und Z-Löcher es gab (neunundfünfzig, falls es Sie interessiert, mich nämlich nicht), hatten aber auch keine größere Ahnung vom Zweck des Bauwerks als die Dutzende von professionellen und Laien-Archäologen, die in den letzten fünfhundert Jahren auf der Fundstelle herumgekrochen waren.
Natürlich mangelte es nicht an Theorien. Das Leben unter Akademikern hatte mich gelehrt, dass eine gut formulierte Theorie normalerweise besser ist als eine schlecht formulierte Tatsache, zumindest wenn es um das berufliche Weiterkommen geht.
Ein Tempel. Ein Gräberfeld. Ein astronomisches Observatorium. Eine Exekutionsstätte (daher die unglückliche Bezeichnung für den »Metzelstein«, der auf der einen Seite halb in seiner eigenen Grube versunken liegt). Ein Marktplatz. Diese Vorstellung gefiel mir, denn ich hatte sofort plastisch vor Augen, wie megalithische Hausfrauen mit Körben auf dem Arm zwischen den Steinen umherschlenderten und kritische Blicke auf die Glasur der jüngsten Lieferung von Tonbechern warfen, während sie skeptisch den Versprechungen der Steinzeitbäcker und der Knochenschaufel- und Bernsteinperlenhändler lauschten.
Das Einzige, was für mich gegen diese These sprach, waren die Toten unter dem Altarstein und die verbrannten menschlichen Überreste in den Z-Löchern. Falls das nicht die Überreste von Kaufleuten waren, die man beschuldigt hatte, ihre Kunden zu übervorteilen, erschien es mir ein wenig unhygienisch, die Leute auf dem Markt zu begraben.
In dem kleinen Steinkreis auf dem Hügel gab es keine Spur eines Begräbnisses. Mit »klein« meine ich nur, dass der Steinkreis kleiner war als Stonehenge; die einzelnen Steine waren immer noch doppelt so hoch wie ich und hatten massive Proportionen.
Von einem anderen Touristenführer in Stonehenge hatte ich gehört, dass diese Steinkreise in ganz Britannien und Europa vorkommen – manche besser erhalten als andere, manche mit kleinen Abweichungen in der Ausrichtung oder Form, alle mit unbekanntem Zweck und von unbekannter Herkunft.
Mr. Crook stand gütig lächelnd da, während ich zwischen den Steinen umherwanderte und hin und wieder stehen blieb, um einen davon sanft zu berühren, als könnte meine Berührung einen Eindruck bei den monumentalen Steinbrocken hinterlassen.
Einige der aufrechten Steine waren gemustert, in gedämpften Farben gestreift. Andere waren mit Flechten bewachsen, in denen sich die Morgensonne als fröhlicher Schimmer fing. Alle waren bemerkenswert anders als die Natursteine, die überall aus den Farnen lugten. Wer auch immer die Steinkreise – ganz gleich, zu welchem Zweck – errichtet hatte, hatte es wichtig gefunden, spezielle Steinblöcke für diese Zeugnisstätten brechen, behauen und transportieren zu lassen. Behauen – wie? Transportieren – wie und aus welcher für mich unvorstellbaren Entfernung?
»Mein Mann wäre fasziniert«, sagte ich beeindruckt zu Mr. Crook, als ich mich schließlich neben ihn stellte, um mich dafür zu bedanken, dass er mir die Stelle und die Pflanzen gezeigt hatte. Der gichtgebeugte alte Mann bot mir am Kopfende des Pfades galant den Arm an. Ich nahm ihn, denn ich warf einen Blick auf den steilen Abstieg und beschloss, dass er trotz seines Alters wahrscheinlich trittsicherer war als ich.
Am selben Nachmittag bog ich in die Hauptstraße ein, die in den Ort führte, um Frank im Pfarrhaus abzuholen. Ich erfreute mich am betörenden Duft der Highlands, einer Mischung aus Heidekraut, Torf und einigen bereits erblühten Ginsterbüschen, hier und da gewürzt mit Kaminrauch und dem Aroma der unverzichtbaren gebratenen Heringe. Die Häuser, die die Straße säumten, waren hübsch und gepflegt, manchen hatte der erblühende Nachkriegswohlstand bereits einen frischen Anstrich beschert. Selbst das Pfarrhaus, das mindestens hundert Jahre alt sein musste, hatte leuchtend gelbe Einfassungen rings um die krummen Fensterrahmen.
Mr. Wakefields Haushälterin öffnete die Tür, eine hochgewachsene, sehnige Frau mit einer dreireihigen Kette aus künstlichen Perlen um den muskulösen Hals. Als sie hörte, wer ich war, hieß sie mich willkommen und führte mich durch einen langen, schmalen, dunklen Flur, an dessen Wänden Sepia-Stiche von Menschen hingen, die vielleicht Berühmtheiten ihrer Zeit gewesen waren, vielleicht auch liebe Verwandte des Pastors, die aber nach allem, was ich im Zwielicht von ihnen sehen konnte, genauso gut die Königliche Familie hätten sein können.
Im Kontrast dazu wurde man in Mr. Wakefields Studierzimmer durch das Licht der enormen Fenster, die an der einen Wand fast von der Decke bis zum Boden reichten, geradezu geblendet. Eine Staffelei neben dem Kamin, die ein halb fertiges Ölgemälde mit schwarzen Klippen vor einem Abendhimmel trug, gab den Grund für die Fenster preis, die lange nach dem Bau des Hauses hinzugefügt worden sein mussten.
Frank und ein kurz gewachsener, rundlicher Mann mit einem Priesterkragen brüteten über einem Berg eselsohriger Papiere, die auf dem Schreibtisch am anderen Ende des Zimmers lagen. Frank blickte nur angedeutet auf, um mich zu begrüßen, doch Mr. Wakefield hielt höflich mit seinen Erklärungen inne und eilte herbei, um meine Hand zu ergreifen. Dabei strahlte ihm freudige Geselligkeit aus dem runden Gesicht.
»Mrs. Randall!«, sagte er und schüttelte mir herzlich die Hand. »Wie schön, Sie wiederzusehen. Und Sie kommen gerade rechtzeitig, um die Neuigkeit zu hören!«
»Neuigkeit?« Ich warf einen Blick auf den schäbigen Zustand und die Schrifttype der Papiere auf dem Schreibtisch und schätzte das Datum der fraglichen Neuigkeit auf circa 1750 ein. Also nicht ganz das, wofür man die Druckerpressen angehalten hätte.
»Ja, genau. Wir sind dem Vorfahren Ihres Mannes, Jack Randall, in den Armeedepeschen jener Zeit auf der Spur.« Mr. Wakefield beugte sich zu mir hinüber und sprach durch den Mundwinkel wie ein Gangster in einem amerikanischen Film. »Ich, äh, habe mir die Originaldepeschen aus dem Historischen Archiv ›ausgeborgt‹. Sie werden das doch niemandem erzählen?«
Amüsiert erklärte ich mich bereit, sein tödliches Geheimnis nicht zu verraten, und sah mich nach einer gemütlichen Sitzgelegenheit um, auf der ich die jüngsten Enthüllungen aus dem achtzehnten Jahrhundert in Empfang nehmen konnte.
Der Armsessel, der den Fenstern am nächsten stand, sah geeignet aus, aber als ich die Hand ausstreckte, um ihn zum Schreibtisch herumzudrehen, stellte ich fest, dass er bereits besetzt war. Sein Insasse, ein kleiner Junge mit dichtem, glänzend schwarzem Haar, hatte sich in den Tiefen des Sessels zusammengerollt und schlief.