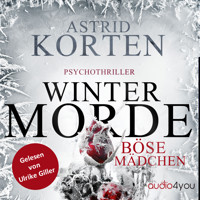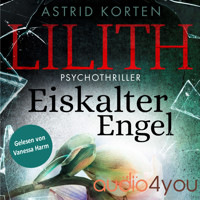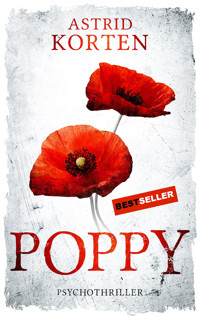4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
LESERSTIMMEN: Packender Thriller, der einen tief in die menschlichen Abgründe blicken lässt * Grausam, voller Gänsehautmomente, macht sprachlos * Gefangen im Käfig * Eine reale Geschichte, die Gänsehaut macht Ein vermisstes Mädchen Ein monströser Psychopath Ein Cold Case Eine Ermittlerin und die Dämonen der Vergangenheit Ende März verschwindet in München die zwölfjährige Greta spurlos. Sie ist nicht die Erste, wissen Polizeihauptkommissarin Mo Celta und ihr Kollege Nico Braun von der Kripo München. Als wäre das nicht genug, werden die Ermittler mit über die Stadt verteilten seltsam inszenierten Skelettteilen konfrontiert. Zeitgleich taucht ein Teenager in der Fußgängerzone auf, gekleidet wie ein Obdachloser und völlig ausgehungert. Und das, obwohl er viel Geld in seinem Rucksack hat. Geld, das die Ausreißerin Peggy dringend braucht. Was ist das Geheimnis des autistisch anmutenden Teenies? Hat er etwas gesehen, was er nicht sehen sollte? In dem Thriller NO-NAME GIRL, Band II der Serie OVERKILL, nimmt Mo Celta es nicht nur mit einem monströsen Psychopathen auf, sondern muss sich auch den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen. Ende März verschwindet in München die zwölfjährige Greta spurlos. Nicht die Erste, weiß Mo Celta, Kripo München. Zeitgleich taucht ein ausgehungerter Teenager mit einem Rücksack voller Geld auf, das die Ausreißerin Peggy dringend braucht. Als Skelettknochen von Kindern gefunden werden, wird Mo auch mit den Dämonen der Vergangenheit konfrontiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
OVERKILL
Über das Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
27 Jahre später
Mittwoch, 29. März 2023
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Donnerstag, 30. März 2023
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Freitag, 31. März 2023
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Samstag. 1. April 2023
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Sonntag, 2. April 2023
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Montag, 3. April 2023
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Dienstag, 4. April 2023
Kapitel 61
Mittwoch, 5. April 2023
KAPITEL 62
Kapitel 63
Donnerstag, 6. April 2023
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Anmerkungen
Ausdrücke der Jugendsprache
OVERKILL
NO-NAME GIRL
Die Nacht ist wie ein großes Haus. Und mit der Angst der wunden Hände reißen sie Türen in die Wände - dann kommen Gänge ohne Ende, und nirgends ist ein Tor hinaus.
Rainer Maria Rilke
Für Poppy, in ihrem Himmel,
und all die anderen verschleppten, geschändeten und gequälten Kinder.
Über das Buch
Ein vermisstes Mädchen
Ein seltsamer Teenager
Ein monströser Psychopath
Eine Ermittlerin und die Dämonen der Vergangenheit
Ende März verschwindet in München die zwölfjährige Greta spurlos. Sie ist nicht die Erste, wissen Polizeihauptkommissarin Mo Celta und ihr Kollege Nico Braun von der Kripo München. Als wäre das nicht genug, werden die Ermittler mit über die Stadt verteilten seltsam inszenierten Skelettteilen konfrontiert. Zeitgleich taucht ein Teenager in der Fußgängerzone auf, gekleidet wie ein Obdachloser und völlig ausgehungert. Und das, obwohl er viel Geld in seinem Rucksack hat. Geld, das die Ausreißerin Peggy dringend braucht. Was ist das Geheimnis des autistisch anmutenden Teenies? Hat er etwas gesehen, was er nicht sehen sollte?
In dem Thriller NO-NAME GIRL, Band II der Serie OVERKILL, nimmt Mo Celta es nicht nur mit einem monströsen Psychopathen auf, sondern muss sich auch den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen.
Kapitel 1
Johanniskirchener Moos
Samstag, 9. November 1996
Durch die offenen Fenster des Wagens strömte kühle Luft herein. Nichts deutete mehr darauf hin, dass es vor ein paar Stunden noch so schön und warm im Fahrzeug gewesen war. Im Grunde war nichts mehr von den vergangenen Stunden übrig geblieben. Die Nacht hatte alles verschlungen wie ein gefräßiges, kaltes Monster.
Der Wagen bewegte sich holpernd vorwärts, als könnte jeden Moment ein Rad aus seiner Halterung springen, wie ein überbeanspruchter Oberschenkelknochen aus einer müden Hüfte. Aber das alte Metallgerippe hielt stand und setzte seine Fahrt auf dem Feldweg fort, wobei seine Insassen im Rhythmus der Bodenwellen und Böschungen durchgeschüttelt wurden. In der Fahrgastzelle war kein Geräusch zu hören, das dem Stottern des Motors entgegenwirkte. Kein Wort, das der Stille eine Pause gönnte, keine Musik, um den Fahrer zu begleiten. Nur der stotternde Diesel des alten Transporters hallte zwischen den Bäumen wider.
Ein Mann lenkte den Wagen. Der Vollmond zeichnete blaue Schatten auf sein Gesicht, die eingefrorenen Gesichtszüge erinnerten an eine Maske.
„Meinst du nicht, dass du zu viel Lärm machst?“, wisperte sein Fahrgast.
Er blickte zur Seite. „Hier ist doch niemand, der uns hören könnte, du Weichei.“
„Bin ich niemand?“
Ihm ging die jämmerliche Stimme im absurden Sopran auf die Nerven.
„Hör auf, du nervst! Ich bringe das hier zu Ende!“ Der Mann hatte sich noch nie so stark gefühlt wie heute. „Und du wirst mir beweisen, dass du kein Jammerlappen bist.“
„Bin ich nicht!“
„Sicher?“ Die tiefe Stimme des Fahrers bekam einen bedrohlichen Klang. „Gut. Ich behalte dich im Auge.“
Der Wagen setzte den Weg noch etwa zehn Minuten fort und bog dann nach links ab, um in den Wald zu gelangen. Von nun an war es nur noch ein kaum befahrbarer Pfad. Der Fahrer fuhr im Schritttempo weiter.
„Bist du sicher, dass es hier ist?“
Wieder schaute der Fahrer zur Seite. „Ich kenne die Gegend, vertrau mir.“
Der Fahrgast lachte laut auf. „Ha! Dir vertrauen? Das hat die Tüte auf der Ladefläche auch getan.“
„Du wolltest doch mitkommen!“, entgegnete der Fahrer verächtlich.
„Mir war langweilig.“
Farne und Brombeeren kratzten an den Blechen – vergebliche, lächerliche Waffen, um den Eindringling aus Metall aufzuhalten. Dieser Teil des Pfades kam dem Fahrer stets endlos vor. Dann tauchte wie aus dem nichts vor ihm ein verlassener, heller Fleck zwischen den hohen Bäumen auf: Ein einsames Haus, dessen Steine im Mondlicht glänzten und das seit Ewigkeiten seine Zwillingsschwester im Spiegel des Sees betrachtete.
Die ausdruckslosen schwarzen Augenhöhlen der Fassade starrten die Eindringlinge an. Der Fahrer brauchte noch einen Moment, wie vor einem Sprung in das kalte, dunkle Wasser eines Sees im Hochsommer. Niemand sagte ein Wort, sie starrten auf die Überreste des verlorenen Hauses. Unzählige Unwetter hatten einen Teil des Daches zerstört. Der untere Teil der Mauern war von Unkraut und Efeu befallen, als versuchte das Pflanzengewirr das Gemäuer zu verschlingen. Die Zeit hatte ihm nach Jahren des heroischen Widerstands in die Hände gespielt, das Mineral kapitulierte langsam.
„Was glotzt du denn so?“, fragte der Fahrer. „Wir haben keine Zeit zu verlieren. In ein paar Stunden wird es hell.“
Als Antwort erhielt er ein Kichern.
Er legte den ersten Gang ein und fuhr langsam auf das Haus zu. Der Pfad war nicht mehr da, das Fahrzeug wälzte das hohe Gras nieder, hinterließ Spuren der nutzlosen Ernte. Obwohl es bis zur Fassade des Hauses nur zweihundert Meter waren, brauchte es einige Minuten, bis der Transporter zum Stehen kam und der Motor verstummte. Die Stille der Nacht kehrte zurück.
Aus der Nähe betrachtet, sah man dem Haus den Zahn der Zeit deutlich an. Die Wände zeigten überall Risse. An einem Fenster im Obergeschoss hingen noch zwei Fensterläden, die sich an rostigen Angeln festklammerten und verzweifelt versuchten, den unvermeidlichen Sturz abzuwenden. Dachziegel und Steine lagen verstreut herum.
Der Mond warf sein Licht im Fahrgastraum auf die Gesichter der Insassen. Ihre Mimik war regungslos, sie wussten, weswegen sie hier waren. Der Fahrgast hüllte sich in Schweigen.
Schließlich stiegen sie aus. Ihre Anwesenheit wirkte unpassend an diesem Lost Place, an dem Pflanzen und Steine im Verborgenen einen stillen Krieg führten. Der Fahrer ging ein paar Schritte nach hinten, wo sich eine Art Plattform befand, hob eine Luke hoch und blickte einen Moment lang wie versteinert in das finstere Loch. Dann kehrte er in die Realität zurück und griff nach einer Schaufel und zwei Fackeln.
„Warum nicht hier, warum im Haus?“, fragte sein Fahrgast.
„Weil es im Haus besser ist. Da geht nie jemand rein, nicht einmal ein Tier. Diese verdammten Mauern werden ohnehin irgendwann einstürzen. Ich gehe allein rein!“
„Nein!“
„Okay, dann komm mit. Aber mach dir bloß nicht in die Hose.“
Es waren nur noch wenige Schritte, die sie von der Haustür trennten. Dann drückte der Mann die Tür mit aller Kraft auf.
„Gemütlich hier“, provozierte der Fahrer mit hämischem Blick.
Ein großer Raum, kalt und dunkel, öffnete sich vor ihnen. Die beiden Fenster waren von Efeu und Dornenbüschen weitgehend verdeckt, es roch modrig. Am Ende des Raumes zeichnete sich ein noch schwärzerer Umriss ab. Der Fahrer zündete die Fackeln an. Die Öffnung führte in einen kleineren Raum, vermutlich ein ehemaliges Schlafzimmer. Der Lehmboden verströmte denselben Geruch wie der Rest des Hauses.
„Hier ist es perfekt“, sagte er und fing langsam an zu graben. Das Licht der Fackeln, die er in den Boden gerammt hatte, verliehen der Szene ein gespenstisches Aussehen. Nur das Geräusch des Spatens, der sich mit unkoordinierten Hieben in den Boden grub, und das Atmen, das immer schneller und lauter wurde, waren zu hören. Nach einer Stunde hatte der Fahrer über zwei Drittel des Raumes ausgehoben und richtete sich auf. Dann verließ er das Haus, ging zum Fahrzeug und wuchtete das längliche, mit schwarzem Plastik überzogene Paket über seine Schulter. Mit vor Anstrengung erschöpften Schritten ging er zurück in den Raum und legte das schwarze Paket und einige Kleidungsstücke in die Grube.
Der Fahrgast schwieg, als ob jedes Wort grausame Folgen haben könnte. Schließlich legte der Fahrer die Schaufel auf den Boden und stand regungslos vor der finsteren Tiefe. Wäre das Licht der Fackeln nicht erloschen, hätte man zweifellos Schweiß über seine erdverschmierten Wangen rinnen sehen können.
Die Zeit stand still. Es lag etwas Schauderhaftes in dem Ausheben des Totengräbers und dem Schweigen des anderen, in dem was sie taten, weil sie es tun mussten: Eine Leiche begraben. Sekunden später nahm der Fahrer die Schaufel wieder zur Hand, schaufelte die Erde über den Sack, bis der Boden wieder genauso aussah wie zuvor.
Im Haus war es still wie bei ihrer Ankunft, als hätte es die Anwesenheit der Totengräber akzeptiert, als würde es sich zum Komplizen machen und das Geheimnis der beiden bewahren.
Als sie sich wieder in den Wagen setzten, spiegelte sich die silbrige Scheibe des Mondes noch immer im kleinen See. Während der Fahrer den kleinen Transporter startete, warf er einen Blick zur Seite. „Hast dich gut gehalten. Kannst du schweigen und damit leben?“
Ein heftiges Nicken, dann ein unerwartetes Schluchzen. „Schon …“
„Was erwartest du eigentlich. Wir hatten doch unseren Spaß. Bist du immer noch nicht zufrieden? Das Leben ist uncool, wenn man nicht über den Tellerrand schaut.“
Er kurbelte das Fenster herunter und spuckte hinaus in die Dunkelheit. „Leute, die an einem Montag, dem wohl verfluchtesten Wochentag aller Zeiten, zur Welt gekommen sind, an einem erbärmlichen Montagmorgen, jammern nicht. Sie sind mutig und voller Tatendrang.“
Dann wurde es still in der Fahrgastzelle.
„Geht doch! Es warten doch noch andere kleine Abenteuer. Bin stolz auf dich, Right!“
Sein Fahrgast schenkte ihm ein kleines Lächeln. „Right?“
„Ja, right wie rechts. Du sitzt rechts neben mir und du warst meine rechte Hand. So werde ich dich fortan nennen. Right.“ Sie fingen an zu lachen, konnten kaum aufhören.
Es hatte wieder zu regnen begonnen, als das Geräusch des alten Wagens sich entfernte. Nach und nach kehrte die Stille wieder ein.
Eine eisige, beängstigende Stille.
Kapitel 2
Aschheim - Sonntag, 10. November 1996
Draußen hatte es zu regnen begonnen, lautlos, friedlich. Ein schwarzer, trauriger Regen, wie ihn der November hervorbringt, wenn die Nacht jeden Baum und jede Wand zu ihrer eigenen macht. Nichts verriet seine Anwesenheit, außer den glänzenden Schlieren auf den Fenstern.
Mo Celta löffelte schweigend ihre Suppe, eine Gemüsesuppe, die sie ekelig fand. Mit ihren fünf Jahren mochte sie Vermicelli lieber. Heute Abend hielt Mo oft inne und zählte die Karos auf der Plastiktischdecke, die die Resopalplatte schützte.
Im letzten Jahr hatten ihre Eltern die alten Möbel weggeworfen die sie in den ersten Jahren nach ihrem Einzug zusammengetragen hatten. Mo erinnerte sich an die Besuche in den Geschäften, in denen sie nichts anfassen durfte. Dabei fand sie dort alles, was es normalerweise auch Zuhause gab. Sofas, Sessel und sogar Betten, auf die sie sich auf keinen Fall legen durfte, es sonst was setzen würde, wenn sie wieder draußen waren. Ein rundlicher Verkäufer mit einem gewinnenden Lächeln hatte über eine Stunde lang geredet, Schubladen geöffnet und wieder geschlossen und auf die Oberflächen gehauen um zu zeigen, wie widerstandsfähig das Mobiliar war. Ihr Vater war skeptisch geblieben, ihre Mutter hingegen begeistert und am Ende hatte sie das letzte Wort. Der Verkäufer nahm ihre Eltern mit in den hinteren Teil des Ladens, um einen Haufen Papiere zu unterschreiben, während ihre Kinder in der Mitte der Ausstellungshalle sich in zwei orangefarbenen Skai-Sesseln lümmelten. Niemand wagte es, sie von dort zu vertreiben.
Einen Monat später fuhr ein Lastwagen vorsichtig rückwärts in die kleine Einfahrt. Zwei Männer in blauen Latzhosen luden einen Berg Kartons in verschiedenen Größen aus. Ihre Mutter war ganz aufgeregt gewesen und hatte nach ihrer ältesten Tochter gerufen.
„Elisa, hol deinen Vater! Die Möbel sind angekommen!“
Mo saß damals mit einer Handvoll Kirschen in der Hand auf der Schaukel und beobachtete aus der Ferne das Geschehen. Während ihr Vater mit Hilfe der beiden Männer die Kisten auspackte, entstanden mitten im Hof bunte und glänzende Möbel, die dann vorsichtig ins Haus getragen wurden. Als Mo die Kirschen aufgegessen hatte, sprang sie von ihrem Hochsitz und rannte zum Haus. Auch sie wollte sich die neuen Möbel aus der Nähe ansehen.
„Mo, wasch deine Hände und fasse nichts an!“
Sie lief zum Waschbecken. Die Flecken der Burlat-Kirschen ließen sich nur schwer entfernen, obwohl sie ihre Finger reichlich einseifte. Als sie das Ergebnis zufriedenstellend fand, sprang sie von dem Hocker, den sie benutzte um an den Wasserhahn heranzukommen, und näherte sich dem neuen Tisch und den Stühlen. Mit großen Augen strich Mo über die kalten, glänzenden Oberflächen und ließ ihre Finger über die Lehnen gleiten.
Später hatte Elisa ihrer kleinen Schwester alles über das Resopal erklärt. Mo hatte nichts kapiert. Elisa hatte gelacht und gespottet: „Mo, unser Baby, das nichts versteht.“
Nein, was Mo an den neuen Möbeln gefiel, war die sanfte grüne Farbe, die sich durch die ganze Küche zog. Sie hatte viel Zeit damit verbracht, die feinen Streifen zu betrachten, die in den Oberflächen erkennbar waren und sich ein ums andere Mal gefragt, welcher Maler diese Tausende von Spuren so gleichmäßig aufgebracht hatte. Und dann waren da noch diese glänzenden Metallfüße, in denen sie ihr kleines Gesicht verzerrt sehen konnte, wenn sie ganz nah heranging. Das war wirklich komisch…
Ihre Mutter holte Mo aus ihren Gedanken, als sie mit dem Löffel auf ihren Tellerrand klopfte. Der Bildschirm des Fernsehers war heute Abend schwarz geblieben, ein schlechtes Zeichen, wie ihre Schwester in solchen Fällen stets behauptete. Sie blickte auf und sah Elisa, die in den Inhalt ihres Tellers vertieft war. Doch nach einigen Sekunden traf ihr Blick den ihrer kleinen Schwester. Sie lächelte.
„Esst zu Ende, Mädchen, es wird Zeit“, beendete ihre Mutter den Blickwechsel.
Natürlich war es an der Zeit. Das Glockenspiel einer italienischen Kirche würde bald acht Stunden schlagen. Das Hochzeitsgeschenk einer entfernten Tante, deren Gesicht Mo vergessen hatte, thronte an der Wand zwischen einem kleinen Ölgemälde, das so dunkel war, dass man die Landschaft kaum erkennen konnte, und einem bunten, emaillierten Fisch, wie man ihn auf Souvenirbasaren an der Adria kaufen konnte. Die Uhr war der einzige Gegenstand in der Küche, der das Prädikat ‚antik‘ für sich beanspruchen konnte.
„Es ist ein bisschen so, als wären wir in Rom“, hatte ihre Mutter oft mit einem Lächeln im Gesicht gesagt.
Aber heute Abend würden diese Worte wohl nicht sprudeln. Aus irgendeinem Grund spürte Mo, dass ihrer Mutter nicht nach Lachen zumute war. Als sie fertig war, räumte sie sofort ihren Teller und das Besteck ab und legte alles in das weiße Spülbecken. Dann drehte sie sich langsam um, ging zu ihrem Vater, der sie auf beide Wangen küsste, dann zu ihrer Mutter, die es ihm gleichtat. Dann nahm sie Mos Gesicht zwischen beide Hände, wie sie es immer tat. Doch heute Abend waren sie eiskalt. Das war ungewöhnlich.
„Gute Nacht, Bambina.“
„Gute Nacht, Mama.“
Sie verließ die große Wohnküche und ließ ihre Schwester und ihre Eltern zurück. Elisa durfte noch ein wenig länger aufbleiben. Das Privileg der Älteren, wie ihre Mutter ihr einmal erklärt hatte. Da Elisa fünf Jahre älter war als Mo, konnte sie hin und wieder kleine Annehmlichkeiten wie diese beanspruchen. Doch heute Abend beneidete Mo sie nicht. Die Stimmung am Familientisch war ihr nicht geheuer.
Mo machte sich daran, die Treppe zu ihrem Zimmer im ersten Stock vorsichtig hinaufzusteigen. Die gewachsten Holzstufen hatten sich schon oft als tückisch erwiesen, ihr Hintern erinnerte sich noch gut daran. Auf dem Treppenabsatz angekommen, ignorierte sie das Bad samt Zähneputzen und entzog sich damit kühn den mütterlichen Anweisungen. Sie spürte, dass heute Abend niemand auf die Idee kommen würde, ihr Vorwürfe zu machen.
Mo ging den Flur entlang, an dessen Ende sich zwei identische Türen gegenüberlagen. Auf der rechten Seite befand sich der Dachboden, vor dem sie sich so fürchtete, auf der linken Seite ihr Schlafzimmer. Sie hob den Riegel der alten Tür an und stieß sie auf. Ihre Hand tastete die Wand ab und fand den Lichtschalter. Sie spürte die kalte, runde Form des Porzellans und drehte den Vorsprung in der Mitte um eine Vierteldrehung. Das Licht schoss von der Decke. Ein großes Wort für die einzige Glühbirne, die den großen Raum ausleuchten sollte. Jeder Winkel schien sich ins Unendliche zu erstrecken und blieb doch hartnäckig im Schatten. Lediglich das Bett in der Mitte wurde von dem gelben Glühfaden ausreichend angestrahlt.
Mo flüchtete schnell dort hin, um sich von der Helligkeit trösten zu lassen. Der Raum war kalt, wie immer. Der große Ofen im Vorraum des Eingangs verteilte seine Wärme überall sonst, aber kaum in ihrem Zimmer, das viel zu weit vom Rest des Hauses entfernt lag. In Windeseile zog sie den Schlafanzug an und schlüpfte unter die Decke. Dort kauerte sie sich zusammen, um der Kälte möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Schnell würde ihre Körperwärme das Bett erwärmen, sie musste nur Geduld haben. Der Schlaf übermannte sie schon vorher.
Ein Klatschen riss Mo aus ihren Träumen. Ihre Sinne waren sofort wach, sie achtete auf jedes Geräusch, aber im ganzen Haus war es still. Aber das Geräusch konnte sie sich nicht eingebildet haben, ganz bestimmt nicht. Einen Moment überlegte sie mit klopfendem Herzen, nach ihrer Mutter zu rufen. Doch dann hörte sie die Stimmen der Eltern im Erdgeschoss. Sie unterhielten sich in der Küche. Mo konnte nur kurz eingeschlafen sein.
Mo hörte nur ein paar Wortfetzen, was sicherlich daran lag, dass die Tür geschlossen war, wie immer, wenn ihre Eltern nach dem Zubettgehen der Kinder unten blieben. Der Fernseher war immer noch stumm. Sie wurde neugierig, denn ihre Eltern hielten sich nie unnötig in der Küche auf. Ihr Vater ging manchmal ins Büro, um Angebote und Rechnungen zu ordnen, ihre Mutter schaute fern oder las ein Buch.
Dieser Abend war wirklich seltsam. Und alles, was anders war, zog die Aufmerksamkeit des fünfjährigen Mädchens auf sich. Mo spitzte die Ohren und konzentrierte sich darauf, besser zu hören.
„Es ist schrecklich, sie haben das Mädchen … noch immer nicht ….“
Die Äußerungen ihrer Mutter ergaben für Mo keinen Sinn, ihre Neugier gewann die Oberhand. Sie entschloss sich, ihr gemütliches Nest zu verlassen, schlug die Decke zurück und sprang aus dem Bett. Dann eilte sie in den Flur. Trotz ihrer Bemühungen, leise zu sein, knarrten die Dielen des alten Holzbodens manchmal unter ihren nackten Füßen. An der Treppe stieg sie vorsichtig zwei Stufen hinunter, setzte sich und achtete darauf, unsichtbar zu bleiben, falls die Küchentür geöffnet wurde. Diesen Trick hatten sie und ihre Schwester schon oft angewandt, um die Gespräche der Eltern über die Weihnachts- oder Ostervorbereitungen zu belauschen. Doch heute Abend war die Aufregung der Sorge gewichen. Von ihrem Platz aus waren die Stimmen viel besser zu hören.
„Wir müssen sie schützen, Thomasz.“ Die Stimme ihrer Mutter klang verzweifelt.
„Solche Dinge passieren immer wieder. Man kann niemand vor allem bewahren. Es ist wie ein Krieg, man weiß nie, wann er kommt. Wir können nur vorsichtig sein.“
Mo konnte sich nicht daran erinnern, ihren Vater schon jemals so ernst sprechen gehört zu haben. Selbst als sie sich das Spielzeugauto ihres Cousins Johann ‚ausgeliehen‘ und vergessen hatte, es ihn zurückzugeben.
Mo glaubte, ihre Mutter weinen zu hören, ein leises, kaum hörbares Schluchzen, vermischt mit Klagen. „Es ist schlimm …“
Mos Herz klopfte schneller. Sie hatte das Gefühl, dass etwas Schreckliches passiert war, ohne den Schimmer einer Ahnung, was es war. Ein Stuhl scharrte über den Boden und warnte Mo, dass ein Elternteil aufgestanden war. Sie sprang hastig auf und schlich zwei Stufen hinauf.
„Ich glaube, Elisa hat es in der Schule gehört.“
„Das wundert mich nicht. Im Ort wird auch schon darüber geredet, Mina.“
„Wir müssen die Mädchen warnen, Thomasz.“
Ihr Vater schwieg einen Moment, als würde er über den nächsten Satz nachdenken. „Ohne Einzelheiten zu nennen, aber so, dass es sie es verstehen.“
Mo hatte das Gefühl, als würde sich ihre Welt in der Dunkelheit des Treppenhauses auflösen. Alle wussten etwas, wovon sie nicht die geringste Ahnung hatte. In der Küche war es still geworden. Sie ging mit schnellen Schritten zurück in ihr Zimmer und schlüpfte unter die Bettdecke. Sekunden später hörte sie, wie die Haustür geöffnet und geschlossen wurde. Ihr Vater hatte das Haus verlassen. Dann vernahm sie die Schritte ihrer Mutter auf der Treppe.
Mo lag unter ihrer Bettdecke und wartete, dass ihre Mutter den Treppenabsatz erreichte, durch den Flur ging, in ihr Zimmer kam und einen Kuss auf ihre Stirn drückte. Und tatsächlich erreichte sie der zarte Duft ihrer Mutter, ein Geruch, den ein Kind nie vergisst, der nie verblasst.
„Schlaf gut, Bambina, hab süße Träume.“
Mo spürte einen Tropfen in ihrer Halsbeuge. Dann hörte sie ihre Mutter das Zimmer verlassen. Mo wischte den salzigen Tropfen weg und stand wieder auf. Das Fenster lockte sie mit seinen kalten, schwarzen Scheiben. Was sie dann sah, verstand Mo an diesem Abend nicht.
Erschüttert schlüpfte sie wieder unter die Bettdecke und schlief weinend ein. Sie wachte weder auf, als ihr Vater spät in der Nacht zurückkehrte, noch nahm sie den geisterhaften Ruf einer Eule auf dem Dach des Hauses wahr.
Der Regen hatte aufgehört. Im Zimmer war es ruhig und still, nur Mos leiser Atem war zu hören. Ab und zu kam ein gleichmäßiges Knarren des Schaukelstuhles hinzu, den Großmutter ihr geschenkt hatte, was sie aber nicht aufweckte.
Elisa saß darin mit einem Stofftier auf dem Schoß und starrte auf ihre kleine Schwester.
Zwei Tage später verschwand Elisa.
27 Jahre später
Die Toten schlafen mit offenen Augen. Sie beobachten uns aus der Vergangenheit.
(Vincent Coccotti)
Mittwoch, 29. März 2023
Kapitel 3
Greta
Zuerst nahm das Mädchen den Geruch von frischem Kiefernholz wahr. Dann schlug es mit dem Kopf gegen die Decke. Vor Gretas Augen war alles schwarz, als wäre sie blind. Nicht ein Fitzelchen Licht drang zu ihr. Vorsichtig tastete sie um sich. Rundum Holz, unter sich eine dünne Wolldecke. Sie tastete weiter. Nach einem Griff oder Schloss. Und fand nichts dergleichen.
Schlagartig bekam sie keine Luft mehr. Hechelte gegen die leeren Lungenflügel. ‚Tief ein- und ausatmen‘, hörte sie ihre Mutter. ‚Ganz langsam und gleichmäßig atmen. Du kannst das. Mach einfach weiter‘. Dabei hatte ihre Mutter ihr rhythmisch über den Rücken gestrichen und damit das Tempo ihres Atmens vorgegeben. Das hatte immer funktioniert, wenn sie in Panik geriet. Doch jetzt war sie nicht da. Niemand, der ihr sagte, wie sie zu atmen habe. Ihr wurde schwindelig.
Sie schloss die Augen, horchte in sich hinein, bis sie die Stimme ihrer Mutter wiederfand. Endlich gelang es ihr, die Lunge vollständig mit Luft zu füllen und öffnete erleichtert die Augen. Doch sie sah nichts, absolut nichts. Sofort kehrte die Panik zurück.
Mit ihren Fäusten hämmerte sie gegen die Holzdecke. Lag sie in einem Sarg? Eingegraben unter der Erde?
„Hilfe, Hilfe“, rief sie so laut sie konnte. Doch nur die Stille antwortete ihr. Und ein leises, gleichmäßiges Brummen.
Plötzlich rollte sie gegen die rechte Wand, nur einen kurzen Moment, dann fiel sie wieder auf den Rücken. Also bin ich nicht unter der Erde, dachte sie erleichtert. Sie musste sich in einem Fahrzeug befinden. Einem fahrenden.
Wie war sie nur hierhergekommen? Es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Ein Erinnerungsfetzen zeigte ihr einen Wagen, auf den sie zugegangen war, ein freundlich lächelndes Gesicht, ein hübsches Gesicht. Das ihr gefiel. Dann wurde alles dunkel. Was war nur geschehen?
Nun wurde sie nach links geworfen und rutschte mit ihrem Kopf gegen das Ende der Kiste. Hoffnung keimte in ihr auf. Das Fahrzeug hatte angehalten, nun würde man sie wieder rauslassen. Bestimmt war das nur ein Spaß gewesen. Ein übler Scherz, aber eben doch harmlos. Gleich würde man sie freilassen.
Glaubte sie das wirklich? Nein. So dumm war sie nicht. Sie musste sich verteidigen, sobald der Deckel aufging. Wenn er aufging. Sie tastete um sich, suchte ihren Rucksack mit den Schulsachen. Und ihr Handy. Warum hatte sie nicht früher daran gedacht?
Die Kiste war zu niedrig, sie konnte sich nicht aufrichten. Hastig tastete sie nach ihren Sachen. Nichts. Sie bewegte die Beine wie damals, als sie als Kind im Schnee einen Engel erzeugte. Kein Widerstand bis zu den Holzwänden. Mist, kein Rucksack.
Sie klopfte ihre Jackentaschen ab. Stieß auf einen vergessenen Kugelschreiber, schloss fest ihre Faust um ihn und zog ihn raus. Besser als nichts.
Es war totenstill. Selbst das Brummen hatte aufgehört. Doch nichts passierte. Wollten die sie hier drin sterben lassen? Wer auch immer. Sie wusste nicht, was schlimmer war: hier drin zu ersticken oder rausgeholt zu werden von irgendwem, der sicher nichts Gutes mit ihr im Sinn hatte. Endlich hörte sie ein leises Schnappen, erst am Kopfende, dann am Fußende. Der Deckel wurde angehoben. Doch es wurde nicht heller.
Bevor sie reagieren, sich auch nur aufsetzen konnte, spürte sie einen Einstich am Arm und sackte weg.
Als sie erneut erwachte, lag sie zusammengekrümmt und nackt in einem Käfig. Ein diffuser Lichtschein von einer nur angelehnten Tür zeigte ihr das silberfarbene Gitter um sich. Wieder konnte sie sich nur gekrümmt aufrichten. Doch diesmal war der Boden unter ihr eiskalt und feucht. Erdig, wie sie beim Tasten feststellte. Und es stank um sie herum. Hektisch krabbelte sie den halben freien Meter zu einem im Gitter eingelassenen Türchen. Erst als sie ganz dicht mit ihrem Gesicht dran war, entdeckte sie das Vorhängeschloss an der Außenseite. Sie rüttelte und zerrte an der Tür, doch sie bewegte sich keinen Millimeter.
„Aber, aber, das wollen wir doch ganz schnell lassen“, hörte sie eine hohe Männerstimme an der Tür, von einem Lichtschein umgeben. „Oder soll ich das Wasser wieder mitnehmen?“
Erst jetzt spürte sie ihren Wahnsinnsdurst. Schon die Vorstellung, kaltes Wasser durch ihren trockenen Mund in die Kehle hinunterfließen zu spüren, machte sie fast verrückt vor Verlangen.
„Bitte, bitte, Wasser“, flehte sie das gesichtslose Wesen an, das sie nur schemenhaft erahnen konnte.
„Nur wenn du brav bist. Bist du brav?“
„Ja, ja, ich bin brav. Bitte, Wasser“, flehte sie. Dafür hätte sie sich umbringen können. Dieses Monster anzuflehen. Aber ihre Kehle sagte etwas anderes.
„Bitte, ich werde alles machen, was sie wollen.“
„Na bestens, das ist doch schon mal ein Anfang.“ Er drehte sich um. „Hast du das gehört, Right? Aber weißt du was? Ich glaube ihr nicht. Ich denke, ihr Durst ist noch nicht groß genug.“
Greta konnte im diffusen Licht niemanden erkennen. Mit wem sprach der Mann?
„Nein, ich denke, wir werden noch ein wenig warten. Damit unsere Greta auch wirklich dankbar ist.“
Kapitel 4
„Sohn“
Ich stehe vor der Eingangstür und versuche, den Schlüssel zu drehen und den Messinggriff runterzudrücken. Bei Vater sieht das ganz einfach aus. Er legt seine Hand auf den Griff und drückt ihn nieder. Dann zieht er daran und die Tür schwingt nach innen auf. Und draußen ist er. Als sei es das Einfachste der Welt. Ein Schritt, der zwischen drinnen und draußen, hier und dort, Sicherheit und Gefahr entscheidet. Und mir unmöglich ist. Ich bin noch nie durch diese Tür gegangen.
Vater hat mir erklärt, dass die Tür aus Eichenholz ist. „Dadurch ist sie massiv, keiner kann sie einrammen, Sohn.“ Ja, das hat er gesagt und: „Egal, mit welchem Werkzeug sie es versuchen. (Wer auch immer). Nur Dynamit kann das.“
Vater ist der Herr der Tür. Niemand darf den Schlüssel drehen. Nur er. Was das bedeutet, ist mir klar. Niemals und unter keinen Umständen darf ich das tun. Er muss mir nicht mit Prügeln drohen. Die sind bei weitem nicht so schlimm wie mein Schicksal jenseits dieser Tür. Sagt er.
Vater hat auch gesagt, dass da draußen Chaos herrsche. Das nur er abwenden könne. Das habe ich nicht verstanden. Stunden habe ich deswegen in unserer Bibliothek verbracht, um die Bedeutung des Wortes Chaos zu verstehen. Ich fand die Erklärung im Brockhaus: Chaos (von altgriechisch χάος cháos) der unendliche leere Raum, die gestaltlose Urmasse des Weltalls; in der antiken Naturphilosophie: das Gähnende, Klaffende, der sich öffnende Abgrund.
Da habe ich es begriffen. Und gewusst, dass ich das nicht will. Nicht ertragen würde. Mein Leben muss klar sein, der Tagesrhythmus immer der Gleiche. Keine Abweichung. Kleinste Änderungen bereiten mir Magenschmerzen. Rauben mir den Schlaf. Machen mich kribbelig als krabbelten Heerscharen von Ameisen über meine Arme. Obwohl ich das noch nie tatsächlich gespürt habe. Ich habe es in einem Buch gelesen. Wie alles, was ich nicht verstehe oder kenne. Es bedeutet, dass man tausende von winzigen Füßen auf der Haut spürt, die gar nicht da sind. Ich habe noch nie eine echte Ameise gesehen. Nur ihr Bild im Brockhaus. Sie sieht so ähnlich aus wie eine Fliege in klein, nur ohne Flügel. Es kitzelt, wenn eine Fliege über meine Haut läuft. Dann muss ich sie verscheuchen und mich kratzen. Wenn ich kribbelig bin, hört es trotz kratzen nicht auf zu jucken, es sitzt tiefer unter der Haut. Da, wo ich nicht drankomme.
Es hat mich nie nach draußen gezogen. Wozu auch. Hier habe ich alles, was ich brauche. Hier drinnen ist alles klar. Und einfach. Ich stehe auf, wenn es hell wird, mache Essen, lese ein Buch – jeden Tag eins. Unsere Bibliothek umfasst Tausende. Für die „Sprachpflege in der Berufsschule“ habe ich nur einen halben Tag gebraucht.
Jetzt stehe ich vor der Eingangstür, weil ich Hunger habe. Nicht erst seit heute. Seit Tagen schon ist da dieses ziehende Gefühl im Magen und das Blubbern im Darm. Ich habe gelesen, dass man zwei Monate ohne Essen auskommen kann, wenn man genügend trinkt. Also habe ich getrunken. Anfangs vor zehn Gläser Wasser über den Tag verteilt, alle zwei Stunden eins. Dann jede Stunde. Aber es half nicht, es hat nur stärker geblubbert in meinem Bauch. Jetzt halte ich es nicht mehr aus.
Vater ist noch nie so lange weggeblieben. Ich habe die Tage gezählt, jeden Tag im Kalender markiert. Um keinen Fehler zu machen. Wenn man Hunger hat, kommt einem die Zeit doppelt so lange vor. Das weiß ich von früher. Das habe ich schon erlebt. Aber noch nie so lange. Zwei Wochen sind es nun. Zwei Monate werde ich das nicht durchhalten.
Ich verstehe nicht, wo er ist. Ihm muss etwas passiert sein. Vielleicht ein Unfall. Als wir einmal im Auto unterwegs waren, (nur darin darf ich das Haus verlassen) kamen wir an einem anderen Fahrzeug vorbei, das im Graben lag. Ganz zerknittert war es vorne. Und es hatte gequalmt. Vater hat mir gesagt, dass das ein Unfall sei und das so was häufig auf den Straßen vorkäme. Dabei könne man umkommen, hat er gesagt. Das bedeutet, dass man stirbt. Ich habe Vater gefragt. Auch davor müsse er mich schützen. Hat er gesagt.
Was aber, wenn ihm ein Unfall passiert ist? Er im Krankenhaus liegt, wie der Mensch, der neben dem verunglückten Auto gelegen hat. Ein großes rotes Auto, mit blitzenden blauen Lichtern auf dem Dach hat danebengestanden. Zwei Männer in ebenfalls roten Anzügen mit seltsamen Streifen drauf knieten neben dem Menschen auf dem Boden.
„Der kommt jetzt ins Krankenhaus, Sohn.“
„Was ist ein Krankenhaus?“
„Stell dich nicht so dumm an“, pflaumte Vater mich an. „Das kannst du dir doch denken.“
Also habe ich nachgedacht. Ein Haus und Kranke waren in dem Wort enthalten. Und dass man dorthin gebracht wird, wenn man auf der Straße liegt.
„Ein Haus, wo Kranke hinkommen?“, fragte ich am Ende der Gedanken.
Vater hat nur genickt.
Vater kann es nicht ausstehen, wenn ich dumme Fragen stelle. Alles andere darf ich fragen. Aber nichts Dummes. Dann wird er böse. Also versuche ich immer, die Antworten selbst zu finden.
Aber was soll man glauben, wenn man gar nichts weiß? Wie jetzt. Fest steht: Er kommt nicht zurück. Das Auto ist weg. Sein Rucksack, auf den ich unbedingt aufpassen soll, ist aber noch da.
Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, muss die Antwort aber selber finden. Denn Vater, der einzige Mensch, den ich hätte fragen können, ist nicht da.
Und ich habe Hunger.
*
Ich habe es nicht an der Haustür ausgehalten. Die Angst hat mich vertrieben. Nun stehe ich am Fenster im ersten Stock hinter der Gardine und versuche, den Mut aufzubringen, rauszugehen. Doch schon der Blick hinaus bereitet mir Ameisenkribbeln unter der Haut.
Eigentlich darf ich hier gar nicht stehen. Vater sagt, das sei gefährlich. Wenn mich jemand sieht, werden sie mich holen (Wer auch immer). Weg von Vater. Und dann sei mein Schicksal besiegelt. Hat er gesagt. Dann komme ich in ein Heim, in dem mich andere Kinder quälen. Das würde ich nicht überleben. Hat er gesagt. Das war nicht wirklich notwendig, war es mir doch auch so schon klar.
Doch wie soll ich es nun schaffen, nach unten zu gehen, die Tür zu öffnen, rauszugehen und Essen zu besorgen? Angezogen für draußen habe ich mich schon. Über meine Latzhose Vaters Wolljacke gezogen. Denn es liegt Schnee, obwohl wir schon Ende März haben. Wenn Schnee liegt, ist es kalt. Das weiß ich. Also habe ich auch meine warmen Schuhe angezogen. Sie sind ein wenig zu groß, haben vorher Vater gehört. Ich musste mehrere Paar Socken übereinander ziehen, bis sie passten und meine Füße nicht mehr hin und her rutschen. Dann Vaters Fellmütze aufgezogen – die mit den langen Pelzohren – und den Rucksack auf den Rücken, so wie Vater ihn trägt.
Langsam wird mir heiß, ich schwitze in der dicken Kluft. Schaffe es aber trotzdem nicht, zur Haustür zu gehen. Obwohl mein Darm krampft. Das kommt vom Hunger, habe ich gelesen.
Während ich die vorbeifahrenden Autos betrachte, hält eins vor unserer Tür. Es ist so ein blau-weißes wie das, das neben dem Unfall stand. Nur dass diese Lichter auf dem Dach jetzt nicht blau rotieren. Zwei Männer steigen aus. Auch sie in Blau, beide mit Mützen auf dem Kopf. Ihnen muss kalt sein.
Sie sehen zur Haustür. Ich werde unruhig. Vater hat mich vor ihnen gewarnt. Als wir an dem Unfall vorbeikamen, hat er gesagt: „Wenn du die siehst, dann lauf schnell weg. Das sind ganz schlimme Menschen. Die wollen uns trennen. Wollen dich mir wegnehmen. Wollen uns töten.“
Die Männer kommen zur Haustür. Einer drückt die Klingel, die ich hinter mir höre.
Nun bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken oder Zaudern. Ich muss hier weg. Raus aus unserem Haus. Ganz schnell. Durch die Hintertür. Der andere Weg ist versperrt von ihnen. Über die Mauer. Vater hat mir beigebracht, wie man das schafft. Man nimmt seitlich Anlauf, greift die Wandoberkante mit der Hand, stößt sich mit dem Fuß der gleichen Seite an der Wand hoch und hakt sich mit dem anderen Fuß oben ein. Dann lässt man sich hinüberrollen.
Vater hat extra eine Holzwand gebaut, damit ich das üben konnte. In unserem Hof, der rundum zugemauert ist. Damit mich niemand sieht. Hat er gesagt. Damit ich geschützt bin. Damit ich sicher sei. Deswegen musste ich auch jeden Tag trainieren. Zweihundert Liegestützen machen und hundert Klimmzüge.
Mit einem Satz bin ich auf der anderen Seite.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Wahrscheinlich ein Höllenfeuer oder ein Jaucheloch. Doch ich lande auf einem Betonboden, ganz ähnlich wie dem in unserem Hof. Doch hier ist er gequadert. Lauter Quadrate, die sich nahtlos aneinanderfügen und zusammen eine Platte bilden. Mir bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich höre hinter mir das laute Donnern an der Haustür. Und Rufe. Und Klingeln.
Ich drehe mich um und stehe vor einem Menschen. Einer Frau. Einer alten Frau. Sie hat ihr graues Haar zum Dutt gezwirbelt, ein schwarzes langes Kleid bis über ihre Knie und ein weißes Spitzending im Haar. Und dunkle Haut. Sie musste eine Schwarze sein. Noch nie habe ich eine gesehen außer in Büchern.
Sie starrt mich an wie ich sie.
„Was machst du hier?“, fragt sie mich.
Vater hat mir verboten, mit anderen Menschen zu sprechen. „Die drehen dir doch nur das Wort im Mund um und wollen dich dazu bringen, etwas zu verraten.“ Hat er gesagt, mir aber nie erklärt, was es zu verraten gäbe.
Doch ich will nichts riskieren, also antworte ich nicht, sondern drehe mich seitlich weg zur nächsten Mauer, nehme Anlauf und stürme über sie hinweg. Hinter ihr liegt eine Straße, an deren Rand Autos parken. Ein Stück weiter entdecke ich den blauen Wagen vor unserer Tür. Doch die blau gekleideten Männer sehe ich nicht. Gut, dann können sie mich auch nicht sehen. Ich drehe mich um und entferne mich gemessenen Schrittes (das habe ich aus Tolstois Krieg und Frieden), in die andere Richtung.
Die Straße hat vier Fahrspuren, auf denen mir jeweils auf zweien Autos entgegenkommen oder von mir wegfahren. Ich will auf die andere Seite, um schneller von den blauen Männern wegzukommen, aber es gibt keine Lücke zwischen den Fahrzeugen. Sie sind so schnell, dass ich keine Chance habe, zwischen ihnen durchzulaufen, ohne dass mich eins erwischt. Also folge ich der Straße bis ich auf eine Gruppe Menschen stoße, die, mit dem Gesicht zur anderen Straßenseite gewandt, vor weißen Querstreifen auf dem Asphalt warten. Auf der anderen Straßenseite steht eine Ampel, aber keine mit rot, gelb, grün wie die, die ich gesehen hatte, wenn Vater mit mir in unserem Wagen unterwegs war. Auf dieser sind kleine Männchen zu sehen. Das rote steht, das grüne geht. Das rote leuchtet hell. Vater hatte bei Rot angehalten. Also stelle ich mich in die Nähe der Menschen. Als das grüne Männchen aufleuchtet, gehen die Menschen zur anderen Straßenseite. Ich gehe mit. Mittendrin. Auch wenn mir diese Nähe zu den Menschen unangenehm ist. Aber so können mich die blauen Männer nicht sehen.
Auf der anderen Straßenseite wende ich mich nach rechts in Richtung eines breiten Flusses. Ich habe noch keinen Kilometer von zu Hause geschafft und bin doch schon in einer fremden Welt. Und friere. Es ist eisig. Die Luft dringt durch meine dünne Latzhose. Hätte ich doch wenigstens Vaters Wollhandschuhe mitgenommen. Ich puste und puste warme Atemluft in die zur Muschel geformten Hände, aber es wird nicht besser.
Ein paar junge Leute rennen in hautenger neonfarbener Kluft am Flussufer entlang. Wieso tun sie das? Wenigstens scheinen sie nicht zu frieren. Vielleicht muss man hier laufen? Ich renne los. Doch nach wenigen Metern lande ich auf dem Hintern. Bin ausgerutscht auf einer gefrorenen Pfütze. Ein älterer Mann in einem langen Mantel kommt auf mich zu.
„Kann ich dir helfen?“
Ich darf nicht reden. Nicht mit fremden Menschen. Hier sind mir alle fremd. Ich drehe mich auf die Knie und wuchte mich hoch. Schüttele den Kopf und renne los. Vorsichtiger, ich will nichts riskieren. Will trotzdem so schnell wie möglich Abstand bringen zwischen mich und diesen Mann mit seinem scheinheiligen Lächeln.
Als ich mich umdrehe, steht der Mann kopfschüttelnd noch immer an der gleichen Stelle. Aber er folgt mir nicht. Ein Glück!
Ich gehe weiter auf eine Brücke zu. Sie ist zu schmal für Autos, aber viele Menschen begegnen mir auf ihr. Sie bleiben stehen, halten ein flaches rechteckiges Ding hoch, lächeln es an. Manche haben so ein Ding auf langen Stöcken montiert und stellen sich dicht beisammen zu Gruppen. Diese Menschen haben schmale Augen wie Briefkastenschlitze, dunkles, glattes Haar, und sie sind sehr schlank.
Am anderen Ufer angekommen, muss ich mich entscheiden. Hier entdecke ich nirgends eine Möglichkeit, mir etwas Essen zu beschaffen. Nur Menschen, Menschen, Menschen. Gehend, rollend auf einem Brett, laufend. Ich nehme eine Straße auf die Häuser zu. Muss wieder an einer Ampel mit rotem Männchen warten.
Dann komme ich an einem großen Wagen vorbei, der an der Seite geöffnet ist. Ein Mann steht darin und es duftet nach Wurst. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Kann ich ihn um eine bitten? Dann muss ich ihn aber ansprechen. Aber das darf ich nicht. Ich beschließe, mir anzusehen, wie andere das machen und setze mich auf eine Bank gegenüber. Es dauert eine Weile, dann nähert sich ein Junge, stellt sich vor den Wagen und verlangt eine Wurst mit viel Senf. Der Mann nimmt mit der rechten Hand eine Zange, in der linken hält er ein Brötchen. Er legt eine Wurst hinein, nimmt eine Plastikflasche und drückt Senf auf die Wurst.
„Einsfuffzig“, sagt der Mann.
Der Junge nimmt die Wurst, schüttelt dem Mann die Hand und geht. Das kann ich auch. Ich gehe zu dem Wagen.
„Eine Wurst bitte mit viel Senf.“
Der Mann nimmt das Brötchen in die linke, die Zange in die rechte Hand, legt die Wurst in das aufgeschnittene Brötchen, drückt aus der Flasche Senf auf die Wurst und reicht sie mir. Ich nehme sie mit der linken Hand und greife mit der rechten seine, um sie zu schütteln. Der Mann sieht mich komisch an. Ich nickt nochmals um zu zeigen, dass ich weiß, wie man sich benimmt. Dann drehe ich mich um und gehe die schmale Gasse weiter. Der Mann schreit hinter mir her. Ich drehe mich um, er fuchtelt mit den Händen und brüllt, ich solle bezahlen. Was meint er nur?
Jetzt eilt er zur Seite des Wagens, reißt eine Tür auf und rennt auf mich zu. War ich nicht höflich genug? Dabei habe ich es doch genauso gemacht wie der Junge vor mir. Ich warte nicht ab, bis er mich erreicht. Die Wurst lasse ich mir nicht mehr wegnehmen. Mein Hunger ist zu groß.
Also renne ich los. Nach ein paar Ecken bleibt der Mann zurück. Ich eile noch ein paar Ecken weiter, dann bleibe ich stehen und beiße hinein. Sie schmeckt himmlisch. Ich schließe die Augen, um sie besser genießen zu können, schlucke, öffne den Mund zum nächsten Biss, da werde ich von hinten angerempelt. Die Wurst fällt auf den Boden, ein Hund an einer Leine, der direkt hinter mir an die Hauswand gepinkelt hat, schnappt sie sich und schlingt sie in wenigen Bissen runter.
Meine Wurst! Ich könnte schreien. Der Rempler geht ohne ein Wort weite. Und ich bleibe hungrig zurück. Tränen schießen mir in die Augen. Ich dachte, es wäre ganz einfach, sich eine Wurst zu holen. Doch nach der Erfahrung von eben ahne ich, dass ich etwas falsch gemacht hatte.
Nur was?
Durch unzählige schmale Straßen bin ich gegangen, an breiten Straßen voller hupender und blinkender Autos vorbeigekommen, habe sie hin und her überquert. Aber eine Möglichkeit, mir Essen zu besorgen, habe ich nicht entdeckt.
Inzwischen ist es dunkel geworden. Und noch kälter. Ich bin auf einer Straße unterwegs, an der viele hell erleuchtete Häuser mit großen Fenstern stehen, in denen alles Mögliche aufgebaut ist: lebensgroße Puppen in bunten Kleidern. Reihenweise kleine rechteckige Dinger, wie sie die Menschen auf der Brücke, aber auch hier überall anlächeln.
Manche drücken darauf herum. Manchmal piepen die Dinger. Sie scheinen sehr wertvoll zu sein. Alle halten sie ganz fest. Wahrscheinlich lösen sie den Blick nicht von ihnen, weil sie ihnen so viel bedeuteten.
Mir sind sie egal. Ich will nur etwas zu essen. Ich komme an flachen Häusern vorbei, die wie der Wagen mit den Würsten aus einem geöffneten Fenster Essen an Leute verteilen, die sich wie der Junge mit Handschlag bedanken. Was habe ich nur falsch gemacht?
Ich traue mich aber nicht, es noch einmal zu versuchen. So viel Glück wie vorhin hat man nicht immer. Und was nützte mir mein Glück? Der Hund hat die Wurst gefressen. Nein, es muss anders gehen.
Doch ich bin müde vom vielen Rumlaufen. Und wo soll ich schlafen? Zurück nach Hause kann ich nicht. Dort warten vielleicht noch die blauen Männer.
Ich schaue mich um. Die erleuchteten großen Fenster mit den bunten Sachen sind inzwischen nicht mehr so hell. Vor den breiten Glastüren, durch die Menschen rein und raus gegangen sind, befinden sich Gitter. Keiner kommt mehr rein. Warum wohl? Und was ist mit denen, die noch drin sind? Vor manchen der Einlässe haben sich Menschen gelegt. Unter ihnen entdecke ich Pappe, auf ihnen Wolldecken undefinierbarer Farbe. Man erkennt kaum die Gesichter. Ich würde mich auch zu gerne hinlegen. Aber ich besitze weder Wolldecken noch Pappen. Meinen Versuch, mich ohne diese Sachen hinzulegen, gebe ich schnell auf. Die Kälte zieht durch meine Kleidung bis auf die Knochen.
Also stehe ich auf, um mich warm zu laufen. Renne durch die Straßen, die inzwischen von Laternen erleuchtet sind. Begegne Menschen, die vermummt an mir vorbeieilen. Andere, die hin und her wanken, als wären sie auf einem Schiff bei Sturm. Mir fällt nicht ein, woher ich die Parabel habe. Das muss aber aus einem meiner Bücher stammen. Ich kann nicht mehr klar denken vor Hunger und Müdigkeit.
Nun stehe ich wieder vor dem breiten Fluss. Neben mir, unter einer breiten Brücke über die Autos fahren, entdecke ich weitere liegende Menschen unter Wolldecken um eine Tonne, in der ein Feuer brennt. Das sieht einladend aus. Das Feuer. Ich sehne mich nach Wärme und Licht. Vorsichtig nähere ich mich.
Die Männer sehen schmutzig aus. Haben lange, ungepflegte Bärte und zottelige Haare.