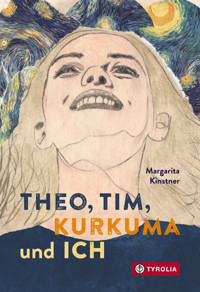Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist mit der neuen Mieterin in Top 10? Wieso schreit ihr Kind Tag und Nacht? Stimmt es, dass das Mädchen aus dem Dachgeschoß ihre Mitschülerinnen via Facebook mobbt? Wieso stützt sich der Ägypter aus dem Erdgeschoß auf einen Rollator? Und warum steckt an der Tür von Frau Klein ein Schreiben des Gerichtsvollziehers? In ihrem preisgekrönten neuen Roman erzählt Margarita Kinstner von einem Mehrparteienhaus in einer beschaulichen Gasse am Rande der Großstadt. Von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Von dem alten Mann gegenüber, der alles akribisch beobachtet, auf fremde Fenster und fremde Leben schaut – und auf die alte Rotbuche, die ein dunkles Geheimnis bewahrt. Eine Geschichte voller Empathie, unaufgeregt und trotzdem spannend. "Wenige beschreiben ihre Romanfi guren mit so viel Geduld und Liebe wie Margarita Kinstner." (Sonja Radkohl)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margarita Kinstner
Papaverweg 6
Roman
Leykam
Für Hannes
I
1
An einem Morgen Anfang September (es ist ein Freitag, kurz nach neun Uhr) biegt ein anthrazitfarbener Audi A6 in die kleine Gasse und hält auf dem Besucherparkplatz des Wohnhauses mit der Hausnummer 6.
Die Gegend wirkt wie aus früheren Zeiten, so ruhig ist es hier. In den Vorgärten der Einfamilienhäuser klettern Prunkwinden und Rosen die Maschendrahtzäune hoch, in den Staudenbeeten blühen blaue, zartrosa und pinke Hor-tensien. Dichte Hecken braucht es hier keine, man vertraut einander, hat nichts zu verbergen, lässt die Blicke der anderen zu.
Auch zwei Mehrfamilienhäuser gibt es in der Gasse. Eines ganz oben, auf Nummer 2, das andere, mit der Hausnummer 6, befindet sich in etwa der Mitte der Gasse. Weiter unten spuckt ein Apfelbaum seine Früchte auf den Gehsteig, wo sie nicht lange liegen bleiben werden, denn hier achtet man noch auf Sauberkeit. Laub und Früchte werden am Papaverweg ebenso schnell beseitigt wie im Winter der Schnee.
Im Haus mit der Nummer 5 – einem Einfamilienhaus aus den Fünfzigern – tritt der sechsundachtzigjährige Oskar Zimmermann ans Küchenfenster. Es ist der letzte Tag des Sommers, schon kann man den Regen ahnen, den der Wettermoderator in den Nachrichten angekündigt hat. Der letzte schwüle Morgen, in wenigen Minuten wird die ersehnte Abkühlung kommen, auf die Oskar seit Wochen hofft.
Draußen knirschen die Autoreifen auf dem Kies. Dann verstummt der Motor und überlässt die Bühne wieder dem Vogelgezwitscher. Seltsam, denkt Oskar, der den Wagen sofort erkennt. Was macht denn der Sucht hier?
Seitdem der Immobilienmakler einen Subunternehmer hat (und das sind jetzt auch schon bald vier Jahre), kommt er nur noch selten in die Gasse. Die Wohnungen am Papaverweg 6 bringen nicht genügend Provision, als dass sich Herbert Sucht persönlich um die Besichtigungstermine kümmern will.
Oskar wendet den Blick wieder ab und geht (wie er es ursprünglich vorgehabt hat) in die Speis. Er ist spät dran mit dem Frühstück, weil er bereits einmal, sehr früh am Morgen, aufgestanden ist und sich dann nochmals schlafen gelegt hat. Ein Rat seines Schwiegersohnes. Jan ist Psychologe. Dass er sich nicht lange mit Wiedereinschlafversuchen quälen, sondern lieber gleich aufstehen soll, hat er Oskar empfohlen, das schlage weniger aufs Gemüt.
Als sich Oskar kurz nach vier Uhr an seinen Küchentisch gesetzt hat, hat noch nicht einmal bei den Bosićs Licht gebrannt.
Die Bosićs sind jene Mieter im Haus gegenüber, die als Erste aufstehen. Auch heute wurden die Rollos der linken Dachgeschoßwohnung um vier Uhr dreißig hochgezogen. Zehn Minuten nach fünf stieg Herr Bosić in seinen weißen Toyota, seine Frau kam zwanzig Minuten später aus dem Haus, um zur U-Bahn zu gehen. Danach war es in der Gasse wieder still. Oskar hörte den Vögeln zu, döste ein wenig vor sich hin und schrieb ein paar Zahlen in das Sudoku. Kurz nach halb sieben trat dann der Mann mit dem Haarknödel auf seinen Balkon. Zündete sich eine Zigarette an und starrte auf das Dach seines schwarzen Geländewagens. Noch während er rauchte, wurden in der mittleren Erdgeschoßwohnung die Fenster geöffnet. Oskar hob die Hand zum Gruß, um dem Ägypter zuvorzukommen. Wenn Hamed El Sayed am Morgen lüftet, winkt er stets zu Oskar hinüber, und Oskar winkt, wenn er es rechtzeitig sieht, zurück – ein Ritual, das die beiden seit fast zwei Jahren vollführen.
Gegen sieben Uhr fielen Oskar die Augen wieder zu. Also verschob er das Frühstück auf später, stieg die Treppen hinauf, schlüpfte aus seiner Weste und legte sich in sein Bett. Zwei Minuten später sprang er wieder auf (sofern man die schnellstmögliche Aufstehbewegung eines Sechsundachtzigjährigen als Springen bezeichnen kann), lief die Treppen hinunter (Schlurfgeräusche), sah nach, ob die Kaffeemaschine ausgeschaltet war, und stellte fest, dass er sogar den Stecker gezogen hatte. Also füllte er für den Kater eine Schüssel mit Futter (wenn er schon hier war) und stieg abermals die Treppen hoch. Schob die blickdichten Seitenvorhänge, die seine verstorbene Frau vor mehr als dreißig Jahren genäht hatte, vor die Fenster, setzte sich auf das Bett, streifte die Hausschuhe von den Füßen, seufzte, kroch unter die Decke und schloss die Augen.
Als er wieder aufwachte, war es dreiviertel neun.
Jetzt steht er in der Speis und blickt auf die Gläser mit der Marmelade, die ihm seine Tochter auf die Regalbretter geschlichtet hat. Apfel mit Zimt und Koriander, Marille mit Marzipan, Zwetschken mit Walnüssen und Bitterschokolade, Birne mit Rosmarin. Kreationen seines Schwiegersohnes Jan (dem Psychologen). Oskar wählt ein Glas Quittengelee, darin sind nichts als Quitten und ein Schuss Quittenlikör (»Zwecks der Haltbarkeit«, wie Jan behauptet). Er greift nach dem Glas und schnappt sich beim Hinausgehen eine der Mineralwasserflaschen. Bleibt mit der Strickweste am Haken für die Schaufel hängen, stößt bei der Rückwärtsbewegung mit dem linken Ellenbogen gegen die Türschnalle und öffnet ganz auto-matisch die linke Hand, worauf das Marmeladeglas auf den Steinboden fällt und zerbricht. Ein Splitter springt ab und landet hinter dem Staubsauger.
Himmel, Arsch und Zwirn!
Er lässt das kaputte Glas, aus dem jetzt das Gelee quillt, liegen und stellt die Mineralwasserflasche auf die Küchenanrichte. Holt das Brot aus dem hölzernen Kasten und greift nach dem Schneidbrett. Legt es auf die Anrichte und stellt sich abermals ans Fenster.
Der Makler steht noch immer neben seinem Audi. Gerade bindet er sich etwas um den Kragen seines weißen Hemdes – nein, keine Krawatte, es ist ein grünes Trachtenbändchen. Sodann öffnet er die hintere Wagentür, holt einen beigen Leinenjanker vom Rücksitz, schlüpft hinein, zieht ein Taschentuch aus dem linken Jackensack, hustet, schnäuzt sich, hustet abermals und spuckt den Schleim ins Papier. Steckt das Taschentuch wieder weg, beugt sich nochmals ins Innere seines Wagens und holt eine schmale Mappe hervor. Streicht sich mit der freien Hand über die kahle Stelle am Hinterkopf, richtet sich auf und wirft die Autotür zu. Ein kurzer Blick auf die Fassade des Wohnhauses, dann fischt er die Fernbedienung aus der Tasche seiner Bluejeans und drückt mit dem Daumen auf den Knopf. Die Zentralverriegelung des Audi gibt einen kurzen Fiepton von sich, der Makler verschwindet hinter der Hecke. Wenn Oskar sich nicht täuscht, wird sein Kopf in spätestens einer Minute im Dachgeschoß auftauchen. Oskar weiß, dass die Wohnung mit der Nummer 10 seit Ende Mai leer steht.
Er lässt den Blick zu den Fensterreihen wandern. Im ersten Stock, hinter der zweiten Scheibe von links, sitzt die junge Lebensmittelretterin vor dem Computerbildschirm. Alice heißt sie. Ein liebes Mädchen, wie Oskar findet, und sehr gescheit. Die restlichen Fenster der Reihe sind noch hinter blickdichten Außenrollos versteckt. Im Dachgeschoß steht der Mann mit dem Haarknödel hinter der Balkontür und glotzt herüber. Als sein Blick den von Oskar streift, huscht er rasch zur Seite. Oskar schüttelt den Kopf. So ein Angsthase!
Jetzt endlich wird die Glastür der rechten Dachgeschoßwohnung geöffnet. Der Makler tritt auf den Balkon, beugt sich über das Geländer, blickt auf den Parkplatz und richtet sich wieder auf. Rückt sein Trachtenbändchen zurecht, streicht sich abermals über den Hinterkopf und schaut in den Himmel. Als Oskar seinem Blick folgt, bemerkt er die dickbauchigen schwarzen Regenwolken, die sich von Osten her über die Dächer schieben. Noch ist der nahende Wetterumschwung nicht mehr als eine Vorahnung. Noch riecht es im Zimmer nach Schwüle, Schweiß und eingetrocknetem Katzenfutter.
Oskar nimmt die Hand vom Vorhang. Hebt die Schale mit den Fleischresten hoch und rümpft die Nase. Dann holt er die Küchenrolle aus dem Schrank und zieht aus einer der Schubladen einen Plastiksack. Draußen grollt der erste Donner.
Er wischt das Futter mit dem Küchenpapier in den Sack, dann geht er in die Speis und hebt das kaputte Glas sowie den Splitter auf. In seinem Bauch grummelt es ähnlich laut wie draußen. Er stellt den Plastiksack ins Eck und beschließt, sich später um die klebrige Stelle auf dem Boden zu kümmern. Jetzt will er erst einmal in Ruhe frühstücken. Als er an die Küchenanrichte tritt, stellt er fest, dass er denselben Gedanken schon einmal gehabt haben muss.
Seltsam, denkt er. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das Brot herausgeholt habe.
Er hebt die Augenbrauen und kratzt sich im Ohr. Schüttelt den Kopf, öffnet die Bestecklade, holt das gezackte Messer heraus und schneidet sich eine Scheibe vom Brot herunter.
2
Ein zweistöckiges Wohnhaus am östlichen Stadtrand Wiens.
Die Adresse: Papaverweg 6.
Früher (ach, früher!) sind hier noch die Gänse gelaufen.
Früher (ach, früher!) war hier alles irgendwie besser – flüstern die Erinnerungen der Alten.
Alice Winter, die sechsundzwanzigjährige Mieterin von Top 4, sitzt jeden Morgen an ihrem Laptop. Von ihrem Fenster aus kann sie direkt auf die Gasse und den Parkplatz schauen.
Auch jetzt blickt sie seit Minuten aus dem Fenster. Vorhin hat sie den Makler dabei beobachtet, wie er in sein Taschentuch gespuckt und sich seine Trachtenjacke angezogen hat. Jetzt zerplatzen auf dem Dach des Audi die ersten Regentropfen.
Alice greift nach der Kaffeetasse neben der externen Tastatur und denkt an Susa und Tom. Schade, dass sie beiden weggezogen sind. Aber natürlich, mit dem Kind wäre es zu kompliziert geworden. Viel zu eng und zu hellhörig sind sie, die Wohnungen am Papaverweg 6.
Der Kaffee ist kalt und zu süß. Alice rümpft die Nase. Als sie die Tasse wieder abstellt, fällt ihr ein dunkelblauer Renault Twingo auf, der sich von rechts vor ihr Fenster schiebt und am Zaun gegenüber stehen bleibt. Das Brummen des Motors verebbt, kurz darauf schält sich aus dem Inneren des Wagens eine Frau in Alices Alter. Sie trägt Jeans und einen hellen Sommerpulli, ihr langes, braunes Haar hat sie zu einem dicken Zopf geflochten. Sie wirft die Autotür zu, sperrt ab, stützt sich am Dach ihres Wagens ab, bückt sich, schlüpft aus dem rechten Schuh und schüttelt ihn. Während der Bewegung fällt ihr Zopf zur Seite und baumelt ein paar Zentimeter über dem Gehsteig. Die Frau zieht den Schuh wieder an, richtet sich auf und läuft dann, mit beiden Händen über dem Kopf, auf das Haustor zu. Alice hört die Gegensprechanlage summen. Eine Sekunde darauf geht alles im Prasseln des Regens unter.
Zur selben Zeit, am anderen Ende des Ganges, liegt der siebenunddreißigjährige Peter Lindner in seinem Bett und schläft. Aus eben diesem Grund hört er weder das Fiepen der Zentralverriegelung noch die Schritte des Maklers, die in der Wohnung über ihm auf dem Laminatboden klappern. Auch vom Trommeln des Regens bekommt er nichts mit. Wenn der Jugendarbeiter schläft, sind seine Ohren stets mit Wachs verstopft. Nichts und niemand darf in seinen Schlaf dringen, nicht die Menschen und auch nicht die Sonne (die nun ohnehin nicht mehr scheint). Das pralle Leben (das Laute und das Helle) erträgt Peter erst nach der zweiten Tasse Kaffee. Deswegen sind seine Rollos auch an diesem Morgen fest verschlossen. Da das Jugendzentrum seine Türen erst nachmittags öffnet, kann er es sich leisten, lange zu schlafen.
Dennoch. Hätte er aus dem Fenster geschaut und das Auto des Maklers erkannt, hätte er den blauen Renault Twingo mit dem Kindersitz darin entdeckt, hätte er die Chance gehabt, ein weiteres Mal einzugreifen.
Ein winziger Moment nur. Ein Augenblick der Unachtsamkeit, geschuldet der frühen Uhrzeit, schon stehen alle Signale auf Grün.
3
Wie eine fette Seegurke wälzt sich das dunkle Band von Ost nach West, grummelt und rülpst und verdaut die Reste der ohnehin nicht sehr kräftigen Vormittagssonne. Jetzt ist er da, der Wettersturz, den der Nachrichtensprecher seit Tagen angekündigt hat.
Oskar dreht das Deckenlicht an und streift sich die blauen Gummihandschuhe über die Hände. Dann greift er nach dem Mikrofasertuch, hält es unter den Wasserstrahl und wringt es aus. Bevor er damit über die klebrige Stelle in der Speis fährt, stellt er sich ans Fenster. Draußen hat nun heftiger Regen eingesetzt, und auch der Sturm hat an Stärke zugenommen, hart peitscht er die Äste der Fichte hin und her. Hoffentlich bricht keiner ab und fällt auf den kleinen Renault, der vor seinem Zaun geparkt hat. (Seit wann steht der überhaupt hier?)
Seit Monaten wartet Oskar nun schon auf die Genehmigung der Stadt, die Fichte fällen zu dürfen. Die ganze Sache ist einfach lächerlich! Da sitzen die jungen Beamten, die seine Enkelkinder sein könnten, in ihren Büros und entscheiden über jeden Bereich seines alten Lebens, lassen ihn nicht einmal den Baum fällen, dessen Wurzeln er vor sechzig Jahren eigenhändig in die Erde gesetzt hat. Wer wird die Verantwortung übernehmen, wenn er auf das Dach stürzt? Oder gar einen Menschen erschlägt? (Ist nicht auch Ödön von Horváth damals?) Werden die, die ihm das Fällen aus Naturschutzgründen versagen, zu seinen Gunsten aussagen? Von wegen. Ganz allein wird er sich vor Gericht verantworten müssen, vielleicht sogar wegen fahrlässiger Tötung. Mit sechsundachtzig noch ins Gefängnis, weil er einen Menschen auf dem Gewissen hat.
Er seufzt und beobachtet die Schatten hinter den Fenstern im Dachgeschoß. Muss an das junge Paar denken, das bis zum Sommerbeginn in der Wohnung gewohnt hat. Oskar hat die sommersprossige Susa und ihren Mann gemocht. Obwohl, Mann ist das falsche Wort, sie sind ja nicht verheiratet gewesen. »Mein Freund«, hat Susa gesagt, und Oskar hat schmunzeln und an seine verstorbene Frau denken müssen. Mit einem Freund geht man Tretbootfahren, mit einem Freund zieht man kein Kind groß, hätte Ella gesagt.
Er betrachtet den Renault genauer. Nun ist er sich doch sicher, dass er vorhin noch nicht hier gestanden ist. Stimmt es, was seine Enkeltochter behauptet? Wird er schwerhörig? Normalerweise fällt ihm auf, wenn jemand vor seinem Haus hält.
Vielleicht liegt es ja bloß am Geräusch des Regens. Oder am Wind.
Er kneift die Augen zusammen. Der Wagen ist alles andere als neu, auch ist er nicht gepflegt. Der blaue Lack ist zerkratzt, die Stoßstange verbogen, und in der Beifahrertür entdeckt Oskar sogar eine Beule. Er schiebt den Vorhang ein Stück weiter zur Seite, greift sich an den Ellenbogen und rubbelt die schmerzende Stelle. Seine Nase berührt nun fast die Fensterscheibe.
Was ist denn das auf dem Beifahrersitz? Doch nicht etwa …
»Aber die können doch keine Frau mit einem kleinen Kind dort oben einziehen lassen!«, ruft er und dreht den Kopf zur Seite, ganz so, als stünde tatsächlich jemand neben ihm und könnte Antwort geben.
Doch da ist niemand.
Ella ist tot und Luise auch.
4
Eine halbe Stunde später beobachtet Alice, wie der Makler in den Audi steigt und die Gasse wieder verlässt. Sie rümpft die Nase. Ein schmieriger Kerl ist das. Aber diese Typen werden auch noch schauen, denkt sie, irgendwann wird es diese Kapitalistenschweine nicht mehr geben. In was für einer verkehrten Welt lebt sie eigentlich, dass Typen wie der fünfmal so viel verdienen wie ein Bäcker oder eine Supermarktangestellte? Was macht er schon? Fährt in seinem schicken Audi durch die Gegend, spaziert durch fremde Wohnungen und kassiert eine saftige Provision nach der anderen. Nicht einmal einen Angestellten leistet er sich, das wäre wenigstens eine gute Tat, aber nein, er lässt Mirko die Drecksarbeit auf Werkvertragsbasis machen. Mirko darf die Fotos aufnehmen (Weitwinkelobjektiv und Lichtstrahler), Mirko darf die Leute durch die Wohnungen führen und sich den Mund fusselig reden, und danach darf er zittern und hoffen. Wenn er etwas an die Frau, den Mann, die Familie gebracht hat, bekommt er den kleineren Teil der Provision.
Seltsam. Normalerweise kommt der Sucht nur, wenn Frau Reiter nach ihm verlangt. Aber das Auto der Eigentümerin, der acht der insgesamt zehn Wohnungen im Haus gehören, steht nicht auf dem Parkplatz.
Ist Mirko krank? Oder hat er endlich (endlich!) den Mut gehabt und dem Sucht gesagt, was er von ihm hält? Hat er etwas Besseres gefunden? Eine fixe Anstellung?
Vor einem dreiviertel Jahr traf Alice Mirko Čolaković zufällig auf der Straße. Grüßte ihn freundlich und tauschte ein paar nette Worte mit ihm aus, worauf er sie überredete, etwas trinken zu gehen. Und da sie ohnehin Liebeskummer wegen Henrik hatte, folgte sie ihm bereitwillig in das nahe gelegene Gasthaus, bestellte ein Glas Bier und hörte Mirko zwei Stunden lang beim Jammern zu. Und ja, beinahe hätte er es geschafft, ihr ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie ihre Wohnung ganz ohne seine Hilfe gefunden hatte.
Nachmieter gesucht, kein Makler!, hatte die Überschrift gelautet. Die Mieterin hatte die Fotos mit der Kamera ihres Handys aufgenommen und auf willhaben.at geladen. Ehrliche Fotos waren das gewesen, ganz ohne überbelichtete Weitwinkeloptik. Und auch der Text war ein einfacher gewesen. Keine Rede von »Single-Hit« oder »Traumobjekt mit Cityanbindung«. Keine Metaphern, keine anschaulichen Geschichten, in denen die Morgensonne geschlossene Lider küsst. Nette, kleine Wohnung mit guter Raumaufteilung!, hatte Alices Vormieterin geschrieben, und genau nach einer solchen Wohnung hat Alice damals gesucht.
An jenem Nachmittag, an dem Mirko ihr sein Herz aus- (und das Bier seinen Rachen hinunter-) schüttete, erfuhr Alice (ohne dass sie danach gefragt hatte) alles über seine prekäre Situation. Von seiner Frau und seiner fünfjährigen Tochter, von seiner Stelle im Elektro-Reparaturzentrum und der Kündigung wegen Mitarbeiterabbaus. Dass er danach keinen Job mehr gefunden habe, weil kaum noch jemand seine Haushaltsgeräte reparieren lasse, dass er schließlich das Inserat von »Herbert« in der Zeitung entdeckt und sich gedacht habe, dass das doch etwas sein könnte für ihn. Eine neue Chance. Als Selbstständiger wäre er sein eigener Herr, dann müsste er nicht mehr kriechen und sich auch nicht mehr beim AMS anstellen. Wie er sich gefreut habe, als »Herbert« sich für ihn entschied. Dass er damals ja noch keine Ahnung gehabt habe, dass der Sucht (»Der Arsch!«), nur einen Trottel brauche, der für ihn den Laufburschen spielt.
»Suche Idioten, der sich seinen WIFI-Kurs und die Sozialversicherung selbst bezahlt, Honorar nur bei Erfolg!«, ätzte Mirko und hinterließ Spuckeflecken auf der Tischplatte. »So hätte die Anzeige damals lauten müssen!«
Jetzt läuft er sich die Füße wund, von einem Single-Hit zum nächsten, von einem Familien-Wohntraum zum anderen, während sich »Herbert« (natürlich sind sie vom ersten Handschlag an per Du gewesen) um die lichtdurchfluteten Penthousewohnungen mit freiem Blick auf den Sternenhimmel kümmert. Mirko fährt von hier nach dort, von dort nach drüben und von drüben nochmals über eine Bezirksgrenze, und wenn er Glück hat, kommt am Ende des Monats eine vierstellige Summe heraus.
»Die Honorarnoten sehen ja nicht einmal so schlecht aus, aber am Ende frisst die Sozialversicherung dann alles weg«, sagte Mirko, als er ein weiteres Bier für sich bestellte und Alice ihm mit beiden Händen zu verstehen gab, dass sie selbst keines mehr trinken wolle.
»Warum meldest du dich nicht arbeitslos und suchst dir etwas Neues?«, schlug sie vor. »Lass dir das doch nicht gefallen!«
Mirko sah sie nur stumpf an. »Weißt du, wie das ist, wenn du den ganzen Tag zu Hause rumhockst und deine Frau arbeiten geht? Ich hab meinen Stolz. Das ist nicht viel, aber besser als nichts.«
Seitdem versteckt sie sich, wenn er kommt. Seit die Wohnung im Dachgeschoß leer steht, ist er ein paarmal hier gewesen. Alice mag Mirko nicht mehr über den Weg laufen, seine Hilflosigkeit macht sie wütend. »Komm endlich raus aus deiner Opferhaltung!«, würde sie ihn gern anschreien, aber sie weiß, dass sie kein Recht dazu hat. Vielleicht stimmt es, was er ihr vorwirft. Dass sie keine Ahnung vom »echten Leben dort draußen« hat. Was tut sie schon? Versteckt sich hinter einem großen Bildschirm und bloggt über Naturkosmetik, umweltfreundliche Putzmittel und saisonale Küche. Dazwischen wäscht sie sich die Haare mit Erde und Apfelessig, kocht vegane Bolognese und Eintöpfe aus gerettetem Gemüse, zerhackt Kastanien, schaut Dokumentationen auf YouTube und stöbert in den Blogs der anderen.
Als sie Mirko an jenem Nachmittag vorgerechnet hat, dass das bedingungslose Grundeinkommen durchaus finanzierbar sei, dass es eines Systemwechsels hin zu einer Mikrosteuer bedürfe, dass man endlich anfangen müsse, umzudenken, weil die Vollbeschäftigung für alle in Zeiten des technologischen Fortschritts gar nicht mehr möglich sei, hat sich ihre Rede wie die eines aufsässigen Teenagers angehört.
Natürlich. Sie hätte ihm erzählen können, dass auch sie für Dumpingpreise arbeitet. Dass sie stundenlang psychiatrische Gutachten abtippt und eine Menge banaler Ratgebertexte verfasst, nur um am Ende des Monats ein paar Hundert Euro überwiesen zu bekommen. Aber davon darf Mirko nichts wissen. Niemand darf davon wissen. Alice Winter ist das Mädchen mit dem Blog für umweltfreundliche und nachhaltige Lebensweise. Aus, Punkt, Ende. Das ist es, was die Menschen glauben sollen. Alice Winter rettet Lebensmittel vor dem Müllcontainer und verteilt sie an die Armen (und weniger Armen), Alice Winter kämpft gegen soziale Ungerechtigkeit und die Ausbeutung von Naturreserven, Alice Winter lebt in ihrem kleinen Wunderland, in dem alles möglich ist.
Mirko hat recht. Was weiß sie schon davon, wie es sich anfühlt, eine Familie ernähren zu müssen? Sie muss ja nicht einmal für das Essen in ihrem Kühlschrank bezahlen!
Als sie Mirko verriet, dass die öffentlichen Kühlschränke für alle da seien, also auch für ihn, lachte er sie aus. »Ach, Mädchen!«, gluckste er in sein Bier (dabei kann er nicht älter als höchstens dreißig sein). »Ich kann doch meiner Frau und meiner Tochter nicht ein paar welke Salatblätter und schrumpelige Karotten nach Hause bringen.«
Alice streckt den Rücken durch. Speichert die bearbeiteten Fotos ab und korrigiert den vorbereiteten Blogartikel. Danach kopiert sie den Text in die Maske, teilt die Absätze ein, formatiert die Überschriften und sortiert die Fotos für die Diashow. Obwohl sie ihre Artikel schon lange nicht mehr mit den passenden Keywords zur Suchmaschinenoptimierung versieht, zählt ihr Blog zu den meistgelesenen in Österreich. Trotzdem hat sie in letzter Zeit das Gefühl, nicht besser zu sein als der schmierige Sucht mit seinem Trachtenbändchen, der den Menschen mittels Fisheye-Optik eine Welt vorgaukelt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
5
Das Wohnhaus mit der Nummer 6 feiert still seinen fünfzehnten Geburtstag. Es hat die junge Mutter gekostet, und sie hat ihm geschmeckt. Danach hat es sein Maul wieder geöffnet und die Frau auf den Gehsteig gespuckt – ganz vorsichtig, auf dass sie wiederkommen möge.
Jetzt ist es in seinem Inneren still. Sogar der Mieter aus Top 2, der das Haus nur selten verlässt, hat seinen lindgrünen Anzug angelegt, den Fernseher ausgeschaltet und sich eine große Portion Aftershave auf die frisch rasierten Wangen geklatscht. Wie jeden zweiten Freitag fährt Hamed El Sayed in ein Kaffeehaus in der Innenstadt, wo er sich mit seinem Freund, dem pensionierten Rechtsanwalt und Mundartdichter Erich Wondrasch treffen wird. Dort werden die beiden Kaffee trinken, zwei Partien Schach spielen, ein wenig plaudern, einen Toast mit Käse und Ketchup essen, und anschließend werden sie sich noch ein Bier genehmigen.
Wie jeden zweiten Freitag wird Hamed gegen achtzehn Uhr nach Hause kommen. Wird seinen Anzug gegen eine bequeme Jogginghose tauschen, ein einfaches Bohnengericht zubereiten, die Wohnzimmerfenster und die Tür zum Gang weit öffnen und den Fernseher einschalten. Die anderen im Haus werden von seinem Tagesablauf nicht viel mitbekommen. Nur der Geruch der Fremde wird wie jeden Abend durchs Haus ziehen.
Als Hamed den Papaverweg verlässt, sitzt Oskar beim Küchentisch und hört Ö1. Der Regen hat ein wenig nachgelassen, jetzt blinzelt sogar die Sonne zwischen den Wolken hervor. Trotzdem. Der Sommer ist vorbei, laut und deutlich hat man im Mittagsjournal den Beginn einer längeren Regenperiode bestätigt. Ansonsten hat Oskar nicht viel von den Nachrichten mitbekommen, denn er hat über die junge Frau nachgedacht, die am Vormittag die Wohnung im Dachgeschoß besichtigt hatte. Vor allem ihr Zopf ist ihm aufgefallen. Ein Zopf, wie ihn sich seine verstorbene Frau gewünscht hat. Ella hat trockenes, sehr krauses Haar gehabt, weswegen sie alle vier Wochen zum Friseur ging, um es nachschneiden zu lassen. Im Gegensatz zu ihr, die ihr Haar gerne länger getragen hätte, hat Oskar die wilde Pracht auf ihrem Kopf gefallen. Wie ein Filmstar hat seine Ella ausgesehen – vor allem in jungen Jahren. Erst als sie damit begann, ihr Haar zu färben, wurde es immer dünner, und nach der Chemotherapie ist es schließlich gar nicht mehr nachgewachsen.
Gedankenverloren sieht Oskar dem Ägypter dabei zu, wie er das Gartentürchen öffnet, seine Gehhilfe ein Stück weit nach vorne schiebt und das Türchen sorgfältig wieder schließt. Hameds Rollator ist ein wenig breiter als der von Oskar. Heute liegen in dem Korb eine Wasserflasche, eine lederne Tasche sowie eine hastig zusammengefaltete Regenpelerine. Normalerweise blickt Hamed beim Verlassen des Hauses kurz zu Oskars Küchenfenster, heute jedoch wendet er sich sofort der großen Straße zu. Bestimmt hat er es eilig, denkt Oskar, der weiß, dass der Mieter das Haus an den Schachtagen um dreizehn Uhr fünfzehn verlässt. Jetzt ist es schon dreizehn Uhr fünfunddreißig.
Ob er sich ebenfalls auf den Weg machen soll? Am Morgen hat er die letzte Milch aufgebraucht, und Wurst ist auch keine mehr im Kühlschrank. Brot wird er keines brauchen, bestimmt hat Alice wieder einen Wecken dabei, wenn sie am Abend an seiner Tür läuten wird, und für den Fall, dass es diesmal kein Brot gibt, hat er noch ein paar Semmeln im Tiefkühler.
Er blickt die Gasse hoch. Noch hängen dunkle Wolken über den Silhouetten der Hochhäuser, noch kann es jederzeit wieder zu regnen beginnen.
Seitdem Oskar sein Haus nur noch mit seiner Gehhilfe verlassen kann (und dass er es nicht mehr ohne tun wird, hat er seiner Tochter Doris versprechen müssen), geht er nicht mehr gern vor die Tür. In seiner Wohngasse spielt es keine Rolle, dass er langsam ist, da kennt man ihn, aber oben, an der großen Straße, reagieren die Menschen selbst bei Sonnenschein ungeduldig und gereizt. Schlimm genug, dass sein Rollator die Hälfte des Gehsteigs einnimmt, aber wenn er jetzt auch noch den aufgespannten Schirm halten müsste, bei dem Wind … nein, das geht gar nicht.
Noch im Frühling hat Oskar beim Verlassen des Hauses nach seinen Wanderstöcken gegriffen. Richtig sportlich sah er mit ihnen aus, ganz und gar nicht nach altem Tattergreis, sondern nach einem, der noch regelmäßig Wandertouren unternimmt. Als wäre er auf dem Weg zum Bahnhof, um mit dem Wiesel-Zug ins Grüne zu fahren. Aber dann ging er auch mit den Stöcken immer unsicherer, musste immer häufiger stehen bleiben und sich an der Hausmauer abstützen. Es sind nicht nur die Knie, die ihn im Stich lassen, die von Woche zu Woche steifer und gleichzeitig weicher werden. In letzter Zeit überfällt ihn manchmal ein derart heftiger Schwindel, dass ihm ganz schwarz vor Augen wird. Und auch an guten Tagen tanzt im Sonnenlicht eine Unzahl grauer Schleierflecken vor seinen Augen.
»Keine Schleiereulen, sondern Schleierflecken«, versuchte er dem Augenarzt das Symptom zu beschreiben, worauf die-ser lachte und ihn bat, in den Apparat zu schauen. Doch mit seiner Netzhaut war alles in Ordnung, und auch der Sehtest ergab nichts Neues.
»Für Ihr Alter sehen Sie exzellent! Also doch eine Eule, Herr Zimmermann! Die schwimmenden Flecken müssen Ihnen keine Sorge bereiten, die sehen andere schon mit vierzig. Aber Ihr Schwindel gefällt mir nicht. Ich tippe auf den Kreislauf, Sie sollten das mit Ihrem Hausarzt abklären.«
Der Blutdruck, ach ja. An den hat er heute auch noch nicht gedacht.
Oskar öffnet die Schublade und nimmt zwei Medikamentenblister heraus. Eine Kapsel für den Blutdruck, eine fürs Hirn. Er steht auf und schenkt sich ein Glas Mineralwasser ein. Dann holt er noch einen Apfel aus dem Obstkorb. An apple a day keeps the doctor away!
Warum nennt man die Schleiereulen eigentlich Schleiereulen?, fragt er sich, als er sich mit dem Apfel an den Tisch setzt. Hat es bloß mit dem weißen Gesichtchen zu tun, oder war da noch mehr? Und wieso weiß er es nicht? Als Biologielehrer müsste er sich doch sicher sein! Oder hat er auch dieses Wissen verlegt? So, wie er seine Geldbörse in letzter Zeit manchmal an den seltsamsten Orten findet?
Eines jedoch weiß er gewiss: Die Eulen sehen bei völliger Dunkelheit ebenso wenig wie er. Das hat er auch zu seinen Schülern gesagt: »Das Märchen von der Eule, die selbst in schwärzester Nacht fliegt, beweist nur, dass man nicht alles glauben soll, was man liest.«
So unrecht hat er also nicht, sein Augenarzt. Wie die Eule sieht auch er nur, was in der Ferne geschieht. Beim Lesen hingegen tut er sich trotz der Brille schwer. Aus diesem Grund bringt ihm seine Enkeltochter jetzt alle paar Wochen ein neues Hörbuch mit, das sie aus der Bücherei ausleiht und für ihn auf CD brennt, damit er wegen der Rückgabefrist nicht unter Zeitdruck gerät. Und weil er nicht weiß, was er während des Hörens mit den Augen, die früher über die Buchstabenreihen gewandert sind, anfangen soll, blickt er eben aus dem Fenster, dorthin, wo sich etwas tut.
Auch jetzt betrachtet er die Fassade des gegenüberliegenden Wohnhauses. Seine einst eierschalene Farbe ist schmutzig, die aufgemalten Blumenranken auf den Trennwänden zwischen den Balkonen sind kaum noch zu erkennen, der grüne Lack der Balkongeländer beginnt bereits abzublättern, und das Blech auf dem Dach glitzert schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Sonne. Still und ein wenig erschöpft wirkt das Haus, wie ein müdes Tier, das geduldig auf dem Rasen Platz genommen hat, um darauf zu warten, dass seine Menschen nach Hause kommen.
Oskar wartet mit ihm. Er kennt sie alle. Weiß, wann wer das Haus verlässt und wiederkehrt, kennt die Motorengeräusche der Autos und das Klacken und Fiepen der Zentralverriegelungen, und wenn es draußen dunkel wird, kann er allein anhand der Art, wie die Klappe des Müllcontainers fällt, sagen, wer gerade seinen Abfall entsorgt hat.
Jetzt fragt er sich, was aus dem Haus werden wird, wenn er nicht mehr hier sitzt. Aber das ist natürlich Unsinn. Das Haus wird sich durch seinen Tod nicht verändern. Es wird weiterhin die Menschen verschlucken und die unverdaulichen Reste nach einer viel zu kurzen Zeit wieder ausscheiden, wie es das immer getan hat.
Oskar stemmt sich an der Tischplatte hoch, tritt zu dem Radio und zieht den Stecker. Dann setzt er sich wieder, öffnet die Lade und holt das linierte A5-Heft hervor, das unter den Medikamenten, Kugelschreibern, Servietten und Taschentüchern liegt. Dreiundfünfzig Namen hat er darin eingetragen. Es sind die Namen jener dreiundfünfzig Mieter und Eigentümer, die in den letzten fünfzehn Jahren, die das Haus nun schon vor seinem Fenster steht, ein- und ausgezogen sind. Jetzt wird bald ein neuer Name dazukommen. Vielleicht sogar zwei.
Kann es sein? Ein Baby? Ob die Frau mit dem Zopf die Wohnung genommen hat? Sie hat so zufrieden gewirkt. So lächelt niemand, der sich erneut auf die Suche machen muss.
Aber welche Mutter zieht in ein Haus wie das am Papaverweg 6? Da gibt es doch viel bessere Wohnungen. Wohnungen mit Lift, Wohnungen mit Kinderwagenabstellplätzen, Wohnungen mit bunten Schaukeln und Sandkisten im Innenhof.
6
Ein Haus an der Peripherie der Großstadt. Eine Gasse mit Einfamilienhäusern und Gartenzäunen, eine beschauliche Insel mitten im Plattenbautenmeer.
Seitdem die U-Bahn verlängert wurde, ist das Viertel näher an die Innenstadt herangerückt. Musste man früher noch im eisigen Wind an der Straßenbahnhaltestelle warten, ist man heute in fünfzehn Minuten im Herzen der Millionenstadt.
Das Haus mit nur zehn Parteien besticht durch seine zentrale und doch idyllische Lage. So hat Herbert Sucht die Anzeige, die er soeben gelöscht hat, formuliert.
Judith Brodkorb gehört zu den Schnellen, gleich nach dem Besichtigungstermin hat sie das verbindliche Mietanbot unterzeichnet. Bestimmt sieht sie sich schon mit dem Kinderwagen die dörflich anmutende Gasse entlangspazieren, und nächsten Herbst werden sie und der kleine Bub Kastanien sammeln.
»Brodkorb, was für ein bescheuerter Name!«, lacht Herbert.
In zwei Wochen wird er an der Gegensprechanlage und auf den Postkästen zu finden sein. In die Wohnung mit der Nummer 10 kommt wieder Leben, und das ist gut so.
Herbert fragt sich, wie lange ihn das Haus diesmal in Ruhe lassen wird. Richtig gegruselt hat es ihn, als er vor drei Monaten das Mail von Ilse Reiter in seinem Posteingang vorgefunden hat. Ganz kurz hat er sogar überlegt, abzulehnen. (Lassen Sie mich mit Ihrem verfluchten Haus in Ruh!) Andererseits darf er sich nicht beschweren. Die Wohnungen am Papaverweg 6 gehören zwar nicht zu den lukrativen Objekten, aber steter Tropfen höhlt bekanntlich auch den Stein. Drei Monatsmieten Provision sind nicht nichts, und bis jetzt hat er die Wohnungen stets ohne großen Aufwand an den Mann gebracht – oder an die Frau, ob mit oder ohne Kind. Die Menschen müssen nur in die kleine, dörfliche Gasse einbiegen, schon sind sie entzückt. Und dass die meisten von ihnen selten länger als das verpflichtende Jahr plus die drei Monate Kündigungsfrist bleiben, ist schließlich auch kein Nachteil für ihn.
Diesmal jedoch war alles wie verhext. Dabei sind laut Mirko alle, die Top 10 besichtigt haben, ganz begeistert gewesen. Kein Wunder, die Wohnungen im Dachgeschoß sind die schönsten im Haus. Wenn er Mirko glauben kann (und warum sollte er lügen?), haben bei den Besichtigungen alle so getan, als könnte es ihnen gar nicht schnell genug gehen mit dem Unterschreiben des Mietvertrags. Aber jedes Mal, wenn Herbert einem der Interessenten ein verbindliches Mietanbot zukommen ließ, sprang dieser sofort wieder ab. Einer schrieb, dass er es sich anders überlegt hätte, ein anderer meinte, er habe noch einen zweiten, anschließenden Besichtigungstermin gehabt und sich für die andere Wohnung entschieden (und das in nur vierzig Minuten!), und die nette Frau mit den dicken Brillengläsern, die Mirko so sympathisch gewesen war, antwortete weder auf Herberts erstes Mail noch auf sein zweites, in dem er sich erkundigte, ob das Mietanbot bei ihr angekommen sei.
»Hast du dich verplappert?«, fragte er Mirko, aber der schüttelte empört den Kopf. »Für wie blöd hältst du mich denn?«
Für sehr blöd, dachte Herbert, doch er sprach es nicht aus, lieber nahm er die Sache selbst in die Hand. Und jetzt ist er sie ja auch los, die Wohnung mit der Nummer 10.
Vielleicht hat Mirko wirklich nur Pech gehabt. Zwar ist er nicht der Hellste, denkt Herbert, aber er hat ein gutes Gespür für die Menschen. Besonders für die kleinen Leute. Mirko ist die Geduld in Person. Mirko lässt sich Zeit, selbst wenn es sich um das billigste Loch handelt. Stets steht er mit seinem Mäppchen in der Mitte des Raums, lässt die Kunden Schubladen herausziehen, Balkontüren öffnen und wieder schließen, nickt auffordernd und beantwortet jede noch so dumme Frage mit einem freundlichen Lächeln.
Herbert selbst kann das nicht. Vor allem nicht bei diesen verwöhnten Studenten und frischverliebten Pärchen, die alle so tun, als wären sie weiß Gott wer, nur weil sie jung und hip sind (oder glauben es zu sein). Am schlimmsten jedoch sind Öko-Mütter mit bunten Tüchern. Dieses entsetzliche Dauergrinsen! Als müsste die ganze Welt das Leben ihres Kindes feiern. Entweder tragen sie ihr Baby im Tuch, oder aber sie haben das Tuch wie einen Rock um ihre Jeans gebunden und lassen ihre Kleinkinder die frisch gestrichenen Wände mit Maisbällchenresten und Rotz beschmieren. Und immer die Erwartung, dass er sich onkelhaft hinunterbeugt und säuselt: »Na, wer bist denn du?«
Und dann kommen ihre Fragen:
»Ist das Fenster kindersicher?«
»Sind die Kanten in der Küche nicht gefährlich?«
»Haben die Steckdosen einen Kinderschutz?«
»Darf man im Gemeinschaftsgarten ein Planschbecken aufstellen?«
»Gibt es in diesem Haus denn gar keinen Kinderwagenabstellraum?«
Mirko bleibt ruhig. Mirko nickt verständnisvoll mit dem Kopf, streichelt den Kleinen über das verschwitzte Haar und fragt, ob sie sich schon ihr Kinderzimmer angeschaut hätten. (»Was? Das hast du noch gar nicht gesehen?«) Und schon nimmt er sie bei der Hand. (»Soll ich es dir zeigen?«)
Erklär einmal einem Vierjährigen, der bereits seine Modelleisenbahn (die er gar nicht besitzt) durchs Zimmer zischen gesehen hat, dass die Wohnung vielleicht doch eine Spur zu klein, zu warm, zu kalt, zu dunkel oder zu grasgrün ausgemalt ist.
Nein. Das muss er Mirko lassen. Mit Kindern kennt er sich aus. Und heute entscheiden nun einmal zu einem großen Teil die Kinder. Deswegen hat er sich ja so geschreckt, als er, kurz nachdem es an der Gegensprechanlage von Top 10 geläutet hatte, den Kindersitz in dem kleinen Renault entdeckt hat. Und tatsächlich. Sobald er die Tür geöffnet und der Frau die Hand zum Gruß hingehalten hatte, ist auch schon ihre Frage gekommen: »Es wird hier doch keine Probleme geben, wenn ich mit meinem vier Monate alten Sohn einziehe?«
»Probleme?«, hat er den Überraschten gespielt. »Wie kommen Sie denn auf die Idee? Eine ruhigere Gasse wie diese werden Sie in ganz Wien nicht finden! Hier können Sie den jungen Mann mit seinem Dreirad herumfahren lassen, ohne Angst haben müssen!«
Judith Brodkorb hat ihn freudestrahlend angegrinst. Wie gut, dass sie ihren Sohn nicht mitgenommen hat. Er braucht sich einem Kind nur zuzuwenden, schon fängt es zu plärren an. Als gingen von seinen Augen bedrohliche Strahlen aus, die nur Kinder sehen können.
Herbert Sucht schüttelt sich, überfliegt das unterschriebene Mietanbot und überträgt die Daten in den Computer.
Name: Mag. Judith Brodkorb.
Geburtsdatum: 6. Juli 1990.
Beruf: Universitätsassistentin in Karenz.
Alleinerzieherin, notiert er in Klammern.
Solche Notizen können einmal wichtig sein, immerhin verlässt sich die Reiter auf ihn.
»Und die Leute hier?«, hat ihn die Brodkorb aus ihren großen, unschuldigen Rehaugen angeschaut. »Die sind doch hoffentlich nett?«
Also hat er sich ein breites Schaukelpferdgrinsen ins Gesicht gezaubert (fast so eines, wie Mirko es bei den Besichtigungen trägt) und in euphorischem Tonfall geäußert: »Sie werden sehen, Frau Brodkorb, hier gibt es noch so etwas wie echte Nachbarschaft!«
7
Wer aber sind die Bewohner des Hauses mit der Nummer 6?
Beginnen wir im Erdgeschoß. Gleich neben dem Treppenaufgang in Top 1 befindet sich das achtzig Quadratmeter große Reich der Ilse Reiter. Ihr gehören acht der insgesamt zehn Wohnungen. Daneben, in Top 2, lebt Hamed El Sayed. Zu Hameds Glück ist Frau Reiter nicht oft zu Hause, Hamed kann seine Vermieterin nämlich nicht leiden. Obwohl, das stimmt nicht so ganz, eher sollte man vielleicht sagen, dass Frau Reiter ihren ägyptischen Mieter nicht ausstehen kann, weswegen dieser ihr aus dem Weg geht, ganz nach dem Motto: »Der Klügere gibt nach«.
Manchmal fragt sich Hamed, wieso Frau Reiter ausgerechnet eine der großen Wohnungen für sich behalten hat. Angeblich lebt sie in einem riesigen Haus im steirischen Eibiswald, kommt nur hierher, wenn es »etwas zum Kümmern« gibt. Wieso vermietet sie nicht die große Wohnung und behält eine der kleinen, die immerhin auch alle vierzig Quadratmeter messen, für sich? (Oder ist sie gar nicht so verschlagen und geldgierig, wie Frau Neuhold behauptet?)
Ute Neuhold und ihr Mann Horst wohnen in Top 3, Schlafzimmer an Schlafzimmer mit Hamed. Die beiden Pensionisten sind neben Frau Reiter und dem schweigsamen Jugendarbeiter im ersten Stock die einzigen Eigentümer im Haus. Aber auch die Neuholds sind oft monatelang nicht zu Hause. Seitdem Ute und Horst in Pension sind, packen sie alle halben Jahre ihre Koffer. In der Zeit, in der sie hier sind, erzählen sie allen, die es hören wollen (und auch jenen, die es nicht hören wollen) von ihren Abenteuern. Wer immer sich auf mehr als nur ein schnelles Schwätzchen am Gang einlässt, muss sich auf ihr Sofa setzen und an die Wand projizierte Bilder anschauen – unendlich viele Bilder von Wiesen und Flüssen und Bergen, von bunten Saris, Blumenmärkten, buddhistischen Tempeln und geschmückten Elefanten, von roten Häusern am Rande riesiger Tannenwälder, speienden Geysiren und weiten, weißen Eiswüsten –, denn die Neuholds lieben das Außergewöhnliche, weswegen ihnen das Königreich Bhutan näher ist als die steirische Toskana, der brasilianische Urwald bekannter als die Hügel der Weststeiermark und das lebendige Hongkong tausendmal lieber als das langweilige Eibiswald der Ilse Reiter.
»In Eibiswald ist’s uns zu kalt!«, beliebt Frau Neuhold zu scherzen, dabei ist auch der Himalaya nicht warm, von Spitzbergen ganz zu schweigen.
Seit Susa und Tom nicht mehr hier wohnen, ist es Hamed, der auf dem Sofa der Neuholds Platz nimmt. Zuerst drückt ihm Ute den Wohnungsschlüssel in die Hand und erklärt, wie viel Wasser die Leuchterblume am Fensterbrett bekommt und wie viel Dünger die Glücksfeder neben dem Stereoturm benötigt, danach werden der Beamer und die Leinwand aufgestellt. Vor einer Woche war es wieder so weit. Hamed hörte sich die Anweisungen an und nickte eifrig mit dem Kopf. Danach bekam er sämtliche Fotos aller vergangenen Reisen zu sehen. Während des Schauens blinzelte er, streckte das linke Bein aus, stopfte sich den Polster in den Rücken, und obwohl ihm die Lendenwirbelsäule und auch die Hüfte wehtaten, obwohl er schon gar nicht mehr wusste, wie er auf dem viel zu weichen und niedrigen Sofa der Neuholds noch sitzen sollte, lächelte er tapfer, als Horst ihn fragte, ob er noch Zeit für die peruanische Hochebene habe, und gab zur Antwort: »Oh ja, ich kann genug nicht kriegen von eure schöne Fotos!«
Als er zurück in seine Wohnung kam, drehte er ein paar Runden durch die Wohnküche, absolvierte seine Turnübungen, putzte sich die Zähne und stellte sich die Frage, wie es kommt, dass die einen durch die Welt tingeln und Robbenfleisch verspeisen, während die anderen mit einer Chipstüte vor dem Fernseher sitzen und sich Sendungen wie Universum ansehen, und das, obwohl sie genügend Geld angespart, keine Schmerzen, keine Lähmungserscheinungen und auch keinen Tumor im Kopf haben.
Würde er selbst reisen, wenn er genügend Geld hätte und gesund wäre? Aber was soll er schon in Spitzbergen, in Singapur oder im Königreich Bhutan? Was soll er in Südafrika, im australischen Outback oder in Peru? Es reizt ihn doch nicht einmal, in ein Flugzeug zu steigen, um nach Ägypten zu fliegen. Selbst bei seiner Schwester Hebba in München ist er seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gewesen.
Drei Tage nach dem gemeinsamen Abend stiegen die Neuholds mit ihren Koffern und der Kameratasche in ein Taxi. Seitdem ist Hamed wieder ganz allein im Erdgeschoß.
Steigen wir hinauf in den ersten Stock.
Ganz hinten, in der Wohnung mit der Nummer 7 (direkt über den Neuholds) wohnt Peter Lindner – jener Mieter, der so gern und lange schläft. Auch sonst ist er sehr still, fast könnte man glauben, dass er sich vor den Menschen fürchtet oder sie einfach nicht mag. (Beides jedoch wollen wir von einem Jugendarbeiter nicht annehmen.) Jedes Mal, bevor Peter seine Wohnung verlässt, blinzelt er durch den Spion und horcht eine Weile nach, ob er auf dem Gang Geräusche vernehmen kann. Hört er etwas, lässt er sich Zeit, dann tritt er von einem Bein aufs andere, bindet sich die Schuhbänder neu, bohrt in der Nase oder steht einfach nur da. Erst wenn es draußen wieder mucksmäuschenstill ist, schleicht er auf Zehenspitzen durchs Stiegenhaus, schlüpft aus dem Haus und geht schließlich, mit gesenktem Blick, die Gasse hinauf.
Neben der Wohnung des scheuen Peter Lindner befindet sich die Wohnung mit der Nummer 6. Seit drei Monaten wohnt in ihr eine Frau namens Muggi Klein. (So zumindest steht es auf dem Türschild). Ein einziges Mal hat Peter eine Frau in die Wohnung gehen gesehen. Sie war etwa fünfundvierzig Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte hennarotes, schulterlanges Lockenhaar sowie eine etwas zu männlich geratene griechische Nase (wie Peter fand). Seitdem ist noch kein einziges Geräusch durch die papierdünnen Wände gedrungen. Keine Fernsehdialoge, keine Radiomusik, kein Weckerrasseln. Auch fällt Peter auf, dass die Rollos der Klein stets zu drei Vierteln heruntergelassen sind.
Warum mietet jemand eine Wohnung, schreibt seinen Namen auf das Türschild und ist dann nie da? Und wieso steckt seit acht Tagen ein Schreiben des Gerichtsvollziehers zwischen Türstock und Tür? Seitdem Peter den Zettel entdeckt hat (der jedoch nicht an eine Muggi, sondern an eine Muriel gerichtet ist), denkt er vor dem Einschlafen über seine mysteriöse Nachbarin nach. Von geheimen Drogendepots im Spülkasten bis hin zu ominösen Scheinfirmen und Identitätsraub reichen seine Theorien.
Dass auch die Wohnung mit der Nummer 5 leer steht, hat (zumindest Peters Ansicht nach) einen durchaus menschlichen Grund. Jürgen Zelechowski ist Nationalratsabgeordneter. Dass er in Scheidung lebe, ließ er Peter kurz nach seinem Einzug im März wissen, dass die Wohnung für ihn eine Übergangslösung sei, bis er etwas Besseres, Größeres, Ruhigeres gefunden habe. Davor jedoch wollte er es offensichtlich doch ein bisschen lauter und lebendiger haben, weswegen alle paar Tage ein anderes Frauenauto am Zaun gegenüber hielt. Aus den Autos stiegen stets ähnlich aussehende, schlanke Frauen in Businesskostümen, die man bis weit nach Mitternacht lachen und (wenn man besonders gut lauschte) auch stöhnen hörte. Tags darauf stiegen die Frauen wieder in ihre Autos, um den Papaverweg für immer zu verlassen. Manche schluchzten dabei leise in sich hinein, andere wirkten erleichtert, und wieder andere taten so, als würden sie nur ein bisschen durch die Gegend fahren und gleich wieder zurückkommen.
Anfang Juni blieb der Platz am Zaun wieder leer, und ein paar Wochen darauf stand auch der Wagen des Abgeordneten nicht mehr auf dem Parkplatz mit der Nummer 5. Nicht etwa, weil Zelechowski eine größere (schönere, hellere, leisere) Wohnung gefunden hat, sondern weil er und seine Frau sich wieder versöhnt haben. (Wie er Peter eines schönen Julitages wissen ließ, ohne dass dieser danach gefragt hatte. Aus irgendeinem Grund schaffte es der Politiker stets, seine Tür ausgerechnet in jenem Augenblick zu öffnen, in dem Peter an ihr vorüberschlich.)
Durch die Versöhnung der Eheleute steht die Wohnung mit der Nummer 5 nun schon seit einigen Wochen leer, und das wird sie noch weitere neun Monate tun. So lange dauert es nämlich, bis das verpflichtende erste Jahr plus die dreimonatige Kündigungsfrist (wie im Mietvertrag vorgesehen) verstrichen sind. In diesem Punkt ist Ilse Reiter sehr streng, schließlich ist ihr Haus kein Taubenschlag!
Fehlt noch die vorderste Wohnung im ersten Stock, jene mit der Nummer 4. In ihr wohnt seit knapp vier Jahren Alice Winter – ein zierliches, etwas zu blasses Geschöpf mit dunkelblonden Haaren (kurzer Pony und Pferdeschwanz), das, sobald es draußen ein wenig kühler wird, einen dicken Schal um den Hals trägt. Im Moment jedoch ist Alice nicht zu Hause. Gerade eben sitzt sie mit ihrer besten Freundin Claudia in einem Bistro nahe des Museumsquartiers und trinkt Chai Latte. Obwohl sich die beiden Frauen viel zu erzählen haben (immerhin sehen sie einander nur noch selten, seit Claudia in Holland lebt), wird Alice an diesem Nachmittag nicht lange bleiben können, denn heute ist Freitag. Jeden Freitag pünktlich um siebzehn Uhr fünfzig holt sie die nicht verkaufte Ware vom Biosupermarkt ab, um sie vor der Mülltonne zu retten. Aber dazu später.
Steigen wir noch in das Dachgeschoß. In die Wohnung mit der Nummer 10 (die sich direkt über der Wohnung von Peter Lindner befindet) wird bald Judith Brodkorb mit ihrem Sohn ziehen. Noch weiß niemand von den beiden, in zwei Wochen jedoch wird man sie nicht überhören können.
In der mittleren Dachgeschoßwohnung wohnt seit etwas mehr als einem Jahr Martin Engelmayr mit seiner Freundin Gudrun Sachs und deren fünfzehnjähriger Tochter Leonie.
Martin Engelmayr ist Anfang dreißig. Mit seinen langen, rotblonden Haaren, die er meist oben am Kopf zum Dutt zusammengebunden trägt, dem ebenso rotblonden Bart, den Tattoos auf seinen Oberarmen und dem protzigen Geländewagen auf dem Parkplatz ist er nicht gerade ein Sympathieträger. Zumal er oft stundenlang auf seinem Balkon steht und raucht. »Bestimmt ein arbeitsloser Schmarotzer!«, heißt es am Papaverweg, wo die Gerüchte schneller von einem Gartentor zum anderen flitzen als der chinesische Bub vom Nachbarhaus auf seinem Skateboard.
Anders als Martin Engelmayr ist seine Freundin Gudrun Sachs eine absolut unscheinbare Frau (sieht man von dem Umstand ab, dass sie acht Jahre älter ist als ihr Lebensgefährte). Nicht dick, nicht dünn, nicht groß, nicht klein, keine Piercings, keine Tattoos. Ihre Kleidung ist dezent, ihr kinnlanger Haarschnitt ebenfalls. Und auch ihre Tochter Leonie (zart, hellbraunes Haar) sieht aus, als könnte sie kein Wässerchen trüben.
Ganz vorne im Dachgeschoß liegt die Wohnung mit der Nummer 8. Azra und Emir Bosić sind gleich nach Fertigstellung des Hauses eingezogen. Oskar, der das Ehepaar seit beinahe fünfzehn Jahren an seinem Fenster vorübergehen sieht, schätzt die beiden auf Anfang fünfzig. Da die Bosićs zur Zeit ihres Einzugs an die fünfunddreißig gewesen sein müssen und Oskar noch nie Kinder gesehen hat, nimmt er an, dass es keine gibt. Die beiden Eheleute jedoch sind wie zwei ineinander verschränkte Glieder einer Kette. Wenn Herr Bosić auf den Balkon tritt, um eine Zigarette zu rauchen, stellt sich seine Frau dazu, und wenn sie die Blumen gießt, tritt er auf den Balkon und zündet sich eine an. Auch zum Einkaufen gehen die beiden stets zu zweit, dann trägt er den schwarzen Stoffsack, während sie sich die Henkel der geblümten Plastiktasche über die rechte Schulter legt. An den Sonntagnachmittagen gehen die Bosićs spazieren. Dann kommen sie, wie sie gehen: Hand in Hand, mit zum Horizont gerichteten Augen.
Was für eine schöne »Zweinsamkeit«, denkt Oskar manchmal, wenn er die beiden an seinem Fenster vorübergehen sieht.
8
»Siehst du die Tussi dort drüben?«
Seit zwei Tagen trägt Fanny ihr rosa gefärbtes Haar in Rastazöpfen. Peter weiß, dass die Fünfzehnjährige gern Gangsta-Rapperin wäre, aber Fanny ist zu schüchtern, niemals wird sie sich auf eine Bühne trauen. Dabei ist sie durchaus talentiert, ihre Texte sind rhythmisch fein gearbeitet, und zu sagen hat sie auch etwas.
Sie stehen ein paar Meter vom Jugendzentrum entfernt. Fanny raucht, und Peter raucht passiv mit, weil Fanny ihn darum gebeten hat. Manchmal will sie mit ihm reden, über ihre Mutter und ihren Stiefvater und deren Erwartungshaltungen, die sie nicht erfüllen kann. Über die Schule und ihre Klassenkameraden, von denen niemand so denkt wie sie. Über Probleme kann Fanny nur reden, wenn sie raucht. (Wozu soll Peter es ihr verbieten? Damit sie es hinter seinem Rücken tut und allein vor sich hin grübelt?)
»Welche Tussi?«, fragt er und blickt in die Richtung, die Fanny mit einem leichten Nicken vorgegeben hat. Er sieht keine Tussi, stattdessen entdeckt er auf der anderen Straßenseite das zarte Mädchen aus dem Dachgeschoß.
»Mannomann, bist du blind, oder was?«, stöhnt Fanny und verdreht die Augen. »Das Elfchen dort drüben mit den langen braunen Haaren!«
»Die gerade hinter dem roten Daihatsu hervorkommt?«
»Siehst du eine andere?«
»Nein.«
»Eben. Das ist eine von den Gelatinis.«
»Von den Gelatinis? Echt? Die sieht gar nicht so aus.«
»Die sehen alle nicht so aus! Das ist ja das Ätzende. Lauter süße Mädchen, die kein Wässerchen trüben können. Die Lehrer lieben sie heiß, also dürfen sie machen, was sie wollen.«
Fanny hat ihm schon einmal von den Gelatinis erzählt. Bei der Clique handelt es sich um eine Art Mädchenmafiabande, deren Treiben darin besteht, alle, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen, in den sozialen Medien zu verunglimpfen. Immer schön so, dass es gerade noch legal ist und trotzdem wehtut. Mit den Lehrern zu sprechen sei – laut Fanny – zwecklos, denn die vier Mädchen haben gute Noten und sind beim Lehrpersonal beliebt.
»Und wie heißt das Mädchen?«, fragt Peter.
»Die?« Fanny drückt die Kippe mit der Schuhspitze aus und hebt sie hoch, um sie zum Mistkübel zu tragen.
»Leonie.«
Leonie? Heißt die Kleine aus dem Dachgeschoß Leonie?
»Und die anderen?«, fragt er.
»Wie, die anderen?«
»Na, die anderen Gelatinis. Die haben ja hoffentlich Namen. Angela! Livia! Rosalinda! Vincenza!«
Fanny lacht.
»Tabea, Rebecca und Pamina.«
Na bitte!
»Pamina? Wie in der Zauberflöte?«
»Keine Ahnung. Die Pamina, die ich meine, heißt so. Gehen wir wieder rein?«
Peter nickt. »Aber die Zauberflöte sagt dir schon etwas, oder?«, fragt er, als er die Glastür aufstößt und für Fanny offen hält.
»Dieses altmodische Kindermusical von diesem Mozart?«
Fanny, Fanny! Was die für Ideen hat. Obwohl: Peter kann die Zauberflöte auch nicht hören. Zwar kann er mit Rapmusik noch weniger anfangen, aber dieses »Heissa Hopsassa« treibt ihn regelrecht in den Wahnsinn.
»Kindermusical!« Er lacht. »Vielleicht solltest du die Werbung für die Staatsoper übernehmen, ein Musical verkauft sich bestimmt besser als eine Oper! Nur das ›altmodisch‹ würde ich streichen.«
»Ha, ha! Sehr witzig!«
»Nein, Fanny, gar nicht witzig. Die Werbebranche könnte wirklich was sein für dich. Überleg dir das mal!«
Sie bleibt stehen und funkelt ihn an. »Ich und Werbung? Träum weiter! Mit meinem Zeugnis kann ich Klofrau werden!«