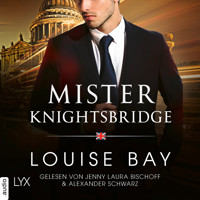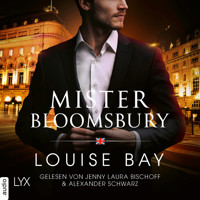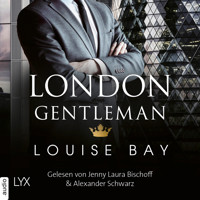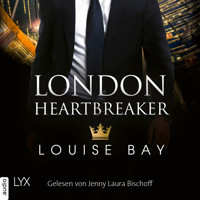9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: New York Royals
- Sprache: Deutsch
Er ist der Prinz der Park Avenue - doch sie regiert sein Herz!
Sam Shaw hat für seinen Erfolg hart gearbeitet und sich aus dem Nichts ein millionenschweres Vermögen aufgebaut - weshalb er noch nie Zeit für Beziehungen hatte. Auch als er die Galeriebesitzerin Grace Astor kennenlernt, scheinen die Spielregeln klar: eine Nacht, nicht mehr. Egal wie sehr sie ihm unter die Haut geht. Doch als Grace mitten in der Nacht Sams Wohnung ohne ein weiteres Wort verlässt und sich nicht mehr meldet, ist sein Ehrgeiz geweckt. Er will der hübschen Prinzessin von Manhattan beweisen, wer in den Schlafzimmern der Park Avenue den Ton angibt - auch wenn er dabei riskieren muss, sein Herz zu verlieren.
"Heiße Liebesszenen und wunderbare Charaktere: Park Avenue Prince ist zum Niederknien romantisch!" USA Today
Band 2 der sinnlich-heißen Kings-of-New-York-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Louise Bay
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Epilog
Dank
Die Autorin
Die Romane von Louise Bay bei LYX
Impressum
LOUISE BAY
Park Avenue Prince
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anja Mehrmann
Zu diesem Buch
Selfmade-Millionär Sam Shaw hatte keinen leichten Start ins Leben. Nach dem Tod seiner Eltern im Kinderheim aufgewachsen, musste er sich seinen Erfolg hart erarbeiten. Doch als er den Schlüssel zu seinem luxuriösen Penthouse auf der Park Avenue in der Hand hält, weiß er, dass er endlich erreicht hat, wovon er immer geträumt hat. Dass seine Karriere ihm noch nie Zeit für Beziehungen gelassen hat, stört ihn wenig. Schließlich liegen ihm die Frauen von New York zu Füßen. Und auch als er eines Abends die Galeriebesitzerin Grace Astor kennenlernt, scheinen die Spielregeln klar zu sein: Eine Nacht, keine Versprechen, egal, wie stark die Anziehungskraft zueinander ist, egal wie leidenschaftlich und echt sich die Gefühle zwischen ihnen anfühlen. Doch als Grace seine Wohnung mitten in der Nacht und ohne ein weiteres Wort verlässt, gerät Sams Vorsatz gehörig ins Wanken. Klug, ambitioniert und anscheinend völlig unbeeindruckt von seinem Erfolg, ist Grace so ganz anders als all die Frauen zuvor. Zum ersten Mal will Sam mehr als nur eine unverbindliche Nacht, und sein Ehrgeiz ist geweckt. Sam schwört, der hübschen Prinzessin von Manhattan zu beweisen, wer in den Schlafzimmern der Park Avenue den Ton angibt – auch wenn er dafür seinen wertvollsten Besitz einsetzen muss: sein Herz!
1. KAPITEL
SAM
»Meine Güte, Sam, so riesig!«, rief Angie und betrat den leeren Wohnraum mit der hohen Decke, von dem aus der Central Park und die City zu sehen waren. Die Sonne schien so grell, dass ich meine Augen abschirmen musste, als ich aus dem Fenster auf die West Side blickte. Ich atmete tief durch und ließ die Umgebung auf mich wirken. Gehörte mir diese Wohnung tatsächlich? Ich wusste, dass meine Unterschrift unter dem Kaufvertrag stand, aber manchmal hatte ich das Gefühl, das Leben eines anderen Menschen zu führen.
»Das sagen sie alle«, antwortete ich und lachte in mich hinein. Wie die meisten Männer hatte auch ich noch immer den pubertären Humor eines Fünfzehnjährigen. Aber nach ebenfalls fünfzehnjähriger Freundschaft erwartete Angie vermutlich nichts anderes von mir.
»Du bist ein Ferkel. Hier geht es nicht um deinen Schwanz, um es mal ganz deutlich zu sagen.«
»Wer redet denn von dem?«, fragte ich und breitete die Arme aus. »Ich spreche von dieser Wohnung. Du und deine schmutzige Fantasie!«
Angie schüttelte den Kopf, aber es ließ sich nicht leugnen, dass die Wohnung, die ich gerade gekauft hatte, wirklich groß war. Sechshundertachtzig Quadratmeter auf der Upper East Side, und dort lebte ich jetzt. »Die Aussicht sorgt dafür, dass die Bude ihren Wert behält«, sagte ich und ließ den Blick über die Skyline von Manhattan schweifen.
»Dafür sorgt allein die Lage. Das hier ist die Park Avenue 740, Sam.« Ungläubig schüttelte sie den Kopf. Ich konnte es ihr nicht verdenken.
Auf diese Adresse legte ich Wert. Den Wohnungsannoncen zufolge gehörte sie zu den begehrtesten in New York, sodass ich mit dem Kauf eines der sichersten Immobiliengeschäfte getätigt hatte, die in den Staaten nur möglich waren. Es war ein Sieg für mich persönlich und gleichzeitig eine gute Art, mein Geld – oder zumindest einen Teil davon – anzulegen.
»Hast du eigentlich manchmal das Gefühl, dass das hier gar nicht dein Leben ist?«
»Ja, manchmal schon.« Jeden einzelnen Dollar für diese Wohnung hatte ich innerhalb der letzten zehn Jahre selbst verdient. Nach dem Abschluss der Highschool hatte ich das Kinderheim verlassen, in dem ich zuvor sechs Jahre lang gelebt und nur zwei Jeans, zwei T-Shirts, ein Sweatshirt und etwas Unterwäsche besessen hatte. Für mich war es eine Befreiung gewesen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und neu anzufangen. Angie war der einzige Mensch aus dieser Zeit, mit dem ich noch in Kontakt stand. Wir hatten uns an meinem ersten Tag in der neuen Schule kennengelernt, nachdem ich zuvor in das Heim gezogen war. Sie wohnte im Mädchenheim ganz in der Nähe und hatte offenbar sofort erkannt, dass auch ich eine Waise war. Seitdem waren wir eng befreundet.
Fünfzehn Jahre lang hatte ich es nicht geschafft, sie wieder loszuwerden. Meine Startbedingungen ins Leben waren schlecht gewesen. Jetzt aber stand ich hier in meiner Wohnung in der Park Avenue und überblickte die gesamte City. Sogar in Zeiten, in denen ich nicht gewusst hatte, woher ich meine nächste Mahlzeit bekommen sollte, war ich mir immer sicher gewesen, dass alles besser werden würde, sobald ich selbst die Kontrolle über mein Leben übernehmen konnte.
Und so war es tatsächlich gekommen.
»Denkst du an Hightimes?«, fragte Angie.
Ich schob die Hände in die Hosentaschen. »Ja, natürlich.« Nichts konnte weiter von der Park Avenue entfernt sein als das Kinderheim, in dem ich den letzten Teil meiner Kindheit verbracht hatte. Und in diesem Heim hatte ich den Tatendrang und die Entschlossenheit entwickelt, die mich dorthin gebracht hatten, wo ich jetzt war.
Knapp zehn Jahre zuvor hatte ich an einem Freitag die Highschool beendet und am Samstagmorgen einen Job in einem Sportgeschäft angetreten – derselbe Tag, an dem ich aus Hightimes aus- und in eine rattenverseuchte Einzimmerwohnung in New Jersey eingezogen war. Ich hatte zwar nie das College besucht, aber in meinen Augen war dieser Tag genauso viel wert wie ein Abschluss.
»Wie viele Schlafzimmer?«, fragte Angie, als ich ihr durch die Wohnung folgte. Die Zimmer waren kahl, aber die alten Stuckleisten, der Mix aus lackiertem Hartholz und nagelneuem Marmor ließen sie trotzdem irgendwie warm wirken. Der Makler hatte mich immer wieder auf die originellen Details und die hochwertige Ausstattung hingewiesen. Aber letzten Endes hatten die Kacheln in der Hauptküche bewirkt, dass ich Ja gesagt hatte. Sie erinnerten mich an meine Mutter – sie hatte für ihr Leben gern gebacken, und dabei durfte ich immer auf der Theke neben ihr sitzen, ihr die Küchenutensilien reichen und von den Erdnussbutterplätzchen und den Karottenkuchenstücken naschen, die sie mir gab. Am liebsten mochte ich ihr Brot – noch heute sehe ich das Lächeln meiner Mutter vor meinem inneren Auge, sobald ich eine Bäckerei betrete.
»Fünf. Und zwei Küchen. Sag mal, wozu braucht man eigentlich zweiKüchen?«
»Eine ist fürs Personal«, antwortete Angie. »Na komm, gehen wir weiter. In dieser Wohnung wirst du Leute brauchen, die dir helfen.«
Ich schnaubte. »Mach dich nicht lächerlich.« Warum sollte ich jemanden dafür bezahlen, dass er für mich kochte, wenn ich selbst die besten Erdnussbutter-Gelee-Sandwiches im ganzen Staat New York machen konnte?
»Jetzt, wo du hier wohnst, kannst du nicht immer nur Sandwiches mit Erdnussbutter und Gelee essen.«
Ich grinste, denn es amüsierte mich, wie leicht Angie meine Gedanken lesen konnte. »Wieso, ist das verboten? Ich mag sie eben.«
»Wie kannst du die noch mögen? Du hast zwei Jahre lang nichts anderes gegessen.«
Nachdem ich zu arbeiten begonnen hatte, sparte ich jeden Penny, den ich verdiente. Ich fing an, in den Stunden, die ich nicht im Laden verbrachte, alles Mögliche zu verkaufen, von billigen, imitierten Turnschuhen bis zu Ersatzteilen für Elektrogeräte. Dann war ich zu Immobilien übergegangen. Dass ich mir alles kaufen konnte, bedeutete nicht, dass ich es auch tun würde. Soweit es mich betraf, fand ich es sinnlos, Geld in etwas zu stecken, bei dem nicht am Ende noch mehr Geld herauskam. Also würde ich keine Mitarbeiter einstellen. Und keine Miete mehr zahlen.
Mir dafür aber Erdnussbutter und Gelee kaufen, so viel ich wollte.
»Jetzt hast du ein Zuhause. Alles kann ganz anders werden«, sagte Angie.
Ein Zuhause. Bilder meines Kinderzimmers – bevor meine Eltern gestorben waren – blitzten vor meinem geistigen Auge auf. Es war das letzte Mal gewesen, dass ich den Ort, an dem ich schlief, als mein Zuhause empfunden hatte. Ich drehte mich um und wurde mir all des Platzes um mich herum bewusst. Würde ich mich hier jemals zu Hause fühlen?
Angie fuhr mit den Händen über die creme- und goldfarben tapezierte Wand gegenüber der Fensterfront. »Sogar diese Tapete fühlt sich an, als hätte sie eine Million Dollar gekostet. Du wirst verdammt viel Geld ausgeben müssen. Ich glaube, die ganzen Teile von Ikea würden in dieser Wohnung ziemlich seltsam aussehen. Ich wüsste nicht mal, wo ich Sachen für so eine Bude kaufen sollte.« Sie breitete die Arme aus und drehte sich um die eigene Achse. »Was willst du hier nur für Möbel reinstellen?«
»Meine Couch wird morgen geliefert. Und ich habe eine Matratze und ein bisschen Zeug für die Küche bei Ikea gekauft. Das reicht.«
Ich sah Angie fragend an, denn sie sagte kein Wort. »Diese ätzende Couch, die du vor hundert Jahren bei Craigslist gekauft hast?«, fragte sie schließlich und starrte mich ungläubig an. »Die willst du mitnehmen?«
»Na ja, dein Mann wollte mir nicht helfen, also nein, ich nehme sie nicht mit. Ich lasse sie mir morgen früh liefern.«
»Unglaublich«, sagte Angie und hob die Hände.
»Was denn?« Ich spürte zwar, dass sie kurz vorm Ausrasten war, wusste aber nicht, warum.
»Diese Wohnung muss dich zehn Millionen Dollar gekostet haben.«
Ich hatte tatsächlich einen achtstelligen Betrag gezahlt, aber das verriet ich ihr nicht, weil sie mich sonst für einen Vollidioten gehalten hätte.
»Und dann kaufst du dir ein Ikea-Bett und lässt dir ein fünfzig Jahre altes Craigslist-Sofa liefern? Was zum Teufel ist nur los mit dir?«
Angie lag mir ständig in den Ohren, ich solle meinen Wohlstand genießen, und das tat ich auch – auf eine gewisse Art. Aber ich brauchte einfach kein teures Zeug.
»Möbel bringen kein Geld ein. Diese Wohnung ist eine Investition – ein Ort, an dem ich wohnen kann, ohne Miete zu zahlen.« Ich zuckte mit den Schultern. Ganz ehrlich war das nicht. Ich hätte die Wohnung vermieten und in eine andere, viel kleinere ziehen können, aber etwas an den Kacheln in der Küche und an der Art, wie die Sonne nachmittags durch das riesige Fenster ins Wohnzimmer schien, etwas an der schieren Menge an Platz hatte dafür gesorgt, dass ich hierbleiben wollte. Es kam mir vor, als würde mein Leben besser … glücklicher werden, wenn ich hier wohnte.
Angie stemmte die Hände in die Hüften. »Ernsthaft, du brauchst ein bisschen was zum Einrichten. Vasen zum Beispiel. Oder Kissen. Irgendetwas, was die Wohnung …«
»Falls es dich tröstet: Ich habe eine Kunstberaterin engagiert, und heute Abend besuchen wir eine Galerie.
Angie rümpfte die Nase. »Was für eineBeraterin?«
»Jemand, der mir Bilder für die Wände hier aussucht.« Ich nickte, als hätte ich ihr beim Pokern gerade einen Royal Flush präsentiert. Besser ging’s nicht.
»Na klar, weil Kunst eine Investition ist, stimmt’s?«, fragte sie und verdrehte die Augen.
»Na und?« Ich zuckte mit den Schultern. »Schön aussehen kann sie ja trotzdem.«
»Die Idee ist gut, aber du kannst doch nicht auf deinem verschlissenen Sofa und mit teurer Kunst an den Wänden in dieser riesigen Wohnung sitzen. Ich meine: wennschon – dennschon.«
»Ist mir egal, wenn es komisch aussieht.« Ich fand Angie ein bisschen scheinheilig, denn mit ihrem eigenen Gehaltsscheck ging sie auch immer sehr vorsichtig um. »Wichtig ist doch nur, dass ich alles habe, was ich brauche.«
»Was du brauchst? Niemand braucht eine Wohnung in der Park Avenue mit fünf Schlafzimmern und zwei Küchen! Aber ist schon okay. Was ich sagen will, ist, dass du dich ein bisschen entspannen solltest.« Sie schob mich aus dem Weg, und ich folgte ihr in die Küche, wo sie anfing, die Schranktüren zu öffnen und wieder zu schließen. »Du hast es verdient. Du sollst ja kein Geld zum Fenster rauswerfen, nur ein paar Dinge besorgen, die dir das Leben ein bisschen angenehmer machen. Wir sind hier in New York fucking City. Wenn es so was wie eine Kunstberaterin wirklich gibt, dann gibt es auch jemanden, der Möbel für reiche Typen wie dich kauft.«
»Mein Leben ist auch ohne teure Möbel sehr angenehm.« Meinte sie das etwa ernst? »Um Himmels willen, wir sind hier in der Park Avenue.«
»Okay. Was ist, wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst? Du kannst sie nicht auf einer Matratze auf dem nackten Fußboden vögeln«, sagte sie und hüpfte mit dem Po auf die Theke.
»Ich habe noch nie eine Frau in meine Wohnung mitgenommen. Warum sollte sich das jetzt ändern?«
»Das liegt nur daran, dass du immer in armseligen Buden gehaust hast«, sagte Angie und blickte an die Zimmerdecke, als suchte sie dort nach Rissen. »Jetzt muss dir deine Wohnung nicht mehr peinlich sein.«
»Hey, ich habe mich noch nie dafür geniert, wo ich wohne. Ich habe immer meine Miete bezahlt – kein Grund, sich zu schämen. Und ich nehme keine Frau mit nach Hause, weil ich auf diese Art jederzeit aufstehen und einfach gehen kann. Daran wird sich auf keinen Fall etwas ändern.«
»Denk noch mal drüber nach, Sam. Bitte«, sagte sie.
Das würde ich tatsächlich tun, einfach, weil ich Angie vertraute. Dennoch hatte ich nicht vor, in nächster Zeit meine Meinung zu diesem Thema zu ändern. Ich brauchte keine Dinge, um mein Leben schöner zu machen.
Je mehr man besitzt, desto mehr kann man wieder verlieren.
2. KAPITEL
GRACE
Ich blickte mich in der Galerie um und musste grinsen. Bevor an diesem Abend die Gäste eintreffen würden, war noch eine Menge zu tun, aber allmählich nahmen die Dinge Gestalt an. Ich war unglaublich stolz und aufgeregt, weil ich zum ersten Mal eine Ausstellung in meiner eigenen Galerie durchführte.
Ich wirbelte herum, als die Türglocke erklang, wie immer, wenn jemand das Lokal betrat. Meine beste Freundin kam zur Tür hereinspaziert. Sie ignorierte die Leute, die überall herumstanden oder -schlenderten, und steuerte schnurstracks auf mich zu.
»Du weißt aber schon, dass du keine Malerin bist, oder?«, fragte Harper, während sie mich von Kopf bis Fuß musterte.
»Ich bessere nur ein paar Macken an den Wänden aus«, sagte ich und hielt eine Dose mit weißer Farbe und einen Pinsel hoch. »Und du kannst dich hier auch nicht auf die faule Haut legen.« Ich deutete mit dem Kopf auf einen Besen in der Ecke. »Wir haben nicht mehr viel Zeit. Fang an.«
Die erste Ausstellung in meiner neu eröffneten Galerie musste einfach gut werden. Ich hatte alles gründlich vorbereitet, aber durch meine Adern raste so viel Adrenalin, dass ich ganz nervös war. Ich blickte mich in dem großen, weiß gestrichenen Raum um. Das Personal der Cateringfirma war mit dem Aufbau beschäftigt; zwei Bilder lehnten noch an der Wand.
»Ich muss mir überlegen, wo ich die aufhängen will«, sagte ich, stellte die Dose mit der Farbe neben der Tür ab und zeigte auf die beiden Gemälde. »Aber ich kann mich einfach nicht entscheiden.« Gestern war mir die richtige Anordnung noch völlig klar gewesen. Heute dagegen änderte ich ständig meine Meinung – alles sollte perfekt sein.
»Spielt das eine Rolle?«, fragte Harper mit ausdrucksloser Miene. »Wir wollen doch gar nicht, dass er sein beschissenes Zeug verkauft, oder?«
Ich kicherte, und ein Teil des Stresses fiel von mir ab. Harper hatte recht, etwas in mir wollte, dass diese Ausstellung floppte. Der Künstler, dessen Werke ich an diesem Abend erstmals zeigte, war ungefähr vier Wochen zuvor noch mein Freund gewesen. Dann kam ich in die Galerie zurück und erwischte ihn, wie er seine Assistentin fickte. In meinem Büro. Seitdem war er nicht mehr mein Freund. Dummerweise würde ich an diesem Abend allen erzählen müssen, wie großartig sein Werk war.
Es war nicht das erste Mal, dass mich ein Partner enttäuscht hatte. Ich mochte Männer mit Talent. Maler, Musiker, Schriftsteller. In der Schule hatte ich immer hart gearbeitet, um bessere Noten zu bekommen, und wenn ich als Erwachsene mit Künstlern ausging, die um ihre Existenz kämpften, dann tat ich im Grunde dasselbe. Eine Partnerschaft bedeutete zusätzliche Verantwortung – ich sah es als meine Aufgabe, den Mann zu ermutigen und zu unterstützen, bis er groß herauskam. Der Vorteil für mich sollte darin bestehen, dass ich dabei war, wenn es endlich so weit war. Aber der große Durchbruch blieb immer aus. Und dann kam Steve. Er war der erste Typ, bei dem, als ich ihm erzählte, wie wundervoll und talentiert er war, in meinem Hinterkopf keine leise Stimme fragte: Echt jetzt? Ist er wirklich so gut, oder vögelst du nur gern mit ihm? Steve würde eine glänzende Karriere hinlegen.
Ich hasste es, dass seine Ausstellung in meiner Galerie vermutlich der Beginn dieses Aufstiegs war.
Unglücklicherweise hatte es mehr Geld gekostet als erwartet, Grace Astor Fine Art zu eröffnen, darum konnte ich es mir nicht leisten, seine Leinwände mit einem Tapeziermesser zu bearbeiten und seinen betrügerischen Arsch einfach aus meinem Leben zu befördern.
Wieder klingelte die Glocke, und Harpers Schwägerin Scarlett kam herein. »Das ist so aufregend!«, sagte sie, als sie erst mich und dann Harper umarmte. »Schade nur, dass es ausgerechnet dieser Künstler sein muss.«
»Hey«, erwiderte ich. »Sag so was nicht. Die Ausstellung muss ein absoluter Verkaufsschlager werden. Nächste Woche ist die Miete für dieses Quartal fällig.«
Es spielte keine Rolle, dass Steve ein Idiot war – seine Werke mussten trotzdem Aufsehen erregen. Um die Galerie zu eröffnen, hatte ich bereits einen Renoir verkauft, den ich von meinem Großvater geerbt hatte. Es hatte mir das Herz gebrochen. Grandpa hatte mir häufig Geschichten über das Mädchen auf dem Bild erzählt, so, als wäre ich diejenige, die nach Paris gehen und selbst alle möglichen Abenteuer erleben würde. Dieses Gemälde zu opfern hatte mich fast umgebracht, aber mein Großvater hatte in seinem Testament einen Brief an mich hinterlassen, in dem stand, dass ich den Renoir für meine eigenen Abenteuer benutzen sollte, egal, ob sie in meiner Fantasie oder im wahren Leben stattfanden. So hatte ich das Bild also mit seinem Segen, aber dennoch schweren Herzens verkauft. Denn diese Galerie war mein Abenteuer im wahren Leben; schon seit dem College hatte ich darauf hingearbeitet. Ich hatte nicht vor, mich selbst oder meinen Großvater zu enttäuschen.
»Du kannst immer noch deinen Dad fragen«, sagte Scarlett. »Falls du es doch nicht schaffst.«
Das Geld war knapp, aber so knapp nun auch wieder nicht. Es reichte, wenn dieser Abend ein Erfolg wurde.
»Sie fragt ihren Vater nicht«, antwortete Harper an meiner Stelle. »Sie schafft das ganz allein.«
Ich war so entschlossen gewesen, meinen Eltern und mir selbst zu beweisen, dass ich es ohne ihre Hilfe hinbekommen würde, dass ich lieber ein Darlehen aufgenommen hatte, als meinen Vater um Geld zu bitten. Er war kein Bankautomat – auch wenn meine Mutter das anders sah –, und ich würde eher scheitern, als ihn wie einen zu behandeln.
»Ich muss meine persönlichen Gefühle für Steve einfach von meinen geschäftlichen Zielen trennen. Schließlich mag ich auch nicht jeden Kunden.« An diesem Gedanken musste ich mich festhalten und mich darauf konzentrieren, dass Steves Werke mir Geld einbringen und andere Künstler auf die Galerie aufmerksam machen würden.
Ich musste einfach die Erinnerung daran aus meinem Gedächtnis verbannen, wie ihm die Hose um die Knöchel hing, während er eine Achtzehnjährige fickte, die in meinem Büro am Aktenschrank lehnte.
Ich zog meine weißen Baumwollhandschuhe an, atmete tief durch und hob die Leinwand vor mir an. »Das muss dorthin.« Ich trug das Bild näher zum Eingang, sodass es eines der ersten Werke sein würde, die die Leute zu Gesicht bekamen. »Es ist das teuerste.« Ich würde meinen Charme spielen lassen, vielleicht sogar meinen leichten britischen Akzent übertreiben, den ich besaß, weil ich auf der anderen Seite des großen Teichs zur Welt gekommen war, und ich würde so viele dieser Bilder wie nur möglich verkaufen. Je eher ich unabhängig von Steve war, desto besser.
»Und das hier«, sagte ich und nahm das Bild, das ich ausgetauscht hatte, »soll da drüben hin.«
Ich musste nur die nächsten Stunden überstehen, dann würde alles großartig sein.
»Schließt du den hinteren Teil ab?«, fragte Scarlett.
Hinten in der Galerie lagerten Werke anderer Künstler, die ich erworben hatte, und hinter einer doppelten Wand befand sich ein kleiner Bereich mit meinen absoluten Lieblingsbildern. Die Leute mussten durch die ganze Galerie gehen, um sie anzuschauen. Ich wollte nicht verheimlichen, dass es sie gab, aber diese kleine Sammlung passte eigentlich nicht zu den restlichen Kunstwerken. Es handelte sich um traditionellere Zeichnungen und Gemälde – Porträts und Akte und ein paar Aufnahmen des Central Parks von einem völlig unbekannten Fotografen. Mein Lieblingsbild, ein La Touche, den ich fünf Jahre zuvor bei einer Auktion ersteigern konnte, hatte bis zur Eröffnung der Galerie in meinem Schlafzimmer gehangen. Darauf ist eine Frau zu sehen, die an ihrem Schreibtisch sitzt und einen Brief schreibt. Ganz schlicht, aber ich fragte mich oft, wem sie schrieb und warum sie das Blatt Papier offenbar verstecken wollte. Kunstwerke wie dieses und mein Renoir waren der Grund, warum ich mir überhaupt eine eigene Galerie gewünscht hatte. Aber keines dieser Bilder war »angesagt«, und ich musste Werke ausstellen, die Geld brachten, zumindest vorläufig war ich darauf noch angewiesen.
»Ich glaube, ich lasse alles offen, nur für den Fall, dass sich jemand für etwas anderes interessiert.« Schließlich war ich Steve gegenüber nicht zu rückhaltloser Loyalität verpflichtet, nicht wahr?
Endlich hatte ich alle Bilder neu angeordnet, und die Handwerker machten sich an die Arbeit, damit ich die Werke aufhängen konnte, sobald die Halterungen an der Wand befestigt waren.
»Also«, sagte ich und stemmte die Hände in die Hüften. »Helft ihr mir bitte, die Tische zu verrücken, damit der Besucherstrom auch in den hinteren Teil geleitet wird?« Verdammt, ich würde meine private Sammlung nicht nur zugänglich machen, sondern im Gegenteil die Leute sogar ermutigen, einen Blick darauf zu werfen. Heute Abend sollte nicht nur Steve, sondern auch Grace Astor Fine Art groß herauskommen. Ich hatte die Nase voll davon, Männer in den Vordergrund zu schieben, weil ich sie glänzen sehen wollte. Das hatte mich exakt nirgendwohin geführt. Von nun an würde ich zuerst an mich selbst denken.
So war das nun mal, wenn man eine erfolgreiche Geschäftsfrau sein wollte.
»Du siehst großartig aus«, sagte Harper, als ich mich im Badezimmerspiegel hinten in der Galerie musterte. »Bist du bereit?«
Ich war so bereit wie nie zuvor. Mein rotes Kleid passte mir wie ein Handschuh, und die acht Zentimeter hohen High Heels fühlten sich wie eine Energiequelle an – als trüge ich Waffen an den Füßen.
Ich sah auf meinem Handy nach der Uhrzeit. Nur noch ein paar Minuten, und die Ausstellung würde beginnen. »Ja, ich bin so weit. Ich hoffe nur, dass viele Leute kommen.« Als ich mir überlegt hatte, eine Galerie zu eröffnen, wollte ich aufstrebende Talente fördern, indem ich Berater dazu brachte, bestimmte Künstler für ihre Auftraggeber auszusuchen. Ich hatte gedacht, dass es nur um die Kunst selbst ging. Aber dann merkte ich, dass sie nur die Spitze des Eisbergs war. Das Kunstgeschäft – genug Geld für die Miete auftreiben, die Steuerunterlagen einreichen, für Liquidität sorgen – beanspruchte eine Menge Zeit. Ich hatte anfangs nicht begriffen, dass ich mein Hauptaugenmerk auf den Profit richten musste. Die »Kunst« bestand oftmals vor allem darin, genug Geld einzunehmen.
»Natürlich kommen viele Leute«, sagte Harper. »Du hast ein Auge für begabte Künstler.« Wir schlenderten wieder zur Ausstellungsfläche zurück. Hinter Steves Bildern war eine Bar aufgebaut, auf der ein Tablett mit bereits gefüllten Champagnergläsern stand. »Würden Sie sich damit an die Tür stellen?«, bat ich einen der Kellner. »Es kann jeden Augenblick losgehen.«
Hoffentlich.
Erneut läutete die Glocke über der Tür. Es war Violet, Scarletts Schwester, die sie gerade abgeholt hatte. Okay, dann war die Galerie zumindest nicht leer, wenn potenzielle Kunden kamen. Ich begrüßte Violet und schlug ihr vor, einen Blick auf die Bilder zu werfen.
Es klingelte ein weiteres Mal. »Melanie, wie schön, dass du kommen konntest«, sagte ich und küsste eine alte Freundin meiner Mutter auf die Wange. Sie kaufte viel Kunst und prahlte gern damit, dass sie neue Künstler schon bemerkt hatte, als sie noch unbekannt waren. Wenn ich ihr Interesse an der Galerie wecken konnte, würde das Ganze in Schwung kommen, das spürte ich. Sie kannte eine Menge reicher Leute überall auf der Welt.
»Aber natürlich, das lasse ich mir doch nicht entgehen.« Sie sah sich um. »Das sind großartige Räume, die du hier hast, Darling.«
»Danke.« Endlich hatte ich erreicht, worauf ich jahrelang hingearbeitet hatte, aber Frauen wie Melanie würden nie wirklich begreifen, was das für ein Gefühl war. Ihre Arbeit bestand darin, zu Wohltätigkeitsessen zu gehen und Geld für Bedürftige zu spenden. Das war die Art von Arbeit, die Frauen wie sie und meine Mutter machten. Und meinem Vater wäre wohler gewesen, wenn ich der gleichen Beschäftigung nachgegangen wäre. Die Vorstellung, dass seine Tochter sich mit Dingen wie Gewinn und Verlust beschäftigen musste, bekümmerte ihn. Er wollte, dass ich seine Prinzessin blieb.
»Komm, ich zeige dir das Werk dieses Künstlers«, sagte ich, nahm zwei Champagnerflöten vom Tablett und reichte Melanie eine davon. »Ich glaube, du wirst ihn sehr mögen.« Mein Magen rebellierte. Ob es mir gefiel oder nicht und trotz allem, was Steve mir angetan hatte, musste ich Käufer von seinem Talent überzeugen und seine Karriere in Gang bringen. Immer wieder rief ich mir ins Gedächtnis, dass ich tatsächlich Grace Astor Fine Art verkaufte und dass Steves Erfolg nur ein Nebeneffekt war.
Glücklicherweise trafen immer mehr Leute ein, während die Cocktails serviert wurden. Ich schob mich durch das Gedränge von einer Person zur nächsten, weckte Begeisterung für Steves Werk und versuchte, Kontakte zu festigen.
Erst als Steve eine Stunde nach der Eröffnung zur Tür hereingestürmt kam, fiel mir auf, dass er bisher ja gar nicht da gewesen war. Sein Blick war glasig, seine zu langen braunen Haare leicht fettig. Taktloserweise hatte er seine Assistentin im Arm. Sie standen in der Tür, und er schien zu glauben, dass die Leute nur auf ihn gewartet hatten. Offensichtlich rechnete er mit einer Runde Applaus, aber niemand wusste, wer er war.
Es war meine Aufgabe, ihn den Anwesenden überschwänglich vorzustellen, und seine war es, sie um den Finger zu wickeln. Aber vor meinem inneren Auge sah ich mich erneut ins Büro kommen und ihn in flagranti erwischen, und das hielt mich davon ab, auf ihn zuzugehen. Mein geschäftliches Geschick erlaubte mir, Freundlichkeit vorzuspielen, wenn ich ihn nicht ansehen musste, aber ich wollte auf keinen Fall mit ihm zusammentreffen.
Unsere Blicke begegneten sich, und er kam auf mich zu. Ich entschuldigte mich rasch bei dem Kunsthändler, mit dem ich gerade gesprochen hatte, und ergriff die Flucht. Dabei rannte ich beinahe Nina Grecco über den Haufen – eine der einflussreichsten Kunstberaterinnen der Stadt.
»Nina, ich bin Grace Astor«, sagte ich und reichte ihr die Hand. Sie bedachte mich mit dem gleichen angespannten Lächeln, das ich selbst schon den ganzen Abend zur Schau stellte, und ergriff meine Hand. »Ich freue mich sehr, dass Sie kommen konnten.«
Ich wusste, welch große Rolle Berater spielten. Ich hatte begriffen, dass es schwierig war, sich in der Welt der Kunst zurechtzufinden, und dass die Leute manchmal Anleitung brauchten, wenn sie etwas kaufen wollten. Aber die meisten von Ninas Kunden interessierten sich nur für Dinge, die ihnen Geld bringen würden. Sie interessierten sich nicht für die Kunst selbst, sondern für die Dividenden, die sich damit erzielen ließen. Kunst war schon seit Jahrhunderten eine Geldanlage, aber ich hoffte immer noch, dass sich reiche Romantiker in all das verlieben würden, was meine Galerie zu bieten hatte. Ich wollte Kunden, die Emotionen in das investierten, was sie kauften. Kunstwerke waren keine Aktien oder Goldbarren – sie waren viel persönlicher. Zumindest sollte es so sein.
»Ms Astor, das ist mein Klient Sam Shaw.« Nina legte dem Mann, der neben ihr stand, die Hand auf den Arm.
Ich hob den Blick und sah einen Mann um die dreißig mit straßenköterblondem Haar und dunkelbraunen Augen, die mich anstarrten. »Mr Shaw, freut mich sehr, Sie kennenzulernen.« Er lächelte, aber das Lächeln erreichte seine Augen nicht. Er wirkte gelangweilt, so als ließ er dieses Event eher über sich ergehen, als es zu genießen.
»Grace, dieser Künstler von heute Abend steht kurz vor dem Durchbruch, oder?«, fragte Nina mich, während ich immer noch Mr Shaw anstarrte.
Beinahe hätte ich die Augen verdreht, riss mich aber gerade noch rechtzeitig zusammen. »Ja, das stimmt. Im Augenblick gibt es einen richtigen Hype um ihn, und heute Abend sind ein paar bedeutende Sammler hier.« Ich schlüpfte erneut in die Rolle, an die ich mich im Lauf des Abends bereits gewöhnt hatte. »Er ist ein sehr schwungvoller Maler, der seine Wurzeln eindeutig im abstrakten Expressionismus hat.« Mr Shaw wich meinem Blick aus. Mit verwirrter Miene blickte er auf die Leinwand. Nina verschwendete ganz offensichtlich ihre Zeit.
»Gracie«, dröhnte Steves Stimme hinter mir und zog auch Mr Shaws Aufmerksamkeit auf sich.
Ich versuchte zu verbergen, wie unwohl ich mich fühlte. »Kommen Sie, ich stelle Ihnen den Künstler vor«, sagte ich.
Steve schlang mir die Arme um die Taille, und ich wand mich vor Unbehagen. »Hey Gracie.«
»Steve, darf ich dir Mr Shaw und Nina Grecco vorstellen.« So unauffällig wie möglich stieß ich ihn gegen die Brust, um mich aus seinem Griff zu befreien. Er ignorierte es einfach und hielt mich weiterhin fest. »Ich wollte ihnen gerade etwas zu diesem Bild erzählen«, sagte ich und deutete auf eine Stelle links hinter Nina. »Könntest du uns dazu noch ein paar Hintergrundinformationen geben?« Lächelnd sah ich Mr Shaw in die Augen. Sein Blick wanderte zwischen Steve und mir hin und her, als versuchte er herauszufinden, was vor sich ging.
Während ich mich noch immer aus seiner Umklammerung zu lösen versuchte, fing Steve an zu erzählen, was ihn zu dieser Serie von Bildern inspiriert hatte.
»Ms Astor, könnten Sie mich durch Ihre Galerie führen?«, fiel Mr Shaw ihm ins Wort.
Ich lächelte. Ob er sie beabsichtigt hatte oder nicht, für diese Rettung war ich ihm äußerst dankbar.
»Soll ich mitkommen?«, fragte Nina.
»Wir kommen schon klar«, antwortete Mr Shaw, bevor ich etwas sagen konnte. »Gehen Sie vor.« Steve ließ mich los, und ich steuerte auf den hinteren Teil der Galerie zu, während Mr Shaw mir folgte.
Als wir die dichte Menschenmenge hinter uns gelassen hatten, blieb ich stehen und drehte mich zu ihm um. »Hier hinten habe ich ganz unterschiedliche Künstler«, sagte ich. Mr Shaw schob die Hände in die Taschen und nickte. »Welche Art von Kunst mögen Sie?«, fragte ich und nutzte die Gelegenheit, ihn mir genauer anzusehen. Ich hätte nicht sagen können, ob er attraktiv war oder nicht, aber sein Gesichtsausdruck fiel mir auf – die Art, wie er mich ansah. Er tat das beinahe so, wie man ein Gemälde betrachtet: Zuerst versucht man, einen allgemeinen Eindruck zu bekommen, und dann sieht man genauer hin, um zu verstehen, was das Bild ausdrücken soll.
Er löste den Blick von mir und sah sich um.
Stirnrunzelnd sagte er lediglich: »Ich habe keine Ahnung.«
Solange er abgelenkt war, musterte ich ihn gründlich, konnte ihn aber nicht einordnen. Die Menge an wirklich reichen New Yorkern war begrenzt. Alles, von der schweren Uhr an seinem Handgelenk bis zu den Schuhen aus weichem Leder, sagte mir, dass dieser Typ Geld hatte – er kam von der Upper East Side. Aber ich war ihm nie zuvor begegnet. Daran hätte ich mich erinnert. Er war groß, deutlich größer als Steve mit seinen einsdreiundachtzig. Mr Shaws breite Schultern füllten sein Jackett auf sehr attraktive Weise aus. Trotz der ansonsten perfekten Fassade war sein Haar leicht gelockt, was auf etwas Wildes in seinem Charakter hindeutete. Plötzlich hörte ich jemanden tief aus dem Bauch heraus lachen, und mir wurde bewusst, dass ich ihn anstarrte. Rasch wandte ich mich ab.
Mr Shaw entfernte sich noch weiter von der Ausstellung, steuerte auf meinen geheimen Bereich zu, und ich folgte ihm, als er hinter die doppelte Wand blickte. »Gehört das hier auch dazu?«, fragte er.
»Zur Galerie? Ja. Aber die Werke hinter dieser Wand passen eigentlich nicht zu den anderen. Sie gefallen mir einfach.«
Er musterte mich, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf die versteckten Objekte. Ich folgte seinem Blick. »Das ist ein La Touche. Ein impressionistisches Ölgemälde. Und das hier«, ich deutete auf den Degas, »ist eine originale Lithografie, von Degas signiert, der, wie Sie vermutlich wissen, dafür berühmt ist, dass er Ballerinen malte. Er war ein Zeitgenosse von La Touche.«
»Und diese hier?« Mit einem Kopfnicken deutete er auf die beiden Fotografien.
»Die sind jüngeren Datums und nicht besonders wertvoll, aber der Fotograf war eine Zeit lang obdachlos, und ich glaube, dass man den Arbeiten das anmerkt. Er sieht New York mit den Augen eines Menschen, der auf der Straße gelebt hat, und er fotografiert, was er dabei wahrgenommen hat. Er zeigt den Gegensatz zwischen der Schönheit und der Härte, der typisch für diese Stadt ist.«
Sam Shaw konzentrierte sich erneut auf mich, und seine Augen wurden schmal, ehe er fragte: »Mögen Sie die Bilder wegen der Geschichte des Fotografen, oder gefallen Ihnen die Bilder als solche?«
Ich dachte einen Augenblick lang nach. »Beides«, sagte ich dann schulterzuckend. »Die Fotos stehen für sich – sie sind schön und gleichzeitig sehr mutig.« Ich sah ihn an, merkte, dass er mich immer noch aufmerksam musterte. »Aber ich glaube, wenn man die Geschichte des Künstlers kennt, gewinnen die Fotos noch. Er kennt diese Stadt auf eine Art wie nur wenige von uns, und ich finde, das strahlen die Bilder auch aus.«
Ich hob den Kopf, um seinem prüfenden Blick zu begegnen.
Schweigen pulsierte zwischen uns. Gefiel ihm, was er sah?
»Wie gesagt, diese Arbeiten hier sind sozusagen meine Leidenschaft. Ich will sie nicht unbedingt verkaufen. Der Rest der Galerie ist zeitgenössischer ausgerichtet.«
»Die sind nicht zu verkaufen?«, fragte er und klang ein wenig verwirrt.
»Na ja, doch, eigentlich schon.« Natürlich war es großartig, wenn die Objekte gut ankamen, ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass den Leuten, die die Arbeiten im Hauptraum der Galerie mochten, auch diese Sachen gefallen würden. »Es ist nur so, dass sie nicht den Schwerpunkt der Ausstellung bilden.«
Erneut musterte er mich, und sein Blick schien zu etwas anderem geworden zu sein – zu etwas nahezu Greifbarem. Ich musste ein Erschauern unterdrücken.
Etwas an seiner Nicht-Antwort war faszinierend, fast so, als hielte er etwas zurück. Vielleicht steckte hinter der glatten Wall-Street-Fassade ja ein kleiner Batman?
»Gefallen Ihnen die restlichen Kunstwerke in der Galerie nicht?«, fragte er, während er über meinen Kopf hinwegblickte. »Nur dieser kleine Bereich hier?«
»Natürlich mag ich alles, was ich hier habe. Steve ist sehr talentiert, und die Werke da vorn sind ausgezeichnet als Sammelobjekte geeignet.« Hatte ich gerade einen potenziellen Kunden vergrault?
»Aber Sie empfinden keine Leidenschaft für sie.« Während er sprach, lag sein Blick auf meinem Mund, und ich fuhr mir mit dem Finger über die Lippen, die auf einmal zu brennen schienen.
»So ist es nicht …« Ach nein? Er hatte es ziemlich gut zusammengefasst. »Aber ich muss das Ganze auch als Geschäft betrachten. Es geht nicht nur darum, wofür ich mich begeistere.«
Mr Shaw nickte, und ich lächelte verlegen. Ich hatte mich ungeschickt ausgedrückt, denn auf diese Frage war ich nicht vorbereitet gewesen. Im Grunde hatte ich nicht damit gerechnet, dass überhaupt jemand diesen Teil der Galerie betreten würde.
Schweigend gingen wir bis zum Rand der Besuchermenge zurück, wo Nina uns erwartete. Als sie Mr Shaw wieder in die Ausstellung zog, machte ich mich auf die Suche nach meinen Freunden. Ich brauchte fünf Minuten Pause vom Dauerlächeln, und ich wollte gern wieder frei atmen können, nachdem ich mich unter Mr Shaws prüfendem Blick so zusammengerissen hatte.
Ich gesellte mich zu Scarlett und Harper, und sie drückten mich beide und gratulierten mir. Über Harpers Schulter hinweg sah ich Mr Shaw. Er ignorierte die Kunstwerke und blickte mir einige Sekunden lang direkt in die Augen. Es war ihm nicht peinlich, dabei erwischt zu werden, aber sein Blick war auch kein Flirtversuch. Ich konnte nicht erkennen, ob er mir etwas mitteilen wollte oder ob er mich immer noch prüfend betrachtete. »Steckt mein Rock vielleicht in meinem Slip oder habe ich Spinat zwischen den Zähnen oder so was Ähnliches?«, flüsterte ich Scarlett und Harper zu.
Die beiden musterten mich von oben bis unten. »Nein, du siehst perfekt aus«, sagte Harper.
»Du bist schön«, fügte Scarlett hinzu. »Warum fragst du?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nichts, nur der Typ da drüben. Er starrt mich an, und ich weiß nicht, warum.«
Harper blickte sich um und entdeckte Mr Shaw sofort, trotz der Menschenmenge, die ihn umgab. »Der da?«, fragte sie. »Dieser sehr große, heiße Typ, dem der Anzug fast so gut steht wie meinem Mann?«
»So heiß ist er nun auch wieder nicht«, sagte ich. Er sah gut aus, nur nicht auf die Art, die ich attraktiv fand. Normalerweise.
»Der ist extrem scharf, und zwar auf dich, würde ich sagen.«
»Er sieht irgendwie wütend aus«, erwiderte ich. »Und außerdem ist er sowieso nicht mein Typ.« Unser Wortwechsel war seltsam gewesen – er ließ sich kaum als Small Talk bezeichnen, eher als ein Gespräch über existenzielle Themen.
»Schon klar«, sagte Harper. »Schließlich sieht er aus wie jemand, der seine Miete selbst bezahlt und regelmäßig zum Friseur geht. So einen willst du natürlich nicht, stimmt’s?« Harpers Geschmack, was Männer betraf, war das absolute Gegenteil von meinem – eine der Voraussetzungen für eine Freundschaft, die das Teenageralter überleben und auch im Erwachsenenalter noch halten soll. Zu oft schon waren Freundinnen daran gescheitert, dass sie auf denselben Mann standen.
»Jedem Tierchen sein Pläsierchen«, sagte ich. Schon immer hatte ich mich gegen die Art von Mann gesträubt, die meine Eltern sich für mich wünschten. Etwas Sicheres. Ein Arzt, ein Anwalt aus einer guten Familie, möglichst jemand von der Upper East Side.
Ich hatte Anzüge nie auf die Art reizvoll gefunden, wie Harper es tat. Zwar ließ sich nicht leugnen, dass Max King, ihr Ehemann, attraktiv war, aber er war einfach nicht mein Typ. Ich wollte einen Kerl, mit dem ich tagträumen konnte, der spontan war, einen Künstler, der mich immer wieder überraschen würde. Ich wollte keinen Mann, der glaubte, dass man Menschen wie Aktien oder Pfandbriefe kaufen und verkaufen konnte – oder wie Kunstwerke.
Und Batman? Er schien in keine dieser Schubladen zu passen. Er trug einen Anzug, aber die Fragen, die er mir gestellt hatte, die Art, wie er mich ansah – es war, als wollte er alles Belanglose von mir abstreifen und tiefer blicken, in meine Seele hinein.
Und vielleicht würde ich ihm das sogar erlauben.
3. KAPITEL
SAM
Bereits eine Woche nach der Vernissage bei Grace Astor Fine Art konnte ich mich an keines der Kunstwerke mehr erinnern, die an jenem Abend zu sehen waren. Grace Astor hingegen … mit diesem vollen Mund, der schmalen Taille und dem verwirrten Lächeln? Diese Frau konnte ich offenbar nicht vergessen. Mein Büro lag in der Innenstadt, und als ich mit der Arbeit fertig war, beschloss ich daher, einen Spaziergang zu machen und Grace einen Besuch abzustatten. Die einzigen Bilder, an die ich mich vage erinnerte, waren die, die sie versteckt hatte. Ich wollte die Kunstwerke und ihre Besitzerin wiedersehen.
Die Glocke über der Tür klingelte, als ich die Galerie betrat, was irgendwie im Widerspruch zu den modernen Gemälden an der Wand stand. Obwohl mir die Bilder nicht gefallen hatten, verrieten die kleinen roten Aufkleber unter jedem Bild, dass die Vernissage erfolgreich verlaufen war.
An den Werken im vorderen Bereich der Galerie hatte ich kein Interesse, also durchquerte ich den Raum mit großen Schritten, um Ms Astors heimliche Reserve zu sehen.
»Guten Tag«, rief eine Frau hinter mir über das Klappern ihrer Absätze hinweg. Ich drehte mich um und sah Ms Astor in einem engen blauen Kleid, das ihr gerade bis unter die Knie reichte, und mit einer Brille mit dickem schwarzem Rahmen auf der Nase rasch auf mich zukommen. Sie sah aus wie Lois Lane, die Nebenfigur in den Superman-Comics. Allerdings verrieten mir ihre gerunzelte Stirn und der entschlossene Blick, dass sie in ihrer eigenen Geschichte die Heldin und nicht nur eine Handlangerin war.
»Ms Astor«, sagte ich und hoffte, dass sie sich an mich erinnern würde.
Sie verlangsamte den Schritt, und das Stirnrunzeln verschwand. Stattdessen weiteten sich ihre Augen vor Überraschung. »Mr Shaw, richtig?«
Ich streckte die Hand aus, um sie zu begrüßen. »Ja, genau«, sagte ich und lächelte. Angie hatte mir mal verraten, dass ich mit meinem Lächeln aus drei Metern Entfernung dafür sorgen konnte, dass einer Frau das Höschen nass wurde. Leider wirkte Grace nicht beeindruckt, sondern nur verwirrt. Sie nahm meine Hand, ich drückte ihre und hielt sie etwas zu lange fest.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie, während sie den Blick auf unsere Hände senkte. Als ich sie losließ, atmete sie aus.
»Ich bin gekommen, um mir die hier noch einmal anzusehen«, sagte ich und deutete auf ihre versteckte Sammlung. »Wenn es Sie nicht stört.«
»Überhaupt nicht«, antwortete sie, nachdem wir bereits losgegangen waren.
»Ist die Vernissage gut gelaufen?«, fragte ich, denn ich hoffte, dass etwas in ihrer Antwort mir verraten würde, in welcher Beziehung sie zum Künstler stand. Seine Hände waren überall auf ihr gewesen, ehe sie mich durch die Galerie geführt hatte.
»Ja, fast alles wurde noch am selben Abend oder in den Tagen danach verkauft, sobald die Kritiken in der Zeitung standen.«
Ich nickte, um sie zum Weiterreden zu ermutigen. Und weil ich sehen wollte, wie ihre Lippen sich bei jedem Wort, das sie sagte, kräuselten und verzogen.
»Vier Bilder sind noch da. Möchten Sie die vielleicht gern sehen?«
»Wie gesagt, ist nicht mein Ding.«
Wir standen vor der geheimen Sammlung.
»Sie mögen also klassischere Kunstwerke«, sagte sie, während wir beide auf die Bilder schauten. Sie hatte es nicht als Frage gemeint.
Ich schob die Hände in die Hosentaschen. »Ehrlich gesagt, weiß ich das selbst nicht genau. Das ist alles noch ziemlich neu für mich.« Normalerweise war ich sehr vorsichtig mit dem, was ich anderen Menschen gegenüber preisgab. Ich hatte schnell gelernt, dass es in der Geschäftswelt und in Manhattan jede Menge Dummschwätzer gab, die nicht an ihre eigenen Fehler und Schwächen erinnert werden wollten, was gleichzeitig bedeutete, dass man seine eigenen nicht verraten durfte. Es war ein Spiel – wenn alle einfach immer so taten als ob, konnte niemand je erwischt werden. Und obwohl ich ein Außenseiter war, spielte ich geschickt die Rolle dessen, der dazugehörte.
»Was ist neu für Sie?«, fragte Grace.
»Kunst«, antwortete ich. »Ich weiß noch nicht, was mir gefällt.«
»Aber die da mögen Sie?« Grace deutete mit dem Kopf auf die Bilder, die wir betrachteten.
Ich nickte. »Ja, ich glaube schon.« Die Innigkeit und das Geheimnisvolle der Bilder zog mich an, aber ich hatte keine Ahnung, ob sie als Geldanlage geeignet waren.
Meine Aufmerksamkeit wanderte von Grace zu den Kunstwerken. Die Bilder waren klein, unaufdringlich und persönlich. Obwohl die Werke in keiner Beziehung zueinander zu stehen schienen – sie stammten eindeutig von verschiedenen Künstlern –, wirkten sie fragil, beinahe so, als wären sie nicht für ein Publikum gedacht. Ihre Vertraulichkeit ließ sie umso unwiderstehlicher wirken, denn sie schienen mir etwas über die Menschen mitzuteilen, die sie erschaffen hatten. Ansonsten war die Galerie voll mit lauten, um Aufmerksamkeit buhlenden Werken, die mich schon beim Hereinkommen mit ihrer Wichtigkeit überfielen – sie hatten nichts Geheimnisvolles an sich.
Diese hier verrieten mir dagegen viel mehr über Grace. Vier Akte, allesamt Zeichnungen; etwas, das wie ein richtiges Gemälde aussah – Grace hatte gesagt, dass es ein Ölbild war – und eine Frau an einem Schreibtisch zeigte; ein kleines Gemälde von einem Hafen und die beiden Fotografien der City.
»Es ist eine ziemlich zusammengewürfelte Sammlung«, sagte Grace und legte den Kopf schief, während sie die Frau am Schreibtisch ansah.
»Ja, aber mir gefallen sie.« Ich konnte förmlich spüren, dass sie die Bilder selbst ausgewählt hatte – sie wirkten persönlich. »Die sind doch zu verkaufen, oder?«
Grace biss sich auf die Unterlippe, dann antwortete sie: »Jep, sie sind zu verkaufen.« Sie klang unsicher, widerstrebend. Wollte sie die Kunstwerke lieber behalten? Oder sollte nur ich sie nicht kaufen?
Ich neigte den Oberkörper zur Seite, um den Akt rechts von mir zu betrachten.
»Na ja, wie ich bei der Eröffnung sagte, passen sie eigentlich nicht zusammen. Die Fotos sind das Modernste an dieser Auswahl. Der Fotograf hat in letzter Zeit ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, aber bislang hat er noch keine große Anhängerschaft.«
»Erzählen Sie mir noch ein bisschen über seine Werke.« Offenbar waren es die einzigen Fotografien in der Galerie.
»Na ja, sie sind schön.«
Ich wünschte mir eine ausführlichere Begründung für ihre Vorliebe. Mir gefiel, was sie mir über den Hintergrund des Künstlers erzählt hatte. »Und?«, fragte ich. Jedes Werk in dieser Abteilung zog mich an, aber die Fotografien waren am interessantesten. Grace hatte die Geschichte des Künstlers gefallen. Ihr Interesse an einem obdachlosen Fotografen verriet einen Grad an Mitgefühl, der mir nur selten begegnete.
Sie blickte flüchtig zu mir auf. »Mir gefällt, dass er immer noch nach dem Schönen sucht, obwohl er so viel Finsteres gesehen hat. Ich finde, man sieht seinen Bildern das Tragische an … aber eben auch die Hoffnung.«
Mir stockte der Atem. Diese Frau war ein Mensch, der hinter die Fassade blickte; ich wollte unbedingt mehr über sie erfahren.
»Und was diese Akte hier betrifft …« Sie deutete mit der Hand auf die beiden Bilder auf der linken Seite. »Auf den ersten Blick sehen sie aus wie nachlässig hingeworfen, aber bei genauerer Betrachtung fällt einem auf, wie sie den Kopf dreht – und dass der Künstler offenbar von ihr fasziniert ist.«
Das Gefühl kannte ich.
»Aber Sie wissen nicht, ob die irgendetwas wert sind«, sagte ich.
Grace verlagerte ihr Gewicht auf das andere Bein und schob die Hüfte vor, was ihre Kurven betonte. Dabei verschränkte sie die Arme, als hätte ich sie beleidigt, doch gleichzeitig umspielte ein Lächeln ihren Mund. War es mir gelungen, ein Stück aus der Rüstung zu schlagen, die sie trug? Sie zuckte mit den Schultern. »Was spielt das für eine Rolle, wenn sie Ihnen gefallen?«
Ich atmete tief durch. »Ich möchte kein Geld verlieren.«
»Natürlich«, sagte sie, und plötzlich klang ihre Stimme geschäftsmäßiger. »Nun, das werden Sie auch nicht. Nicht bei einem von denen hier.«
»Ich nehme sie«, sagte ich und straffte die Schultern.
»Welches?«, fragte sie, nun wieder mit gerunzelter Stirn.
Ich lächelte sie an und glaubte, als Reaktion darauf einen Hauch von Röte auf ihren Wangen zu sehen. Ließ meine Aufmerksamkeit sie erröten? Ich konnte es nur hoffen. »Alle.«
»Alle?«, fragte sie und hielt den Atem an. »Sind Sie sicher?«
Ich legte den Kopf schief. Warum zögerte sie so? War ich in ihren Augen nicht gut genug, um die Bilder zu kaufen? »Ist das ein Problem?«
Sie schob sich die Brille auf der Nase hoch und sagte: »Nein, nein, überhaupt nicht. Ich dachte nur, Sie wären gekommen, um sich die Steve-Todd-Ausstellung anzusehen.«
»Das war Ninas Idee«, sagte ich und machte einen Schritt auf sie zu. »Mein Ding ist das nicht.« Nicht dass ich wüsste, was mein Ding war. »Schien ein spannendes Spiel für sie zu sein, Geld für etwas auszugeben, was ich nicht verstehe und worüber ich auch nicht mehr erfahren will.« Ohne nachzudenken, schob ich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht.