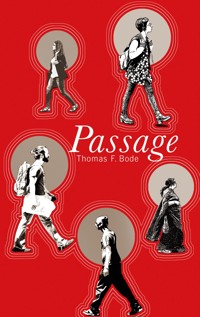
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch ist Nick jung, frei von Verpflichtungen. Aber sein Verlangen nach Orientierung wird immer drängender. Das treibt ihn auf eine riskante Suche in ein weit entferntes Land. Neugierig sucht er seinen Weg in der Natur, in Beziehungen, in Drogen und bei Gurus. Getrieben von inneren Widersprüchen, Abenteuerlust und Umsicht, Naivität und Scharfsinn begibt er sich auf eine Entdeckungstour voller Überraschungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noch ist Nick jung, frei von Verpflichtungen. Aber sein Verlangen nach Orientierung wird immer drängender. Das treibt ihn auf eine riskante Suche in ein weit entferntes Land. Neugierig sucht er seinen Weg in der Natur, in Beziehungen, in Drogen und bei Gurus.
Getrieben von inneren Widersprüchen, Abenteuerlust und Umsicht, Naivität und Scharfsinn begibt er sich auf eine Entdeckungstour voller Überraschungen.
Umschlag und Titelbild: Thomas F. Bode
„Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.”
RUMI
Der buntbemalte Bus rüttelt eilig durch die Schlaglöcher, hin zu den Tempeln am Fluss, eine Staubfahne hinter sich herziehend. Menschen, Hunde und Hühner müssen sich mit Sprüngen vor ihm in Sicherheit bringen, aber niemand scheint das übel zu nehmen. Am Heck steht in Schönschrift, von Blumen umrankt, „Please Horn!“ Auf der schmalen Sitzbank steckt Nick fest eingekeilt zwischen einer drallen Frau im roten Sari rechts und einem ihn überragenden Sack links. Die Körperwärme der Frau spürt er deutlich am Bein. Es scheint sie nicht zu stören, dass der Druck ihrer Schenkel sich mit dem Schaukeln des Fahrzeugs gelegentlich verstärkt. Es ist, als ob sie sich verstohlene Signale geben. Sie blickt aber in eine andere Richtung, nestelt an ihrer prall gefüllten Einkaufstasche. Der Sack zu seiner Linken verströmt einen fremdartigen Geruch, den Nick in diesem Land schon öfter wahrgenommen hatte; in Schränken, an Textilien und an Verkaufsständen. Leicht stechend wie von Mottenkugeln oder Desinfektionsmitteln. Die Sonne scheint jetzt voll durch die Busfenster ins Innere, was den Geruch nach Chemie, Metall und Schmierfett intensiviert. Die schmalen Schatten der am Straßenrand aufgereihten Pappeln trommeln in schneller Folge auf Nicks Augen. Seine Pupillen schließen und öffnen sich reflexartig im Versuch, dem schnellen Rhythmus zu folgen. Er spürt wachsenden Druck hinter der Stirn und schließt die Lider. Aber jetzt setzt sich das Geflacker fort in unscharfem Rot und Schwarz, was einen noch hypnotischeren Effekt hat. Eine unerwartete Attacke auf die Kontrolle über seine Sinne. Unbehaglich rutscht er auf seinem Sitz nach vorne, legt eine Hand über die Augen. Schon wird das Spalier der Bäume, die den Blick auf die Landschaft versperrten, aus dem Sichtfeld gerissen. Der Horizont klappt abrupt nach hinten, an den Rand einer weiten, kahlen Fläche abgeernteter Felder. Nur von fernen, dunklen Punkten belebt, die Vögel oder Menschen sein können. Heller, bläulicher Dunst verdichtet sich in der Ferne. Alles ruht still auf den Feldern, über denen eine fahlweiße Sonne steht. Duft von Strohfeuern zieht durch die offenen Oberlichter herein. Der Fernblick wird nun wieder ruckartig, wie von einer zuschlagenden Tür verschlossen; von einer massiven Front roher Ziegel- und Betonbauten, die vollständig das Sichtfeld füllen. Die Wärme, das rhythmische Schaukeln und die Monotonie von Hupen, Klingeln und unverständlichen Rufen verwandeln die anfängliche Anspannung Nicks in das vertraute Gefühl, passiv in einem zeitlosen Strom zu treiben. Nie gesehenen Szenen und einzigartigen Erlebnissen entgegen, endlich von der Last des Alltags in der Heimat befreit. Leicht und ohne Spur dahinziehend wie ein Zugvogel. Jedes Detail auf das sein Blick fällt, die mit Klebeband geflickte, dickglasige Brille des Fahrers, die sorgsam geflochtenen, mit Plastikblumen verzierten Zöpfe der Schulmädchen, das handgroße Loch im blanken Metall des Busbodens. Alles scheint ungewöhnlich und wert der Betrachtung. Im kleinen, dicht besetzten Bus gibt es nur je eine lange Sitzbank entlang der Fensterreihen, man sitzt sich gegenüber. Eine Frau hält einen kleinen Jungen, fast ein Baby auf dem Schoß. Seine riesigen, aufgerissenen Augen im braunen Gesicht starren so wissend und mit solch unbewegtem Ernst, dass er Nick wie ein Erwachsener im Miniaturformat erscheint. Der kantige Schädel ist straff von der Haut umspannt. Als ihn dieser uralte Blick trifft, muss Nick seine Augen abwenden. Die anderen Passagiere beachten Nick nicht, trotz seiner graublauen Augen, seines blonden Haarschopfes und der langen, von hellem Flaum bedeckten Beine, die aus seinen Shorts ragen.
Eigentlich heißt er Nicolas, aber war es leid immer wieder zu erklären, dass man den Namen französisch aussprechen muss, auf der letzten Silbe betont. Auch die Verbindung zum biederen Nikolaus mit dem Geschenkesack missfällt ihm. Er erhielt den Namen als Erinnerung an seinen französischen Großvater mütterlicherseits, dem er auch äußerlich ähnelt. Seine Familie lebt schon lange in Wilhelmshaven. Das nahe Meer hat wohl beigetragen zu seiner Entdeckerlust, der Sehnsucht immer wieder den Horizont zu überschreiten. Das Mysteriöse entdeckt er aber auch im ganz Nahen. Neben seinem Fenster zu Hause steht eine große Eibe, die ihr Inneres in Dunkelheit hüllte. Das machte sie beliebt als sicheren Rastplatz für kleine Tiere. Die schnalzenden Rufe von Eichhörnchen und das Piepen der Meisen kennt er gut. Aber immer wieder dringen Geräusche aus dem Grün, die er auch nach Jahren nicht entschlüsseln kann. Da gibt es dieses aberwitzig vielfältige Gegluckse, Geschnatter und Gefiepe, das stets verstummt, sobald er sich nähert, um dessen Urheber zu ertappen. Er vermutet, dass es Stare sind. Vor einigen Monaten nun wurde die Eibe nach Ansicht des Hauseigentümers zu hoch und ein Arbeiter-Trupp rückte an, um ihre Spitze zu kappen. Seither dringt von oben das Tageslicht in ihr zuvor verborgenes Innerstes, was Nick fast als Sakrileg empfindet.
Er entspricht trotz seiner Herkunft äußerlich nicht dem Stereotyp des kleinen, dunkelhaarigen Franzosen, wie dem Antoine in Truffauts „Geraubte Küsse“. Sein Aussehen ist eher das eines Skandinaviers, vermutlich ein Erbe der Wikinger, die einst die Normandie eroberten. Doch seine Experimentierlust ähnelt der von Antoine. Sein Nachname Textor bedeutet auf Deutsch „Weber“. Was ihm allerdings gefällt, denn er sieht sein Leben wie einen Teppich, an dem er unaufhörlich webt. Wobei er sich aber noch nicht sicher ist, ob nicht eher er selbst vom Leben gewebt wird. Er bemüht sich, die anderen Passagiere im Bus nicht zu aufdringlich zu mustern. Direkt gegenüber sitzt aber ein ungewöhnlich großer, alter Herr, so aufrecht und würdevoll, dass er seinen Blick unwillkürlich anzieht. Traditionell, aber ärmlich gekleidet, vielleicht ein Bauer. Hosen, langes Hemd und Käppchen aus ungefärbtem, grobem Leinen. Darüber eine hellgraue Weste. Sein sonnengegerbtes Gesicht strahlt in langen Lebensjahren erworbene Gelassenheit aus. Das Ziel ihrer Fahrt ist Pashupatinath, heiligster Ort der nepalesischen Hindus, nahe Kathmandu am Fluss Bagmati, Verbrennungsstätte der Toten. Oben auf den gemauerten Treppenstufen des Ufers, der Ghats. Jeder im Bus hat seinen eigenen Grund, dorthin zu fahren. Der des Alten, der keinerlei Gepäck außer einem kleinen Plastikbeutel bei sich trägt, ist Nick allerdings ein Rätsel. Der Mann greift in den raschelnden Beutel und bringt eine Orange zum Vorschein. Langsam und genüsslich beginnt er sie zu schälen. Nick beobachtet dies beiläufig mit der trägen Aufmerksamkeit, in die er seit einiger Zeit verfallen ist.
Hinter dem Busfenster huschen Bündel von Stromkabeln, Maste, riesige rosafarbene Reklame-Gesichter mit schwarz umrandeten Augen vorbei. Ein surrealer, auf und ab tanzender Film, in dem sich nichts fassen und fixieren lässt, der sich in Variationen ständig wiederholt. Die Fenster sind hoch angesetzt, nicht für Touristen geschaffen, die Panoramen betrachten wollen. Man sieht nur den oberen Teil von allem, das draußen vorbeizieht. Das verstärkt sein Gefühl, ins Unbekannte zu fahren. Der Fahrer kurbelt schwungvoll am glänzenden, abgenutzten Lenkrad, hämmert routiniert den langen Schalthebel in die ausgeleierte Gangschaltung, hupt alle paar Sekunden. Neben ihm auf der Ablage schwankt eine Statue des glücksbringenden Elefantengottes. Ein Fahrgast auf einem Vordersitz, der Ganesha die Füße entgegenstreckt, wird vom Fahrer mit einer kurzen Bemerkung zurechtgewiesen, denn dieses Verhalten ist blasphemisch und bringt Unheil. Der Sünder zieht murrend seine Füße zurück. Unverständliche Satzfetzen und quiekende Stimmen indischer Schlagersängerinnen, die von außen dringen und zugleich aus dem Autoradio bilden einen wirren Reigen, graben sich immer tiefer in Ohr und Gehirn, verdrängen die Gedanken. Ein schmachtender Refrain bohrt sich besonders penetrant in Nicks Bewusstsein, auch dank seiner provozierenden Sinnlosigkeit. Es klingt wie „Putti-Pull Napuli-Schwucki, Putti-Pull Napuli-Schwuckiii“.
Plötzlich hält der Alte gegenüber inne, Nicks Wachsamkeit ist geweckt. Ein völlig unerwarteter Ausdruck, Scham oder Ekel verzerrt das gerade noch so würdige Antlitz. Mit einem schiefen Lächeln, wie dem Ausdruck von Enttäuschung über sich selbst, als hätte er sich ertappt bei einer schlechten Gewohnheit, blickt er herab auf die Frucht. Die Hände senken sich wie entkräftet nach oben geöffnet, in den Schoß. Die Orange bleibt in ihnen halb geschält liegen. Nick hat das Gefühl ungewollt, aber dennoch indiskret etwas Intimes erspäht zu haben. Er senkt den Blick auf das heiße, verbeulte Bodenblech des Busses. Der Lärm der Fahrt schwappt wieder über ihn herein. Nichts weiter war geschehen, niemand sonst hat etwas bemerkt, der Augenblick ist vorüber, aber Nick spürt, wie sein Herz klopft. Was war das? Wurde er Zeuge des Moments der Entsagung dieses Mannes von seinem Leben? Als ob er von sich selbst enttäuscht erkannte, dass er sogar auf seinem letzten Weg einem animalischen Verlangen nach Nahrung und Genuss nachgab. Bis zuletzt schmählich gefangen in Reflexen, die ihn ans Dasein fesseln, obwohl das Spiel des Lebens „Lila“, vorbei ist? Ist er einer von denen, die sich schon in Erwartung ihres baldigen Todes auf den Weg an diesen Befreiung verheißenden Ort machen? Oder ist er Nick, überspannt und interpretiert etwas hinein, wofür es eine triviale Erklärung gibt? Wie auch immer, er fühlt sich von diesem Menschen, der zufällig seinen Weg kreuzte, berührt. Der Alte steckt die Orange mitsamt den Schalen zurück in den dünnen Beutel. Mit einer, wie es Nick scheint, resignierten Geste.
Der Bus erreicht die Endstation. Alle drängen sich taumelnd in geschäftigem Durcheinander, unter das niedrige Fahrzeugdach gebeugt durch die enge Tür nach draußen. Pashupatinath ist wie das monumentale, ewige Benares im Kleinformat. Tempel an Tempel. Auf einer Seite des Ufers die Verbrennungsstätten auf den Plattformen oberhalb der Ufertreppen. Sich erstreckend entlang des trüben und trägen Bagmati, der nach Indien fließt und dort mitsamt seiner Fracht von Asche, Schlamm und Fischen in den heiligen Ganges strömt, weshalb auch er selbst heilig ist. Nick steht unschlüssig unter der schon brennenden Sonne inmitten all der Menschen, die zielstrebig ihrer Wege gehen. Er fühlt sich auffällig groß und unbeholfen. Die Passagiere zerstreuen sich in alle Richtungen, weg von dem schäbigen Platz, der noch so gar nichts Erhabenes an sich hat. Die Sonnenstrahlen dreschen auf ihn ein. Von Schultern und Rücken melden sich unangenehm juckende Signale, kleine Stiche von rinnenden Schweißtropfen. Er zieht die Jacke aus und knotet sie um die Hüfte, da sie nicht in seine Umhängetasche aus dunkelroter und schwarzer Yakwolle passt. Seine Lieblingsjacke von Carhartt, Begleiterin vieler Reisen, unverwüstliche, sandfarbene Baumwolle mit braunem Cordkragen. Mit seiner ein wenig sommersprossigen hellen Haut und der geröteten Narbe mitten auf der Stirn, er hatte sich als schlaksiger, linkischer Junge versehentlich die Kante seines Skis gegen den Kopf geschlagen, hat er das unangenehme Gefühl, wie ein weißer Elefant auf der sich leerenden Fläche zu stehen. Ein seltsames, kleines Lachen oder eher ein Lächeln gluckst in ihm, als er sich seines Unbehagens bewusst wird. Er kennt diese Befangenheit nur zu gut. Altbekannte, störende Gefühle kommen unerbittlich immer wieder. Er will sie nicht, aber das kümmert sie nicht. Die mechanische Eintönigkeit seiner Reflexe entnervt und belustigt ihn zugleich.
Sein schweifender Blick fällt auf den großen, weißen Schriftzug „DIDIDAS“ auf der Trainingsjacke eines jungen Mädchens. Sie hat sich statt für den eleganten Sari für den globalen Teenie-Dresscode mit Sneakern und Jeans entschieden. „Didi“ heißt „Schwester“ auf Nepali. Logo und Jacke sind die billige Kopie eines ADIDAS-Produktes; was durch die Naivität der Nachahmung einen unschuldigen Charme erhält, der einem hier oft begegnet. An die Wände geschmierte Graffiti, die im Westen den Betrachtern Botschaften wie „Fuck you!“ ins Gesicht schleudern, verkünden hier eher in edler Einfalt „God is love!“. Das Mädchen ist zart und die Kontur ihrer Wange so anmutig, dass Nicks Augen ihrer Linie folgen, sie bewundernd mit seinem Blick berührt. Er ist sich zwar seiner Fremdheit bewusst, aber fühlt sich paradoxerweise auch zu Hause, er ist nicht zum ersten Mal hier. Was nicht nur an den Bergen liegt, die ihn in ihrer mittleren Höhenlage an die geliebten Alpen erinnern. Nirgends auf der Welt und Nick hat sich trotz seiner erst fünfundzwanzig Jahre schon in vielen Ländern ruhelos umher getrieben, hat er erlebt: bedrängt zu werden von einem Dutzend einander überschreiender, wild gestikulierender Taxifahrer. Um dann die bedrängende Situation ganz einfach auflösen zu können, indem er zusammen mit all diesen zappeligen Burschen in herzhaftes Gelächter ausbricht. Als hätte man sich gerade geeinigt, alles sei doch nur ein Riesenspaß. Oder einem alten Männlein auf der Straße zu begegnen, dessen Gesicht bei seinem Anblick spontan erstrahlt und ihn im Vorbeigehen mit anmutig gefalteten Händen grüßt. Dieses Land birgt für ihn eine einzigartige Mischung aus Fremdheit und Vertrautheit.
Er schlägt die Richtung ein, die die Mehrzahl der Passanten nahm. Der Ort ist klein und bald erblickt er um eine Ecke biegend, den Fluss und die Ghats. Das unglaubliche Bild lässt ihn ruckartig innehalten. Es ist plötzlich mitten drin, in Sekunden durch einen Zeitsprung versetzt in uralte Zeit. Ein Gewirr von Fassaden, Säulen, Ornamenten, Kühen und Menschen. Unbegreiflich für den Außenstehenden und doch offensichtlich stimmig.
Ping, ping, ping, eine metallische Folge von Glockenschlägen neben seinem Ohr klirrt durch sein Innerstes, macht ihn hellwach. Ein Gläubiger verkündet seinem Gott seine Anwesenheit. Nicks erstaunt aufgerissene Augen treffen die eines Sadhus, der am Ufer sitzt. Ein Yogi mit einem orangenen Schal lose umhüllt. Der lächelt ihm zu und deutet ihm mit einer kleinen Handbewegung näher zu treten und sich zu setzen. Aus seinem schmalen Gesicht blicken wache Augen. Sein fast nackter Körper ist mit grauer Asche eingerieben. Malerisch, respekteinflößend und verwirrend ist die üppige Pracht von Ketten, Blüten und Symbolen, die Kopf, Oberkörper und Arme umranken. Die verfilzten langen Haare sind zu einem Knoten getürmt, der ebenfalls umwickelt ist mit Kettenschmuck und gespickt mit silbernen Gestecken. Die Lebensweise dieser Leute ist Nick unbegreiflich. Manche Einheimische betrachten sie allerdings weniger als Heilige, als Faulpelze und bessere Bettler. Meist lagern sie mit würdevoller Lässigkeit an heiligen Plätzen, eingehüllt in Haschisch-Wolken. Einige präsentieren sich aber in eindrucksvollen Yogaposen, die erhebliche Übung verlangen und ihre mageren Köper sind Resultat echter Askese. Nick grüßt ihn mit zusammengelegten Händen und lässt sich im Schneidersitz neben ihm nieder. „Ich bin Jai Baba“, sagt der Saddhu in fließendem Englisch, „willkommen an diesem glückbringenden Ort mein Freund. Heute ist ein guter Tag, die Sterne stehen gut!“ „Oh danke, erzählen Sie mir gerne mehr darüber.“ Nick stellt sich vor und wartet auf das, was sicherlich gleich kommen wird. Das ist nicht der erste Guru, dem er lauscht. Der setzt mit dem typisch indischen, näselnden Tonfall zu einer längeren Erklärung an. Der Kontrast zwischen der Tiefe und Erhabenheit der spirituellen Lehren und dem zum Schmunzeln anregenden Akzent irritiert Nick immer wieder. Jai Baba zählt bedeutende Gurus auf, die hier in Shivas Heiligtum gewirkt haben. Unter anderem auch sein eigener Meister, der aus Südindien zu Fuß hierher wanderte und bei seinem Tod Befreiung fand. Schließlich sagt er „Ich sah sofort, dass Du ein Zeichen auf der Stirn hast. Dein drittes Auge erwacht. Vielleicht weißt du, dass die Welt untergeht, wenn Shiva sein drittes Auge öffnet?“ Nick fühlt sich unangenehm berührt. Unerwartet wird er ganz persönlich in diese Welt hineingezogen. Seine kleine Narbe auf der Stirn hatte er bisher nur als kosmetisches Problem betrachtet. Was bedeutet „Die Welt geht unter“? Ist damit der Schrecken der universellen Apokalypse oder nur das Ende seiner persönlichen Illusion gemeint? Er fühlt aber kein großes Bedürfnis, danach zu fragen und sich in obskure Theorien verwickeln zu lassen. Misstrauen manipuliert zu werden, flackert auf. Er nutzt eine Gesprächspause, um sich schnell zu verabschieden.
Um sich Überblick zu verschaffen, geht er einen schmalen Pfad zu einer kleinen Anhöhe hinauf. Erstaun-licherweise ist sie bedeckt von heimatlich wirkenden Kiefern, die sich bewegungslos in die subtropische, tiefblaue Himmelskuppel strecken. Dieser Raum über ihm, sanft dröhnend wie eine schwingende Klangschale, erweitert die Szenerie ins unendliche Vertikale. Er verweist auf dasselbe Mysterium wie das irdische Gewimmel um die Tempel, aber reduziert auf reine Farbe und leeren Raum. Eine grünglänzende Echse liegt mit zerquetschtem Kopf am Rand des Weges und ebenso gefärbte, metallisch-grüne Fliegen schwirren summend davon, als zerstiebe der kleine Körper in Fragmente. Oben angekommen betrachtet Nick einige Zeit das altertümliche Treiben am Fluss unter ihm. Unverständliche, fromme Geschäftigkeit, in Rauchschwaden gehüllt. Familien verbrennen scheinbar gelassen ihre Verstorbenen, deren Asche in den Fluss gekehrt wird, in dem sie spurlos verschwinden. Vorsichtig schnuppert er, aber der leichte Luftstrom weht weg von ihm.
Er hat nicht das Bedürfnis, sich mitten dort hinein zu begeben, oder gar zu fotografieren. So schlendert er ziellos ein Stück weiter fort in den lichten Kiefernhain und fühlt sich in seiner Wärme und Stille plötzlich sehr müde. Die Schatten der Kronen bilden eine filigrane Struktur auf dem Boden. Der ist einladend bedeckt mit hellem Sand und duftenden Kiefernadeln, sodass er sich, die Tasche unter dem Kopf unter einem Baum niederlässt. Die Beine lang gestreckt, die Hände über dem Bauch verschränkt, schließt er die Augen. Der erdige Wollgeruch der Tasche hat etwas Beruhigendes. Die Geräusche aus dem Tempelbezirk sind verklungen, die Gedanken verschwimmen. Er ist wohl gerade erst eingedöst, als er schon wieder aufschreckt. Schnauben und Schnüffeln, ein großer Schatten direkt vor seinem Gesicht. Er reißt die Augen auf, sein Atem stockt. Die Schnauze eines kalbsgroßen, grauen Hundes, nur eine Handbreit vor seiner Nase. Er beugt sich neugierig zu ihm herab, sein Atem hechelt ihm ins Gesicht. Ein Untier wie aus dem Nichts, ausgespien von Naraka der Unterwelt, der verdammt größte Köter, den er je gesehen hat. Ausgerechnet hier? Unweit ein zweiter Hund, wie ein Zwilling des Ersten, der mit langen Ohren schlackernd, ebenfalls auf ihn zuspringt, während der erste noch seine feuchte Schnauze aufgeregt vor seinem Gesicht bewegt. Es ertönt ein gellender, befreiender Kommando-Pfiff. Der Herr der Hunde, ein kleiner Mann mit Nepali-Käppchen, taucht im Hintergrund auf. Die langgliedrigen Riesen-Zwillinge werfen sich herum und tollen ihrem Herren nach. Diese Kreaturen sind das Letzte, das er hier erwartet hätte. Eher noch einen Tiger, der mit aufgerissenen Augen und tiefem Gebrüll aus dem Gebüsch bricht. Die Müdigkeit ist wie weggeblasen, die Schläfen pulsieren. Alles ist überdeutlich sichtbar und zugleich fremd. Es scheint weder Asien noch Europa noch sonst etwas Bekanntes zu sein. In den Schreck mischt sich die Scham, sich vor den Augen eines Fremden, vertrauensselig dösend wie ein Kind, allem ausgeliefert zu haben, das zufällig des Weges kommt. Nick drückt sich mit einem kleinen Keuchen hoch aus seiner hilflosen Position und unterdrückt das Bedürfnis, einen Schrei loszulassen, den Bann dieses Überfalls zu brechen.
Er macht sich in der erneuten, nach Kiefern duftenden Stille auf den Weg zurück in grelles Licht und Gedränge, zur Bushaltestelle. Das Gefühl, hier im Tempelbezirk etwas finden zu können oder zu sollen, ist verflogen. Hindu-Heiligtümer sind, je weiter er sich nähert, ihm dem Ungläubigen und Kastenlosen desto verschlossener, anders als buddhistische Tempel. Falls er doch einmal ganz hinein gelangt, ist er oft überrascht, im Innersten reich geschmückter Mauern, Fassaden und Tore nur den Stumpf eines Shiva-Lingam oder einige Götter-Puppen naiver Machart zu finden, die nur für Auge und Herz der Gläubigen von himmlischer Macht erfüllt sind. Später erfährt er, dass sich in der Nähe seines Rastplatzes ein Golfplatz von Offizieren der königlich-nepalesischen Armee befindet. Vielleicht verschafft hier ein Bursche den Hunden seines Generals regelmäßig Auslauf. Er wird es nie wissen und der kleine Hundeführer, den er nur schemenhaft wahrgenommen hat, wird seinerseits keine Überlegungen über die Absichten dieses Fremden angestellt haben. Sondern gleichmütig seiner Wege gegangen, mit den Gedanken schon bei der nächsten Mahlzeit mit Reis, Linsen und Chutney oder grübelnd über die Gesetze des Karma. Der Weg zurück fühlt sich für Nick nun ganz anders an als der Weg hin, auch wenn es dieselbe Strecke ist. Mit dem lokalen Bus zurück nach Kathmandu zu holpern, ist eine viel nüchternere Reise. Die Unbequemlichkeiten sind nicht mehr gemildert, da notwendiger Teil einer verheißungsvollen Erkundung, sondern eben nur noch Unbequemlichkeiten.
Diesmal sitzt Nick am Fensterplatz eines größeren Busses, sieht nun schonungslos alles dort draußen, diese zugleich friedliche und trostlos harte Welt. Funktionierend nach ihren eigenen, unbegreiflichen Regeln, die doch allen ihr Unterworfenen ein Überleben zu sichern scheinen. Gelassenes Umherschlendern und Hocken am Straßenrand, stoisches, sehniges sich Stemmen hinter hoch beladene Karren. Der Anblick ruft bei Nick weniger Bedauern hervor als Verwunderung und das Empfinden eigener Unzulänglichkeit. Die Ahnung trotz scheinbarer und immer noch allgemein angenommener Überlegenheit des Weißen, in dieser Welt kaum einige Tage überleben zu können. Nicht ohne die Dollarnoten, die längs gefaltet den Geldgürtel aufpolstern, der ihm gerade in den Bauch zwickt. Die Augen folgen absichtslos mit schnellem Hin und Her Schlaglöchern, Kuhdung, Abfallhäufchen von buntglänzendem Plastik und Kochabfällen, zwischen denen winzige Katzen tapsen. Über die Schulter schielenden, räudigen Hunden, die entlang des Straßenrandes schleichen. Bis nach Einbruch der Dunkelheit ihre Wolfsseele erwacht, in haarsträubend jaulenden und kampflustig umherjagenden Rudeln, denen man besser weiträumig aus dem Weg geht.
Oskar, der Labrador seines Vaters, kommt ihm in den Sinn. Er begrüßte sogar Katzen mit seelenvollem Blick und freundlichem Schwanzwedeln. Inzwischen ist er aber alt und blind. Und er stinkt ein bisschen wegen seiner chronischen Hautgeschwüre. Wenn er bemerkt, dass jemand die Wohnung betritt, läuft er an der Wand entlang, bis er auf der Höhe des Ankömmlings ist und steuert dann nach kurzem Zögern, in den Raum hinein, bis er mit der Schnauze auf den Besucher stößt. Nick fühlt, wie sich seine Kehle vor Rührung verengt. Er hofft, den alten Oskar wieder zu sehen. Was verbirgt sich hinter den vorbeiziehenden Fassaden da draußen? Sie geben keine Erklärung, haben keine eigene Substanz, sind nur Kulisse. Das Eigentliche muss irgendwo dahinter zu finden sein. Trampelpfade zwischen überwucherten Mauern führen dorthin, wo er keinen Zugang hat. Fensterlose Räume öffnen sich, in denen Schemen Rituale ausführen, ihre Gemeinschaft zelebrieren, mit Messingtöpfen und Öllampen hantierend. Beherrscht von Meisterinnen, die selbst Sklavinnen strenger Liturgien sind, die von Männern ersonnen wurden. Um die Regeln der Gruppe zu bekräftigen und dem Unsichtbaren zu huldigen. Sein starrender Blick wird ungerührt von den Oberflächen draußen zurückgeworfen. Seine Augen fühlen sich sandig und trocken an. Er wendet den Blick wieder auf die Rückenlehne vor ihm. Direkt vor seinem Gesicht erscheint eine braune Kinderhand, makellos wie die einer Putte, die gelangweilt auf das blaue Kunstleder der Lehne patscht. Er zieht behutsam an dem kleinen Daumen. Die Hand zuckt zurück, zwei verwunderte, schwarze Mandelaugen unter ebenso schwarzen Haaren erscheinen. Nick grinst das Kind an und es gleitet wieder außer Sicht. Er hört Getuschel und eine Frauenstimme, wohl die der Mutter. Kurz erscheint ihr Auge im Spalt zwischen den Sitzen.
Eine undeutliche Folge innerer Bilder verdrängt den Anblick der schäbigen Ziegel- und Betonbauten in den Außenbezirken, alle errichtet in den letzten Jahrzehnten in der unbegreiflichen Hässlichkeit der asiatischen Moderne. Der geplante Marsch durch die Berge des Himalaya, der Pilgerort, der Pass, der Höhepunkt, 5500 m. Schon stellt sich wieder ein wenig von der angenehm erregenden Erwartung einer Reise in Neuland ein. Weg von hier, weiter zum Anderswo, dem eigentlichen Ziel der „Suche“, das sich zwar verbirgt, aber doch existieren muss. Falls es sich ihm doch noch nicht enthüllt, das große Geheimnis der Existenz, gibt es da noch die pragmatische Idee, den Plan B: auf dem Rückweg direkt bei den Bergbauern zwei Kilo Haschisch zu kaufen und in seinen geräumigen Rucksack verstaut, zurück nach Deutschland zu bringen. Was weniger seine spirituelle, aber zumindest seine materielle Lage als Student verbessern kann. Ein bezaubernd schlankes, hell honigfarbenes Bein taucht links in seinem Gesichtsfeld auf, lässt den Bilderreigen vom inneren Bildschirm verschwinden, als hätte man den Aus-Knopf gedrückt. Von den violett lackierten Fußnägeln der staubigen, niedlichen Zehen die aus der Sandale ragen, wird der Blick nach weiter nach oben geleitet, zu einem Stück leuchtend gelben Stoffes, das noch weiter oben neben der Rückenlehne wieder auftaucht, sich entlang einer nackten Schulter schmiegt und unter zerzausten, kastanienbraunen Locken verschwindet. Deren Besitzerin stemmt sich plötzlich ruckartig mit den Knien gegen den Vordersitz und windet sich empor aus der unbequemen Position, in die sie bei der Fahrt gerutscht ist. Dabei werden für einen Moment lange Wimpern und eine kleine Nase sichtbar. Keine Stupsnase, sondern eine mit feiner, sinnlicher Krümmung. Verführerische Geometrie im Kleinformat. Er sieht all das nicht nur mit den Augen, sondern spürt es mit dem ganzen Körper. Das plötzliche Erscheinen dieses Wesens, so andersartig wie er selbst in dieser Umgebung, was sie in gewisser Weise verbindet, lässt alles andere in den Hintergrund treten. Er reist zwar willentlich alleine, aber es gibt dennoch immer dieses quälend fehlende Etwas. Und das flattert von Zeit zu Zeit so wie jetzt, überraschend wie ein schimmernder Falter in sein Gesichtsfeld. Wie meist versetzt ihn das zunächst in lähmende Verwirrung. Auch das kennt er von sich bis zum Überdruss. Er versucht an etwas anders zu denken und wendet sich wieder der Außenwelt zu. Draußen huscht eine Apotheke mit verdreckten Scheiben vorbei, vor der Dr. Leonard „Pille“ McCoy aus Star-Trek als winkende Pappfigur steht. Richtig, er muss noch ein Antibiotikum besorgen, um sich in den Bergen bei Infektionen selbst versorgen zu können; Tagesmärsche entfernt vom nächsten Stützpunkt der modernen Zivilisation. Es hatte sich beim Trekking schon mal eine Wunde an seiner Ferse entzündet, es sah nach Blutvergiftung aus. Der rote Fleck breitete sich nach oben Richtung Herz aus. Glücklicherweise hatte er eine antibiotische Salbe dabei. Ein Freund von ihm musste allerdings mit einem zu elefantöser Größe angeschwollenen Bein tagelang zum Krankenhaus getragen werden und laboriert heute noch an den Folgen. Diese Überlegungen bringen ihm kurzfristig Ablenkung. Aber schon kündigt sich das Ziel an, werden die Häuser entlang der Strecke höher, manche mit geschnitzten Holzfassaden verziert, die Reklameschilder dichter, die Bündel von Stromkabeln zwischen den Masten noch wirrer. Affen turnen geschickt an ihnen entlang, als seien es die Lianen ihres natürlichen Lebensraums und schauen unter halb gesenkten Lidern hochmütig auf die Passanten herab. Der Bus kommt zum Stehen, zwischen dicht umlagerten Chai-Ständen mit brodelnden Aluminiumkesseln auf Gaskochern. Chai-Wallahs gießen süßen Milchtee, gewürzt mit Zimt und Kardamom, in hohem Bogen in kleine Gläser. In den breiten Pfützen vom letzten Regenguss des Monsuns spiegelt sich der Himmel mit vereinzelten, blendend weißen Götterwolken. Die Unbekannte wird kurz vor ihm von der Menge aus dem Bus gespült. Beim Aufstehen bemerkt er, dass sie kleiner ist als er, schlank und biegsam, was das vage Gefühl von Nähe und Stimmigkeit vertieft. In der Eile mit ihr Schritt zu halten, tritt er mit seinen Wanderstiefeln fast auf die Füße einer Einheimischen, ungeschützt in ihren chinesischen Flipflops. Schon öfter hat er bemerkt, dass seine Beine ihm in den ersten Tagen auf einem anderen Kontinent nicht so zuverlässig wie sonst gehorchen. Als ob sie ein Eigenleben führen, sich erst auf die neuen Koordinaten einstellen müssen. Was in engen, schwan-kenden Verkehrsmitteln manchmal dazu führt, dass er unbeholfen wie ein Kind umhertappt, sich festklammert an den Haltestangen, bemüht niemanden wehzutun, sich als ausländischer Tölpel zu erweisen.
„Hello Mister, Namaste!“ gellt es ihm auf den steilen, rutschigen Metallstufen von unten entgegen. Bündel undefinierbarer Produkte werden von einer dunklen Hand vor seinen Augen geschwenkt. Sein Fortkommen stockt für einige Momente. Heiße Ungeduld schießt in ihm hoch, bis er sich an dem Verkäufer mit der in solchen Situationen ratsamen Vermeidung von Blickkontakt vorbei drängen kann. Das Mädchen hat sich mittlerweile schon ein Stück in eine andere Richtung entfernt, als die er zu seiner Unterkunft einschlagen muss. Wie um sich zu vergewissern, nichts vergessen zu haben, dreht sie plötzlich im Gehen den Kopf in einer schwungvollen, die Locken wirbelnden Bewegung zurück. Wobei sich für eine Sekunde ihre Blicke treffen, als ob ein Drehbuch dies vorgesehen hat. Ihr Gesicht ist ihm vertraut, ohne es je zuvor gesehen zu haben. Sie blicken sich einen Moment in die Augen. Das trägt fast ein Versprechen in sich. Das Glück irgendwo in der Zukunft, es ist möglich, wie auch immer es aussieht. Die unendliche Zukunft der Jungen, voll von Versprechungen. Dieser Raum der eines Tages unfasslich schrumpfen wird, aber erst viel später. Davon bekam Nick bereits einen Vorgeschmack. Denn als er kürzlich fünfundzwanzig wurde, stellte sich die unabweisliche Erkenntnis ein, dass er endlich einen Platz in der Gesellschaft finden, sich entscheiden muss. In die Spur kommen, die dem Leben die Sicherheit eines Ziels gibt. Das war eine unangenehme Zäsur. Die jugendliche Verant-wortungslosigkeit und Unbeschwertheit muss er hinter sich lassen. Die Zeit hat zugeschlagen, ein Gong ist ertönt. Nur weiß er noch nicht, was er tun soll, um dem Ruf zu folgen. Die unerbittliche Begrenztheit seiner Existenz wurde ihm sogar schon sehr viel früher bewusst. Er muss etwa drei Jahre alt gewesen sein, als nachts in seinem Kinderbett aus der tiefen Schwärze des Zimmers über ihm die Erkenntnis auf ihn einstürzte, dass er unweigerlich eines Tages sterben müsse. Egal wie lange es noch dauert, dieser Moment wird kommen. Der Blick gerichtet in das absolute Schwarz über ihm – und darin der Tod. Zurück in die Nicht-Existenz. Er schrie so lange entsetzt „Ich will nicht sterben!“, bis der Kopf seines Vaters vorsichtig im erleuchteten Rechteck der halb geöffneten Tür erschien. Der in der fragwürdigen Überlegenheit des Erwachsenen glaubte, es nur mit einem kindlichen Alptraum zu tun zu haben. Beruhigend flüsterte er, alles sei in Ordnung, er müsse nicht sterben und solle schön weiterschlafen. Der kleine Nicolas, wie er da noch hieß, wusste, dass das Unsinn war. Dass natürlich auch der Vater selbst, so wie ausnahmslos alle sterben müsse. Dieses Wissen belastet ihn derzeit allerdings wenig. Im Gegenteil treiben ihn unverwüstliche Zuversicht und instinktive Neugier dazu, die Grenzen seines Lebens auszuloten. Paradoxerweise auch um vielleicht die Person Nick, die irgendwann in früher Kindheit entstand, durch seine Suche wieder loszuwerden. Denn seine kindliche Todesfurcht konnte ihn nur deshalb überkommen, weil er sich kurz zuvor als eigenes, von anderen getrenntes Ich entdeckt hat. Er konnte sich genau daran erinnern, wie er eines Tages mit den Beinen schlenkernd auf dem Wohnzimmertisch saß. Er wurde dorthin gesetzt, damit ihm die Mutter bequem die Schuhe für einen Spaziergang binden konnte. Da wandte er den Blick hinüber zu dem anderen Kind neben ihm, einem Spielgefährten oder Cousin und wurde überwältigt von der Erkenntnis „Ich bin!“. Ich bin ich und da neben mir, das ist ein Anderer! Damit fingen sozusagen alle seine Probleme an. Fangen sie für jeden an, glaubt er. Er ist ein Philosoph, seit er denken kann. Er denke zu viel, sagte ihm mal ein Mädchen, er nehme sich zu wichtig, ein anderes. Er zieht das in Betracht, ist aber nicht sicher, ob es stimmt. Und wenn er wirklich zu viel denkt, wo ist der Aus-Knopf, um das zu beenden?
Zu seinem Guesthouse „White Tara“ geht es durch diese unglaublichen, uralten Gassen. Sein Kopf und seine Brust werden wieder frei, die Beine schreiten mühelos. Die Augen versuchen vergeblich und gerade deshalb umso lustvoller, alle Einzelheiten entlang des Weges zu erfassen. Lächeln hebt seine Mundwinkel. Das berühmte, alte Hippie-Restaurant dort heißt, so passend für diese Stadt, „Hungry Eye“. Vorbei geht es an mit Schnitzereien übersäten Stützbalken, Fenstern und Türen windschiefer Häuschen, die sich gegenseitig stützen und keinen Durchlass bieten. Auf einer verwitterten Holztür tanzt fröhlich das Relief eines Skeletts und begrüßt schon seit Jahrhunderten die Heimkehrer, besonders eindrücklich wohl die nächtlichen. Oben in einer der Fensteröffnungen, kauert ein hagerer Alter mit gemustertem Käppchen, der zufrieden an einer gewaltigen Wasserpfeife saugend, das Treiben beobachtet. Vermutlich gönnt er sich ein wenig Opium oder zumindest Haschisch, das man hier Charas nennt. Vorrecht derjenigen, die nach einem Leben voller Mühe in die geruhsame, letzte Lebensphase eingetreten sind. Nick fühlt sich in das Lieblingsbilderbuch seiner Kindheit versetzt – „Mecki im Schlaraffenland“. Jede Seite mit einer großen, querformatigen Illustration geschmückt. Eine war besonders liebevoll ausgestaltet, der Einzug von Mecki durch eine Gasse in die Stadt des Schlaraffenkönigs. Auch hier wimmelte es von märchenhaften und grotesken Figuren, die aus Ecken und Giebeln lugen, Pfeife rauchend, Töpfe ausleerend und Fratzen schneidend. Mittelalter von seiner pittoresken Seite, wie es sonst nirgends auf der Welt noch erlebt werden kann. Außer hier und in einigen Ecken von Marrakesch, Fes und Alt-Delhi. Wo sture Zivilisationsverweigerer mit gefärbten Bärten, in blaugrünen Nischen der Kashba hockend, die von trüben Glühbirnen mehr verdüstert als erhellt werden, ihren archaischen Geschäften nachgehen. Jetzt am Nachmittag ist auch längst der Gestank verzogen, der sich unweigerlich jeden Tag im kühlfeuchten Frühnebel ausbreitet. Wenn in den Nebengassen dunkle Silhouetten in Hockstellung aufgereiht entlang einer Mauer sitzen. Einer neben dem anderen in angemessenem Abstand und mit hochgezogenem Hemd, um dort wie in Absprache einen dampfenden, morgendlichen Haufen zu hinterlassen. Der in den folgenden Stunden zuverlässig von kastenlosen Straßenkehrern und streunenden Hunden beseitigt wird. Als Nick das zum ersten Mal sah, traute er seinen Augen kaum. Nichtsahnend hatte er am Tag zuvor sein Zimmer in einem stattlichen, mehrstöckigen Guesthouse bezogen, das aber ausgerechnet am Ende einer solchen Straße der Notdurft lag. Diese ist offenbar meist da, wo eine Straßenseite von einer Mauer begrenzt wird, mindestens eine Seite also keine Zugänge zu Wohnhäusern aufweist. Er zog daraufhin schleunigst um, da es zu seinen Gewohnheiten gehörte, gleich frühmorgens in dieser kritischen Zeit das „Swiss Restaurant“ im Zentrum der Altstadt für Milchkaffee und Käse-Omelett anzusteuern. Um die Schultern geschlagen, trug er dann über seiner Jacke einen breiten Wollschal, sein einziges Zugeständnis an den Kleidungsstil des Himalaya.
Er steuert geschmeidig durch das Gewühl, vorbei an gebrechlichen Greisen und Müßiggängern, die an den Ecken lungern, wird selbst im Eilschritt überholt von Warnrufe ausstoßenden Lastenträgern. Er ist nun ganz eins mit dieser Welt und seinem Körper, der ihn, als funktioniere er autonom, leichten Schrittes durch die Gassen und ohne Stocken um alle Hindernisse trägt. In einem, der für kleine Läden vorgesehenen, offenen Erdgeschoss-Räume wird schneeweißer, frischer Joghurt in flachen Tonschalen angeboten. Ein kurzes Zögern, aber die aufkeimende Lust vergeht sofort wieder nachdem ein Dickwanst im ersten Stock laut vernehmlich seinen Rotz hochzieht und im Bogen neben ihm auf die Straße spuckt. Eine bedauerliche Angewohnheit der sonst liebenswerten Einheimischen. Wie von unsichtbaren Fäden gezogen biegt er um die Ecke und steht nun vor dem „White Tara-Guesthouse“, dessen bunt bemaltes Schild ihn heimatlich grüßt. Sein einziger Rückzugsort in dieser chaotischen Welt. Bett und Obdach, die ihm zustehen, dank der dicken, schmierigen Bündel nepalesischer Rupees, die er für jeden seiner griffigen, neuen 100-Dollar-Noten erhält. Er beugt sich beim Eintreten durch die niedrige Holztür und zieht zugleich seine Füße hoch, um nicht über die hohe Schwelle zu stolpern. Im Haus herrscht solch eine Stille, dass es verlassen wirkt. Es riecht leicht nach Räucherstäbchen und Moder. Auf den zweiten Blick erst sieht er im Halbdunkel den Besitzer, der sich gerade mit einem Schraubenzieher an einem Lichtschalter zu schaffen macht. Ein rundköpfiger Sherpa mittleren Alters, der ihn nun wie immer bei seinem Anblick so breit angrinst, dass sein Mund den Kopf vollständig in einen oberen und unteren Bereich teilt. Seine Augen kneift er dabei so schmal zusammen, dass Nick sich unwillkürlich fragt, wie viel er so überhaupt sehen kann. Allerdings hat er manchmal den Eindruck, dass er sogar mehr sieht als er sollte, dieser kleine Schnüffler. Seine Gesichtshaut strafft sich faltenlos. Da er gerade die Hand in Nicks Gesichtsfeld hebt, nimmt Nick auch die teuer aussehende, goldfunkelnde Uhr am Handgelenk wahr und fragt sich unwillkürlich wie der Betreiber einer bescheidenen Unterkunft sich so etwas leisten kann. Plötzlich so dicht einander gegenüberstehend, sieht Nick alle Details an seinem Gegenüber wie unter einer Lupe, es fühlt sich an, als sei man sich zu nahe gekommen. Sacht tritt er ein wenig zurück. Das passiert ihm oft und der Widerspruch zwischen seiner peinlich genauen Wahrneh-mung der physiognomischen Eigenheiten seines Gegenübers und der formalen Höflichkeit der Beteiligten, belustigt ihn immer wieder. Er fragt sich manchmal ob das auch anderen so geht.
„Namaste Sir, wie gehts? Wissen Sie, dass ein berühmter Lama heute Abend ein Teaching gibt? Dorje Rigpa aus Sikkim. Sie haben vielleicht schon gehört von ihm. Nicht weit von hier in der Nähe des Marktplatzes. Sehr guter Lama!“. Der Wirt weiß, dass Nick sich für so etwas interessiert. „Ah ja, danke, wann und wo genau?“. Die Neuigkeit berührt Nick eigentümlich. In diesem Land scheint alles bedeutungsvoller und weniger zufällig als anderswo. Wahrscheinlich weil er hier auf der „Suche“ ist oder diese deutlicher und drängender hervortritt als in seinem Alltag in Europa. Instinktiv fühlte er sich schon als Teenager vom Buddhismus angezogen und das vertiefte sich noch, da er es schätzt, von ihm nicht zum Glauben gedrängt, sondern zur Selbsterfahrung angeregt zu werden. Es muss etwas geben, DAS, das auch er finden kann und wo, wenn nicht hier? Welchen Sinn hat sonst alles? Dieser ungeheure Aufwand des Lebens, all die mit unendlicher Mühe geschaffenen Tempeln, Bibliotheken und entbehrungsreichen Übungswege. Alles was seinen Weg kreuzt, kann für ihn ein Zeichen sein, eine Aufgabe, es gilt wachsam zu sein, keine Chance zu verschwenden. Er wird den Lama aus Sikkim also aufsuchen. Wie „Mr. Bob“ sein Wirt sagt, der als Fan von Bob Dylan so gerufen werden will, ist es nicht weit. Ein paar Ecken weiter in einer Richtung, die er noch kaum erkundet hat, Richtung Fluss. Einmal erst ging er bisher in diese Richtung und kam zu einer kleinen Brücke, von der aus man den Unrat im schlammigen Flussbett sah und darin etwas, das wie eine zerbrochene Puppe aussah. Es war ein toter Säugling. Entsetzt kehrte er auf dem Absatz um, wollte nicht weiter in die Viertel der Stadt vordringen, die nur über diese Brücke des unwürdigen Todes zugänglich sind.
Nachdem sich Nick umgezogen hat, macht er sich auf zu der von Mr. Bob angegebenen Adresse. Das Gebäude in dem das Teaching stattfindet, erweist sich als ungewöhnlich langes, eingeschossiges Ziegelgebäude mit einer gleichförmigen Reihe von Fenstern, die mit geschnitzten Holzgittern versehen sind. Der Zweck des Gebäudes ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Es wirkt abweisend, nur für Befugte zugänglich. Niemand ist zu sehen, aber eine Tür steht offen, neben der eine kleine Tafel mit einer Beschriftung in Nepali angebracht ist, die Nick nicht entziffern kann. Aber hier muss es sein. Zögernd hebt er den Fuß über die hohe Holzschwelle und befindet sich in einem mit Steinplatten gefliesten langen Gang, der ins Dunkel führt. Er zögert, strohige Trockenheit macht sich im Mund breit. Er geht ein paar Schritte, niemand ist zu sehen. Eine offene Tür erscheint zu seiner Linken. Er blickt im Vorbeigehen hinein und bleibt wie angewurzelt stehen. Ein langer, schmaler Saal zieht sich die ganze vergitterte Fensterfront entlang, von der er gedämpftes Spätnach-mittags-Licht erhält. Er ist überfüllt mit Menschen, die stumm auf dem Boden hocken. Kein Laut ist zu hören. Auf der, der Tür gegenüber liegenden Schmalseite, leicht erhöht auf einem Podest, sitzen mehrere in den Raum blickende Personen, die sofort als bedeutend zu erkennen sind. Er nimmt seidigglänzende, farbige Roben wahr, aber alles tritt in den Hintergrund durch die Ausstrahlung einer stattlichen Frau mittleren Alters, die rechts sitzt. Sie ist eine ungewöhnliche Erscheinung, nicht wie eine Nonne oder Würdenträgerin gekleidet, sondern eher malerisch wild wie eine Yogini, eine Tantra-Meisterin aus den Bergen. Die langen, dichten Haare zu einem großen Haarknoten nach Saddhu-Art gebunden, der verwegen schräg auf dem Kopf sitzt. Aus dem Knoten fallen Strähnen über ihre Schulter, über klobige Holzperlenketten, an denen aus weißen Knochen geschnitzte Anhänger baumeln. Sie wirken wie kleine Totenschädel, aber Nick kann das aus der Entfernung nicht genau erkennen. Nachdem er sich möglichst unauffällig zwischen die nächsten Sitzenden gedrückt hat, fährt er fort, die Frau neugierig zu betrachten. Und als ob sie das spürt, sendet sie den Strahl eines durchdringenden Blicks quer durch den Raum, bis ganz nach hinten, wo Nick sitzt. Er hat den Eindruck, dass sie leise lächelt. Nun, jedenfalls scheint sich der Weg gelohnt zu haben. Diese Leute machen Eindruck und die vielen, ehrfürchtig schweigenden Besucher bezeugen ihren Rang. Es sind überwiegend Einheimische hier in einer bunten Mischung. Sowohl Hindus, erkennbar an ihren Nepali-Käppchen, als auch Buddhisten, so wie kleine Gruppen von Westlern. Eine kahl geschorene, weißhäutige Dolmetscherin in dunkelroter Wollrobe übersetzt mit sanfter Stimme die segnenden Begrüßungsworte des Lamas, der im Zentrum sitzt. Seine Lachfalten und funkelnden Augen fallen Nick auf. Er ist mittelgroß, sehnig, wirkt sportlich und kantig. Er hat nicht die oft rundlich-weichen Gesichtszüge der tibetischen Mönche. Seine Haare sind nicht geschoren, sondern jugendlich strubbelig, passend zum lebhaften Eindruck den er macht. Er sitzt mühelos aufrecht, seine Bewegungen sind energisch aber kontrolliert. Er gibt eine Belehrung zum Thema „Anhaftung“:
Aus dem grundlegenden Irrtum ein vom großen Ganzen getrenntes Wesen zu sein, ergeben sich unvermeidlich weitere falsche Vorstellungen und leidvolle Gedanken, Worte und Taten. Es entsteht das „Begehren“. Das Begehren, das alles einteilt in Dinge, die man haben will, ablehnt oder die einem gleichgültig sind. Symbolisiert vom Hahn für Gier, Schlange für Abneigung und Schwein für Indifferenz. Die auf den bekannten Rollbildern, auch bei Touristen als Souvenir beliebt, im Zentrum des Rades der Wiedergeburten zu sehen sind. Dieses antreiben, wie Hamster ihr Laufrad. All diese Begriffe haben eine seit Jahrtausenden definierte präzise Bedeutung. Es sind nicht nur die persönlich gewählten Worte eines Predigers. Der Vortrag hat eher den Charakter einer akademischen Vorlesung, als einer Predigt. Allerdings aufgelockert vom verschmitzten Lächeln dieses irritierend kumpelhaft wirkenden Meisters. Einem Mann von der Sorte mit der man gerne ein Bier trinken würde. Zur Bekräftigung seiner Worte zieht er seine Armbanduhr mit Metallarmband ab, lässt sie um einen Finger kreisen, greift sie mit einer ruckartigen Bewegung und sagt: „Wenn unsere teure Uhr auf den Boden fällt, empfinden wir sofort großen Schmerz. Wenn wir dasselbe bei einem anderen beobachten, schmerzt uns das kaum. Der Irrtum eine Person zu sein und daher Dinge zu besitzen und zu brauchen die ‘mir‘ gehören, führt zu diesen Gefühlen, die uns so alltäglich und selbst-verständlich erscheinen. Anhaftung ist allerdings nicht nur eine Art falscher Gedanke, den man los wird indem man ihn durchschaut, sondern sie gehört untrennbar zu dem Phänomen des scheinbaren Ich-seins selbst.“ Nick hört gebannt zu, deshalb war er gekommen, alles fühlt sich völlig stimmig an. Er muss nur lange genug zuhören, Zeit in der Nähe solcher Lehrer verbringen, bis es irgendwann in der Zukunft „Klick“ macht und er es endlich geschafft hat – so leben wie bisher auch, aber nun mit unerschütterlichem innerem Frieden, ohne Leid. Eine hellhäutige, hagere Frau neben ihm, Hippie-Look, eine Gebetskette um den sommersprossigen Arm gewickelt, schaut immer wieder mit gerunzelten Brauen zu ihm herüber. Jeder Blick ist wie ein geworfenes Steinchen, erzeugt störende kleine Wellen auf dem Wasserspiegel seiner gehobenen Stimmung. Unauffällig guckt er an sich herunter, um einen Makel zu entdecken, findet aber nichts. Allerdings bemerkt er, als er sich bewegt, um seinen Rücken zu straffen, dass sein neues Deodorant, das er in einer winzigen Drogerie des AltstadtBasars gekauft hat, im Laufe des Tages einen zunehmend penetrant-süßlichen Geruch entwickelte. Der jetzt als warmer Dunsthauch aus seinem Flanellhemd aufsteigt. Vermutlich ist es das. Diese westlichen Yoga- und Meditations-Freaks gehen ihm auf die Nerven. Er macht möglichst einen großen Bogen um sie und ihre abgedroschene Sammlung von Spruchweisheiten wie „Der Weg ist das Ziel“, die sie bei jeder Gelegenheit hervorholen. Sie sind so übermäßig sensitiv, dass ihre Liebe zu allen fühlenden Wesen sich schon durch einen aufdringlichen Duft verflüchtigen kann. Sarkasmus kräuselt seine Nase und Aversion sträubt seine Nackenhaare. War im Ashram des berühmt-berüchtigten Bhagwan, später Osho genannt, nicht auch jedes Parfüm und Deo verboten? Der Bekleidungsstil dieser spirituellen Schimären, die weder östlich noch westlich sind, reicht vom vollständigen Kopieren tibetischer oder indischer Kleidungsstile bis zu unterschiedlichsten Kombinationen dieser Elemente mit westlicher Kleidung. Er hasst das, er kleidet sich so, wie er es auch anderswo täte, den Anforderungen der Reise und Wanderungen angepasst. Somit hat er diese Angelegenheit geklärt und wendet sich wieder dem Lama zu, wenn auch noch mit unterschwelligem Groll, der Schlange die leise zischt.
Es gibt nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. „Was ist anders, wenn man erleuchtet ist?“. „Der Orangensaft schmeckt besser!“ Augenzwinkernd nimmt Dorje Rigpa das Glas das neben ihm steht und nippt daran.
„Kann man auch glücklich sein, wenn man durch einen Wald geht, der wegen Umweltschäden stirbt?“ Ein entschiedenes „Ja“ und bekräftigendes Nicken.
Nick schluckt, das geht ihm nun doch zu weit. Was allerdings beweisen dürfte, dass er noch nicht den vollen spirituellen Durchblick hat, sonst säße er ja auch nicht hier. Ok, noch mal – wenn man das wahre Glück „nicht bedingt“ nennt, dann kann es eben nicht von Bedingungen abhängen, auch nicht vom Zustand der Bäume. Rein theoretisch passt das. Könnte er das doch nur tief empfinden und ES nicht nur begrifflich erfassen. So geht es eine Weile weiter. Sonst hat auch er immer quälende Fragen, aber jetzt fällt ihm partout keine von Bedeutung ein. Aber der nächste Teil der Zeremonie hat schon begonnen. Die Anwesenden scheinen die Abläufe zu kennen, bilden eine Warteschlange, die sich langsam nach vorne schiebt, an der Bühne vorbei, wo jeder den Segen empfängt. Nick reiht sich ein und rückt in kleinen Schritten nach vorne. Er gibt sich selbst nicht Rechenschaft, warum er das tut, es geschieht einfach spontan. Er ist nun mal hier und Teil des Ganzen. Um sich zu sammeln, fixiert er den breiten, gebeugten Rücken vor sich. Er ist geborgen in einer gleichgestimmten Menge. Gäbe es weit hinten in seinen Kopf nur nicht den lästigen Beobachter, der alles kommentiert. Die tiefstehende Sonne schickt jetzt magische Strahlenbündel durch die Fenstergitter, die unvermittelt in seinem Augenwinkel aufleuchten. In den Strahlen blinken Staubteilchen wie kleine Sterne, sie treffen auf Messing-Gefäße und aufblitzende Brokatfäden. Er fühlt sich in eine andere, viel ältere Zeit versetzt. Nun ist er an der Reihe. Eine Verbeugung und der Lama legt ihm eine rote Schnur locker um den Hals und verknotet sie mit geübter Bewegung, ein Mantra rezitierend. Er sagt mit leiser, klarer Stimme auf Englisch, dass er, wenn er „Zuflucht“ nehmen wolle, anschließend in das Hinterzimmer kommen könne. Seine Augen blicken gütig. Nicks Atem geht schneller, er hat das Gefühl, in einen Sog geraten zu sein, der ihn mit sich trägt. Das Hin- und Her-Strömen all dieser Körper, Wogen von murmelnden Stimmen und Leibern. Es ist wie ein Rauschen von Wind in den Blättern eines Baumes. Irgendwie findet er zu seinem Platz zurück und verharrt dort. Allmählich lichtet sich das Durcheinander, es kehrt wieder Ruhe ein. Die malerisch gewandete Yogini mit dem Haarknoten sagt mit kräftiger Stimme einige unverständliche Sätze auf Nepali, auf die die Anwesenden mit einem kurzen, rituellen Singsang antworten. Dann fordert die Übersetzerin alle die Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nehmen möchten, nach vorne zu kommen, von wo sie ins Nebenzimmer geleitet werden, um die Einweihung zu erhalten. Sie äußert abschließend den Wunsch, dass der Verdienst, der durch diese Versammlung erworben wurde allen fühlenden Wesen zugute komme, dass sie von allem Leid befreit werden mögen. Ohne nachzudenken stellt Nick sich zu einer Gruppe, aus der sie jeweils zu dritt nach hinten geführt werden. Er nimmt kaum wahr, wer die Anderen sind, sein Kopf ist wie leergefegt. Plötzlich sieht er den Lama vor sich. Der blickt ihn schmunzelnd an und fragt nach seinem Namen. Dann sagt er „du bist schon viel herumgekommen, nicht wahr?“ Nick ist verblüfft, das ist eine wahrlich treffende Bemerkung. Allerdings trifft sie wohl auf die meisten Westler zu, die sich hier herumtreiben. Schon ertönt die Formel „Buddham saranam gacchami”, Zuflucht zu Buddha, zum universellen Gesetz und der Gemeinschaft. Er spricht sie nach. Nach einem weiteren prüfenden Blick schreibt der Lama mit zierlicher Schrift seinen Einweihungs-Namen auf einen kleinen Zettel und überreicht ihn Nick. „Karma Sherab“ heißt er nun. Nick verstaut ihn behutsam in seiner Hemdtasche. Der Kommen-tator in ihm ist auch jetzt zur Stelle und fragt, ob vielleicht nur seine gelehrtenhafte, schmalrandige Brille zu dem Namen inspiriert hat, denn „Sherab“ heißt „Weisheit“. Obwohl er eigentlich keine Brille braucht, gefällt sie ihm manchmal als Accessoire, John Lennon trug auch so ein rundes Metallgestell. Heute hat er sie aus einer Laune heraus aufgesetzt. Er und seine zwei unbekannten, neuen Weggefährten erheben sich und machen den nächsten Platz.
Nick geht geradewegs durch den langgestreckten Hauptraum zur Tür und verlässt das Gebäude. Draußen hält er aufatmend inne, es dunkelt bereits. Was für ein Tag. Es gibt nichts weiter zu tun, aber für den Schlafsack ist es noch zu früh. Nun ist er offiziell Buddhist, was sich richtig und feierlich anfühlt. Aber – dennoch, er hat nicht vor sich völlig vereinnahmen zu lassen, von welcher heiligen Gemeinschaft auch immer. Obwohl er bestimmt nicht völlig frei ist, so will er doch zumindest seine Freiheit gegen jeglichen Anspruch von Außen verteidigen. Auch wenn er sich wie jeder sehnt, irgendwo dazu zu gehören, er hat sich dennoch immer Kirchen, Armeen, Parteien und Vereinen verweigert. Das war jetzt weder eine Taufe noch die Konvertierung zum Islam, kein religiöser Buchhalter im Himmel oder auf Erden soll ihn je zur Rechenschaft ziehen. Er bezeichnet sich als Agnostiker. Man kann mittels Denken und Logik weder beweisen, noch widerlegen, dass es eine höhere Macht gibt. Er steuert den Platz beim nahen Königspalast an. Er muss beim Gehen konzentriert das Dunkel vor seinen Füßen fixieren, um Hunden, Abfallhaufen und Löchern auszuweichen. Noch um eine Ecke und da ist der Platz - ein märchenhaftes Ensemble von Pagoden, deren elegante Silhouetten sich gegen den Abendhimmel abzeichnen. So malerisch ist die Szene, dass sie unwirklich wirkt. Die Kulisse eines Fantasy-Films. Aber eines, der von einem begnadeten Designer ausgestattet wurde. Hier kann er in der lauen Luft auf den hohen Stufen sitzen, ungestört, entrückt, einige Meter über dem Treiben. Oft genießt er das auch tagsüber. Meist treiben sich hier kleine Kinder aus der Nachbarschaft herum. Nick fiel auf, wie angenehm er deren Gesellschaft empfindet, anders als die der nach Aufmerksamkeit heischenden, verwöhnten Bälger in Europa. Er fühlt sich wohl mit ihrer arglosen und unaufdringlichen Art. Nie gibt es Geschrei und Geheule und die wenig Älteren kümmern sich schon um ihre jüngeren Geschwister, schleppen sie geduldig auf dem Rücken umher.





























