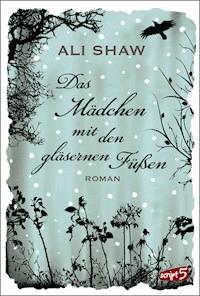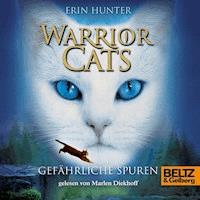3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anna Katharina Scheidemantel
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
„Selbst Vögel müssen ins Ungewisse aus dem Nest springen, bevor sie lernen, dass sie fliegen können.“Aurelia Fehrmann ist sechzehn Jahre alt und glaubt nicht an mysteriöse Zufälle. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sie auf dem Dachboden ihrer Großeltern eine alte Truhe findet. Darin: Das Tagebuch einer jungen und kreuzunglücklichen Adligen, die über hundert Jahre vor ihr lebte und sie mit ihren Worten trotzdem sofort in den Bann schlägt. Fasziniert versucht Aurelia, mehr über die geheimnisvolle Patrizia von Eschbach herauszufinden – bis sie zu viel weiß und sich selbst in gefährliche Probleme verstrickt, in einem Leben, das nicht ihres ist und in einer Zeit, die ganz eigenen Regeln folgt…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
© 2014, Anna Katharina Scheidemantel, Gerlingen
www.aks-autorin.jimdo.com
1. Auflage
Umschlagillustration: Anna Katharina Scheidemantel
Innengestaltung: Anna Katharina Scheidemantel
Titelschriftart: Jellyka Delicious Cake, © Jellyka Nerevan
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks auf jedwede Weise, sind vorbehalten.
Für Esther, Carmen und Antje
– weil ihr mich gesehen habt, als ich noch unsichtbar war.
Inhalt
Prolog
1 – Berlin
2 – Entdeckungen
3 - Das Tagebuch
4 – Lesen
5 – Nächtliche Suche
6 – Recherche
7 – Eine Theorie
8 - Erwachen
9 – Die Begegnung
10 – Familie von Eschbach
11 – Der Bankiersball
12 - Florentin
13 – Ein Besuch
14 – Gefängnisse
15 – Geisterleben
16 – Die Warnung
17 – Feuerstolz
18 – Die Jagd
19 – Die Verlobung
20 – Ein Entschluss
21 – Abschied
22 – Der Aufbruch
22 – Berlin im Rücken
23 – Auf der Reise
24 – Verfolger und Verräter
25 – Die ganze Wahrheit
26 – Die drei Reisenden
27 – Nächtliches Picknick
28 - Eingeholt
29 – Veränderungen
Danksagung
Prolog
Ein G.
Es hing einen winzigen Augenblick lang in der Stille, dann wurde es verweht durch die aufschlagende Tür. Eine ältere Dame mit krausem Haar trat ein.
„Ihr Vater wünscht Sie zu sprechen.“
Das Mädchen erhob sich vom Klavierhocker. Sie ließ den Deckel offen stehen und strich noch einmal über die Klaviatur, wie zum Abschied. Dann raffte sie ihre Röcke und folgte der alten Dame, die das Musikzimmer bereits verließ.
Sie gingen durch eine große Halle, über glänzend gewachsten Boden, zu der Tür, an die nur in äußerst dringenden Notfällen geklopft werden durfte und hinter die man nur in äußerst seltenen Fällen einen Blick werfen durfte.
Es sei denn natürlich, man wurde gerufen, so wie heute.
Die alte Dame ordnete ein paar dunkelblonde Strähnen neu, die sich aus der aufwendigen Frisur des Mädchens gelöst hatten, und strich nichtexistente Falten an ihrem moosgrünen Kleid glatt. Als das Mädchen nervös Luft holte, schenkte sie ihm ein aufmunterndes Lächeln.
„Aber, aber - man muss sich doch nicht vor seinem eigenen Vater fürchten.“
Damit öffnete sie die Tür.
Das Mädchen trat zögernd ein. Das Gesicht ihres Vaters empfing sie, streng und unlesbar wie immer, umrahmt von der dunklen Wandvertäfelung seines Büros. Seine stechenden Augen musterten sie von oben bis unten, als sähe er seine eigene Tochter zum ersten Mal, als hätte er sie siebzehn Jahre lang mit ganz anderen Augen gesehen als heute.
Er rückte einige Kleinigkeiten auf seinem massiven Schreibtisch zurecht, sagte ewig kein Wort. Die Stille wurde bedrückend, erstickend irgendwie. Wartete er vielleicht darauf, dass sie etwas sagte?
„Sie haben mich rufen lassen, Vater?“, fragte sie vorsichtig.
Er nickte bedeutungsvoll.
„Du wirst bald siebzehn.“
Sie nickte, nicht wissend, was nach dieser Feststellung kommen sollte.
„Du bist kein Kind mehr. Kein kleines Mädchen. Du bist jetzt eine Frau. Eine junge Dame von adligem Stand.“
Sie wartete schweigend ab. Er nahm eine körnige Fotografie vom Schreibtisch. Ein junger Mann im schwarzen Frack, seine Dame im blütenweißen Kleid. Er selbst, vor zwanzig Jahren.
„Es wird Zeit, dass du den Bund der Ehe eingehst. Ich denke, das wirst du längst wissen. Und ich denke, du wirst nicht überrascht sein, wenn ich dir sage, dass ich jemanden gefunden habe, der dir eine sorgenfreie und standesgemäße Zukunft ermöglichen kann und wird.“
In den Augen des Mädchens wachten Befürchtungen auf. Wie ein verschrecktes Reh hörte sie ihrem Vater zu, innerlich leer bis auf die Angst, die ihre kalten Klauen nach ihrem Herz ausstreckte.
„Ihr kennt euch bereits gut. Ich bin mir sicher, du wirst die Wahl ebenso treffend finden wie deine Mutter und ich. Aus zwei geschäftlich eng verbundenen Familien wird eine. Eure Väter haben dafür gesorgt, dass eure Zukunft mit Gold gepflastert ist. In wenigen Monaten wirst du Frau Baronin von Stettenwald sein.“
Die kalten Klauen schlossen sich um das flatternde Mädchenherz. An dieses Gefühl des Gefangenseins, des Erstickens würde sie sich gewöhnen müssen. Ihr ganzes Leben würde ab jetzt davon geprägt sein, das wusste sie in diesem Moment mit nie dagewesener Sicherheit.
„Es ist bereits alles in die Wege geleitet. Die Verlobung wird im Frühjahr sein, im Sommer werden wir Hochzeit feiern. Ich erwarte von dir, dass du unserer Familie Ehre erweist.“
Am geöffneten Fenster zitterten die Vorhänge lautlos im Wind. Es war, als würde all ihre Hoffnung durch ebendieses Fenster verschwinden und sie zurücklassen mit einem Leben voller Tristesse und Einsamkeit. Die wenigen Träume, die sie gehabt hatte, verloren sich im grauen Januarhimmel.
Während sie noch versuchte die Tränen wegzublinzeln, bebten die Vorhänge wieder und ein Schatten stahl sich davon, nicht sichtbar und doch anwesend, im Mundwinkel ein Lächeln.
1 – Berlin
Als ich die Augen aufschlug, wusste ich zunächst nicht, wo ich war. Die Decke über mir war grau und fleckig, die Tapete an den Wänden des kleinen Zimmers löste sich bereits am oberen Ende. Auf dem Mahagoninachttisch neben mir tickte etwas mit der Lautstärke eines Presslufthammers.
Ich wälzte mich herum. Jetzt wusste ich wieder, wo ich mich befand – im Erkerzimmer des Hauses meiner Großeltern, auf einem quietschenden Bettgestell, genau dort, wo ich mich eigentlich jedes Jahr am Anfang der Sommerferien befand. Im alten Apfelbaum vor dem Fenster zwitscherte ein Vogel und durch die Vorhänge vor dem Erkerfenster drang genug Sonnenlicht, um mich zu blenden.
Ich drehte meinen Kopf, um auf den Wecker zu schauen, der auf dem Nachttisch stand, etwa so alt sein musste wie meine Großmutter und im Übrigen Urheber des Presslufthammergeräusches war. Viertel vor neun.
Irgendwie fand ich keinen Grund, aufzustehen. Dabei konnte ich mich eigentlich nicht beklagen. Die Sommerferien hatten gerade erst angefangen, das Wetter war herrlich und ich hatte ganze sechs Wochen, um zu faulenzen und mich von der Schule zu erholen. Da meine Eltern geschieden waren und beide arbeiteten, hatte meine Mutter mich wie üblich bei meinen Großeltern in Berlin ‚geparkt‘, wo ich vier ganze Ferienwochen verbringen sollte. Ich hatte auch absolut nichts gegen meine Großeltern, aber die Aussicht darauf, vier Wochen bei ihnen zu verbringen, versetzte mich nicht gerade in Freudentaumel. Der Alltag von zwei alten Leuten bot für eine Sechzehnjährige wenig Abwechslung. Draußen lockte zwar die Metropole, doch sie ganz allein zu erkunden machte wenig Spaß, vor allem, wenn man meinen - besser gesagt keinen - Orientierungssinn besaß.
Ich wälzte mich noch einmal im Bett herum und entlockte dem Gestell dabei einen trommelfellzerschneidenden Ton, dann beschloss ich, dass ich wohl doch nicht mehr einschlafen würde. Als ich mich auf die Bettkante setzte, jaulte das Bett wieder auf.
Seit ich klein war, bewohnte ich dieses Zimmer in den Sommerferien. Ich kannte jeden Winkel und mittlerweile war es mir auch ans Herz gewachsen. Es hatte große Fenster, die den kleinen Raum mit Helligkeit überfluteten, und in einer Ecke hatte es einen kleinen Erker, dem es seinen Namen verdankte. Vor zwei Sommern hatten Opa und ich dort eine kleine Sitzecke eingebaut. Auf dem massiven Schreibtisch hatte Oma wie immer Zeichenpapier für mich bereitgelegt, obwohl mein Talent sich weiterhin in engen Grenzen bewegte, und auf dem Nachttisch lag wie jeden Sommer Stolz und Vorurteil, obwohl ich Oma schon mindestens hundertundeinunddreißigmal gesagt hatte, dass ich Schnulzen nicht ausstehen konnte.
Endlich! Meine Zehen ertasteten die Hausschuhe - ein wichtiges Kleidungsstück in einem Haus, in dem es Ecken gab, in die sich seit zwanzig Jahren niemand mehr mit dem Staubsauger hineingewagt hatte.
Unten würde mich mit höchster Wahrscheinlichkeit ein gewaltiges Frühstück erwarten.
Tatsächlich saßen Oma und Opa schon am Frühstückstisch, der reich gedeckt in ihrem kleinen Wintergarten stand. Ich schob die Blätter einer Zimmerpalme zur Seite und ließ mich in einen der Korbstühle fallen.
„Guten Morgen, mein Schätzchen. Möchtest du Kaffee?“, fragte mich Oma mit ihrer kratzigen, aber hellen Stimme. Ich seufzte.
„Lieber Kakao!“ Sie hoffte wohl immer noch, dass ich Gefallen an ihrem Kaffee finden würde, den sie mir bereits seit drei Sommerferien täglich anbot. Aber erstens konnte ich Kaffee nicht ausstehen und zweitens würde ihre Giftbrühe an ersterer Tatsache mit Sicherheit nichts ändern. Mama behauptete immer, das Zeug würde wie „Wasser aus dem Nil mit ein paar rohen Kaffeebohnen“ schmecken, wobei sie das nicht wissen konnte, denn sie war noch nie am Nil gewesen.
Oma schenkte mir Kakao aus einer Karaffe ein. Er war schon längst zubereitet, denn auch Opa wagte sich nur noch selten an Omas Kaffeebrühe heran. Er schob immer seine Nierenprobleme vor, aber in Wirklichkeit konnte er die Flüssigkeit ebenso wenig ausstehen wie ich. Komischerweise war gekonntes Kaffeebrühen die einzige Fähigkeit, die Oma ihr Leben lang versagt geblieben war, denn Kochen und Backen konnte sie ausgezeichnet, sogar ihre selbstgepressten Obstsäfte waren tausendmal besser als ihr Kaffee.
Ich nippte an meiner Tasse und nahm mir dann ein Brötchen aus dem gut gefüllten Korb, um es mit Erdbeermarmelade zu beladen. Eben wollte ich den ersten Bissen nehmen, da wandte sich Opa an mich.
„Und - was hast du für heute vor?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Weiß nicht. Nichts Bestimmtes.“
„Wenn du willst, kannst du mir helfen, den Dachboden ein bisschen zu entrümpeln. Aber musst du nicht. Hast ja Ferien!“ Er grinste schief und entblößte eine Reihe unregelmäßiger, leicht gelblicher Zähne. Seine blauen Augen strahlten auch auf seine alten Jahre noch vor Unternehmungslust.
„Ich schau mich jedenfalls gerne mal oben um!“ Das letzte Mal, dass ich auf dem Dachboden gewesen war, war Jahre her. Im Speicher eines mindestens hundertjährigen Hauses in einem guten Berliner Stadtbezirk fand sich bestimmt allerlei interessanter Krempel.
„Jetzt brumm dem Mädel doch nicht gleich Arbeit für die ganzen Ferien auf, Karl. Lass sie erst einmal essen!“ Aufmunternd schob Oma den Käseteller in meine Richtung. Brav belegte ich die zweite Hälfte meiner Semmel mit Käse. Schrippe, korrigierte ich mich. Ich war schließlich in Berlin und ein paar wesentliche Vokabeln waren über die Jahre dann doch hängengeblieben.
Zwischen Schlucken, Kauen und Abbeißen musste ich gelegentlich eine Frage zur Schule oder meinen Eltern beantworten. Oma wollte wie immer wissen, wie mein Zeugnis gewesen war, ob ich zufrieden war und was meine Mutter denn so machte. Da Mama sehr beschäftigt war, sah sie Oma und Opa oft seltener als ich. Seit drei Jahren fuhr sie mich nicht einmal mehr nach Berlin, sondern setzte mich nur in München in den Zug. Ich war es gewöhnt, also machte es mir nichts aus.
Nach dem Frühstück zog ich mich an, um sofort den Dachboden zu erkunden. Opa war allerdings erstmal zum Getränkemarkt aufgebrochen und so bekam die Entrümplung noch ein bisschen Aufschub. Ich stromerte solange ziellos durch das Haus.
Es war bestimmt hundert Jahre alt, mindestens, und hatte eine schneeweiße, glatte Fassade. Oma hatte das Haus von ihren Eltern geerbt, nachdem ihr Vater gestorben war. Sie hatte keine Geschwister, deshalb war die komplette Erbschaft an sie gefallen. Lange hatte ihre Mutter Marie-Luise noch das oberste Stockwerk bewohnt, doch sie war schon vor meiner Geburt gestorben. Früher hatte ich mich deshalb oben ein bisschen gegruselt, weil dort überall noch alte Möbel, Bilder und Erinnerungsstücke meiner toten Uroma herumstanden, doch mittlerweile machte mir das nichts mehr aus. Im Gegenteil, ich fand es sogar spannend, immer wieder neue von der Zeit angefressene Sachen dort zu entdecken.
Ich malte mir gerne aus, wie das Leben in diesem Haus früher gewesen war. Mama sagte immer, ich wäre eine Tagträumerin, und ganz abstreiten konnte ich das nicht. Jedes Mal, wenn ich hier war, kreuzten unwillkürlich Bilder aus der Vergangenheit in meinem Kopf auf: wie davor Kutschen hielten, wie die vornehmen Herrschaften auf der Veranda Tee tranken, wie jemand auf dem alten Klavier im Salon spielte … Ja, das Klavier hatte es mir besonders angetan. Das lag wohl daran, dass ich selbst Klavier spielte. Ich fragte mich immer, wie das alte Instrument wohl geklungen hatte, bevor der Zahn der Zeit sich in den Kopf gesetzt hatte, es penetrant immer wieder zu verstimmen…
Ja, diese Zeiten würde ich gerne einmal sehen. Natürlich nur kurz, Plumpsklos und Korsetts interessierten mich nämlich eher weniger. Trotzdem war es schade, dass ich nicht den Nachnamen Brauning trug, wie einst meine Oma und damit die Herrschaften, denen dieses Haus seit Generationen gehörte. Ich hieß Fehrmann, wie mein Vater. Das Bild meiner Vorfahren, die früh morgens am nebelverhangenen Fluss standen und auf die Reisenden warteten, gefiel mir zwar auch nicht schlecht, aber das alte Haus war doch faszinierender, mit dem eingewachsenen Garten, dem knarzenden Fußboden, dem von Generationen abgegriffenen Klopfring mit Löwenkopf …
Ok, zugegeben, meine Mutter nannte mich wohl nicht umsonst Tagträumerin.
Opa riss mich mit dem Poltern der Haustür und einem herzhaften „Hallo!“ aus meinen Traumbildern. So, wie er sich zwischen Wohnzimmer und Treppe aufgebaut hatte, erinnerte er mich wie so oft an einen alten, gutmütigen Teddybär. Er hatte sich halbherzig einen weißen Vollbart wachsen lassen, der allerdings alle paar Monate dran glauben musste, nämlich dann, wenn er plötzlich der Meinung war, der Bart würde ihn alt aussehen lassen.
Neben dem noch nicht ganz vollbärtigen Brummbär standen zwei große Getränkekisten und eine Plastiktüte mit Einkäufen.
„Ich bring noch schnell den Krempel hier in den Keller, dann mache ich mich an den Dachboden!“, kündigte er regelrecht enthusiastisch an und ergriff eine der Kisten. Ich nahm die Plastiktüte und trug sie die schmale Treppe in den Keller hinunter. Die Einkäufe waren schnell in die Vorratskammer geschafft. Opa trug auch die zweite Kiste noch nach unten, dann machte er sich auf den Weg nach oben.
Die Treppe zum Dachboden befand sich in einer Nische hinter dem alten Salon der Madame, wie Opa Marie-Luise manchmal nannte. Er schloss die Tür auf und ließ mich zuerst die knarrenden, morschen Stufen hinaufsteigen.
Als ich oben angekommen war, musste ich erst einmal Atem holen. Es roch modrig und die alten Sachen verströmten einen sonderbar süßlichen Geruch. Ich glaubte zu spüren, wie der Staub beim Einatmen in meine Lungen kroch und unterdrückte einen Hustenreiz, der mit Sicherheit noch mehr Staub aufgewirbelt hätte.
Es war düster hier oben, stickig und drückend, und wahrscheinlich krochen auch herdenweise Spinnen herum. Trotzdem faszinierte mich dieser Raum auf Anhieb noch mehr als alle anderen im Haus meiner Großeltern – und wie gesagt, das ganze Haus stellte immer etwas Komisches mit mir an. In allen Ecken schienen hier oben Geheimnisse zu lauern, Erinnerungen an vergangene Zeiten, die nur darauf zu warten schienen, von mir entdeckt zu werden.
Es gab so viel Gerümpel, dass meine Augen Mühe hatten, alles auf einmal aufzunehmen. Neben mehreren Truhen und hölzernen Kisten gab es pappkartonweise alte Papiere und Dokumente, Ordner mit zerfransten Umbänden lagen verstreut herum, es gab ein antikes Sofa, dessen Polster nur noch halb komplett war, dann etwas, das aussah wie ein alter Geigenkasten, zwei alte Schiffsmodelle, mehrere undefinierbare und etwas mitgenommene Möbelstücke, ein paar alte Abdrucke von Bildern, die Gartenszenen und Seerosen zeigten, und hinten in einer Ecke stand eine lange Garderobe mit verstaubten alten Kleidern. Wie konnte Opa das nur ‚entrümpeln‘ wollen? Ein Museum würde ihm bestimmt einige hundert Euro dafür zahlen!
Apropos Opa: Er hatte nun ebenfalls den Gipfel erklommen und baute sich am Ende der Treppe auf, die Hände in die Seiten gestemmt.
„Meine Güte! Das ist ja schlimmer, als ich dachte!“
Ich konnte nicht so recht verstehen, was Opa an dieser wundersamen Ansammlung schlimm fand, aber vielleicht hätte ich anders gedacht, wenn es mein Dachboden gewesen wäre.
„Willst du das ganze Zeug wirklich wegschmeißen?“, fragte ich trotzdem ungläubig.
„Naja, das meiste schon, kann ja nicht ewig hier rumgammeln! Aber vorher müssen wir alles genau durchsehen, kann ja sein, dass noch alte Familienschätze dazwischen sind!“ Er lachte sein tiefes Brummbärenlachen in seinen Bart hinein.
„Ok. Wo fangen wir an?“
Opa schien überrascht von meinem Tatendrang.
„Wo du willst. Such dir was aus!“
Ich nahm die erstbeste Truhe und öffnete den Deckel. Der Großteil des Inhalts schien aus Stoffen verschiedenster Art zu bestehen, aber ich entdeckte auch zwei fragile kleine Statuen: ein von Hunden umringter Jäger und ein Reiter auf einem Pferd. Vorsichtig wickelte ich beide aus den Leinentüchern und stellte sie auf die Dielen des Dachbodens.
„Ach, die alten Dinger! Ich wusste doch, dass sie hier irgendwo herumgeistern. Gut, dass du sie gefunden hast, Aurelia, deine Großmutter nervt mich schon ewig damit!“
„Was sind das für Skulpturen?“, fragte ich.
„Nur zwei alte Figuren, die früher im Salon der Braunings standen. Nichts Wichtiges eigentlich, aber Annegret hat sich gefragt, wo sie geblieben sind.“
Ich durchsuchte die Truhe auf weitere Schätze, konnte aber nur noch Stoff finden.
„Das sollte Oma besser mal selbst durchsehen, wahrscheinlich kann sie das meiste Zeug noch gut gebrauchen!“ Oma nähte gerne, wenn auch nicht immer gut. Kissenbezüge und Schürzen gelangen ihr, aber an Kleider sollte sie sich wohl besser nicht mehr so oft heranwagen. Früher hatte sie mir oft meine Kostüme zu Fasching genäht - mit dem Erfolg, dass keiner erkannte, als was ich mich eigentlich verkleidet hatte.
Ich sah einige Kartons mit Fotos durch. Die meisten zeigten meine Mutter als Kind mit ihren Eltern, und einige Bilder fesselten mich wirklich minutenlang. Ich konnte mir meine Mutter kaum als Kind vorstellen, sie ging jetzt immerhin auf die Fünfzig zu und war bei allem, was sie tat, energisch und patent – erwachsen eben. Nichts erinnerte mehr an dieses kleine Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und Kniestrümpfen. Auch meine Großeltern hatten sich ziemlich verändert, Omas Brillenmodell jedoch nicht.
Irgendwie war es komisch, sich vorzustellen, dass auch ich irgendwann einmal so wenig mit dem schüchternen blonden Mädchen auf meinen Kinderfotos gemeinsam haben würde, dass ich alt werden würde und meine Mutter auch und meine Großeltern, die schon jetzt alt waren … Aber noch waren sie bemerkenswert vital, was Opa just in dem Moment dadurch unterstrich, dass er sich mit einem begeisterten Aufschrei auf die Kiste mit seiner alten Dampfmaschine stürzte.
Nachdem ich beschlossen hatte, dass die Fotos ebenfalls von Oma durchgesehen werden sollten und sie auf die Truhe gestellt hatte, bahnte ich mir den Weg nach hinten, wo mehr Gerümpel stand. Aus einem milchigen Spiegel mit Goldrahmen blickte mir mein Gesicht aus dreckiggrünen Augen entgegen, viel zu blass für Anfang August, umrahmt von glatten, dunkelblonden Haaren mit etwas Rotstich. Ich lächelte ihm schief zu und widmete mich meinen nächsten Entdeckungen – einem Schaukelstuhl mit einigen gebrochenen Rückenstreben und mottenzerfressenem Polster, und einen alten, bereits ziemlich ramponierten Frisiertisch. Hinter der Sperrholzsammlung ragte ein riesiges, metallenes Rad hervor.
„Opa! Wie kannst du nur daran denken, das alles hier wegzuwerfen? Ein Museum würde dir jeden Preis dafür zahlen! Jedenfalls für das hier!“
Das hier war ein altes Fahrrad, dessen Vorderrad bestimmt fünfmal so groß war wie sein Hinterrad. Die Speichen waren bereits stark angerostet und das Fahrrad wohl kaum noch zu gebrauchen, aber bestimmt hundert Jahre alt – oder sogar noch älter.
„Ach, du hast das alte Velo gefunden … Meinst du wirklich, jemand will so etwas haben?“
„Wir können es ja polieren und auf eBay verkaufen!“, schlug ich vor. Opa zog die Augenbrauen fast bis zum Haaransatz hoch - das heißt, bis zu der Stelle, wo früher einmal der Haaransatz gewesen sein musste. Jetzt hatte er nur noch einen feinen Kranz schneeweißer Haare und darüber eine glänzende Glatze.
„eBay … So ein moderner Unsinn! Wenn, dann gibt es eine Zeitungsannonce und einen Anschlag am schwarzen Brett im Supermarkt!“, brummte er.
„Wenn du meinst … Aber ich glaube nicht, dass irgendeine von den Einkaufsomas oder einer von den wenigen, die Zeit haben, sich alle Annoncen durchzulesen, ein Fahrrad aus dem vorigen Jahrhundert haben will!“
„Ach, wir werden einfach deine Mutter fragen. Die kennt sich doch mit so etwas aus!“ Das stimmte. Meine Mutter war Werbefachfrau. Allerdings bewarb die Agentur, in der sie arbeitete, große Firmen und nicht alte Fahrräder. Naja, fragen konnten wir sie ja trotzdem.
Ich schob das Velo, wie es Opa genannt hatte, ein bisschen zur Seite und quetschte mich daran vorbei in die hinterste Ecke des Dachbodens. Auf einem Stapel lagen ein paar alte Kleidungsstücke, bunte Blusen, Overalls und auch richtig schicke Kleider. Dahinter stand, eingeklemmt unter der Schräge, eine weitere Truhe. Ich versuchte sie herauszuzerren, aber sie erwies sich als sperrig.
Das Holz war ziemlich glatt und bot keine Anhaltspunkte für meine Finger, was das Ganze verkomplizierte, aber die Truhe hatte meine Neugier geweckt. Sie war irgendwie anders als die ganzen lieblos gestalteten Kisten, die sonst hier herumstanden: Die Seiten waren mit Schnitzereien und verwitterten bunten Bildern geschmückt und auf ihrem Deckel prangte ein kleines, silbernes Schild mit den eingravierten Buchstaben P.v.E. in sehr alter, verschnörkelter Schrift. Um diese Initialen rankten sich rosenartige Blumen, die kunstvoll in das Metall eingearbeitet worden waren.
Endlich fand ich ein eisernes Schloss, das ich fest umfassen konnte. Ich stemmte mich gegen die Balken des Gewölbes und zog mit all meiner Kraft an der Truhe. Zentimeter für Zentimeter rutschte sie nach vorne, aber sie blieb weiterhin eingeklemmt.
„Brauchst du Hilfe?“, rief Opa vom anderen Ende des Dachbodens. Seine Stimme klang gedämpft durch das ganze Gerümpel, das mich von ihm trennte.
„Nein, geht schon!“ Aus irgendeinem Grund wollte ich nicht gestört werden. Vielleicht, weil ich ganz allein die Erste sein wollte, die einen Blick in diese scheinbar für lange Zeit vergessene Truhe warf, auch wenn dieser Blick vermutlich nichts Spannendes offenbaren würde. Was konnte schon darin sein? Alte Schwarzweißfotos vielleicht oder Kleider oder wieder irgendwelche Statuen. Aber es war wohl das Äußere der Truhe, das mich faszinierte, die bunten Zeichnungen, von denen nichts mehr zu erkennen war, außer, dass es sie einmal gegeben hatte. Außerdem waren da die drei Buchstaben: P-V-E. Das V war allerdings kleiner als die anderen beiden Initialen. Wenn es sich aber um die Anfangsbuchstaben eines Namens handelte, was wohl am wahrscheinlichsten war, konnte ich mir diesen Größenunterschied nicht erklären.
Noch einmal ruckte ich an der Truhe, stemmte mich gegen sie und von ihr weg. Ich hämmerte sogar mit etwas, das wohl einmal ein Hutständer gewesen sein musste, auf ihr herum - als ob das irgendetwas bewirken würde. Ich war kurz davor aufzugeben, da ging ein Ruck durch die Truhe und sie rutschte ein ganzes Stück auf mich zu. Nun konnte es nicht mehr schwer sein, sie so weit unter der Schräge hervorzuzerren, dass ich ihren Deckel öffnen konnte.
Mit meiner eigentlich recht spärlichen Muskelkraft schaffte ich es schließlich, sie an dem dicken Schloss noch ein paar Zentimeter nach vorne zu ziehen. Ja, vielleicht hatte mich auch das Schloss fasziniert. Vielleicht war die Truhe etwas Verbotenes, das man eigentlich nicht anrühren durfte, vielleicht barg sie sogar ein großes Geheimnis, ein Geheimnis, das meine eintönigen Sommerferien urplötzlich zu einem Abenteuer aufwerten würde.
Vielleicht hatte meine Mutter auch Recht und ich hatte einfach zu viel Fantasie. Einen Blick wollte ich trotzdem hineinwerfen.
Endlich hatte ich die Truhe so weit hervorgeholt, dass ich ihren Deckel ein Stück weit öffnen konnte, ohne an die Schräge zu stoßen. Ich wollte ihn sofort anheben, doch es ging nicht. Er ließ sich nicht das kleinste bisschen öffnen. Das schwere Eisenschloss erfüllte tatsächlich seinen Dienst und war verschlossen.
2 – Entdeckungen
Vergeblich versuchte ich, den Deckel zu öffnen, doch es ging partout nicht. Wieder fragte Opa mich, ob ich nicht doch Hilfe bräuchte und wieder verneinte ich. Irgendwann musste dieses blöde Schloss schließlich nachgeben; es war schon ziemlich angerostet, vielleicht splitterte es sogar, wenn man nur lange genug darauf herumhackte.
Ich hackte sehr lange darauf herum, mit einem alten Hammer, dem Huthalter, mit einer abgebrochenen Speiche des Velos und mit meinen bloßen Händen. Helfen ließ ich mir dabei nicht. Diese Truhe war mein Projekt, mein Geheimnis, und ich war nicht bereit, es zu teilen.
Ansonsten gab es wenige Geheimnisse in meinem Leben. Vor meiner Mutter konnte ich sowieso nichts geheim halten, nicht, weil sie mir ständig auf die Finger sah, sondern weil sie einen unglaublich durchdringenden Blick hatte, wenn sie mich mit ihren graublauen Augen fixierte. Dann konnte ich nicht anders und sagte die Wahrheit – obwohl es in meinem Leben wirklich nicht viel zu verbergen gab. Das größte Geheimnis, das ich je gehabt hatte, war das Versteck meines Tagebuchs, das ich zwei Monate lang mangels einer besten Freundin geführt hatte. Ich hatte alle paar Wochen ein neues Versteck gesucht, weil meine Mutter es ständig beim Staubsaugen fand. Nach zwei Monaten hatte ich es wie gesagt aufgegeben.
Natürlich war es idiotisch, zu glauben, diese Truhe würde irgendetwas daran ändern, dass mein Leben absolut hundertprozentig durchschnittlich war. Aber ich hatte schon immer zu viel Fantasie gehabt und so wurde ich nicht müde, mir die absurdesten Szenarien auszumalen. Wer wusste schon, was sich darin befand – ein Geheimtresor vielleicht, oder eine Schatzkarte, oder gar eine Leiche…
Oder aber nur weitere Stofffetzen, Lumpen und Schwarzweißfotos.
Verschlossen blieb die Truhe allemal und meine Frustration wuchs. Immer unwirscher hämmerte ich auf das Schloss ein, bis meine Finger wehtaten und ich spürte, wie sich an meinem Ellbogen ein blauer Fleck bildete, weil ich auch ihn als Hammer missbraucht hatte – keine gute Idee, wie sich herausstellte, und auch vollkommen zwecklos. Da ging es hin, mein Geheimnis, meine aufregenden Ferien, und was blieb, war wieder nur drohende Langweile. Und wenn ich doch nach einem Brecheisen fragte? Möglicherweise würde ich mich sonst mein ganzes Leben lang fragen, was in dieser Truhe war. Ich sah mich schon als alte Frau, nachdenklich aus dem Fenster eines futuristischen Altenheims starrend, in Gedanken bei der Truhe…
„Karl, Aurelia, ihr wollt doch sicherlich ein paar Himbeertörtchen!? Kommt schnell runter, das Vanilleeis schmilzt sonst!“ Das war Oma. Sie hatte mal wieder ihre Himbeertörtchen mit Vanilleeis gemacht, die eigentlich längst einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde verdient hatten. Ich liebte die Törtchen abgöttisch, aber jetzt gerade in diesem Augenblick kamen sie höchst ungelegen. Wer wusste schon, was Opa nach dem Essen vorhatte? Womöglich würde ich die ganzen Ferien über nicht noch einmal die Möglichkeit erhalten, auf dem Dachboden herumzustöbern. Und die Truhe machte weiterhin keine Anstalten, sich zu öffnen …
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!










![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)