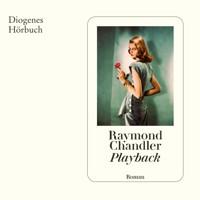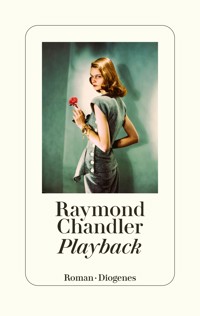
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Philip Marlowe
- Sprache: Deutsch
Eigentlich sollte Marlowe nur eine junge Frau im Bahnhof von Los Angeles ausfindig machen: »Es war kein Kunststück. Der ›Super Chief‹ war pünktlich, wie fast immer, und meine Zielperson stach heraus wie ein Känguru im Smoking.« Doch kaum beschattet er die Dame, jagt eins das andere: falscher Name, Erpressung, Verfolger, Gangster. Ja, die attraktive Rothaarige wird wie in einem Playback so fatal von ihrer Vergangenheit eingeholt, dass Marlowe schwach wird und ihr beizustehen beginnt ... In der brillanten Neuübersetzung von Ulrich Blumenbach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Raymond Chandler
Playback
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Blumenbach
Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay
Diogenes
Für Jean und Helga, ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre
1
Die Stimme am Telefon klang scharf und herrisch, was sie genau sagte, bekam ich nicht mit – ich war noch nicht ganz wach, und außerdem hielt ich den Hörer verkehrt herum. Ich drehte ihn zurecht und knurrte.
»Haben Sie mich verstanden? Ich habe gesagt, hier ist Clyde Umney, der Anwalt.«
»Der Anwalt. Ich nehm an, davon gibts ein paar mehr.«
»Sie sind Marlowe, stimmts?«
»Ja. Soweit ich weiß.« Ich sah auf die Armbanduhr. Es war 6.30 Uhr, nicht meine beste Zeit.
»Werden Sie bloß nicht frech, junger Mann.«
»Tut mir leid, Mr. Umney, aber ich bin kein junger Mann. Ich bin alt, müde und kaffeelos bis zum Eichstrich. Was kann ich für Sie tun, Sir?«
»Ich möchte, dass Sie um acht am Bahnsteig sind, wenn der Super Chief einfährt, unter den Passagieren eine junge Frau identifizieren, ihr folgen, bis sie sich irgendwo ein Zimmer genommen hat, und sich dann bei mir melden. Verstanden?«
»Nein.«
»Warum nicht?«, blaffte er.
»Ich weiß zu wenig, um sicher zu sein, dass ich den Fall übernehmen kann.«
»Ich bin Clyde Um–«
»Stopp«, unterbrach ich. »Ich schrei gleich. Geben Sie mir einfach die Fakten durch. Ein anderer Ermittler ist da vielleicht besser geeignet. Ich war nie ein FBI-Typ.«
»Aha. Meine Sekretärin, Miss Vermilyea, kommt in einer halben Stunde in Ihrem Büro vorbei. Sie bringt Ihnen alle nötigen Informationen. Sie ist sehr tüchtig. Sie hoffentlich auch.«
»Nach dem Frühstück bin ich tüchtiger. Lassen Sie sie hierherkommen, ja?«
»Wo ist hierher?«
Ich diktierte ihm meine Privatadresse an der Yucca Avenue und erklärte ihm den Weg.
»Na gut«, sagte er widerwillig. »Eins möchte ich noch klarstellen. Die Frau soll nicht mitbekommen, dass sie beschattet wird. Das ist sehr wichtig. Ich vertrete eine sehr einflussreiche Anwaltskanzlei in Washington. Miss Vermilyea wird Ihnen erste Spesen vorstrecken und einen Vorschuss von zweihundertfünfzig Dollar aushändigen. Ich erwarte höchste Effizienz. Verschwenden wir keine Zeit mit Reden.«
»Ich werde mein Bestes tun, Mr. Umney.«
Er legte auf. Ich kämpfte mich aus dem Bett, duschte, rasierte mich und hätschelte gerade meine dritte Tasse Kaffee, als es klingelte.
»Ich bin Miss Vermilyea, Mr. Umneys Sekretärin«, sagte sie mit einer ziemlichen Plüschstimme.
»Kommen Sie doch rein.«
Eine Sahneschnitte in Reinkultur. Sie trug einen gegürteten weißen Regenmantel und keinen Hut, hatte gut gepflegtes platinblondes Haar, zum Regenmantel passende Stiefeletten, einen Plastik-Knirps und zwei blaugraue Augen, die mich ansahen, als hätte ich einen unanständigen Antrag gemacht. Ich half ihr aus dem Regenmantel. Sie duftete angenehm. Sie hatte Beine, deren Anblick – nach allem, was ich davon zu sehen bekam – nicht wehtat. Sie trug durchscheinende, dunkle Nylonstrümpfe. Ich musterte sie fasziniert, besonders als sie die Beine übereinanderschlug und darauf wartete, dass ich ihrer Zigarette Feuer gab.
»Christian Dior«, las sie meine Gedanken. »Ich trage nur diese. Feuer, bitte.«
»Heute tragen Sie deutlich mehr als diese«, sagte ich und ließ mein Feuerzeug aufschnappen.
»So früh am Morgen bin ich für Annäherungsversuche nicht zu haben.«
»Welche Zeit passt Ihnen denn, Miss Vermilyea?«
Sie lächelte säuerlich, machte in ihrer Handtasche Inventur und warf einen braunen Briefumschlag vor mich auf den Tisch. »Hier dürften Sie alles finden, was Sie brauchen.«
»Sagen wir, fast alles.«
»Machen Sie schon, Sie Scherzkeks. Ich weiß über Sie Bescheid. Glauben Sie, Mr. Umney ist auf Sie gekommen? Fehlanzeige. Das war ich. Und hören Sie auf, meine Beine anzustarren.«
Ich öffnete den Umschlag. Er enthielt den nächsten zugeklebten Umschlag und zwei auf meinen Namen ausgestellte Schecks. Auf dem einen, über 250 Dollar, stand »Honorarvorschuss«. Der zweite war ein Scheck über 200 Dollar und trug den Vermerk »Spesenvorschuss für Philip Marlowe.«
»Ihre Ausgaben rechnen Sie en détail mit mir ab«, sagte Miss Vermilyea. »Drinks gehen auf Ihre Rechnung.«
Den zweiten Umschlag machte ich noch nicht auf. »Wie kommt Umney auf die Idee, ich würde einen Fall übernehmen, über den ich nichts weiß?«
»Sie werden ihn übernehmen. An der Bitte ist nichts Illegales. Ich gebe Ihnen mein Wort.«
»Bekomm ich sonst noch was?«
»Ach, das können wir mal an einem Regenabend bei einem Drink besprechen, wenn ich nicht zu viel um die Ohren habe.«
»Da sag ich nicht Nein.«
Ich öffnete den zweiten Umschlag. Er enthielt das Foto einer jungen Frau. Die Pose strahlte natürliche Ungezwungenheit aus oder sehr viel Erfahrung vor der Kamera. Die Frau hatte dunkle, ins Rot changierende Haare, eine breite, offene Stirn, ernst dreinschauende Augen, hohe Wangenknochen, nervöse Nasenflügel und einen abweisenden Mund. Sie hatte feingeschnittene, fast strenge Gesichtszüge und sah nicht gerade glücklich aus.
»Drehen Sie es um«, sagte Miss Vermilyea.
Auf der Rückseite standen sauber getippte Informationen.
»Name: Eleanor King. Größe 1,62 m. Alter Ende 20. Haar kastanienrot, dicht, Naturlocken. Gerade Haltung, leise, deutliche Stimme, soigniert, aber nicht übertrieben elegant gekleidet. Zurückhaltend geschminkt. Keine sichtbaren Narben. Auffällige Eigenheiten: Lässt bei Betreten eines Raums den Blick schweifen, ohne den Kopf zu bewegen. Kratzt sich bei Nervosität die rechte Handfläche. Linkshänderin, verbirgt das aber geschickt. Forsche Tennisspielerin, ausgezeichnete Schwimmerin und Taucherin, trinkfest. Keine Vorstrafen, aber Fingerabdrücke vorhanden.«
»Im Knast gewesen«, sagte ich und sah zu Miss Vermilyea hoch.
»Ich habe keine weiteren Informationen. Halten Sie sich einfach an Ihre Anweisungen.«
»Kein zweiter Name, Miss Vermilyea. Mit neunundzwanzig wäre so ein Leckerbissen unter Garantie verheiratet. Kein Wort von Ehering oder anderem Schmuck. Das gibt mir zu denken.«
Sie sah auf die Uhr. »Erledigen Sie das Denken an der Union Station. Sie haben nicht viel Zeit.« Sie stand auf. Ich half ihr in den weißen Regenmantel und hielt ihr die Tür auf.
»Sie sind im eigenen Wagen gekommen?«
»Ja.« Schon halb durch die Tür, drehte sie sich noch mal um. »Eins mag ich an Ihnen. Sie betatschen einen nicht. Und Sie haben gute Manieren – in gewisser Weise.«
»Miese Technik – Betatschen.«
»Und eins mag ich nicht an Ihnen. Einmal dürfen Sie raten.«
»Tut mir leid. Keine Ahnung – mal davon abgesehen, dass mich manche Leute nur schon dafür hassen, dass ich am Leben bin.«
»Das hab ich nicht gemeint.«
Ich ging hinter ihr die Treppe hinunter und öffnete ihr die Autotür. Sie fuhr eine billige Karre, einen Fleetwood Cadillac. Sie nickte noch kurz und glitt den Hügel hinab.
Ich ging wieder hoch und packte eine Reisetasche. Man weiß ja nie.
2
Es war kein Kunststück. Der Super Chief kam pünktlich an, wie fast immer, und meine Zielperson stach heraus wie ein Känguru im Smoking. Sie hatte kein Gepäck, nur ein Taschenbuch, das sie in den erstbesten Papierkorb warf. Sie setzte sich in der Wartehalle und sah zu Boden. Der Inbegriff der unglücklichen Frau. Nach einer Weile stand sie auf und ging zum Bücherdrehständer. Ohne etwas herauszunehmen, wandte sie sich wieder ab, warf einen Blick auf die große Wanduhr und trat in eine Telefonzelle. Nachdem sie ein paar Silbermünzen in den Schlitz gesteckt hatte, sprach sie mit jemandem. Ihre Miene änderte sich nicht. Sie hängte ein, ging zum Zeitungsständer, nahm einen New Yorker heraus, sah auf ihre Armbanduhr, setzte sich wieder und schlug die Zeitschrift auf.
Sie trug ein nachtblaues Kostüm, über das der Kragen einer weißen Bluse herausragte, und eine große saphirblaue Reversnadel, die wahrscheinlich zu ihren Ohrringen passte, nur konnte ich ihre Ohren nicht sehen. Sie hatte dunkelrote Haare. Sie sah aus wie auf ihrem Foto, war aber etwas größer, als ich erwartet hatte. An ihrem eleganten dunkelblauen Hut war ein kurzer Schleier befestigt. Sie trug Handschuhe.
Nach einer Weile ging sie durch die Arkaden nach draußen zum Taxistand. Sie sah nach links zum Café, wandte sich ab, ging in die große Wartehalle zurück, musterte den Drugstore und den Zeitungskiosk, den Auskunftsschalter und die Menschen auf den blank polierten Holzbänken. Die Fahrkartenschalter waren nur teilweise besetzt. Die interessierten sie nicht. Sie nahm wieder Platz und sah zur großen Wanduhr hoch. Sie zog den rechten Handschuh ab und stellte ihre Armbanduhr, ein schlichtes, kleines Platinspielzeug ohne Edelsteine. Im Geist setzte ich Miss Vermilyea neben sie. Sie wirkte weder empfindlich noch zimperlich oder prüde, doch Vermilyea wirkte im Vergleich zu ihr wie ein Flittchen.
Auch diesmal blieb sie nicht lange sitzen, sondern stand wieder auf und schlenderte durch die Halle, ging in den Patio hinaus, kam zurück, ging in den Drugstore und blieb dann eine Weile am Taschenbuchgestell stehen. Zweierlei war offensichtlich. Wenn sie verabredet war, dann nicht zur Ankunftszeit des Zuges. Und sie wirkte vielmehr wie eine Frau, die auf ihren Anschlusszug wartete. Sie ging ins Café, setzte sich an einen der Plastiktische, las das Menü und dann ihre Zeitschrift. Eine Kellnerin kam mit dem obligatorischen Glas Eiswasser und der Speisekarte. Die Zielperson bestellte. Die Kellnerin ging, die Zielperson las weiter ihre Zeitschrift. Es war ungefähr 9.15 Uhr.
Ich ging durch die Arkaden nach draußen, wo ein Gepäckträger am Taxistand auf Kundschaft wartete. »Sind Sie für den Super Chief zuständig?«, fragte ich.
»Ja. Auch.« Ohne großes Interesse sah er zu, wie ich mit einem Eindollarschein herumspielte.
»Ich warte auf jemanden aus dem Kurswagen Washington–San Diego. Ist da jemand ausgestiegen?«
»Meinen Sie endgültig, mit Gepäck und allem?«
Ich nickte.
Er dachte nach und betrachtete mich mit intelligenten kastanienbraunen Augen. »Ein Passagier ist ausgestiegen«, sagte er schließlich. »Wie sah Ihr Bekannter denn aus?«
Ich beschrieb einen Mann, der Edward Arnold ähnelte. Der Gepäckträger schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid, Mister. So sah derjenige überhaupt nicht aus. Wahrscheinlich ist Ihr Freund noch im Zug. Aus dem Kurswagen müssen sie nicht aussteigen. Der wird an den Vierundsiebziger umgehängt und fährt hier um halb zwölf ab. Noch sind sie nicht so weit.«
»Danke«, sagte ich und gab ihm den Dollar. Sie hatte ihr Gepäck also im Zug gelassen; mehr hatte ich nicht wissen wollen.
Ich ging zum Café zurück und sah durch die Scheibe hinein.
Die Zielperson las ihre Zeitschrift und widmete sich einem Kaffee und einer Schnecke. Ich ging zu einer der Telefonzellen und gab der Werkstatt meines Vertrauens Anweisung, meinen Wagen abzuholen, wenn ich bis Mittag nicht wieder anrief. Das machten die öfter und hatten einen Zweitschlüssel. Ich ging zum Wagen raus, holte meine Reisetasche und verstaute sie in einem billigen Schließfach. In der großen Wartehalle kaufte ich mir eine Fahrkarte L.A.–San Diego hin und rück und trabte wieder ins Café.
Die Zielperson hatte sich nicht von der Stelle bewegt, war aber nicht mehr allein. Ein Mann saß ihr gegenüber, grinste, sülzte ihr die Hucke voll. Schon auf den ersten Blick stand fest, dass sie ihn kannte und das bedauerte. Er war ein typischer Kalifornier, von den Spitzen der portweinfarbenen Loafer bis zum zugeknöpften und ohne Krawatte getragenen, braun-gelb karierten Hemd unter der derben cremeweißen Sportjacke. Er war vielleicht 1,85 groß, schlank, hatte ein schmales, selbstgefälliges Gesicht und zu viele Zähne. Er zerknitterte ein Blatt Papier in der Hand.
Das gelbe Einstecktuch in seiner Brusttasche war gefächert wie ein Narzissensträußchen. Und eins war so klar wie destilliertes Wasser: Die Frau wünschte ihn dahin, wo der Pfeffer wächst.
Er redete weiter und zerknitterte das Blatt weiter. Schließlich stand er achselzuckend auf. Fuhr ihr mit einer Fingerspitze über die Wange. Sie zuckte zurück. Dann strich er das Blatt glatt und legte es ihr sorgfältig hin. Wartete grinsend.
Ihr Blick senkte sich sehr, sehr langsam auf das Papier. Sie wollte es an sich nehmen, aber er war schneller, steckte es ein und grinste immer noch. Dann zog er ein Notizbuch mit perforierten Seiten aus der Tasche, schrieb mit einem Kuli etwas hinein, riss das Blatt heraus und gab es ihr. Das konnte sie haben. Sie nahm es, las es und schob es in ihre Handtasche. Jetzt sah sie ihn das erste Mal an. Und lächelte. Für meinen Geschmack fiel ihr das ganz schön schwer. Er tätschelte ihr die Hand, drehte sich um und ging hinaus.
Er trat in eine Telefonzelle, schloss die Tür hinter sich, wählte und redete eine Weile. Als er wieder herauskam, rief er einen Gepäckträger und ging mit ihm zu einem Schließfach. Er entnahm ihm einen leichten perlweißen Koffer und eine dazu passende Reisetasche. Der Gepäckträger folgte ihm damit zu einem schnittigen, zweifarbigen Buick Roadmaster, dem Cabriotyp mit hartem Verdeck, das sich gar nicht aufklappen lässt. Dort verstaute er das Gepäck hinter dem vorgeklappten Fahrersitz, nahm sein Geld und ging. Der Mann in der Sportjacke mit dem gelben Einstecktuch stieg ein, setzte zurück und hielt dann noch einmal an, um eine Sonnenbrille aufzusetzen und sich eine Zigarette anzuzünden. Dann fuhr er davon. Ich notierte mir sein Kennzeichen und ging wieder in den Bahnhof.
Die nächste Stunde dehnte sich wie drei Stunden. Die Frau verließ das Café und las ihre Zeitschrift in der Wartehalle. Sie war nicht bei der Sache. Immer wieder blätterte sie zurück und las etwas noch einmal. Manchmal las sie auch gar nicht, hielt die Zeitschrift nur in der Hand und sah ins Leere. Ich hatte eine Morgenausgabe der Abendzeitung dabei, konnte sie ungesehen beobachten und sortieren, was mir durch den Kopf ging. Nackte Tatsachen waren nicht dabei. Aber es vertrieb mir die Zeit.
Der Mann, der bei ihr am Tisch gesessen hatte, hatte den Zug verlassen, denn er hatte sein Gepäck dabei. Es konnte ihr Zug gewesen sein, und er konnte der Reisende gewesen sein, der aus dem Kurswagen ausgestiegen war. Ihr Verhalten machte deutlich, dass sie ihn nicht in ihrer Nähe haben wollte, und seines, dass er das zwar jammerschade fand, doch sowie sie das Stück Papier sah, das er ihr hinhielt, würde sie es sich anders überlegen. Und das tat sie offenbar auch. Dass er ihr das Stück Papier nicht in aller Ruhe im Zug gezeigt hatte, hieß, dass er das Blatt im Zug noch nicht gehabt hatte.
An diesem Punkt stand die Frau plötzlich auf, ging zum Zeitungskiosk und kam mit einem Päckchen Zigaretten zurück. Sie riss es auf und steckte sich eine an. Sie rauchte ungelenk, als wäre sie es nicht gewohnt, und beim Rauchen änderte sich ihr Auftreten, sie wurde halbseidener und härter, als wollte sie aus irgendeinem Grund bewusst gewöhnlicher erscheinen. Ich sah auf die Wanduhr: 10.47 Uhr. Ich überlegte weiter.
Das Blatt hatte wie ein Zeitungsausriss ausgesehen. Sie hatte danach gegriffen, aber er hatte es weggezogen. Dann hatte er ein paar Worte auf ein leeres Stück Papier geschrieben, ihr das gegeben, und sie hatte ihn angelächelt. Ergo: Der Traumprinz wusste etwas über sie, und sie musste so tun, als gefiele ihr das.
Weiter: Vorher hatte er den Bahnhof verlassen und war irgendwo hingegangen. Vielleicht hatte er seinen Wagen geholt, vielleicht den Zeitungsausschnitt, vielleicht sonst was. Er war sich also sicher, sie würde ihm nicht weglaufen, und das bestätigte meine Annahme, dass in dem Moment noch nicht alle Karten auf dem Tisch lagen. Vielleicht traute er dem Braten noch nicht. Wollte sich absichern. Jetzt, wo alle Karten aufgedeckt waren, war er mit seinem Gepäck in einem Buick weggefahren. Also hatte er keine Angst, sie zu verlieren. Was sie zusammenschweißte, reichte, um sie auch weiterhin zusammenzuschweißen.
Um 11.05 Uhr warf ich das alles über Bord und fing mit neuen Annahmen von vorne an. Weit kam ich nicht. Um 11.10 Uhr wurde durchgegeben, Zug Nr. vierundsiebzig an Gleis elf mit Halt in Santa Ana, Oceanside, Del Mar und San Diego sei jetzt zum Einsteigen bereit. Mehrere Leute, darunter auch die Frau, verließen die Wartehalle. Andere gingen schon durch die Sperre. Ich sah ihr nach und ging zu den Telefonzellen zurück. Ich warf einen Dime ein und wählte die Nummer von Clyde Umneys Kanzlei.
Miss Vermilyea hob ab und meldete sich mit der Telefonnummer.
»Hier ist Marlowe. Mr. Umney im Haus?«
Mit unpersönlicher Stimme sagte sie: »Tut mir leid, Mr. Umney ist im Gericht. Kann ich etwas ausrichten?«
»Hab Kontakt aufgenommen und fahr mit dem Zug nach San Diego oder zu einem Unterwegsbahnhof. Weiß noch nicht, wohin genau.«
»Danke. Sonst noch was?«
»Ja, die Sonne scheint, und unsere Freundin macht ebenso wenig die Biege wie Sie. Sie hat im Café mit der Glaswand zur Halle gefrühstückt. Mit hundertfünfzig anderen Leuten im Wartesaal gesessen. Dabei hätte sie im Zug außer Sicht bleiben können.«
»Danke, das habe ich alles notiert und werde es Mr. Umney so bald wie möglich ausrichten. Sie haben also noch keine Einschätzung?«
»Doch, eine: dass Sie mich zum Narren halten.«
Ihre Stimme änderte sich schlagartig. Jemand musste das Büro verlassen haben. »Passen Sie mal auf, Sportsfreund, Sie haben einen Auftrag bekommen, und den erledigen Sie lieber zu aller Zufriedenheit. Clyde Umney kann in dieser Stadt keiner das Wasser reichen.«
»Wer braucht denn Wasser, chérie? Ich brauch zum Schnaps nur ein Bier zum Nachspülen. Wenn ich Ansporn kriege, kann ich auch Süßholz raspeln.«
»Sie kriegen Ihr Honorar, Schnüffler – wenn Sie den Auftrag ausführen. Sonst nicht. Ist das klar?«
»Das ist das Schönste, was ich je von Ihnen gehört habe, Schätzchen. Wiederhören.«
»Hören Sie, Marlowe«, sagte sie mit plötzlicher Dringlichkeit. »Ich wollte Sie nicht abkanzeln. Für Clyde Umney ist diese Sache sehr wichtig. Wenn er sie nicht gedeichselt bekommt, könnte er einen sehr wichtigen Kontakt verlieren. Ich hab mir nur Luft gemacht.«
»Mir hats gefallen, Vermilyea. Hat mein Unbewusstes auf Trab gebracht. Ich melde mich, sobald ich kann.«
Ich hängte ein, lief durch die Sperre, die Rampe runter und fast bis Ventura, bis ich endlich Gleis elf erreichte. Dort stieg ich in einen Wagen, den schon Schwaden von Zigarettenrauch durchzogen, der so gut für die Kehle ist und einem fast immer einen gesunden Lungenflügel lässt. Ich stopfte mir eine Pfeife, steckte sie an und mischte mich unter die Schlote.
Der Zug verließ den Bahnhof, tuckerte endlos an den Schrottplätzen und Stadtbrachen von East Los Angeles vorbei, nahm kurz Fahrt auf und hielt schon wieder in Santa Ana. Die Zielperson stieg nicht aus. In Oceanside und Del Mar auch nicht. In San Diego sprang ich schnell raus, setzte mich in ein Taxi und wartete acht Minuten vor dem alten spanischen Bahnhof, bis die Gepäckträger mit den Koffern kamen. Endlich kam auch die Frau.
Sie nahm kein Taxi. Sie überquerte die Straße, ging um die Ecke und in einen Autoverleih. Nach einiger Zeit kam sie wieder heraus und sah enttäuscht aus. Ohne Führerschein kein Mietwagen. Hätte sie doch wissen müssen.
Jetzt nahm sie doch ein Taxi, das wendete und nach Norden fuhr. Meins auch. Der Fahrer wurde erst pampig wegen der Beschattung.
»Das gibts bloß in Büchern, Meister. In San Diego läuft das so nicht.«
Ich gab ihm einen Fünfer und die 10×6 cm große Fotokopie meiner Lizenz. Er musterte sie eingehend. Beide. Er sah hoch und die Straße lang.
»Na gut, aber ich melde das«, sagte er. »Und die Zentrale meldet es vielleicht der Polizei. So läuft das hier, Meister.«
»Klingt ganz, als könnt ich mich in der Stadt wohlfühlen«, sagte ich. »Und Sie haben das Ziel verloren. Ist zwei Blocks weiter abgebogen.«
Der Fahrer gab mir die Brieftasche zurück. »Von wegen verloren«, sagte er knapp. »Wofür gibts wohl Funkgeräte?« Er griff danach und sprach hinein.
Von der Ash Street bog er auf den Highway 101 ab, fädelte sich in den Verkehr ein und fuhr gemütliche sechzig Sachen. Ich starrte ihm auf den Hinterkopf.
»Lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen«, warf er mir über die Schulter zu. »Der Fünfer ist zusätzlich zum Fahrpreis, oder?«
»Ja. Und warum muss ich mir keine grauen Haare wachsen lassen?«
»Der Fahrgast fährt nach Esmeralda. Das liegt knapp zwanzig Kilometer weiter nördlich am Meer. Wenn sich das Fahrtziel nicht unterwegs ändert – was ich mitkriegen würde –, gehts zu einer Absteige namens Rancho Descansado. Das ist spanisch und heißt entspannt, locker.«
»Mensch, da hätt ich ja gar kein Taxi gebraucht«, sagte ich.
»Sie zahlen für den Service, Mister. Gratisfahrten machen keinen Kühlschrank voll.«
»Sind Sie Mexikaner?«
»Das sagt man nicht, Mister. Wir nennen uns Hispanoamerikaner. In den USA geboren und aufgewachsen. Viele von uns sprechen kaum noch Spanisch.«
»Es gran lástima«, sagte ich.»Una lengua muchissima hermosa.«
Er sah sich zu mir um und grinste. »Tiene Vd. razón, amigo. Estoy muy bien de acuerdo.«
Wir kamen nach Torrance Beach, fuhren hindurch und bogen zur Landzunge ab. Ab und zu sprach der Fahrer in sein Funkgerät. Dann drehte er wieder den Kopf und sah mich an.
»Wollen Sie unbemerkt bleiben?«
»Was ist mit dem anderen Fahrer? Sagt der seinem Fahrgast, dass sie verfolgt wird?«
»Das weiß der selber nicht. Darum frag ich Sie ja.«
»Überholen Sie ihn und versuchen Sie, vor ihm da zu sein. Dann leg ich noch fünf drauf.«
»Ein Klacks. Der kriegt mich gar nicht zu sehen. Und nachher kann ich ihn bei ’ner Flasche Tecate damit aufziehen.«
Wir kamen durch ein kleines Zentrum mit Geschäften, dann wurde die Straße breiter, und die Häuser auf der einen Seite sahen teuer und eher alt aus und die auf der anderen brandneu und auch nicht gerade billig. Die Straße wurde wieder schmaler, wir kamen in eine Tempo-40-Zone. Mein Fahrer bog rechts ab, schlängelte sich durch ein paar Gässchen, überfuhr ein Stoppschild, und bevor ich mich orientieren konnte, glitten wir in einen Canyon hinab. Links glitzerte der Pazifik hinter einem breiten, flachen Strand mit zwei Rettungsschwimmern auf metallenen Aussichtstürmchen. Unten im Canyon wollte der Fahrer durchs Tor fahren, aber ich hielt ihn zurück. Auf einem großen Schild stand in Goldschrift auf grünem Grund El Rancho Descansado.
»Bleiben Sie außer Sicht«, sagte ich. »Ich möchte kein Risiko eingehen.«
Er machte Richtung Highway kehrt, fuhr schnell an der verputzten Mauer entlang, bog in eine Seitenstraße ein und hielt. Ein knorriger Eukalyptus mit gespaltenem Stamm verdeckte uns. Ich stieg aus dem Taxi, setzte die Sonnenbrille auf, ging das Stück zum Highway zurück und lehnte mich an einen knallroten Jeep, auf den man den Namen einer Tankstelle gepinselt hatte. Ein Taxi war den Hügel heruntergefahren und bog zum Rancho Descansado ab. Drei Minuten vergingen. Das Taxi kam leer zurück und fuhr wieder den Hügel hoch. Ich kehrte zu meinem Fahrer zurück.
»Taxi Nr. 423«, sagte ich. »Kommt das hin?«
»Das ist Ihr Täubchen. Und jetzt?«
»Warten wir. Kennen Sie die Anlage?«
»Bungalows mit Carports. Einzel- und Doppelzimmer. Büro in einem kleinen Bungalow vorn am Eingang. In der Hauptsaison ganz schön teuer. Jetzt ist eher tote Hose. Wahrscheinlich halber Preis und jede Menge freie Zimmer.«
»Wir warten noch fünf Minuten. Dann check ich ein, stell mein Gepäck ab und schau mich nach ’nem Mietwagen um.«
Er sagte, das sei kein Problem. In Esmeralda gebe es drei Autoverleihfirmen, Marke, Mietdauer und Strecken frei nach Wahl.
Wir warteten die fünf Minuten. Es war kurz nach drei. Mir knurrte dermaßen der Magen, dass ich jedem Hund das Futter geklaut hätte.
Ich bezahlte meinen Fahrer, sah ihm nach und ging zum Empfang.
3
Ich stützte mich mit einem höflichen Ellbogen auf den Empfangstresen und musterte den strahlenden jungen Mann mit der Pünktchenfliege. Dann sah ich zu der jungen Frau an der Telefonzentrale an der Seitenwand hinüber. Sie sah nach Frischluftfanatikerin aus, trug glänzendes Make-up, und ein mittelblonder Pferdeschwanz ragte ihr aus der Rübe. Aber sie hatte hübsche, sanfte Kulleraugen, und wenn sie den Portier ansah, strahlten sie. Ich sah wieder ihn an und verkniff mir ein Knurren. Die Telefonistin schwang ihren Pferdeschwanz herum und fasste auch mich ins Auge.
»Ich zeige Ihnen gern unser Angebot an freien Zimmern, Mr. Marlowe«, sagte der junge Mann. »Sie können sich später eintragen, wenn Sie bleiben möchten. Können Sie schon sagen, bis wann Sie eine Unterkunft brauchen?«
»Nur so lange wie sie«, sagte ich. »Die Frau im blauen Kostüm. Sie hat sich gerade eingetragen. Unter welchem Namen weiß ich nicht.«
Die Telefonistin und er starrten mich an. Ihre Mienen zeigten dieselbe Mischung aus Argwohn und Neugier. Man kann die Szene auf hundert Arten spielen. Diese probierte ich zum ersten Mal aus. In keinem städtischen Hotel auf der Welt käme man damit durch. Hier vielleicht schon. Ich setzte alles auf eine Karte.
»Das gefällt Ihnen nicht, stimmts?«, fragte ich.
Er deutete ein Kopfschütteln an. »Wenigstens reden Sie nicht drum herum.«
»Ich hab das Rumeiern satt. Es schlaucht. Haben Sie ihren Ringfinger gesehen?«
»Ähm, nein, hab ich nicht.« Er sah die Telefonbraut an. Sie schüttelte den Kopf und ließ mich nicht aus den Augen.
»Kein Ehering«, sagte ich. »Nicht mehr. Alles hin. Alles kaputt. All die Jahre – ach, zum Teufel damit. Ich bin ihr nachgefahren, die ganze Strecke von – ist ja auch egal, von wo. Sie redet nicht mal mit mir. Was will ich hier eigentlich? Ich mach mich doch nur zum Affen.« Ich drehte mich hastig weg und putzte mir die Nase. Sie waren ganz Ohr. »Ich fahr lieber wieder«, sagte ich und drehte mich wieder zu ihnen hin.
»Sie wollen sich versöhnen, und sie will nicht«, sagte die Telefonistin leise.
»Ja.«
»Ich fühle mit Ihnen«, sagte der junge Mann. »Aber Sie wissen ja, wie das ist, Mr. Marlowe. In einem Hotel muss man vorsichtig sein. Solche Situationen können sich zuspitzen – bis hin zu Schießereien.«
»Schießereien?« Ich sah ihn erstaunt an. »Meine Güte, wer macht denn so was?«
Er stützte sich mit beiden Armen auf den Tresen. »Was haben Sie denn vor, Mr. Marlowe?«
»Ich wäre gern in ihrer Nähe – falls sie mich braucht. Ich muss gar nicht mit ihr sprechen. Ich muss nicht mal bei ihr klopfen. Sie wüsste, dass ich da bin, und sie wüsste, warum. Ich würde auf sie warten. Ich werde immer auf sie warten.«
Die Frau war hingerissen. Ich steckte bis zum Hals im Schmalz. Ich holte tief Luft und schoss den Vogel ab. »Und irgendwie hab ich was gegen den Mann, der sie hergebracht hat«, sagte ich.
»Niemand hat sie hergebracht – sie ist mit dem Taxi gekommen«, sagte der Portier. Aber er wusste genau, was ich meinte.
Die Telefonfrau deutete ein Lächeln an. »Das meint er nicht, Jack. Er meint die Reservierung.«
Jack sagte: »Das hab ich mir schon gedacht, Lucille. Ich bin ja nicht blöd.« Auf einmal zog er eine Karte unter dem Tisch hervor und legte sie vor mir auf den Tresen. Eine Meldekarte. Schräg in der Ecke stand der Name Larry Mitchell. In ganz anderer Handschrift an den vorgesehenen Stellen: (Miss) Betty Mayfield, West Chatham, New York. In der linken oberen Ecke in derselben Handschrift wie Larry Mitchell ein Datum, eine Aufenthaltsdauer, ein Preis, eine Nummer.
»Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte ich. »Dann hat sie also ihren Mädchennamen wieder angenommen. Was natürlich nicht verboten ist.«
»Jeder Name ist erlaubt, solange keine betrügerische Absicht besteht. Möchten Sie das Nachbarzimmer?«
Meine Augen weiteten sich. Vielleicht glänzten sie ein bisschen. Niemand hat je angestrengter versucht, Augen glänzen zu lassen.
»Sind Sie sicher?«, fragte ich. »Das ist verdammt nett von Ihnen. Aber das können Sie nicht tun. Ich will zwar keine Scherereien machen, aber man weiß ja nie. Wenn ich was anstelle, geht es Ihnen an den Kragen.«
»Schon gut«, sagte er. »Irgendwann werde ichs noch lernen. Aber Sie machen einen anständigen Eindruck. Behalten Sie es für sich.« Er zog die Kappe vom Stift und hielt ihn mir hin. Ich unterschrieb und gab eine Adresse in der East 61st Street, New York City, an.
Jack musterte sie. »Das ist in der Nähe vom Central Park, oder?«, fragte er nebenbei.
»Gut drei Blocks weit weg«, sagte ich. »Zwischen Lexington und Third Avenue.«
Er nickte. Er wusste, dass dem so war. Ich hatte es geschafft. Er griff nach einem Schlüssel.
»Ich würd mein Gepäck gern hierlassen«, sagte ich, »etwas essen und vielleicht ein Auto mieten, wenn das geht. Können Sie die ins Zimmer stellen lassen?«
Klar. Das wollte er gern für mich tun. Er ging mit mir nach draußen und zeigte durch ein Wäldchen aus jungen Bäumen. Die Doppelhäuschen waren alle geschindelt, weiß mit grünen Dächern. Sie hatten Veranden mit Geländer. Er zeigte mir meins durch die Bäume. Ich bedankte mich. Er wollte wieder hineingehen, und ich sagte: »Ach, eins noch. Sie fährt vielleicht wieder, wenn sie es merkt.«
Er lächelte. »Natürlich. Da kann man nichts machen, Mr. Marlowe. Viele Gäste bleiben nur ein oder zwei Nächte – außer im Sommer. In dieser Jahreszeit können wir kaum erwarten, ausgebucht zu sein.«
Er ging ins Bürohäuschen, und ich hörte, wie sie zu ihm sagte: »Der ist ja ganz nett, Jack – aber das hättest du nicht machen sollen.«
Ich hörte auch noch seine Antwort: »Ich kann diesen Mitchell nicht ab – selbst wenn er ein Spezi vom Chef ist.«
4
Das Zimmer war passabel. Es hatte das übliche betonharte Sofa, Sessel ohne Kissen, Tischchen an der Stirnwand, begehbaren Kleiderschrank mit eingebauten Schubfächern, Badezimmer mit freistehender Badewanne und neongrellen Rasierleuchten am Spiegel über dem Waschbecken, Küchenecke mit Kühlschrank und weißem Herd, elektrisch, drei Kochplatten. In einem Wandschrank über der Spüle genug Geschirr und dergleichen. Ich brach ein paar Eiswürfel aus der Schale, holte die Flasche aus der Tasche, schenkte mir einen Drink ein, trank einen Schluck, setzte mich und horchte. Die Fenster ließ ich geschlossen, die Jalousien herabgelassen. Nebenan hörte ich erst nichts und dann die Toilettenspülung. Die Zielperson war anwesend. Ich trank aus, fackelte eine Zigarette ab und betrachtete die Heizung an der Trennwand. Sie bestand aus zwei langen, mattierten Heizkolben hinter einer Metallverkleidung. Sie sah nicht sehr leistungsfähig aus, aber im Schrank stand ein elektrischer Heizlüfter mit Thermostat und Dreipolstecker, also für 220 Volt. Ich nahm das Heizungsgitter ab und drehte die mattierten Kolben heraus. Dann holte ich ein Arztstethoskop aus dem Koffer, hielt es an die Metallwand und lauschte. Wenn im Nebenzimmer die gleiche Heizung war, wovon ich ausgehen konnte, dann gab es zwischen den beiden Zimmern nur ein Metallpaneel und allenfalls ein Minimum an Isoliermaterial.
Ein paar Minuten lang hörte ich nichts, dann drehte sich die Wählscheibe eines Telefons. Der Empfang war eins a. Eine Frauenstimme sagte: »Esmeralda 4-1499, bitte.«
Eine kühle, zurückhaltende Stimme in mittlerer Tonlage und bis auf den müden Unterton praktisch ausdruckslos. Zum ersten Mal seit Beginn meiner stundenlangen Beschattung hörte ich ihre Stimme.
Nach einer längeren Pause sagte sie: »Mr. Larry Mitchell, bitte.«
Wieder eine Pause, aber kürzer. Dann: »Hier ist Betty Mayfield im Rancho Descansado.« Sie sprach das »a« in ›Descansado‹ amerikanisch aus. Dann: »Betty Mayfield, hab ich gesagt. Tun Sie nicht so begriffsstutzig. Oder muss ichs Ihnen buchstabieren?«
Am anderen Ende der Leitung gab es allerlei zu sagen. Sie hörte zu. Nach einer Weile sagte sie: »Apartment 12C. Sollten Sie eigentlich wissen. War schließlich Ihre Buchung … Ach so. Verstehe … Na gut. Ich warte hier.«