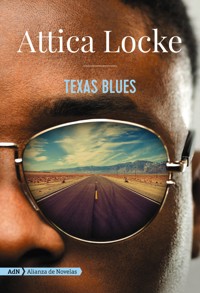21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal in der 160-jährigen Geschichte Houstons hat ein schwarzer Kandidat Aussicht aufs Bürgermeisteramt. Auch wenn sein Vorsprung vor der Stichwahl schmilzt. Die Bevölkerung befürchtet wegen der hohen Verbrechensrate sich nicht von der Ölkrise und dem wirtschaftlichen Niedergang erholen zu können. Eine Wahlkämpferin ist verschwunden. Im Fall zweier weiterer vermisster und ermordeter Mädchen ist bereits ergebnislos ermittelt worden. In Verdacht gerät der Enkel eines einflussreichen schwarzen Angehörigen der Community in Pleasantville. Als Jay Porter den Fall übernimmt, deckt er geheime Baupläne und politische Verschleierungen auf. Die Geschichte spielt 1996. Clinton ist zum Präsidenten wiedergewählt worden. Es geht um weit mehr als eine Lokalwahl, bei der eine Staatsanwältin alle Hebel in Bewegung setzt, um sich ein Amt zu sichern. Im Hintergrund bereiten die Republikaner die Präsidentschaftswahl für 2000 vor. Dafür müssen sie Wahlkreise wie Pleasantville für ihre Partei erobern. Wie erfolgreich sie damit waren, zeigten die Jahrzehnte danach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Attica Locke
Pleasantville
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf Herausgegeben von Wolfgang Franßen
Polar Verlag
Originaltitel: Pleasantville
Copyright: © 2015 by Attica Locke
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2022
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf
Mit einem Nachwort von Benjamin Whitmer
© 2022 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Sven Koch, Gabriele Werbeck
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto: © charles taylor / Adobe Stock
Autorenfoto: © Mel Melcon, Los Angeles
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland
ISBN: 978-3-948392-56-7
eISBN: 978-3-948392-57-4
per te, Saroci vediamo lì
INHALT
Anmerkung der Autorin
Wahlabend
Texas, 1996
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 2
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil 3
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Wahltag
Texas, 2000
Danksagung
Vielschichtige Figuren
Anmerkung der Autorin
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig und liegt nicht in der Absicht der Autorin. Pleasantville ist ein realer Ort, aber Teile seiner Geschichte und seiner Geografie sind um einer guten Story willen erfunden.
Jeder Politiker, der etwas taugt, weiß, dass der Weg zu einem Amt über Pleasantville führt.
James Campbell, Houston Chronicle
Wahlabend
Texas, 1996
An diesem Abend feierten sie in ganz Pleasantville. Von der Laurentide Street bis zur Damaree Lane stießen sie miteinander an, setzten den Tonarm auf Platten, ließen das Geschirr in der Spüle stehen. Sie saßen auf Ledersofas vor Farbfernsehern, drängten sich um Küchenradios, belegten Telefonleitungen, verbreiteten Gerüchte über Wahlbeteiligungen und Wahlkreisergebnisse. Es fehlte nicht viel, und ihr Lebenstraum würde sich erfüllen, könnten sie die längst überfällige Ernte jahrzehntelanger harter Arbeit und Kämpfe einfahren. Es waren Soldaten a. D., erwachsene Männer, von denen einige unverhohlen weinten, als die ersten Zahlen in den Wahlsondersendungen genannt wurden. Es waren Ärzte und Anwälte, Krankenschwestern, Lehrer und Ingenieure, Männer und Frauen, die sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Pleasantville niedergelassen hatten. Das Viertel war 1949 aus dem Boden gestampft worden, und im Lokalradio und in den Houstoner Zeitungen, dem Defender und der Sun, wurde es als das Erste seiner Art in den gesamten USA beworben: »Ein auf dem Reißbrett entworfenes Viertel mit ganz neuen, modern und großzügig geschnittenen Häusern, die eigens für begüterte Negerfamilien der Mittelschicht errichtet werden.« Diese Beschreibung wurde dem rebellischen Geist der ersten Bewohner, die der zähen Kriegsgeneration angehörten, nicht gerecht. Hatten sie nicht am meisten unter dem Rassismus und der Rassentrennung in Bussen und auf öffentlichen Toiletten gelitten? Hatten sie nicht die Wahlsteuer bezahlt und mussten trotzdem an jedem Wahltag meilenweit gehen oder fahren und zwei, drei Stunden in Warteschlangen stehen? Ja, sie warteten. Aber sie demonstrierten auch. In polierten Halbschuhen und Lacklederpumps, gebürsteten Filzhüten und Nadelstreifenanzügen, gegürteten Kleidern und Seidenstrümpfen marschierten sie zum Rathaus, zur Schulbehörde, selbst zum Stadtbauamt. Nachdruck verliehen ihnen die geballten Wählerstimmen ihres nagelneuen Viertels, mit denen sie Politiker unter Druck setzten, die sich bislang kein Bein ausgerissen hatten, die Belange der neuen schwarzen Mittelschicht zu berücksichtigen. Unverhofft erhielt das Viertel eine politische Macht, die im Laufe der nächsten vier Jahrzehnte geradezu legendär wurde. Niemand konnte daran zweifeln, dass alles auf den heutigen Abend zulaufen würde.
Channel 13 und Channel 11 hatten schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen ausgerufen und sahen Sandy Wolcott und den in Pleasantville geborenen Axel Hathorne nächsten Monat in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt. Demnach stand Houston kurz davor, das erste Mal in seiner 160-jährigen Geschichte einen schwarzen Bürgermeister zu bekommen. Auf Channel 2 gestand Stadtrat Lewis Acton seine Niederlage ein, nachdem er augenscheinlich weit abgeschlagen auf dem dritten Platz landen würde. Inzwischen machte auf den breiten Eichen- und Ulmenalleen von Pleasantville das Gerücht die Runde, dass der Lokalmatador Axel Hathorne, dessen Vater Sam »Sunny« Hathorne Oberhaupt einer der Gründerfamilien des Viertels gewesen war, mitsamt der wichtigsten Mitglieder seines Wahlkampfteams kommen und mit seinen früheren Nachbarn feiern wollte. Vom Gellhorn Drive zur Silverdale Street brühten die Leute Kaffee auf und holten den guten Gin unter der Küchenspüle hervor. Sie stellten Eis, Punsch und Kekse bereit und warteten darauf, dass es an der Tür klingelte, weil man ihnen gesagt hatte, Axel wolle von Haus zu Haus gehen und den Bewohnern die Hand schütteln, so wie es Fred Hofheinz an jenem Abend gemacht hatte, als ihm Pleasantville zum Bürgermeisteramt verholfen hatte, und vor ihm Oscar Holcombe – nur würde die Feier heute Abend die ersten beiden bei Weitem übertreffen.
Das Mädchen war nicht eingeladen.
Aber das hatte sie auch nicht erwartet.
Sie hatte bloß eine kleine Rolle gespielt, war ein paar Stunden herumgelaufen und hatte an Türen geklopft, und jetzt wollte sie nur noch eines, nach Hause. Sie wartete in ihrem dünnen blauen Baumwoll-T-Shirt, das kaum Schutz gegen die feuchte Nachtluft bot, an der Ecke Guinevere und Ledwicke Street darauf, dass sie wie verabredet abgeholt wurde. Als sie nachmittags von zu Hause aufgebrochen war, hatte es über zwanzig Grad gehabt, und sie hatte damit gerechnet, früher fertig zu sein, aber wenigstens würde sie einen Zuschlag bekommen, ein paar Dollar mehr, wenn sie die Faltblätter, die man ihr zum Verteilen gegeben hatte, zurückbringen würde. Sie war zu klug, vielleicht auch zu stolz, sie in die Mülltonne am Gemeindezentrum zu werfen, wie es andere getan hatten und prompt gefeuert worden waren, als das Wahlkampfteam Wind davon bekam. Diese Arbeit bedeutete ihr mehr als den anderen, das wusste sie. Vor einem halben Jahr hatte sie die Highschool abgeschlossen, und ihre einzige Aussicht weit und breit war, sich im Wendy’s am Old Spanish Trail von ihrem Teilzeitjob zur Kasse hochzuarbeiten. Also legte sie sich ins Zeug, bewies Ausdauer und Fleiß und blieb demonstrativ bis in die Nacht. Allerdings hatte sie ihren Plan nicht bis zu Ende gedacht, sonst hätte sie eine Jacke oder wenigstens einen Pulli mitgenommen und wäre jetzt nicht pleite, nachdem sie ihre letzten Münzen in ein Telefon am Rastplatz in der Market Street geworfen hatte. Zum wiederholten Mal sah sie nach, ob das letzte Faltblatt, das sie sorgfältig im vorderen Fach ihrer Lederhandtasche verstaut hatte, noch darin steckte. Sie kramte nach dem Pager, den ihr Kenny vor seinem Umzug zum College gekauft hatte, und sah auf die Zeitanzeige. Sie würden zusammenbleiben, hatte er versprochen. Hatte er sich gemeldet? Sie ging die Nummern durch, die in dem kleinen Gerät gespeichert waren. Wie lange musste sie noch warten? Es war fast neun, und ihre Mutter machte sich bestimmt Sorgen. Sie sah sie vor sich, immer noch in ihrer rosa Schwesternuniform, wie sie am offenen Küchenfenster eine Newport rauchte und auf KTSU All the Blues You Can Use hörte. Bestimmt blickte sie im Minutentakt auf die gelbe Sonnenblumenuhr über dem Herd und fragte sich, warum ihre Tochter noch nicht zu Hause war. Das Mädchen verschränkte die dünnen Arme vor der Brust, um sich vor der kühlen Nachtluft zu schützen, die ganz im Süden des Viertels, wo die Ledwicke Street abrupt an einer riesigen Brachfläche endete und der Wildwuchs aus Buscheichen, Gras und hohen, krallenähnlichen Bäumen über die Grenze drängte, noch kälter wirkte. Bis hierher reichten die Straßenlaternen von Pleasantville nicht, und das Mädchen war sich allzu bewusst, dass sie mutterseelenallein an einer dunklen Straßenecke weit weg von zu Hause stand. Einzig das unablässige tiefe Brummen eines Motors im Leerlauf leistete ihr unbehagliche Gesellschaft.
Er beobachtete sie jetzt schon seit einigen Minuten. Der Wagen stand mit der Schnauze zur Guinevere Street unter den tief hängenden Ästen einer Trauerweide, sodass sie nicht mehr als den groben Umriss eines Mannes hinter der Windschutzscheibe ausmachen konnte, scharfe Kanten gegen das schwache gelbliche Licht, das von der anderen Seite der Ledwicke aus dem Fenster eines Hauses fiel. Die Scheinwerfer waren ausgeschaltet, weshalb sie ihn zuerst nicht bemerkt hatte. Er sah in ihre Richtung, der Motor lief. Welche Marke oder Modell das Auto war, konnte sie nicht sagen, aber es hatte die Höhe und Breite eines Lieferwagens oder Pick-ups.
Lauf. Schnell, lauf.
Das flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf, es war die ihrer Mutter, die sie nach Hause rief. Aber sollte sie nicht lieber warten, bis sie abgeholt wurde? Plötzliche Unsicherheit befiel sie, eine so heftige panische Angst, dass ihr Tränen in die Augen schossen. Alles hing von dieser Entscheidung ab. Ich sollte warten, um wegzukommen, dachte sie, weil sie immer noch glauben wollte, dass ein Wegkommen möglich war, obwohl sich in ihr bereits die kalte Gewissheit breitmachte, dass die Nacht sich gegen sie gewandt hatte, dass ihr Verschwinden begonnen hatte. Sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht hatte, wusste es, noch bevor sie hörte, wie die Tür des Fahrzeugs aufging. Schnell, lauf.
Auf der anderen Seite der Stadt stand auch Jay Porter an einer verwaisten Straßenecke.
Spät am Abend um kurz nach elf hatte er den Anruf erhalten, dass in seine Kanzlei in der Brazos Street eingebrochen worden war. Während er ein gutes Stück südlich von Downtown auf den Streifenwagen wartete, der angeblich unterwegs war, sah er die glitzernde Hochhausfassade des Hyatt Regency im Geschäftszentrum der Stadt auf der anderen Seite des Freeway 45. Der Freeway bildete die Grenze zu seinem Viertel, einer kruden Mischung aus zu Büros umgebauten alten viktorianischen Häusern, lieblosen Ladenfronten, Plattenläden, Grillimbissen, Ramschgeschäften und einem abgewrackten Kaufhaus. Letztes Jahr war er endlich aus den engen Büroräumen in der Ladenzeile an der West Gray Road hierher gezogen. Er hatte ein marodes, nach einer Zwangsvollstreckung jahrelang leer stehendes Haus gefunden, das er für wenig Geld hatte kaufen können. Es war ein bescheidener, aber solider viktorianischer Bau mit offenem Grundriss. Im ersten Stock gab es ein Zimmer für seine juristische Bibliothek, in der er geschützt vor Besuchern und Straßenlärm Schriftsätze verfassen konnte. In einem solchen Haus hätte Bernie gern gewohnt, noch lieber als in dem großen Ranchhaus, in das sie einige Jahre nach der Geburt ihres Jüngsten Ben gezogen waren. Das war zwar praktisch, aber kaum von den anderen Häusern aus hellem Ziegel und lackiertem Holz in der Nachbarschaft zu unterscheiden. Sie reihten sich auf wie Pralinenschachteln in einem Supermarktregal, hübsch, aber langweilig.
Jay hatte das Haus aus der Zeit der Jahrhundertwende eigenhändig renoviert, so als hätte seine Frau noch die Gelegenheit, es sich nachmittags auf der umlaufenden Veranda gemütlich zu machen, als könnten sie hier noch mal von vorne anfangen. Wenn er manchmal durch das schmiedeeiserne Tor trat, erwartete er fast, sie in der weißen Hollywoodschaukel sitzen zu sehen. Das Haus hatte ihm keine freie Minute gelassen, ständig gab es etwas zu tun – fehlende Türknäufe, kaputte Lampen, die Böden, die er rausreißen musste –, und damit hatte es ihm durch die schlimmste Zeit im letzten Jahr geholfen. Tagtäglich dankte er ihm, dass es ihn an den langen Nachmittagen, an denen er seine Kanzlei vor die Hunde gehen ließ, zwang, Werkzeug in die Hand zu nehmen.
Seit Juni hatte es drei Einbrüche in der Gegend gegeben.
Selbst Hathornes Wahlkampfbüro in der Travis war betroffen gewesen, und der Chronicle schlachtete die anscheinende Unfähigkeit des ehemaligen Polizeichefs, sein eigenes Wahlkampfbüro zu schützen, genüsslich aus. In Jays Haus wurde im Juli eingebrochen, dabei hebelten die Einbrecher die Hintertür komplett aus. Sie klauten eine Bohrmaschine, einen Farbfernseher, einen kleinen Sony Watchman, auf dem Eddie Mae den Prozess gegen O. J. Simpson von Anfang bis Ende angeschaut hatte, ein wenig Kleingeld und ein goldenes Armband von ihr. Eine Woche später ließ er eine Alarmanlage einbauen.
Dieses Mal mussten sie durch ein Fenster eingestiegen sein.
Als er an der Kanzlei ankam, war das Scheinwerferlicht seines Land Cruiser über die Veranda gestrichen und hatte die zerbrochene Fensterscheibe im Erdgeschoss erfasst. Direkt darunter auf den breiten Dielen lagen in einem Halbkreis Scherben, eine wie auf einem Schnappschuss eingefrorene Szenerie. Die Einbrecher mussten das Haus auf anderem Wege verlassen haben, oder sie waren immer noch darin. Seit der Geburt der Kinder bewahrte Jay im Haus der Familie keine Waffen mehr auf, er besaß nur noch einen Revolver, für den er inzwischen einen Waffenschein hatte und der jetzt unnütz in einer abgesperrten Schatulle in der untersten Schublade seines Schreibtischs lag. Daher stand er geduldig auf der anderen Straßenseite und wartete auf die Cops. In der Kanzlei befand sich nichts, was er nicht entbehren konnte, nichts, wofür er sein Leben riskieren würde. Er musste nicht den Helden spielen.
Der Crown Victoria kam mit ausgeschalteter Sirene angeschlichen. Die Reifen knirschten über den groben Asphalt, als der Fahrer das Lenkrad einschlug und die vordere Stoßstange knapp vor Jays Füßen fast auf dem Gehsteig aufsaß und das Scheinwerferlicht ihn voll in die Brust traf. Automatisch hob er die Hände.
»Porter«, sagte er klar und laut. »Das ist mein Haus.«
Die Frau war relativ jung und klein. Ihre Haare waren straff zu einem winzigen Knoten zurückgebunden und ihre vollen Lippen in einem billigen Pink angemalt, für das sie zu alt war. Sie stieg aus und ging, eine Hand am Griff der Dienstwaffe, schnurstracks auf das Gartentor zu. Mit einem stummen Nicken grüßte sie Jay, als er es öffnete.
»Waren Sie drin?«
Jay schüttelte den Kopf und ließ sie vorbei. Dabei reichte er ihr den Haustürschlüssel.
Ihr Partner ließ sich Zeit. In aller Ruhe hievte er sich aus dem Streifenwagen und schlenderte gelassen zur Veranda. Gut möglich, dass es für sie heute Abend der fünfzigste Einbruch war, dachte Jay. Der Mann war älter als die Frau, aber nicht viel. Jay glaubte nicht, dass er die vierzig überschritten hatte. Er trug einen Schnurrbart und einen rasiermesserscharf gezogenen Rechtsscheitel, und Jay roch sein starkes Rasierwasser, als er ihn vorbeiließ. Beim Überschreiten der Schwelle wanderte auch seine Hand zum Pistolengriff. Jay folgte ihm ins Haus. Das leise Knacken der Dielen war das einzige Geräusch, das in der Dunkelheit zu hören war. Er tastete an der Wand zwischen der Haustür und Eddie Maes Schreibtisch nach dem Lichtschalter. Schlagartig erhellte das Licht den Empfangsraum und vertrieb die Schatten wie aufgeschreckte Mäuse. Die Polizistin ging durch den Flur zur Rückseite des Hauses mit Küche und Speisekammer. Ihr Partner stieg die Treppe hoch. Oben waren das Bibliotheks- und das Besprechungszimmer. Derweil warf Jay einen prüfenden Blick auf Eddie Maes Schreibtisch und zog die Schubladen heraus. Dann ging er nach links in sein Büro, das neben der weit offen stehenden Hintertür lag. »Da müssen sie raus sein«, hörte er hinter sich sagen. Es war der Schnauzbärtige. »Oben war nichts zu sehen.« Seine Partnerin hatte auch nichts in der Küche entdeckt. Inzwischen hatte sie ihre Waffe wieder ins Holster gesteckt und zog einen Stift hervor.
Innerhalb von zehn Minuten hatten sie das Erstaufnahmeformular ausgefüllt. Jay vermisste nichts: Weder fehlte sein Scheckbuch noch der silberne Brieföffner, den er so gut wie nie benutzte, noch seine LP- und Singlesammlung, rare R&B-Pressungen von Arhoolie und Peacock Records, unter anderem die wie neue Belle Blue von A. G. Hats. Es war der Texas-Blues seiner Kindheit, der sich nicht durch CDs ersetzen ließ. Hinter der Tür stand sein Plattenspieler, ein alter Magnavox, den die Einbrecher auch nicht angefasst hatten. Er sah nach dem Bargeld und der Metallschatulle mit seinem .38er, die genau dort war, wo er sie am Morgen des Einzugs in die Kanzlei verstaut hatte. Die Polizisten verbrachten mehr Zeit damit, seinen Waffenschein zu prüfen, als sie fürs Ausfüllen des Formulars gebraucht hatten. Sie gingen davon aus, dass die Alarmanlage den oder die Einbrecher verscheucht hatte. Anscheinend waren sie einfach durch die Hintertür raus. Die Cops hatten sich flüchtig den Garten angesehen. Es war ein winziges Rasenviereck, und ein kurzer Blick reichte, um die Ermittlungen abzuschließen. »Okay«, sagte Jay und schob die Hände in die Hosentaschen. Er begleitete die Cops nach vorne auf die Veranda und schloss den Reißverschluss seiner Windjacke. Über Funk kam die Meldung eines 22-11, in der Crawford Street an der Ecke Wheeler wurde Verstärkung angefordert. Der Mann war schneller am Funkgerät, und dann waren die beiden verschwunden. Jay schloss das Gartentor hinter ihnen und sah dem Streifenwagen hinterher, der rot und blau blinkend die Brazos Street entlangrauschte. Zurück im Haus, holte er einen Besen aus dem Flurschrank. Er brauchte eine Sperrholzplatte oder wenigstens ein Stück dicke Pappe, damit er das kaputte Fenster für die Nacht vernageln konnte oder bis jemand kam, der die Scheibe ersetzte. Er hatte das Haus mausgrau gestrichen, die Fassade aber sonst so gelassen, wie sie war, inklusive der alten Fenster. Die Reparatur würde ihn mindestens zweihundert Dollar kosten.
Das Fenster befand sich direkt neben Eddie Maes Schreibtisch, und wenn es morgen nicht wärmer würde als heute, dürfte sich Jay bestimmt den ganzen Tag anhören, welche Hausmittelchen sie sich gegen die Erkältung besorgen müsse, die sich garantiert in ihrem Hals und der Lunge festsetzen würde. Er sah sie vor sich, ein zitterndes Bündel, das sich alle fünfzehn Minuten räuspern und schließlich um eine verlängerte Mittagspause bitten würde, um Hühnerbrühe aufzutreiben. Bei der Vorstellung musste er grinsen, trotz der späten Stunde und des Besens in seiner Hand. Sie arbeiteten jetzt seit beinahe zwanzig Jahren zusammen. Er hatte ihre Ausbildung finanziert und aus ihrem Anteil an den erstrittenen Abfindungssummen einen Treuhandfonds für ihre Enkel eingerichtet. Das war natürlich in der Zeit, als noch Geld reinkam und Jay mehr als einen Mandanten hatte. Mittlerweile war sie geprüfte Rechtsanwaltsgehilfin, kaufte nur mehr bei Casual Corner ein und hatte ihre Perückensammlung auf zwei reduziert, deren Farben auch in der Natur vorkamen. Aber Eddie Mae war immer noch Eddie Mae und fest davon überzeugt, dass sich jeder Tag mit ein, zwei Bier und einem nachmittäglichen Dominospiel versüßen ließ. Außer einem Enkel, der neben dem Studium in einem Radio Shack arbeitete, war sie mit ihren fast siebzig in einem Haus voller Kinder und Enkel die Einzige mit einem regelmäßigen Einkommen. Einmal in der Woche verfluchte sie Jay für dieses »blöde Treuhanddings«, weil es ihre Sippschaft dazu brachte, sich in der Kunst des Nichtstuns zu üben, und sie dazu zwang, außer Haus zu arbeiten, um wenigstens dreißig Stunden die Woche ihren Frieden zu haben. Sie war eine der wenigen Konstanten in Jays Leben, und er hatte sie lieb gewonnen, sie und ihre kleinen Marotten, nach denen man die Uhr stellen konnte.
In der Linken hielt Jay das Kehrblech. Seine sechsundvierzig Jahre alten Knie knirschten, als er sich neben Eddie Maes Schreibtisch auf den Boden sinken ließ und dazu ansetzte, mit dem Besen über die Stelle zu kehren, wo viele kleine Scherben hätten sein müssen.
Und da bemerkte er den Fehler.
Im Haus war nicht eine einzige Scherbe.
Auf dem Boden lag nichts als der handgewebte Indianerteppich, den er bei Foley’s gekauft hatte. Die Scherben sind auf der falschen Fensterseite, dachte er. Das war so offensichtlich, dass er kaum begreifen konnte, es nicht gleich bemerkt zu haben. Genauso wenig konnte er begreifen, dass die Polizisten es nicht bemerkt hatten. Allerdings hatten sie auch nicht mehr als zehn Minuten ihrer wertvollen Zeit an die Sache verschwendet. Wenn Jay nicht jeden Monat eine Sicherheitsfirma dafür bezahlen würde, hätte die Notrufleitstelle sowieso niemandem vom Houston Police Department geschickt, davon war er überzeugt. Dazu hatte die Polizei viel zu viel zu tun. Die hohe Verbrechensrate gehörte zur kulturellen Identität Houstons wie Footballbegeisterung und Linedance, Barbecue und die Haarmähnen der Frauen – sie war ein Wahrzeichen der Stadt, unabhängig von Wirtschaftslage oder Bürgermeister. Das zu ändern versprachen jetzt zwei Law-and-Order-Kandidaten – der ehemalige Polizeichef Axel Hathorne und die derzeitige Staatsanwältin von Harris County, Sandy Wolcott. Hierin konnte man einen mehr als deutlichen Hinweis auf das Hauptanliegen der Wähler erkennen – die Angst, dass Houston sich nie von der Ölkrise und der auch für sein Selbstbild vernichtenden ökonomischen Talfahrt der Achtziger erholen würde, wenn es nicht endlich seine Verbrechensrate in den Griff bekam.
Ächzend stand Jay auf. Er stützte eine Hand auf den Besenstiel und sah sich um. Wäre der Einbrecher durch dieses Fenster eingestiegen, wie Jay zunächst vermutet hatte, hätte er die Scheibe nach innen eingeschlagen, und die Scherben wären genau dorthin gefallen, wo er jetzt mit dem leeren Kehrblech in der Hand stand. Aber das Fenster war von innen eingeschlagen worden, die Scherben waren nach draußen gefallen und lagen auf der Veranda, wo Jay sie entdeckt hatte. Jemand wollte es also so aussehen lassen, als wäre er durch das vordere Fenster eingestiegen, während er mit einem Dietrich oder einem Schlüssel durch die Hintertür spaziert war. Das zerbrochene Fenster war reine Inszenierung. Es war ein Trick, wenn auch kein besonders gewitzter, aber doch mit mehr Mühe verbunden, als einem Schmalspureinbrecher auf der Jagd nach Werkzeug, Schmuck oder Drogengeld zuzutrauen war. Jay begriff nur den Grund dafür nicht.
Das Telefon auf Eddie Maes Schreibtisch klingelte.
Jay zuckte zusammen und ließ das Kehrblech fallen.
Es krachte mit der Kante auf die Fichtendiele neben Jays Tennisschuhen und hinterließ eine kleine Kerbe. Rasch griff er nach dem Telefonhörer und stieß dabei einen Bilderrahmen und Eddies Maes Glas mit Butterscotch-Bonbons um. Am anderen Ende der Leitung war ein leises Hüsteln zu hören und dann eine vertraute Stimme. »Alles in Ordnung bei dir, Counselor?«
Rolly Snow.
Er rief aus einer Gasse hinter dem Hyatt Regency an, wo die Town Cars zwei, vier und sechs aus der Lincoln-Flotte von Rolling Elegance standen und darauf warteten, Versprengte von Sandy Wolcotts Wahlkampfparty aufzusammeln. Die Party war nach wie vor im Gange, die Unterstützer feierten den Überraschungserfolg ihrer Kandidatin. Man war davon ausgegangen, dass Axel Hathorne mit weitem Abstand gewinnen und mit mehr als fünfzig Prozent der Stimmen der erste schwarze Bürgermeister der Stadt werden würde. Doch als Wolcott ziemlich spät ins Rennen einstieg, wurde es schnell eng. Sie surfte auf der Welle ihres frisch erworbenen Ruhms. Im letzten Jahr hatte sie Charlie Luckman, den angeblich besten Strafverteidiger in ganz Texas, in einem viel beachteten Mordprozess bezwungen und sich landesweite Aufmerksamkeit und Auftritte im Gerichts-TV gesichert, wo sie stundenlang den O.J. Prozess kommentieren durfte. Für ein Buch erhielt sie einen Vertrag über ein sechsstelliges Honorar, eine Einladung zu Oprah folgte. Da dauerte es nicht lange, bis jemand ihre Eignung zur Bürgermeisterin erkannte. Wolcott schaffte es ohne Probleme auf die Stimmzettel und machte seither Axel Hathorne auf seinem eigenen Feld der Law-and-Order-Politik Konkurrenz. Jetzt gingen die beiden in dreißig Tagen in die Stichwahl. Die Party im Hyatt schien ihren Höhepunkt noch nicht überschritten zu haben. Wenn Rolly Glück hatte, dann würde ein besoffener Potentat oder Wahlkämpfer vergessen, mit welchem Auto er gekommen war, und sich stattdessen auf den Rücksitz eines seiner Town Cars sinken lassen. Rolly – dem Anlass entsprechend elegant in schwarzem Anzug, Stacy-Adams-Schuhen und mit unter dem gestärkten Hemdkragen verstecktem Zopf – hatte gerade mit zwei seiner Fahrer eine geraucht und sich eine Portion Shrimps geteilt, die ihnen ein Hilfskellner für zwanzig Dollar besorgt hatte, als die Sicherheitsfirma ADT anrief. Sein Name stand an zweiter Stelle auf Jays Kontaktbogen. Zuerst hatte er bei Jay zu Hause angerufen, und Ellie hatte ihm gesagt, ihr Dad sei noch unterwegs.
»War sie etwa noch wach?«
»Als ich angerufen habe, schon.«
Jay seufzte. Er hatte seiner Tochter gesagt, sie solle endlich das Telefon in Ruhe lassen.
Damit hatte er das Haus verlassen. Sie hatte am nächsten Morgen eine Prüfung in Geometrie, und er hatte ihr unmissverständlich klargemacht, dass sie auflegen und ins Bett gehen sollte. Dieses Theater wiederholte sich inzwischen jeden Abend. Soweit er wusste, waren es noch keine Jungs. Nur Freundinnen, von denen Lori King die engste war. Sie verschlangen einander geradezu, saugten jedes Wort, jeden Atemzug der anderen auf und konnten stundenlang miteinander reden – es waren dieselben Mädchen, die Jay verständnislos ansahen, wenn er sie fragte, was sie mittags zu essen bekommen hatten, welche Kurse sie im Herbst belegen wollten oder wie ihre Geschwister hießen. Sie gehörten einer nicht zu fassenden, chamäleonartigen Spezies an, von der er nicht den blassesten Schimmer hatte. In Gegenwart eines Erwachsenen, besonders eines Erwachsenen, der zu viele Fragen stellte, erstarrten sie und kriegten kein Wort heraus. Heute Abend hatte er Ellie das erste Mal mit Ben allein gelassen. Es war zu spät gewesen, einen Babysitter zu organisieren, und Rolly arbeitete und war außerdem sicher nicht erpicht darauf, sich mit zwei Cops in Jays Kanzlei zu treffen. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als selbst zu gehen, die Haustür abzuschließen und zu versprechen, in einer Stunde zurück zu sein.
»Wenn du mich brauchst, komm ich in der Kanzlei vorbei, sobald ich hier fertig bin.«
»Ja, mach das«, sagte Jay.
Aus irgendeinem Grund erzählte er Rolly nichts von den seltsamen Details des Einbruchs und davon, wie beunruhigend er den inszenierten Tatort fand. Stattdessen bat er ihn darum, die Nacht über einige Male an der Kanzlei vorbeizufahren, um nachzusehen, ob nicht noch mehr passierte. »Ich kann dir zweihundert Dollar dafür geben«, sagte er, was knapp Rollys Stundensatz aus den Jahren entsprach, als er noch gelegentlich Ermittlungsdienste für Jay übernommen hatte. Rolly hatte aus seiner Kneipe heraus ein Einmannbüro betrieben, und seit das Lula’s geschlossen war, empfing er seine Klienten in der Garage seiner Town-Car-Flotte. »Sachen abchecken« hatte Rolly seine Arbeit genannt, die nie mehr als ein kleiner Nebenjob war, ein Zusatzverdienst, aber auch ein gottgegebenes Talent wie ein absolutes Gehör oder ein Wurfarm wie der von Joe Montana, das man nicht verschwenden durfte. Mit dem Chauffeurservice verdiente er viel Geld und hatte vor, im nächsten Jahr die erste Limousine zu kaufen. Heute »checkte« er nur noch für alte Freunde »Sachen ab«.
»Das geht aufs Haus, Counselor«, sagte er.
Jay legte auf und bückte sich nach dem Kehrblech.
Er wollte zum Flurschrank gehen, blieb aber noch einmal stehen, um das Bild auf Eddie Maes Schreibtisch gerade zu rücken. Es war ein Schnappschuss eines Mädchens mit Zöpfen, ihre erste Urenkelin Angel. Die Butterscotch-Bonbons lagen über den ganzen Schreibtisch verstreut, und Jay sammelte sie Stück für Stück ein. In dem Moment hörte er ein dumpfes Geräusch aus dem ersten Stock wie von einem schweren Schritt, wie wenn ein Stiefelabsatz auf Holz trifft. Er sah zur Deckenverkleidung aus bronzefarbenen Blechfliesen und hätte schwören können, erneut etwas zu hören. Egal was dort oben war, es brachte die Gaslampe an der Decke leicht zum Schwingen. Das Licht bewegte die Schatten, und Jay merkte, dass er den Atem anhielt.
Da muss noch jemand sein, dachte er.
Er streckte die Hand nach dem Telefon aus, aber sein Kopf war blank. Selbst unter Folter hätte er sich nicht an die ersten zwei Ziffern von Rollys Handy- oder Pager-Nummer erinnert. Ein Anruf bei der Polizei brachte nichts. Die Streifenpolizisten hatten fast fünfzehn Minuten hierher gebraucht, und so lange würde Jay nie durchhalten, wenn es mit demjenigen, der mit ihm in dem dunklen Haus war, zu einer Auseinandersetzung kam.
Er entschied sich für den .38er.
Er lag in der Schatulle, die er vorhin auf den Schreibtisch gestellt hatte.
Er erinnerte sich nicht, wann er das letzte Mal eine Waffe berührt hatte, aber der Revolver schien sich an ihn zu erinnern und wurde in seiner Hand schnell warm. Er hielt ihn an der Seite, als er aus seinem Büro in den Flur trat, den Blick zur Decke gerichtet, und sich fragte, was ihn oben erwartete. Schweiß lief ihm den Nacken hinunter, und die Windjacke klebte an seiner Haut. Er öffnete den Reißverschluss und schlüpfte aus den Ärmeln, während er zur Treppe ging und sie gegen die Wand gepresst Stufe um Stufe erklomm. Keine der Deckenlampen im ersten Stock brannte. Im Dunkeln tastete er sich weiter. Dass er den Grundriss seines Hauses besser als jeder andere kannte, war sein Vorteil. Hier oben lagen seine Bibliothek und das Besprechungszimmer, das er vorläufig als Abstellraum für die Umzugskartons nutzte, die er nach seinem Einzug letztes Jahr nicht ausgepackt hatte. Darin lagerten seine Akten, die bis zum Ainsley-Fall zurückreichten, seinem ersten großen Zivilrechtsstreit gegen Cole Oil Industries. In dem Moment hörte er aus dieser Richtung Glas klirren. Rasch lief er zum Besprechungszimmer und sah beim Eintreten eine Silhouette vor dem zerbrochenen Fenster. Er roch Pomade und Alkohol und noch etwas anderes, den unangenehm beißenden Geruch von Marihuana. Seine Hand tastete nach dem Lichtschalter, und er hob den .38er.
Der Junge erstarrte.
Genau wie Jay. Er hatte den Jungen direkt vor der Mündung, aber der Blick aus dessen rot geränderten schwarzen Augen traf ihn ins Herz und lähmte ihn. Er war neunzehn oder zwanzig, groß und schlaksig wie ein Basketballspieler, mit einem kindlichen Gesicht. Sein Flattop musste dringend nachgeschnitten werden, und die Hose reichte ihm nur bis zu den Knöcheln, Details, die Jay automatisch erfasste. Weder hob der Junge die Hände noch versuchte er wegzulaufen, und Jay fragte sich, ob er ein Messer oder, schlimmer noch, eine Pistole hatte. Die Zeit verstrich, ohne dass einer von beiden den ersten Zug machen wollte, fast wie in einem Duell. Von Rechts wegen hätte Jay schießen dürfen, und eine harte Stimme in seinem Kopf, die er vor langer Zeit zum Schweigen gebracht zu haben glaubte, flüsterte: Schieß. Schieß doch. Langsam hob der Junge die Hände. »Nur die Ruhe, Mr. Cosby«, sagte er und musterte den vor ihm stehenden Schwarzen mittleren Alters. »Schön locker bleiben.«
Jay spürte, wie sich seine Hand mit der Waffe entspannte. Er sah zum Telefon auf dem Konferenztisch, überlegte, ob er es erreichen könnte. Nur diese eine Sekunde wandte er die Augen von dem Jungen ab, aber sie genügte. Der Junge trat die Scherben, die unten aus dem Fensterrahmen ragten, weg und kletterte wieselflink durch. Noch immer war er vor der Mündung von Jays Revolver. Aber er konnte nicht. Er konnte ihn nicht in den Rücken schießen. Der Junge warf einen kurzen Blick über die Schulter und grinste Jay unvermittelt an. Dann sprang er. Jay lief zum Fenster und lehnte sich hinaus, vorsichtig, um sich nicht zu schneiden. Mit einem dumpfen Stöhnen landete der Junge auf dem Gras und kam mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung wieder auf die Füße, setzte über das niedrige Tor und rannte nach Süden Richtung Wheeler Avenue, der Grenze zwischen Jays Viertel und dem Third Ward.
Schwer atmend stand Jay am Fenster.
Er wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte, wusste es schon, bevor der Junge auf dem Boden auftraf.
Zum einen war da dieses Grinsen, dieser unverhohlene Hohn. Aber auch die Umstände des Einbruchs, die Inszenierung im Erdgeschoss und das Gefühl, dass der Junge Spielchen mit ihm spielte. Und jetzt war er weg, hatte sich in die Nacht davongemacht, in der sich schon die Feuchtigkeit sammelte, die sich bis zur Morgendämmerung als dichter weißer Nebel über die Stadt legen würde. Über Jay ragte eine große Scherbe aus dem Rahmen, und in dem harschen Licht des Besprechungszimmers erhaschte er sein Spiegelbild darin. Seit Tagen hatte er sich nicht rasiert, und sein Kinn war mit stahlgrauen Stoppeln bedeckt. Seine Augen hatten im Laufe der Jahre an Glanz und Tiefe verloren, wie zwei vom Feuer verschmähte Kohlestücke. Jay musterte sich ungerührt. In vier Jahren würde er fünfzig werden, er hatte zwei Kinder, die etwas wesentlich Besseres verdienten als das, was ihnen bisher zuteilgeworden war, und vor einem Jahr war seine Frau gestorben.
Er ging nach Hause.
Teil 1
Kapitel 1
Als Jay das erste Mal den Namen Alicia Nowell hört, sitzt er an einer roten Ampel im Auto. Es ist Donnerstagmorgen, und er bringt Ellie zur Schule, nachdem sie den zehnjährigen Ben abgeliefert haben. Ben hat sich in der Schule vom ersten Tag an schwergetan, und als er in die Dritte kam, ließ Bernie ihre Beziehungen in der Schulbehörde spielen, für die sie arbeitete, und brachte ihn in einer Spezialklasse der Poe Elementary unter. Dort beginnt der Unterricht eine halbe Stunde früher als in der Lamar High School, die Ellie besucht, und auch dafür hatte Bernie ihre Beziehungen spielen lassen. Jetzt also sitzen Jay und seine Tochter im Auto und hören KCOH. Montags und mittwochs darf Ellie den Sender aussuchen. Dienstags und donnerstags ist Jay dran. Freitags ist theoretisch Ben an der Reihe, aber er hat mehr als einmal erklärt, es sei ihm egal, was sie hören, und Jay hat auch diesen Tag seiner Tochter überlassen. Schweigend sieht sie zum Beifahrerfenster hinaus, die Arme über ihrer weiten schwarzen Starter-Jacke verschränkt, das Kinn in dem geschlossenen Kragen vergraben. Seit sie von zu Hause losgefahren sind, hat sie kaum etwas gesagt, nur ein paar leise gemurmelte Worte beim Abschied zu Ben, dass er sein Mittagessen nicht vergessen soll. Für Jay ist bisher nicht mehr als ein »Guten Morgen« rausgesprungen. Sie haben sich gestern nach der Schule wegen ihrer Telefoniererei gestritten, und Jay ist sich bewusst, dass auch er kurz angebunden war. Gegenüber seiner Tochter kennt er nur zwei Zustände. Entweder ist er gelassen und anteilnehmend, offen für ihre Gedanken und Sorgen, oder er ist beinhart und ungerührt: Je mehr sie sich auf etwas seiner Meinung nach Falsches oder Unvernünftiges versteift, desto überzeugter ist er, dass sie seinen Rat bewusst in den Wind schlägt und genau das Gegenteil davon macht. Es ist ein unschöner Zug von ihm, auf den Bernie ihn oft aufmerksam gemacht hat, und mit ein paar wenigen Worten brachte sie ihn auch zum Einlenken. Nur hat seine Frau ihn besser gekannt, als seine Tochter das jemals tun wird, und auch er hat seine Frau besser gekannt, als er seine Tochter kennt. Bernie wusste so vieles von ihm und den Kindern, nicht unbedingt Geheimnisse, aber Vertrauliches, und dieses redlich verdiente Wissen hat sie ungewollt mit ins Grab genommen, sodass sie nun in dieser völlig neuen Situation allein zurechtkommen müssen, wenn sie sich ohne ihren Dolmetscher am Küchentisch treffen oder im Flur begegnen. Anders als den meisten ist ihr bewusst gewesen, dass sich hinter Jays schlechter Laune oft Sorgen verbergen, dass seine Ängste sich in Schweigsamkeit äußern, einer Schweigsamkeit, die anderen die Luft zum Atmen rauben kann. Daran muss er im Verhältnis zu seiner Tochter noch arbeiten.
Dass er gestern Abend so erschöpft war, nachdem er Dienstagnacht keine Sekunde geschlafen hatte, hat das seine dazu getan. Stunden hatte er wach gelegen, bis er schließlich aufstand und über den hellbraunen Teppich zu dem Sessel neben Bernies Bettseite tappte. Er zog den Durchschlag des Erstaufnahmeformulars aus der Hosentasche. Dann rief er die Polizeistation an und bat darum, es zu berichtigen, da die erste Fassung in zu großer Eile entstanden sei und ohne, wie ihm erst jetzt bewusst wurde, dass die Polizisten das Haus gründlich durchsucht hätten. Er berichtete von dem seltsamen Fundort der Scherben im Erdgeschoss, was auf ein Täuschungsmanöver hindeutete, und natürlich von dem Jungen. Jay konnte ihn genau beschreiben: »Neunzehn oder zwanzig Jahre, schwarz, männlich, die Haare zu einem Flattop geschnitten, und er war groß, mindestens eins fünfundachtzig, und schlank, fast mager.« Der Polizist, mit dem er sprach, hatte keine Lust, das alles am Telefon mitzuschreiben. Er werde den Officers Young und McFee eine Nachricht hinterlassen, sagte er. Nach dem Telefonat drehte Jay das Formular um und notierte auf der Rückseite alle Details, an die er sich erinnerte. Er sah nach den Kindern, legte die Ninja-Turtles-Decke über Bens Füße und schaltete in Ellies Zimmer das Radio aus. In der Küche machte er sich einen Drink. Drei Fingerbreit Jack Daniel’s und eine Handvoll Eiswürfel.
Er saß im Dunkeln, nippte an seinem Whiskey und dachte über den Einbruch nach. Warum das Täuschungsmanöver, und warum traf er den Einbrecher, fast noch ein Jugendlicher, gerade in dem Raum an, in dem er seine Akten aufbewahrte? Das Ganze hatte einen üblen Beigeschmack, der ihn dazu brachte, weiterzutrinken. Früher hätte er die ganze Nacht am Küchentisch gesessen und versucht, aus dem wenigen, was er wusste, eine Verschwörungstheorie zusammenzubasteln. Das hatte er viele Jahre getan, im Dunkeln sitzend, begleitet nur vom Pochen seinen furchtsamen Herzens. Aber das war in einem anderen Leben. Mittlerweile hatte Jay mehr oder weniger Frieden mit sich und seiner Jugend geschlossen: der Bürgerrechtsbewegung, seiner Verhaftung und dem Prozess im Jahr 1970, als man ihm ein Komplott zur Last gelegt hatte und er allein wegen einer Geschworenen nicht für immer hinter Gittern gelandet war. Inzwischen belasteten ihn die Erinnerungen nicht mehr, im Gegenteil, er war fast stolz darauf. Sein alter Kumpel Kwame Mackalvy, der sich zum Feind und wieder zurück zum Freund gewandelt hatte, hatte recht gehabt. Es war ihnen tatsächlich einmal um etwas gegangen. Die Märsche und Proteste, die Demonstrationen für eine Demokratie, die diesen Namen verdiente. Es war ihnen um etwas gegangen, und sie hatten einiges für die Menschen erreicht, zu denen auch die beiden Kinder gehörten, die ein paar Türen weiter schliefen. Etwas Ähnliches hatte Jay mit seiner Kanzlei erreichen wollen. Er hatte für Erman Ainsley und die übrigen Hausbesitzer in der Nachbarschaft des Salzbergwerks, wo das von Cole Oil illegal gelagerte Rohöl in schwarzen, fetten Klumpen durch den Rasen drang, von dem Petrochemiegiganten vor Gericht sechsundfünfzig Millionen Dollar erstritten. Ein noch größerer Triumph war für Jay im folgenden Jahr die Fahrt nach Washington, D. C., gewesen, wo er Ainsley half, einen Anzug für seine Aussage vor dem Kongressausschuss auszusuchen. Bei der Anhörung ging es um Coles Geschäftspraktiken und den Vorwurf der Preistreiberei und Umweltverschmutzung. Jay ging davon aus, dass das Ölunternehmen mächtig Federn lassen würde. Aber die Sache gelangte nie über den Ausschuss hinaus und verlief schließlich im Sande, weil bei der Kongresswahl 1984 so gut wie jeder Kandidat aus Texas und Louisiana Zuwendungen von Cole Oil erhielt. Das von Jay erreichte Urteil hielt im Lauf von zehn Jahren zwar zahllosen Berufungsverfahren stand, war jedoch nicht vollstreckt worden. Weder Jay noch seine Mandanten haben bisher einen Cent gesehen.
Mittlerweile ist Ainsley gestorben.
Statt mit ihm bespricht Jay sich jetzt mit Dot, Ainsleys Witwe, und mit einem ihrer Enkel, einem Zahnarzt in Clear Lake, der jeden Monat auf den neuesten Stand gebracht werden möchte.
Dennoch war der Cole-Fall ein Wendepunkt in Jays Leben.
Nur einen Monat nach dem Urteil erhielt Jay einen Anruf von einer Verwaltungsangestellten aus Trinity County, das nicht einmal zehn Meilen von Jays Geburtsort entfernt lag. Die Frau sprach so leise, fast flüsterte sie in den Apparat. Ein Holzunternehmen aus Diboll, sagte sie, würde über die County-Grenze fahren und Holzabfälle in einer illegalen Deponie vor den Toren von Groveton entsorgen. Das Arsen, mit dem die Firma das Holz behandelte, sickere in Boden und Grundwasser. Bewohner aus der Gegend hätten sich gemeldet. Einer Frau seien zwölf Hühner weggestorben. Eine andere habe geschworen, ihr Trinkwasser rieche nach Tod. Noch am selben Nachmittag fuhr Jay auf dem Highway 59 dorthin, zuerst nach Diboll. Von dort nahm er die Route, die seiner Vermutung nach das Sägewerk nutzte. Und tatsächlich, direkt bei der Farm Road 355, in Sichtweite einer Siedlung mit Maschendrahtzäunen und Hühnerställen, wo die Mehrheit der schwarzen Einwohner Grovetons lebte, machte Jay Fotos von einem riesigen Haufen rostfarbener, faulender Holzspäne und Pulpe, aus dem nach einem kalten Winterregen Gift sickerte. Zwei Tage später traf er den überforderten Bürgermeister von Groveton und kehrte zurück als der Rechtsbeistand in der Sache Groveton gegen Sullivan Lumber Co. Wieder eine Woche später reichte er beim Gericht in Lufkin Klage ein und machte zu Mittag Pause in seiner Geburtsstadt Nigton, um bei seiner Mutter in gedrückter Atmosphäre Hühnchensalat und gekochte Erdnüsse zu essen. Die beiden vermieden so viele Themen, dass beinahe nichts zum Reden blieb.
Danach kamen immer mehr ähnlich gelagerte Fälle herein – DDT-Spuren in einer Wohnwagensiedlung in der Nähe einer Fabrik in Nacogdoches; eine Giftmülldeponie, die das Brunnenwasser in Douglass verseuchte; ein Chemieunternehmen, das verbotenerweise Abwässer in ein Latinoviertel in Corpus Christi laufen ließ – und mit jeder außergerichtlichen Einigung stieg Jays Reputation.
Aber der Cole-Deal ist der bislang höchste Vergleich, auch wenn noch kein Cent davon auf seinem Konto gelandet ist.
Jedes Jahr schickt er Thomas Cole eine Weihnachtskarte und wartet.
Inzwischen ist er geduldiger geworden, nüchterner und, wie er hofft, klüger und hat etwas von der Paranoia seiner jungen Jahre verloren, als er alles als persönlichen Angriff auffasste und um sich herum immerzu Lügner und Spione vermutete. Unter seinem Kopfkissen liegt keine Waffe mehr, davon hat ihn seine Frau vor Jahren nach vielen Streitereien überzeugt. Ihretwegen reißt er sich zusammen und hält ein Versprechen, das er vor langer Zeit gegeben hat: sich für sie und ihre gemeinsamen Kinder zu bessern, die beide wohlgeratener sind, als er zu verdienen glaubt.
KCOH bringt eine weitere Wahlnachlese, als Jay in die Westheimer Road einbiegt und ungefähr einen Block von der Lamar High School entfernt auf dem Parkplatz der Reinigung auf der anderen Straßenseite hält. Das letzte Stück lässt er seine Tochter allein gehen. Bei KCOH glühen an diesem Morgen die Drähte, so viele Anrufe für die Talksendung Person to Person kommen rein. Keiner ist übermäßig überrascht, dass Clinton im Weißen Haus bleibt, und so geht es an diesem Tag um ein regionales Thema, nämlich die Stichwahl zwischen Axel Hathorne und Sandy Walcott. Die Frage lautet: Warum zum Teufel hat Dallas vor Houston einen schwarzen Bürgermeister? »Wir schreiben das Jahr 96, Leute«, sagt Moderator Mike Harris – ein Phil Donahue für Schwarze – gerade, dann wechselt der Sender zu einer Kurzzusammenfassung der wichtigsten Nachricht an diesem Morgen.
Den Bericht über das vermisste Mädchen hat er schon zweimal gehört.
In den Halb-acht-Uhr-Nachrichten hat sie jetzt auch einen Namen: Alicia Ann Nowell. Jay stellt lauter. Ellie hat ihre Bücher auf den Schoß genommen und greift nach dem Türgriff, hält aber noch einmal inne, um den Bericht zu Ende zu hören. Es heißt, das Mädchen aus Houston sei Dienstagabend nicht nach Hause gekommen. Ersten Berichten zufolge wurde sie zuletzt in Pleasantville gesehen, an der Ecke Ledwicke und Guinevere Street, einige Meilen von ihrem Wohnort in Sunnyside entfernt. Als der Name Pleasantville fällt, dreht sich Ellie zu ihrem Vater. Mit finsterer Miene trommelt Jay auf das Lenkrad. Der Bericht endet mit der flehentlichen Bitte ihrer Familie. Jay kann die Worte der Mutter kaum verstehen, ihre Stimme wird fast erstickt von Panik und Tränen. »Ich heiße Maxine Robicheaux. Alicia Nowell ist meine Tochter. Bitte, wenn Sie mein Kind gesehen haben, rufen Sie bei der Polizei an, sagen Sie bitte alles, was Sie wissen, bitte.« Danach übernimmt wieder der Sprecher und gibt eine Beschreibung der achtzehnjährigen schwarzen Alicia. Zuletzt hatte sie ein langärmliges blaues T-Shirt an. An jedem Ohr trägt sie drei Ohrstecker. »Ich muss los«, sagt Ellie und öffnet die Autotür.
Jay schaltet das Radio aus und sieht ihr nach.
Plötzlich bleibt Ellie stehen und rennt zum Auto zurück. Ihre Haare lösen sich aus dem Jackenkragen. Mehr als Bernie gleicht sie Evelyn, ihrer Tante mütterlicherseits, aber am meisten ähnelt sie Jays Schwester Penny in Dallas. Ellie ist hellhäutiger als ihre Eltern, auf dem Land nannte man das früher redbone. Nase und Stirn sind mit Sommersprossen übersät, und ihre kupferfarbenen Augen funkeln, wenn sie lacht oder singt, was sie oft tut, wenn sie glaubt, es kriegt keiner mit. Ben dagegen ist seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, er hat sogar das gleiche Grübchen in der linken Wange. Jay öffnet das Beifahrerfenster. »Ms. Hilliard will mit dir reden«, sagt Ellie.
»Wer ist das?«
»Die Rektorin.«
»Was will sie denn?«
Sie zuckt mit den Schultern, sagt ihm, dass sie nach der Schule bei Mrs. King, Loris Mutter, mitfahren wird, die auch Ben abholen kann. »Bye, Daddy.«
»Elena«, ruft er ihr nach. Aber sie kriegt es nicht mehr mit, von der Horde von Teenagern verschluckt, die über die Straße laufen. Draußen ist es angenehm sonnig. Jay hört, wie auf der anderen Seite der Westheimer Road das Seil gegen den Fahnenmast der Schule schlägt, und sieht Ellie nach, bis er sie aus den Augen verliert. Mindestens ein Dutzend der Mädchen tragen solche Starter-Jacken, eine Art Uniform für den Übergang zwischen Kindheit und Jugend, denkt Jay. Er erinnert sich noch an den Tag von Ellies Geburt, wie er Bernies weinenden Vater Reverend Boykins auf dem Krankenhausparkplatz umarmte. Seine eigenen Tränen sparte er sich für den Moment auf, in dem er seine Tochter nach Hause brachte, an einem Herbsttag wie diesem.
Wie angekündigt kommen die Officers Young und McFee kurz vor Schichtende um halb vier in Jays Kanzlei vorbei. Normalerweise haben sie die Tagschicht zwischen sieben und vier, aber Dienstagabend mussten sie Überstunden machen. Im hellen Sonnenlicht sieht McFee ein wenig älter aus, als Jay dachte, und sie ist Latina, worauf ihr Name nicht schließen lässt. Auch heute trägt sie die Haare straff zurückgebunden. Zögernd bleibt sie in der Tür stehen und sieht im Rahmen geradezu winzig aus. Sie lässt ihrem Partner den Vortritt. Jay ärgert sich, dass Young nicht ein Wort mitschreibt. Er hält einen Block in der Hand und lässt den Kugelschreiber klicken.
»Er war in dem Zimmer, in dem ich meine Akten aufbewahre«, sagt Jay. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich so einer für irgendwas interessiert, das er nicht bis Sonnenaufgang verticken oder am Morgen ins Pfandleihhaus tragen kann.«
Youngs Nicken soll ihn eher beruhigen als Zustimmung anzeigen. »Allerdings haben Sie selbst gesagt, dass Ihnen nichts gestohlen wurde.«
»Die Akten umfassen einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren«, sagt Jay. »Um festzustellen, ob etwas davon weggekommen ist, müsste ich mir jedes Foto und jedes einzelne Blatt ansehen, und das würde ungefähr genauso lang dauern.« Das Telefon auf Jays Schreibtisch klingelt. Eddie Mae ruft durch den Flur. Ihr ältester Enkel hat eine Telefonanlage eingerichtet, und sie weiß mittlerweile, wie sie einen Anruf zu ihm durchstellt, aber an die Gegensprechanlage traut sie sich nicht ran. Das ist auch kaum nötig, weil sie die halbe Zeit allein in der Kanzlei sind.
»Mrs. Delyvan möchte mit Ihnen sprechen.«
Jay seufzt.
Den Anruf muss er entgegennehmen.
»Haben Sie gesehen, wie er etwas einsteckt?«
»Nein, wie schon gesagt.«
»Trug er etwas in den Händen?«
Jay erinnert sich nur an eins: das Grinsen auf dem Gesicht des Jungen, kurz bevor er aus dem Fenster sprang. Außerdem hat er nicht darauf geachtet, ob der Junge irgendeine Beute mit sich herumtrug, weil er vor allem nach Waffen Ausschau hielt. »Wenn Sie das Haus gründlich abgesucht hätten, bevor Sie gegangen sind, hätten Sie den Jungen sicher entdeckt. Dann hätten Sie ihn auch durchsuchen können.«
»Noch mal, Mr. Porter«, sagt Young und schiebt seinen kantigen Kiefer vor. »Oben war niemand. Ich habe selbst nachgesehen.«
»Ich habe auch nichts von einem Verdächtigen bemerkt«, sagt McFee.
Aha, ein Verdächtiger, nicht der Verdächtige, denkt Jay.
Als stünde in Frage, ob es überhaupt einen Täter gibt, als hätte Jay sich die Sache nur eingebildet oder ausgedacht oder wäre selbst eingebrochen, was die Cops wahrscheinlich wirklich denken. Wahrscheinlich überlegen sie schon, wegen möglichen Versicherungsbetrugs gegen ihn zu ermitteln. Er ist stinksauer auf die beiden, weil sie ihm das Gefühl geben, nicht ganz dicht zu sein, seinen eigenen Augen nicht trauen zu können.
Wieder klingelt das Telefon auf Jays Schreibtisch.
»Das ist wieder die Delyvan, Jay!«
»Hören Sie, Mr. Porter«, sagt der Cop. »Officer McFee und ich können gerne den ursprünglichen Bericht abändern und Ihre Beschreibung des Einbrechers und die Sache mit den Scherben auf der falschen Fensterseite aufnehmen.« Aus seinem Mund klingt das wie aus einem Agatha-Christie-Roman. Aber es soll heißen, dass das hier kein Krimi ist, sondern ein Einbruch, wie er je nach Wetterlage jede Nacht dreißig oder vierzig Mal in Houston vorkommt. »Aber ich werde auch nicht verschweigen, dass ich bei meiner jahrelangen Berufserfahrung keinerlei Hinweis auf einen Einbrecher entdecken konnte, als meine Partnerin und ich in Ihrem Haus waren.«
Jay streckt einen Finger in die Luft, wenn auch nicht den, den er am liebsten genommen hätte, um anzuzeigen, dass er ans Telefon gehen muss.
»Mrs. Delyvan«, sagt er, nachdem er abgehoben hat.
»Jay, hier ist Arlee.«
»Ja, Ma’am.«
Jays Büro in einem der kleineren Zimmer im rückwärtigen Teil des Hauses liegt direkt gegenüber der Küche, wo Eddie Mae mindestens einmal in der Woche einen Topf rote Bohnen auf den Herd stellt. Der Geruch nach Schweinefett und braunem Zucker erfüllt das ganze Zimmer. Im Fenster hinter seinem Schreibtisch klemmt ein altes Exemplar der texanischen Verfassung aus seiner Bibliothek, um es am Zufallen zu hindern. Für ein Anwaltsbüro wirkt es ausgesprochen ordentlich. Allerdings arbeitet er seit dem Tod seiner Frau auch nur mit halber Kraft und hat keine neuen Fälle übernommen und die Akten der alten verräumt. Nur eine Sammelklage betreut er noch, Pleasantville gegen ProFerma Labs, und den Fall hat er auch bloß behalten, weil er sich dazu nicht von Houston und seinen Kindern wegbewegen muss. Außerdem glaubt er, dass es zu keinem Prozess kommen wird und er nicht vor Gericht gehen muss. Letztes Jahr hatten zwei Explosionen in der Chemiefabrik von ProFerma beinahe dazu geführt, dass eines von Houstons geschichtsträchtigsten Vierteln bis auf die Grundmauern niederbrannte, und die Bewohner von Pleasantville riefen Jay Porter an, um ihm den vermeintlich todsicheren Fall zu übertragen. Die halbe Stadt hatte das rauchende Fabrikgelände im Fernsehen gesehen, hatte gesehen, wie die Glut in die Gärten in der Nachbarschaft flog und Dächer und Holzhäuser orange leuchten ließ, und Jay war sicher, dass dieser Fall nie in einem Gerichtssaal verhandelt werden würde. ProFerma hatte gute Gründe für eine rasche Einigung. Seither sind anderthalb Jahre vergangen, und die Einigung ist so fern wie eh und je. Das Unternehmen hat noch nicht einmal ein ernst zu nehmendes Angebot unterbreitet. Arlee Delyvan ist die Erste gewesen, die zu einer Klage bereit war.
Sie gehört zu den »37ern«, einer der gut drei Dutzend Familien, die 1949 die ersten Häuser von Pleasantville bezogen. Dr. Delyvan, ein Kinderarzt, kaufte ein großes Ranchhaus in der Tilgham Street. Zu dem Haus gehörte eine riesige Garage, in der sein Ford und der blaue Lincoln Continental seiner Frau Platz hatten. Die verwitwete Mrs. Delyvan ist mittlerweile Ende siebzig und arbeitet ehrenamtlich im Samuel P. Hathorne Community Center. Von dort aus ruft sie gerade an. Stets um ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Mandanten bemüht, nimmt Jay ihre Anrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit an, egal worum es geht.
»Ich vermute mal, dass Sie von dem Mädchen gehört haben«, sagt sie. »Alicia Nowell.«
Es dauert einen Moment, bis Jay den Namen wiedererkennt, aber dann hat er sofort einen Kloß im Hals. »Ja, Ma’am, ich habe heute Morgen im Radio von ihr gehört«, sagt er.
»Es heißt, sie ist vielleicht entführt worden.«
»Ja, das habe ich auch gehört.«
»Und?«
Sie wartet darauf, dass er noch etwas sagt, dass er zwei und zwei zusammenzählt oder, in diesem Fall, zwei und eins. Alicia Nowell ist das dritte Mädchen, das aus Pleasantville oder der unmittelbaren Umgebung verschwindet. Der erste Fall war 1994, der zweite letztes Jahr. Zwei Mädchen im Abstand von mehr als einem Jahr kann ein furchtbarer Zufall sein. Drei Mädchen sind offiziell ein Problem.
Jay legt die Anruferin in die Warteschleife und sagt den beiden Cops, dass er den abgeänderten Bericht gern sehen würde, wenn er fertig ist. Er bittet Eddie Mae, sie zur Tür zu begleiten. Dann lehnt er sich auf dem Kontorstuhl hinter seinem Schreibtisch zurück und geht wieder ans Telefon. Arlee Delyvan klingt erregt, ihre Stimme leise, aber ernst. Niemand, nicht im Radio, nicht in der Zeitung, nicht einer hat die anderen Mädchen erwähnt, die beide aus der Gegend stammen, in Pleasantville aufgewachsen sind und deren Familien ein weiteres Weihnachten verbringen müssen, ohne dass der Täter gefasst ist.
»Das Mädchen jetzt stammt südlich von hier aus Sunnyside«, sagt Arlee, und es klingt wie etwas Ungehöriges. »Aber ein Kind ist ein Kind, und auch dieses scheint direkt vor unserer Haustür verschwunden zu sein.« Sie seufzt tief in den Hörer. »Ihre Eltern rufen unentwegt an. Ich weiß leider nicht mehr als sie, nur das bisschen, was ich auf der Straße gehört habe. Elma Johnson hat das Mädchen an der Ecke Ledwicke und Guinevere gesehen. Elma hat gerade in der Spüle einen Kohlkopf geputzt und zum Fenster rausgesehen. Da stand das Mädchen mutterseelenallein an der Ecke. Ihre Beschreibung stimmt mit dem überein, was die Eltern der Polizei erzählt haben. Sie hatte eine Tasche in der Hand, aber sonst hatte sie nichts dabei. Elma hatte den Eindruck, als würde sie auf jemand warten.« Immerzu habe das Mädchen die Straße Richtung Norden entlanggeschaut, auf die Autos, die aus der Richtung kamen. Arlee fügt hinzu, dass Clarence Watson und eine andere Anwohnerin am Pleasantville Drive glauben, die kleine Nowell schon einmal gesehen zu haben oder zumindest ein Mädchen, das ihr sehr ähnele, als sie Handzettel für Hathorne verteilt habe. »Das kann aber gar nicht sein, Jay. Die Voters League hat ihre Wahlempfehlung am Sonntag abgegeben.« Damit meint sie die Wählervereinigung von Pleasantville, die wichtigste und einflussreichste Gemeindeorganisation dieser Art in der Stadt, die beinahe so alt ist wie das Viertel selbst.
Der Wahlkreis Pleasantville, der in Harris County die Nummer 259 trägt, ist von der Stimmenzahl her einer der größten in Texas, und daher verfügt die Voters League über einigen Einfluss. Dieser politischen Macht sind sich die Bewohner von Pleasantville überaus bewusst, denn sie haben sie aus eigener Kraft aufgebaut, als sie zu Beginn der 1950er-Jahre gegen die Stadt und die Schulbehörde, die ganz in weißer Hand lag, durchsetzten, dass sie für ihr neues Viertel eine Grundschule bekamen, die nicht so überfüllt und schlecht ausgestattet war wie die in Denver Harbor und im Fifth Ward. Beinahe ein Jahr lang mussten sie auf den Bürgermeister Druck ausüben, aber schließlich erhielten die Bewohner dank ihrer immer größeren Proteste eine moderne Schule. Und sie erhielten etwas noch Bedeutsameres: einen Ort, an dem sie wählen konnten. Dadurch konnte die Wählerschaft von Pleasantville nicht mehr willkürlich den bestehenden Wahlkreisen im Norden und Osten und Westen zugewiesen werden, und es entstand ein Wahlkreis mit einer starken schwarzen Wählermacht. Mehr als ein Bürgermeister, Stadtrat, Senator, Gouverneur und Kongressabgeordneter nennen ihn »den mächtigen 259er«, weil sie wissen, dass dieses Viertel bei einer Wahl das Zünglein an der Waage sein kann. Schon immer ist es ebenso sehr von bürgerschaftlichem Engagement geprägt wie von seinen breiten, sauberen Straßen mit den rosa und weißen Kräuselmyrten zu beiden Seiten, seinen legendären Weihnachtsbanketts und Sonntags-Barbecues, den Gin-Rummy- und Whist-Partys an Samstagabenden.
Kurz gesagt: Die Leute in Pleasantville wählen, schon immer.
Und zwar in einer Zahl, die am höchsten in ganz Texas liegt.
»Es ist kein Geheimnis, dass wir für Hathorne stimmen, den Sohn von Pleasantville«, sagt Arlee Delyvan. »Sonntag haben wir es offiziell gemacht. Pleasantville unterstützt Hathorne ohne Wenn und Aber. Sonntagabend waren seine Leute schon weg, um die Umgebung von Memorial zu beackern, Tanglewood und South Post Oak, alles Stadtviertel, in denen vielleicht noch ein paar Stimmen zu gewinnen waren. Von Sonntag bis Dienstagabend, als die Wahllokale schlossen, war nicht einer von Hathornes Wahlkampfteam hier unterwegs. Klar, später am Abend haben wir Axel und ein paar seiner Leute und Familienmitglieder erwartet. Aber ich habe keine Ahnung, was das Mädchen in Pleasantville wollte.«
»Haben Sie mit Axel gesprochen?«
»Ich habe seinem Neffen eine Nachricht hinterlassen. Neal leitet den Wahlkampf.«
»Was ist mit Sam?« Sam ist der Vater von Axel.
»Mir wurde gesagt, dass er Bescheid weiß«, sagt sie. »Es ist jetzt zwei Tage her.«
»Ja«, sagt Jay und nimmt die leichte Verzweiflung in ihrer Stimme wahr, die Alarmglocke, die die ganze Zeit im Hintergrund zu hören ist. Die beiden anderen Mädchen, Deanne Duchon und Tina Wells, fand man in einem Abstand von einem Jahr genau sechs Tage nach ihrem Verschwinden. Man entdeckte ihre Leichen nicht mehr als hundert Meter voneinander entfernt in dem Gebüsch am selben Bach, und in der ganzen Stadt ging das Gerücht, dass beide Mädchen bis wenige Stunden vor Auffinden ihrer Leichen gelebt hatten. In Pleasantville haben die Leute immer geglaubt, dass man eine oder beide hätte retten können, wenn die Mädchen aus River Oaks oder Southampton gestammt hätten und die Polizei schneller gehandelt hätte.
»Es ist noch nicht zu spät, Jay. Vielleicht lebt sie noch«, sagt Arlee. Sie scheint überzeugt zu sein, dass die Fälle miteinander verbunden sind.
Auch Jay glaubt das.
Der Gedanke kam ihm sofort, als er die Nachricht hörte.
»Die Duchons haben das Zimmer des Mädchens abgeschlossen. Alles ist so, wie sie es hinterlassen hat, sogar ihr Auto steht noch in der Garage, ein kleiner gelber Mustang, den Betty ihr zum sechzehnten Geburtstag gekauft hat. Das war einen Monat vor ihrem Verschwinden.«
Jay blickt aus seinem Fenster. Auch er hat noch Bernies Auto. Mit Evelyns Hilfe packte er an einem Tag, an dem die Kinder in der Schule waren, die meisten ihrer Kleider zusammen, aber der Camry steht noch genau wie Deanne Duchons gelber Mustang in der Garage. Noch immer setzt er sich manchmal abends hinein, wenn die Kinder schon im Bett liegen.
»Elma, Ruby, Joe Wainwright und ich«, sagt Arlee, »haben eine Versammlung einberufen, wir wollen der Polizei Beine machen. Sie soll wissen, dass Pleasantville das Leben dieser Mädchen wichtig ist.« Nichts anderes hätte Jay von ihnen erwartet. Es sind Leute, die glauben, dass es kein Problem gibt, das sich nicht mit einer Versammlung lösen ließe, die zutiefst überzeugt sind von der Macht der Zahl, und Jay bewundert sie dafür. Sie haben ihren politischen Aktivismus zehn Jahre früher begonnen als er, und er ist sich stets bewusst, dass er tief in ihrer Schuld steht. »Wir finden, dass Sie heute Abend kommen sollten, Jay.« Er zieht den Rolodex zu sich heran und blättert nach der Nummer von Alice King, Loris Mutter. Er weiß jetzt schon, dass er seine Kinder nicht vor dem Abendessen abholen kann. »Um wie viel Uhr?«, fragt er.
»Ruby wird gegen sechs den Kaffee aufsetzen.«
»Ja, Ma’am.«
Er zieht ein frisches Hemd an. Im Badezimmer rasiert er sich gründlich, das erste Mal in dieser Woche. Dann ruft er Alice King an, um zu fragen, ob es ihr etwas ausmacht, wenn die Kinder länger bei ihr bleiben. Ellie sei oben bei Lori, sagt sie. Ben steht neben ihr in der Küche. »Ich will nach Hause«, sagt er, sobald er den Hörer in der Hand hat. Von allen Leuten, die Jay für die Betreuung der Kinder organisiert, ist Ben bei den Kings am wenigsten gern. Loris ältere Schwestern gehen beide aufs College, sonst gibt es niemanden, der ungefähr in seinem Alter wäre. Die meiste Zeit lungert er in der Küche der Kings herum und bringt Loris Mutter bei, wie man mit dem Computer umgeht, während sie ihn alle zehn Minuten fragt, ob er Hunger hat. So erzählt es Ben, natürlich. »Geht’s euch gut?«
»Ja.«
»Bist du nett zu Mrs. King?«
»Ja.«
»Gut, ich komme, sobald ich kann.«
»Ja.«
»Ich hab dich lieb, mein Sohn.«
»Ich dich auch, Dad.«
Ben macht es ihm leicht. Ihre gegenseitige unverstellte Zuneigung ist in ihrer Schlichtheit fast rührend. Ben sagt, was er denkt, oder er sagt überhaupt nichts. Jay mag diesen Charakterzug an ihm, was wohl auch daran liegt, dass er ihn von sich kennt. Es ist etwas ungerecht, dass Ben und er so gut miteinander klarkommen, während Ellie mit dem Elternteil zurückgeblieben ist, das mit einem heranwachsenden Mädchen Probleme hat. Jay nimmt Anzugjacke und Krawatte und geht zu Eddie Mae, um ihr zu sagen, dass er für eine Weile unterwegs sein wird. Sie sitzt am Computer und kämpft mit ihrem AOL-Zugang. »Rolly hat angerufen«, sagt sie und deutet zu dem Fenster mit der zerbrochenen Scheibe, das noch mit Pappe bedeckt ist. »Er hat irgendwas von Dienstagabend gesagt.«
Jay seufzt. »Ich muss Sie das leider fragen.«
»Ich hab niemand den Schlüssel gegeben, das wissen Sie ganz genau.«
»Ich weiß, dass Sie es nicht von sich aus tun würden, Eddie Mae, aber bei Ihnen gehen so viele Leute ein und aus, da könnte sich doch jemand einen nachmachen lassen, wenn er meint, hier ließe sich was holen.«
»Sie glauben, dass einer aus meiner Familie Sie beklauen würde?«
»Wie gesagt, ich muss das fragen.«
»Die Jungs mögen nicht immer alles richtig machen, aber so was würden sie nie tun.«
Jay zieht die Schlüssel aus seiner Tasche. »Nehmen Sie’s mir nicht krumm, ja?«
Eddie Mae winkt ab. »Wollen Sie was von den Bohnen? Es ist auch Reis da und Bier«, sagt sie, und Jay denkt angesichts ihrer geröteten runden Wangen, und weil es schon fast fünf ist, dass sie sich bereits eins genehmigt hat. »Können Sie mir einen Gefallen tun?«, sagt er im Gehen. »Sehen Sie sich noch mal um, ob etwas weggekommen ist, ja? Morgen gehe ich die Akten oben durch, nur um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen haben.« Er dreht sich um, geht durch die Haustür und die Verandastufen hinunter, dann tritt er durchs Gartentor und läuft zu seinem Auto.
Aus einem Impuls heraus fährt er an Hathornes Wahlkampfbüro in der Travis Street vorbei. Die Schaufenster des Ziegelbaus sind mit rot-weiß-blauen Plakaten mit dem Wahlkampfslogan HATHORNE FÜR HOUSTON!