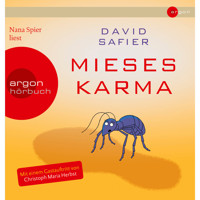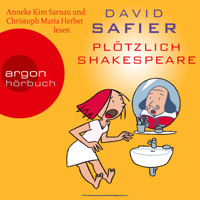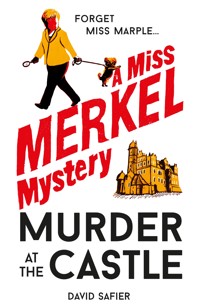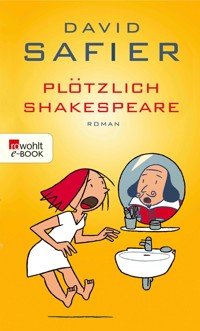
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Liebesleben der Grundschullehrerin Rosa gibt Anlass zu Klagegebeten. Bei einem Zirkusbesuch erklärt ihr ein Hypnotiseur, dass die Lösung ihrer Probleme in einem früheren Leben zu finden ist. Noch bevor Rosa «Veralbern kann ich mich alleine» sagen kann, wird sie per Hypnose in ein solches Leben zurückgeschleudert. In das Jahr 1594. In den Körper eines Mannes. Der sich gerade duelliert. Und der William Shakespeare heißt! Mit einem Male muss sich Rosa im London des 16. Jahrhunderts nicht nur mit Shakespeares Feinden herumschlagen, sie wird als Mann auch noch mit völlig neuen Fragen konfrontiert. Unter anderem: «Wie hält man sich liebestolle Verehrerinnen vom Leib?» oder «Wie geht man als Mann eigentlich auf Toilette?» Und dann gibt es da ja auch noch Shakespeare, dessen Geist in seinem Körper gefangen ist. Und so quasselt er Rosa bei ihrem Versuch, das Leben zu meistern, ständig verärgert dazwischen. Denn von der Tatsache, dass Rosa seinen Körper kontrolliert, ist er «not at all amused».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
David Safier
Plötzlich Shakespeare
Roman
Über dieses Buch
Das Liebesleben der Grundschullehrerin Rosa gibt Anlass zu Klagegebeten. Bei einem Zirkusbesuch erklärt ihr ein Hypnotiseur, dass die Lösung ihrer Probleme in einem früheren Leben zu finden ist. Noch bevor Rosa «Veralbern kann ich mich alleine» sagen kann, wird sie per Hypnose in ein solches Leben zurückgeschleudert. In das Jahr 1594. In den Körper eines Mannes. Der sich gerade duelliert. Und der William Shakespeare heißt! Mit einem Male muss sich Rosa im London des 16. Jahrhunderts nicht nur mit Shakespeares Feinden herumschlagen, sie wird als Mann auch noch mit völlig neuen Fragen konfrontiert. Unter anderem: «Wie hält man sich liebestolle Verehrerinnen vom Leib?» oder «Wie geht man als Mann eigentlich auf Toilette?» Und dann gibt es da ja auch noch Shakespeare, dessen Geist in seinem Körper gefangen ist. Und so quasselt er Rosa bei ihrem Versuch, das Leben zu meistern, ständig verärgert dazwischen. Denn von der Tatsache, dass Rosa seinen Körper kontrolliert, ist er «not at all amused».
Impressum
Das auf den Seiten 125 ff sowie 263 f zitierte Sonett XVIII von William Shakespeare folgt der Übersetzung von Max Josef Wolff.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2010
Copyright © 2010 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke und Cordula Schmidt
Umschlagabbildung: Ulf K.
ISBN 978-3-644-30361-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Warnung an den ...
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
Epilog
Danksagung
Gutes Karma Stiftung
Für Marion, Ben und Daniel …
… und natürlich auch Max,
ohne euer Sein wäre meins ein «Nicht-Sein».
Dieses Buch ist in historischer Hinsicht beeindruckend unfundiert.
1
Au Mann, ich war ja so etwas von einem Frauenklischee! Im Vergleich zu mir waren sogar die Heldinnen in Hollywoodfilmen richtig originell: Seit Jahren war ich Single, meine biologische Uhr ging mir auf den Wecker, und ich badete im Swimmingpool des Selbstmitleids: Meine große Liebe wollte seine große Liebe heiraten, und bei dieser handelte es sich leider nicht um mich.
«Was hat sie, was ich nicht habe?», greinte ich, während ich aus meinem bemerkenswert unaufgeräumten Küchenregal eine Flasche Ramazzotti herausholte.
«Sie hat Stil, Rosa», antwortete mein schwuler bester Freund Holgi, der im Gegensatz zu den schwulen besten Freunden von Hollywoodheldinnen nicht umwerfend aussah, sondern eher wie ein kleiner Hobbit.
«Es gibt Fragen, auf die man keine Antwort will», seufzte ich und stellte Flasche und Glas auf den Tisch.
«Und sie sieht aus wie ein Topmodel», redete Holgi dennoch weiter. Er glaubte nun mal fest daran, dass Freunde absolut ehrlich miteinander umgehen sollten.
Und dummerweise hatte er recht: Während Olivia eine Figur hatte, die selbst Heidi Klum vor Neid in die Tischkante beißen lassen würde, besaß ich Orangenhaut, zu dicke Waden und sah bei schlechtem Licht aus wie ein Hängebauchpuma.
Wie gesagt, ich war voll das Klischee.
«Und sie hat studiert.»
«Hab ich auch!», protestierte ich.
«Du Grundschullehramt in Wuppertal. Sie Medizin in Harvard.»
«Sei still», antwortete ich und schenkte mir den Ramazzotti ein.
«Sie kommt eben aus der gleichen Schicht wie er, Rosa.»
«Was genau hast du an ‹Sei still› nicht verstanden? Das ‹Sei› oder das ‹still›?», fragte ich.
«Und sie ist nicht so schnippisch wie du», grinste er.
«Dir ist schon klar», lächelte ich nun süßsauer, «dass ich hier viele Geräte habe, mit denen man jemandem die Männlichkeit nehmen kann … die Nudelzange … die Saftpresse … den Elektromixer …»
«Und sie hat gute Manieren.»
«Ich habe also schlechte?», fragte ich und nippte schon mal an meinem Ramazzotti.
«Na ja, Rosa, du lachst immer zu laut, rülpst manchmal und drohst, sehr netten, attraktiven Kerlen ihre Männlichkeit zu rauben. Außerdem fluchst du, als wärst du die uneheliche Tochter von Uli Hoeneß und Donald Duck.»
«Den Zeugungsakt zwischen den beiden möchte ich mir lieber nicht vorstellen», antwortete ich.
Leider hatte mein Kumpel auch mit den Manieren recht. Während Jan immer genau wusste, wie man sich in einem noblen Restaurant zu benehmen hatte, war ich schon froh, wenn ich das Fischmesser als solches erkannte und mich bei der Lektüre der Speisekarte nicht blamierte mit Fragen wie ‹Ist Vitello Tonnato nicht ein italienischer Sänger?›.
Ich starrte auf das Foto der Hochzeitseinladung: Jan und Olivia waren ein Bilderbuchpaar, eins, wie Jan und ich es nie hätten sein können. Dabei glaubten wir mal fest daran, dass wir beide füreinander bestimmt waren. Damals, als wir uns kennenlernten, an jenem Tag, an dem ich ihm das Leben rettete. Es war am Strand von Sylt gewesen, ich war Mitte zwanzig und im Campingurlaub mit Holgi, Jan machte Urlaub mit seinen Harvard-Freunden im Ferienhaus seiner Eltern in Kampen. Ja genau, wir stammten nicht nur aus zwei verschiedenen Welten, sondern aus zwei verschiedenen Universen.
Hätte Jan nicht beim Schwimmen einen Krampf bekommen und ich es nicht bemerkt, wären wir uns wohl nie begegnet. Und er wäre ertrunken. So aber schwamm ich die paar Meter zu ihm hin – damals hatte ich noch so etwas Ähnliches wie Kondition –, tauchte unter und zog den fast schon bewusstlosen Jan an die Oberfläche. Rettungsschwimmer kamen mit einem Schnellboot hinzu und hievten uns hinein. Erst auf dem Boden des Bootes öffnete Jan wieder die Augen. Er sah mich mit seinen wunderbaren grünen Augen an und hauchte verzaubert: «Du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe.»
Und ich hauchte zurück: «Danke gleichfalls.»
Es war Liebe auf den ersten Hauch.
Jans Mutter, die mich nicht ausstehen konnte, bewertete diese erste Begegnung hingegen etwas weniger romantisch: «Seine Liebe zu dir wurde durch Sauerstoffmangel ausgelöst.»
Überhaupt war ich Jans nobler Familie ein Dorn im Auge, erst recht, nachdem sie meine Eltern vorgestellt bekommen hatte. Jan und ich hatten in unserem Liebeswahn gedacht, es sei eine zauberhafte Idee, wenn sich unsere Eltern mal bei einem zwanglosen Essen kennenlernten. Leider entwickelte sich diese Begegnung zu dem übelsten Treffen zweier unterschiedlicher Parteien seit der Schlacht von Stalingrad.
Anfangs gaben sich alle noch Mühe: Jans Eltern erzählten beflissen von ihrem Urlaub in einem Golfclub auf den Seychellen, und meine Eltern erzählten jovial von ihrem Stamm-Campingplatz. Dabei erwähnte meine Mutter launig, dass sie sich am Badesee einen ganz unangenehmen Vagina-Pilz zugezogen hatte.
Jans Mutter schob daraufhin ihren Teller beiseite.
Mein Vater bemerkte das allerdings nicht und fühlte sich bemüßigt zu erwähnen, dass er jetzt auch eine Antipilzsalbe brauche. Jetzt schob auch Jans Vater seinen Teller beiseite. Und ich fragte mich, ob ich mich in meinem Alter noch von jemandem adoptieren lassen könnte. Jans Mutter bezeichnete meine Eltern pikiert als ‹originell rustikal›, woraufhin meine Mutter antwortete: ‹Besser rustikal als aufgeblasen.› Ab da nahm der Abend die Rolltreppe abwärts: Er endete noch vor dem Dessert mit der Empfehlung meiner Mutter an Jans Mutter, doch ‹mal den Stock aus dem Hintern zu ziehen›, und der Empfehlung von Jans Mutter an ihren Sohn, ‹sich eine Frau aus einem besseren Stall zu suchen›.
Am Ende saßen Jan und ich alleine am Restauranttisch, ich futterte traurig drei der sechs bestellten Portionen Tiramisu und war weder von meinem noch von Jans Stall sonderlich begeistert.
Ich wollte nun endlich den Ramazzotti runterkippen, da machte Holgi weiter: «Da gibt es aber auch etwas, was du hast und Olivia nicht.»
«Eltern, die über Vagina-Pilze reden?»
«Auch. Aber ich meine etwas anderes.»
Ich verdrehte die Augen, ich wollte nichts mehr hören.
«Keine Sorge, ich will mit meiner ganzen Auflistung nachher noch auf etwas hinaus», lächelte Holgi aufmunternd.
Vielleicht, so dachte ich mir, würde ich also auch mal was Nettes von ihm hören. Also beschloss ich mitzuspielen: «Also gut, was hat die Schnepfe nicht?»
«Olivia hat ihn nicht betrogen.»
«Ich habe Jan auch nie betrogen!», protestierte ich und kippte den Ramazzotti in einem Zug runter.
«Hast du wohl, Rosa», hielt Holgi nett lächelnd dagegen.
«Das ist Definitionssache», erwiderte ich kleinlaut, genau wissend, dass der Definitionsspielraum relativ klein war. Es war vor genau zwei Jahren gewesen. Über die Zeit hinweg hatte sich unsere wunderbare Liebe verändert. Wir hatten als ‹Romeo und Julia› begonnen und wurden zu ‹Romeo und Trampeltier›. So fühlte ich mich jedenfalls, ging ich doch mit meinem Selbstbewusstsein zu Fuß. Jan war mittlerweile ein erfolgreicher Zahnarzt mit eigener Riesenpraxis und angeschlossenem Dentallabor in der Düsseldorfer City, ich nur eine kleine Grundschullehrerin, die nicht allzu viel Freude an ihrem Job hatte. Von Tag zu Tag fragte ich mich mehr, was so ein wunderbarer, erfolgreicher und weltgewandter Mann wie Jan mit so einer durchschnittlichen Frau wie mir wollte. Eine Frage, die sich übrigens auch viele Menschen in seinem Bekanntenkreis stellten.
Jeden Augenblick rechnete ich damit, dass Jan mich mit einer der vielen tollen Frauen betrügen würde, die ihm Freunde, Eltern und Kollegen ständig vorstellten, in der Hoffnung, Jan würde endlich erkennen, dass es besser wäre, mich in die Wüste zu schicken, möglichst in eine ohne Wasserstellen.
Entsprechend aufbauend für mein Selbstbewusstsein war es daher, als mich der Sport- und Sachkundelehrer Axel auf einer Kollegiumsfeier anbaggerte. Axel war ein leichtfüßiger, extrem charmanter Frauenheld, der Ähnlichkeit mit Hugh Jackman hatte und schätzungsweise mit allen Grundschullehrerinnen der westlichen Welt im Bett war. Nur mich hatte er noch nicht verführen können, weil ich meinen Jan so sehr liebte. Das war sicher auch das Einzige, was mich für ihn attraktiv machte, Axel brauchte mein Foto wohl noch für sein Treffer-versenkt-Sammelalbum.
Während wir bei der Feier einen Obstpunsch nach dem anderen schlürften und dabei die leckeren, mit Alkohol getränkten Früchte aßen, flirtete Axel mit mir. Er machte mir diverse Komplimente und brachte es sogar fertig, dass ich den Begriff «Vollweib» richtig schmeichelhaft fand. Als Axel mir schließlich anbot, mich nach Hause zu begleiten, wurde es mir dann doch zu heiß, war doch klar, dass er mich erst über einen kleinen Abstecher in seine Wohnung nach Hause bringen wollte. Ich verabschiedete mich hastig von ihm und eilte nach draußen, wo mir eine schwüle, sommerliche Gewitterluft entgegenschlug. Axel ließ jedoch nicht locker, folgte mir nach draußen und raunte mit tiefer Stimme in mein Ohr: «Du willst es doch auch, Rosa.»
Eloquenz war nicht gerade seine Stärke. Dafür war es Spontaneität. Entschlossen nahm er mich in die Arme, zog mich zu sich … und … was soll ich sagen … ich war betrunken … es war heiß und schwül … und ich bin doch auch nur eine Frau.
Axel küsste mich wild, aber das passte zu einem Typen, der aussah wie der Schauspieler, der ‹Wolverine› im Kino darstellte. Während mein Gewissen noch letzte Versuche machte, eine Warnung zu formulieren, jubilierte meine Libido. Im Chor mit meinem geschundenen Selbstbewusstsein, das sich durch das Interesse dieses attraktiven Mannes aufgewertet fühlte. Schade eigentlich, dass Jan auf die spontane Idee gekommen war, mich von der Feier abzuholen, da ein Gewitter angesagt war und er wusste, dass ich Angst davor hatte. Er war so ein lieber, fürsorglicher Mensch.
Als er Axel und mich beim Knutschen erwischte, fragte er geschockt: «Rosa … was machst du denn da?»
Axel antwortete: «Nach was sieht es denn aus?» Feinfühligkeit war auch nicht seine Stärke.
Ich aber starrte nur in Jans entsetztes Gesicht. Ich hätte ihm in diesem Moment sagen sollen, dass ich das aus Minderwertigkeitskomplexen heraus getan hatte, dass die Ablehnung seiner Freunde und seiner Familie mich fertigmachte … aber stattdessen stammelte ich: «Ich, ähem … hatte da was im Mund, und er wollte mir helfen …»
Jan kämpfte mit den Tränen: Die Frau, zu der er all die Jahre trotz aller Widerstände gehalten hatte – knutschte fremd. Und damit war bewiesen, dass alle recht hatten: Ich war es nicht wert, seine Julia zu sein. Für Jan brach in diesem Moment eine Welt zusammen. Genauer gesagt: unsere gemeinsame Welt. Und ich hatte auf den Selbstzerstörungsknopf gedrückt.
Ich stellte das Ramazzottiglas vor Holgi auf dem Tisch ab und wollte nach dieser Erinnerung lieber gleich aus der Flasche trinken.
«Da gibt es aber auch etwas, was du hast und Olivia nicht …», hob Holgi im freundlichen Tonfall an.
«Ich will es nicht hören.»
«Du …»
«Ich hab den Eindruck, du bist es, der nicht hören will!», motzte ich. Er sollte endlich aufhören, in meinen Wunden zu pulen, man konnte es mit der Ehrlichkeit unter Freunden auch übertreiben.
«Du hast mehr Herz als sie, Rosa!»
Ich blickte völlig erstaunt zu dem aufmunternd lächelnden Holgi.
«Und du hast jede Menge Temperament», bekräftigte er anerkennend. «Richtig viel Pfeffer im Hintern.»
«Der ist ja auch groß genug für eine ganze Pfefferplantage», grinste ich.
«Und du hast Humor. Und wegen alldem bist du auch eine viel tollere Frau als Olivia.»
Diese Aussage von Holgi wärmte mein Herz mehr, als jeder Ramazzotti es hätte tun können. Das war das Schöne, wenn man einen Freund hatte, der immer ehrlich war. Er war auch im Lob aufrichtig.
Ich blickte noch mal auf das Foto der Hochzeitseinladung und fragte mich, ob Jan nicht womöglich doch noch etwas für mich empfand, insgeheim vielleicht immer noch dachte, ich wäre die tollere Frau als Olivia. Schließlich hatte er mich ja nur verlassen, weil ich ihm das Herz gebrochen hatte. Vielleicht sollte ich noch mal um ihn kämpfen, einfach schnurstracks zu ihm in seine Zahnarztpraxis gehen und ihn daran erinnern, dass wir beide einmal dachten, wir wären füreinander bestimmt. Ihm vorschlagen, dass wir es vielleicht noch mal versuchen sollten und er der blöden Olivia sagen könnte, dass sie den Stock in ihrem Hintern alleine in ihrem guten Stall spazieren führen konnte … und während ich das so dachte, schenkte ich mir nach.
Drei Ramazzotti später war ich auf dem Weg zum Zahnarzt.
Ich wollte Jan zurückerobern. Wie die Heldinnen in den Hollywoodfilmen.
Wenn schon Klischee, dann richtig!
2
Als Holgi merkte, dass ich zu Jan gehen wollte, folgte er mir zur Tür meiner kleinen Mietwohnung und sagte dabei Dinge wie «Auweia», «Herrjemine» und «Du, ich kenn da einen wirklich sehr guten Psychologen».
Ich klärte ihn auf, dass ich ein Klischee war und die Klischee-Heldinnen in den Hollywoodfilmen auch immer damit Erfolg hatten, wenn sie in der letzten Sekunde um Verzeihung baten und ihre Liebe gestanden. Meistens machten sie das direkt vor dem Traualtar, und da die Hochzeit erst übermorgen stattfinden sollte, war ich vergleichsweise früh dran.
«Aber», so gab Holgi zu bedenken, «diese Frauen haben alle bis zum Finale eine Entwicklung durchgemacht und ihren Charakter verändert. Das Einzige, was sich bei dir in all den Jahren verändert hat, ist die Figur.»
Das stimmte, gegen mich war das Krümelmonster ein echt zurückhaltendes Kerlchen.
«Und da gibt es noch einen Grund, warum du nicht zu ihm gehen solltest», erklärte Holgi und stellte sich zwischen mich und die Wohnungstür.
«Welchen?»
«Jan ist gar nicht so toll, wie du denkst.»
Ich blickte erstaunt: «Wieso das denn?»
«Hallo? … Der Mann ist Zahnarzt!»
Ich schob Holgi beiseite, ging aus der Wohnung und hörte, wie er mir verzweifelt hinterherrief: «Der Psychologe ist aber gut … sogar sehr gut … er hat mir sogar bei meinem Penisneid geholfen …!»
Aber ich hörte nicht mehr auf Holgi und fuhr stattdessen in die Düsseldorfer Innenstadt zu Jans großer Zahnarztpraxis. Die junge blonde Zahnarzthelferin am Empfang erklärte mit aufgesetztem Zahnweiß-Lächeln, dass Jan noch bis 18 Uhr Termine hätte, und wandte sich dann wieder ihrem Computer zu. Ich blickte auf die Uhr und stellte fest, dass ich nicht in der Lage war, noch ein paar Stunden zu warten, hatte ich doch gerade genau den richtigen Alkoholpegel, um meinen verrückten Plan durchzuziehen. In ein paar Stunden würde ich meinen ganzen Schwung und meinen angetrunkenen Mut bestimmt verloren haben.
«Ich habe jetzt aber einen Behandlungstermin bei ihm!», erklärte ich daher energisch.
Die Frau schaute in ihren Computer und sagte dann: «Sie sind wohl kaum Herr Bergmann?»
«Ich meine, in zehn Minuten», korrigierte ich hastig meinen Bluff.
«Ach, dann sind Sie Frau Reiter.»
«Ja, klar bin ich Frau Reiter», erwiderte ich überdreht. Die Zahnarzthelferin sah mich zweifelnd an. Dann stellte sie fest, dass ich (bzw. Frau Reiter) schon bei der Behandlung zuvor die Krankenkassenkarte für das Quartal abgegeben hatte, und wies mir Behandlungszimmer eins zu. Ich ging dort hinein, und es war wie alle Zahnarztbehandlungszimmer auch: ein schöner kleiner Vorhof der Hölle. Es roch nach Desinfektionsmittel, Neonlicht schien, und im Hintergrund hörte man klassische Musik. Als ich mir gerade die Folterinstrumente ansah und mich fragte, warum die Menschheit zwar zum Mond fliegen konnte, es aber nicht schaffte, eine humane Zahnmedizin zu entwickeln, hörte ich, wie sich Schritte näherten. Mein Herz schlug höher, gleich würde ich Jan wiedersehen. Ich atmete tief durch, ging in Gedanken noch mal die Worte durch, die ich ihm sagen wollte. Die Tür ging auf, und … Olivia kam rein.
Ich bekam Schnappatmung.
Olivia hatte ihre Haare nach hinten zu einem Zopf gebunden und trug einen weißen Kittel, dennoch besaß sie selbst in diesem Outfit die Frechheit, sehr viel besser, stilvoller und aristokratischer auszusehen als ich. Dem Kittel nach zu urteilen, arbeitete sie jetzt mit Jan in der Praxis. Und sie war mindestens genauso erstaunt, mich zu sehen, ihrerseits: «Rosa? … Ich dachte, Frau Reiter …?»
Was sollte ich jetzt sagen? Ihr gestehen, dass ich geflunkert hatte, weil ich ihr ihren Zukünftigen ausspannen wollte?
«Ähem … ich … ich … wurde als Termin dazwischengeschoben, ich bin hier zur Vorsorge», stotterte ich.
Olivia überlegte kurz und sagte dann: «Na gut … dann setz dich mal hin …»
«Ich … ich dachte, Jan …»
«Der hat eine OP nebenan, ich kann das auch machen.»
Ich schluckte.
«Oder vertraust du mir nicht?», fragte sie bohrend nach.
Natürlich tat ich das nicht. Sie hatte mich noch nie ausstehen können, weil sie Jan schon liebte, bevor ich ihn aus dem Meer gefischt hatte.
«Ähem, doch … doch … na klar … vertraue ich dir», erwiderte ich und setzte mich unschlüssig auf den Stuhl. Olivia machte einen auf superprofessionell, nahm eins von diesen kleinen Zahnspiegeldingsbums in die Hand und forderte mich auf: «Dann mach doch bitte mal den Mund auf.»
Ich tat, wie mir geheißen, und sie sagte, leicht angewidert: «Uhh.»
«‹Uhh› … Wieso ‹uhh›?», fragte ich besorgt. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr beim Zahnarzt gewesen, weil mich ein Besuch zu sehr an Jan erinnert hätte.
«Du hast eine ganz schöne Alkoholfahne», antwortete Olivia etwas indigniert.
Ich wurde rot.
«Und das dahinten sieht nicht gut aus.»
«Nicht gut?»
Mir wurde mulmig.
«Mit ‹nicht gut› meine ich böse.»
«Böse?!?»
Jetzt bekam ich es mit der Angst zu tun.
«Richtig böse. Ein Riesenloch. Aber keine Sorge, das kriegen wir gleich hin», erklärte Olivia und nahm einen Bohrer in die Hand.
«Das … das müssen wir doch gar nicht hinkriegen», erwiderte ich panisch.
«Doch, das müssen wir», erklärte sie kühl sachlich. Dann drückte sie auf eine Sprechanlage und sprach hinein: «Frau Asmus, ich brauche Watte in Behandlungszimmer eins.»
«Watte, wieso brauchst du Watte?», fragte ich irritiert.
«Um die Instrumente etwas zu säubern.»
«Ach so», erwiderte ich.
«Und zum Blutstillen.»
«ZUM BLUTSTILLEN?!?»
Ich konnte es nicht fassen.
«Keine Sorge», sagte Olivia.
Keine Sorge? Keine Sorge?!? Die blöde Kuh hatte gut reden, sie war ja auch auf der richtigen Seite des Bohrers.
«Mach einfach eine Handbewegung, wenn es weh tut», schlug sie vor.
Sie machte den Bohrer an, der surrte los, und ich wedelte augenblicklich mit meiner Hand, bevor der Bohrkopf sich meinem Mund nähern konnte.
«Das kann doch noch gar nicht weh getan haben», erklärte Olivia und drückte mich in den Sessel. Der Bohrer surrte nun vor meinem Gesicht, jetzt konnte ich nicht mehr fliehen, ohne dass das Ding mir ein Zickzack-Muster in die Wange ritzen und ich dann aussehen würde, als wäre ich einem Tätowierer in die Hände gefallen, der an Parkinson litt.
Der Bohrer enterte meinen Mund, und Olivia sagte: «Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, dich zu fragen, ob du eine Betäubung willst. Ist doch okay so, oder?»
Als sie das fragte, glaubte ich bei Olivia die Andeutung eines sadistischen Lächelns zu sehen. Und meine fuchtelnde Handbewegung übersah sie dabei geflissentlich.
3
Zehn Minuten später saß ich da mit Schmerzen und jeder Menge Watte im Mund. Olivia hatte den Bohrer ausgestellt und fragte: «So schlimm war es doch nicht, oder?»
Doch, es war sogar unglaublich schlimm. Aber ich wollte Olivia nicht die Genugtuung geben, das einzugestehen. Deswegen machte ich tapfer ein Daumen-hoch-Zeichen. Mit der ganzen Watte im Mund konnte ich kein Wort herausbringen.
Im Radio spielten sie gerade Abba. Mir schoss durch den Kopf, dass Abba sich einst nach den Anfangsbuchstaben ihrer Gründungsmitglieder – Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid – benannt hatte, und ich fragte mich, wie Abba wohl geheißen hätte, wenn die Namen Frieder, Bjarne, Merle und Friedafrid gelautet hätten. FBMF? Oder was wäre gewesen, wenn die Musiker folgende Namen gehabt hätten: Frietjof, Ulla, Catherine und Karlsson?
In diesem Augenblick eilte Jan, ebenfalls im Kittel, ins Zimmer und berichtete empört: «Da hat sich jemand als Frau Reiter ausgegeben, die steht jetzt im Wartezimmer und ist total aufgebracht …»
Da entdeckte er mich und blieb mitten in der Bewegung stehen. Er sah für seine fast vierzig immer noch toll aus, so viel besser als ich mit vierunddreißig. Ich war bei seinem Anblick völlig hin und weg. Ich liebte diesen Mann. Über alles!
Jan war hingegen weniger hin noch weg, sondern einfach nur völlig verblüfft: «Rosa … hast du dich als Frau Reiter ausgegeben?»
Ich hatte keine Ahnung, was ich antworten sollte. Aber ich konnte Jan noch nie anlügen, und daher nickte ich leicht.
«Warum?», wollte er nun wissen.
«Weil sie betrunken ist», erläuterte Olivia.
Jan näherte sich meinem Mund und schnupperte meine Fahne. Besorgt sagte er: «Ach du meine Güte, das stimmt ja.»
Ich wäre am liebsten vor lauter Scham im Zahnarztstuhl versunken. Meine große Wiedereroberungsaktion hatte ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt.
«Warum bist du hier?», wollte Jan nun mit unsicherer Stimme wissen.
Ich stand auf und nahm mir die Watte aus dem Mund. Es tat zwar sehr weh, aber das war mir jetzt egal. Hollywoodheldinnen kennen keinen Schmerz.
«Das ist nicht gut für das Heilen der Wunde», tadelte Olivia.
«Da hat sie recht», erklärte Jan.
Es war herzerwärmend zu erleben, dass er sich immer noch um mich sorgen konnte.
«Ich muss dir dringend etwas sagen», erklärte ich Jan. Dann deutete ich auf Olivia und ergänzte: «Unter vier Augen.»
Jan zögerte. Olivia machte das sichtlich nervös.
«Du wirst doch nicht auf diese Frau hören?», fragte sie mit einem leicht panischen Unterton.
Dass sie Angst hatte, gefiel mir. Anscheinend nahm sie mich noch als Bedrohung wahr. Das war ein gutes Zeichen. Abba sang nun ‹The winner takes it all …›. Gleich würde sich herausstellen, wer von uns beiden der ‹winner› sein sollte.
«Bitte warte draußen», bat Jan. Olivia konnte es nicht fassen. Aber Jan blieb mit seinem Blick standhaft, so verließ sie wortlos das Behandlungszimmer. Und ich nahm das ebenfalls als gutes Zeichen: Für mich schickte Jan seine zukünftige Braut weg. Durfte ich da etwa nicht hoffen?
«Also, Rosa … was willst du mir sagen?», fragte Jan. Auch er war nervös. Spürte er, was kommen würde? Hoffte er sogar darauf? Durfte ich darauf hoffen, dass er darauf hoffte?
Nervös begann ich loszuplappern: «Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass mir der ganze Mist leidtut, den ich damals veranstaltet habe, und ich würde ihn unglaublich gerne ungeschehen machen, aber leider kann man ja nicht in die Vergangenheit reisen …»
Ich kicherte etwas nervös, nahm einen Schluck Wasser aus einem dieser kleinen Plastikbecher von dem Zahnarztstuhl, die immer nachgefüllt werden, und redete dann weiter: «Ich will mich dafür bei dir entschuldigen …»
Er schwieg, war durcheinander, versuchte das alles zu verarbeiten, bekam es aber sichtlich nicht hin. Dann sagte ich den einzigen Satz, auf den es hier ankam, all mein Gestammel zuvor war irrelevant, es ging doch nur um diesen einen Satz und Jans Antwort darauf. Und so erklärte ich tapfer: «Ich liebe dich immer noch.»
Jan musste schlucken. Und ich musste jetzt auf eine Antwort warten. Die Zeit dehnte sich, es waren vielleicht nur Sekunden, aber tatsächlich kamen sie mir vor wie Stunden, Tage, Jahre, Äonen. In dieser gefühlten Zeit hätten Zivilisationen entstehen und wieder vergehen können. Hätte Albert Einstein diesen Moment mitfühlen können, er hätte seine Relativitätstheorie neu geschrieben. Endlich hob Jan zu einer Antwort an. Mein Herzschlag setzte vor Aufregung fast aus. Dieses Behandlungszimmer, dieser Vorhof der Hölle, könnte sich jeden Augenblick in den Himmel verwandeln. All meine Träume könnten wahr werden. Mein tristes Leben könnte wieder einen Sinn bekommen.
Und dann erklärte er mit leiser Stimme: «Aber ich liebe dich nicht mehr.»
Es war, als ob mir jemand das Herz zerquetschte, so sehr schmerzte es.
Jan sah mich entschuldigend an, es tat ihm sichtlich leid, mir so weh zu tun.
«Ich habe dich geliebt», begann er sich zu erklären, «und ich war nach der Geschichte damals am Boden zerstört …» Er lächelte schwach, aber ich war zu schwach, um schwach zurückzulächeln. «Doch bin ich durch diese Erfahrung auch reifer geworden», redete er weiter. «Ich weiß jetzt besser, was ich will, und die Liebe mit Olivia ist eine tiefe, erwachsene Liebe … eine reife Liebe … Wir wissen, dass wir füreinander bestimmt sind … und … und …»
Er sah in meinem Gesicht, dass ich nicht wirklich hören wollte, warum es mit Olivia so viel großartiger war als mit mir, und stellte fest: «… und ich sollte vielleicht nicht mehr weiterreden.»
Er sah mich nun an, schwieg, und bevor er so etwas Albernes wie «Wir können ja Freunde bleiben» sagen würde, entließ ich ihn aus seiner Unsicherheit: «Geh ruhig zu ihr, ich finde schon allein hinaus.»
Er nickte, sah mich noch einmal kurz an und ging dann zu seiner Olivia in den Gang und umarmte sie, was sie sichtlich erleichterte. Sie hatte wirklich Angst vor mir gehabt.
Ich betrachtete die beiden: Ihre Liebe war also reif, wunderbar und groß, sie waren füreinander bestimmt … das hatte Jan gesagt. Nicht nur, dass er mich nicht mehr liebte. Er liebte Olivia mehr, als er mich je geliebt hatte. In meinem Inneren zerbrach nun alles. All meine Hoffnung, all meine Lebensfreude und all mein Selbstbewusstsein.
Dazu sang Abba: «The looser is standing small.»
Und ich dachte mir: Frietjof, Ulla, Catherine und Karlsson.
Jetzt hasste ich es total, ein Klischee zu sein.
Und ich wünschte mir so sehr, nicht mehr ich zu sein.
4
Währenddessen im Leben von William Shakespeare, London, 12. Mai 1594
Sir Francis Drake, der Admiral der Königin, hatte sein mächtiges Schwert gezogen und brüllte mich an: «William Shakespeare! Du wagst es, mit meinem Weibe das Bett zu teilen, während ich draußen auf See für England kämpfe?»
Dabei stand ich splitterfasernackt vor ihm. In seinem edlen Schlafgemach. Neben seinem ebenfalls nackten Eheweib Diana.
Augenscheinlich war der Admiral früher als von uns allen erwartet von seiner jüngsten Seefahrt in die Heimat zurückgekehrt, und wir hatten seine Schritte auf der Holztreppe nicht gehört, vermutlich, weil sie von unserem eigenen wollüstigen Gestöhne übertönt wurden. Selbstverständlich hatte ich schon vorher gewusst, dass ich mich in höchste Gefahr begebe, wenn ich Beischlaf vollziehe mit dem Weib von Englands größtem Helden, dem Bezwinger der spanischen Armada. Allerdings lag allein in dieser Tatsache der erotische Reiz, das lustvolle Prickeln, die gesamte Begehrlichkeit von Diana begründet. Gab es doch viele Frauen, die sie an Schönheit übertrafen. Dies konnte man Diana allerdings nicht zum Vorwurf machen, schließlich besaß sie schon ein reifes, fast überreifes Alter, war sie doch siebenundzwanzig Jahre alt.
Und was ihre Liebeskünste betraf, nun, die waren lediglich mäßig entwickelt. Um der Wahrheit Genüge zu tun, hätten sie Grund gegeben, Klagegesänge anzustimmen.
«Das wirst du sühnen, Shakespeare!» Der Zorn des mit einem feinen Ballonhemd und enganliegenden Seidenhosen elegant gekleideten Edelmannes ließ seine Adern so hervortreten, dass ich durchaus auf eine schnelle Rettung durch einen plötzlichen Schlaganfall seinerseits hoffen mochte.
Die zitternde Diana betrachtete indessen furchtsam ihren Ehemann und beschloss, sich mit einer Ohnmacht aus der Affäre zu ziehen.
«Mir schwindelt es», rief sie schrill aus, wohl hoffend, dass einer von uns beiden sie auffangen möge. Sie sank zu Boden. Doch keiner von uns beiden eilte zu Hilfe.
Ich nicht, weil mein nackter Hals von dem Schwerte bedroht war, und Sir Francis nicht, weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, mir die Klinge an den Hals zu halten. Diana stieß mit dem Kopf gegen den aus edlen Hölzern der neuen Länder geschnitzten Bettpfosten, was ein hohles Geräusch verursachte, von dem man sich nicht ganz sicher sein konnte, ob es von dem Bettpfosten stammte oder von Dianas Kopf.
Ich sah kurz hinab und empfand sogar etwas Mitleid mit ihr, aber nicht halb so viel wie mit mir selbst: Sir Francis würde mich hier auf der Stelle auf seinem Bärenfell mit einem Schwerthieb töten. Ich würde also nie die großen Theaterstücke schreiben dürfen, von denen ich seit meiner Kindheit im kleinen Stratford träumte, sondern nur bekannt für die mittelmäßigen sein, die ich bisher geschrieben hatte. Ich würde nie reich werden und nie wieder dem bedeutungslosen Beischlaf mit schönen Frauen frönen. Auch würde ich nie mehr mit meinen lieben Schauspielerfreunden raufen, saufen und huren oder ihnen dabei zusehen, wie sie für hohe Summen um die Wette furzten … gut, auf Letzteres mochte ich womöglich noch verzichten …
Aber vor allen Dingen würde ich nie wieder meine Kinder sehen, nie wieder ihr wunderbares Lachen hören dürfen … ein Gedanke, der mir unendliche Trauer bereitete.
«Wehr dich, Shakespeare!», unterbrach Drake meine sentimentalen Gedanken an das Leben, das ich nicht mehr weiterführen durfte.
«Eine exzellente Idee», erwiderte ich, «doch wie soll ich mich wehren, wo Sie mir doch die Klinge an den Hals legen?»
Drake zog ein weiteres Schwert aus einer Halterung an der Wand und warf es mir zu. Ich fing es nicht sonderlich elegant auf, war es doch viel größer als die Klingen, mit denen wir auf der Bühne unsere Theater-Scheingefechte aufführten. Das Schwert lag schwer in meiner Hand. Jetzt galt es: Ich konnte um mein Leben betteln wie eine jämmerliche Maus oder gegen den besten Fechter des Königreichs um mein Leben kämpfen wie ein echter Mann!
Ich entschied mich für die jämmerliche Maus.
«Verschont mich», bettelte ich und kniete mich auf den Boden. «Bitte tötet mich nicht, edler Lord, gewähret Gnade.»
Mein Verhalten war eingestandenermaßen nicht sehr würdevoll, doch dafür klug und weise, denn was half einem all die Würde, wenn man seinen Kopf unter dem Arm trug?
«Ob du dich wehrst oder nicht, Shakespeare, deine Tat muss gesühnt werden.» Drake hob das Schwert zum Schlag. Diana wachte auf, sah, dass ihr Ehemann mich enthaupten wollte, und schloss schnell wieder die Augen.
So kam ich nicht weiter. Rasch änderte ich meine Taktik. «Ich werde Euch nie wieder Hörner aufsetzen, habe ich doch keinerlei Verlangen mehr nach Eurem Weibe. Sie wissen doch, sie ist im Bett wie ein Brett.»
Jetzt öffnete Diana wieder die Lider und rief aus: «Enthaupte ihn!»
«Ich werde deinen Kopf vor den Stadttoren aufspießen!», zürnte Drake und ging einen Schritt auf mich zu.
Da ich nicht als krude Belustigung für verrohte Bauern enden wollte, die nach London kamen, um ihre Waren feilzubieten, suchte ich hastig nach einem Ausweg aus meiner furchtbaren Lage. Und der einzige Ausweg bestand in einer klugen Finte: «Sir Francis, hinter Ihnen …!»
Ich gestehe ein, es war keine besonders originelle Finte, eher eine, wie man sie in einem miesen komödiantischen Werk eines meiner Dramatikerkollegen fand, aber sie erfüllte ihren Zweck. Sir Francis, der es gewohnt war, dass ihm katholische Meuchelmörder der spanischen Krone heimtückisch auflauerten, blickte hinter sich. In diesem Moment sprang ich vom Boden auf, eilte zum Fenster seines Stadtpalastes und blickte hinab auf die im Dunkeln sanft dahinfließende Themse. Obwohl ich wusste, dass das Wasser außerordentlich kalt sein würde, kletterte ich flink durch das Fenster auf den steinernen Sims und sprang ohne Zögern hinunter. Als ich durch das eisige Wasser tauchte, zürnte ich für einen Augenblick dem Umstand, dass Drakes Bedienstete ausgerechnet hier die Fäkalien aus dem Haus entsorgten.
Zurück an der Oberfläche, schnappte ich nach Luft und begann um mein Leben zu schwimmen. Ich blickte mich um zu Drake, der wutentbrannt am Fenster stand. Aber er sprang mir nicht hinterher, um die Verfolgung aufzunehmen. Anscheinend wusste auch er, wo die Bediensteten seine Fäkalien zu entsorgen pflegten.
«Ich werde dich töten, William Shakespeare!», schrie er mir hinterher.
Ich war zu schwach, ihm eine geistreiche Replik zurückzurufen. Ich schwamm einfach nur die Themse hinab, die nur durch einige wenige Fackeln am Ufer schwach erleuchtet war. Das kalte Wasser ließ meine nackte Haut frieren, doch meine Adern froren noch mehr beim Gedanken daran, dass Diana meinen Tod wollte. Ebenjene Diana, die noch vor wenigen Minuten ausgerufen hatte, dass sie mich auf ewig liebe. So waren nun mal die Frauen in der Großstadt London, sie betrogen ihren Gemahl und forderten dann den Kopf des Geliebten. Doch dies machte mir nichts aus, ich wollte Frauen ohnehin nur noch meinen Körper widmen und nie wieder mein Herz! Denn eins habe ich im Leben gelernt: Wenn man der Liebe verfällt, kann man nur um zwei Dinge bitten: ein Stück Seil und einen wackeligen Stuhl.
5
Nach diversen weiteren Kummer-Ramazzottis verfrachtete mich Holgi sicher in mein Bett. Während er mich liebevoll zudeckte, sagte er den blödesten Satz, den man einer Frau, die an Liebeskummer litt, nur sagen konnte: «Auch andere Mütter haben hübsche Söhne.» Und er ergänzte auch noch: «Und diese Söhne sind keine Zahnärzte.»
Es war ja nicht so, dass ich nicht schon versucht hatte, mich mit anderen Männern zu verabreden. Ich hatte mich in den letzten beiden Jahren bei Single-Börsen mit Namen wie Elite-Liebe.de angemeldet und dort mit Männern angebandelt, die genauso wenig Elite waren wie ich. Auf den Partnerbörsen fand man eben nur beschädigte Ware.
Zuerst gab es Thomas, einen netten, aber etwas langweiligen Journalisten, bei dem ich im Bett nur abwechselnd dachte: «Was veranstaltet der denn da?» und «Das ist ja drollig.»
Danach kam Peter, der in seinem Profil angab, sich für Lyrik zu interessieren, und ein schickes Foto eingestellt hatte. Bei unserem ersten Treffen stellte sich dann leider heraus, dass Peter ‹erotische Gedichte› schrieb, das Foto gefälscht war und er in Wahrheit aussah wie Gollum.
Schließlich trat der Sozialarbeiter Olaf in mein Leben, allerdings tat er dies nur halbherzig, war er doch noch nicht über seine Exfrau Eva hinweg. Er trauerte so sehr um sie, dass er für sie sogar einen eigenen Song geschrieben hatte:
«I love you, Eva,
and I will go,
wherever you are, Eva,
even if it is Jever!»
Nachdem er mir das in einer schwachen Minute vorgesungen hatte, wollte ich am liebsten auch nach Jever.
Aber ich konnte ihn auch ein bisschen verstehen, schließlich sang ich doch selbst in Gedanken: «I love you, Jan, and I will go, wherever you are, Jan, even if it is Aserbaidschan.»
Das war das Problem mit diesen Partnerbörsen, sie versuchten für einen Leute zu finden, die so ähnlich waren wie man selber. Und ich fand daher nur Männer, die genauso kaputt waren wie ich. Doch ich wollte niemanden, der mir ähnlich war. Ich wollte jemand, der anders war. Ich wollte immer nur Jan.
«Du weißt doch, ich habe es mit anderen Männern schon versucht», antwortete ich Holgi, leicht Ramazzotti-lallend. Aber er erwiderte: «Du brauchst ja erst mal keinen Mann fürs Leben, nimm dir doch einen für einen One-Night-Stand.»
Und dann begann er spontan zu singen, wie er es gerne mal tat: «One-Night-Stand, One-Night-Stand, hast du Frust, so habe einen One-Night-Stand, danach willst du zwar duschen und deine Lust verfluchen, aber du vergisst den Frust bei einem One-Night-Staaaaaaaaand!»
Er sah mich erwartungsvoll an. Doch ich konnte mir so einen One-Night-Stand nicht vorstellen. Ich war nicht in der Stimmung für so etwas. Und selbst wenn. Mit welchem Mann außer Jan hätte ich Sex haben wollen?
6
Am nächsten Vormittag hatte ich einen unglaublichen Kater, der auch nicht gerade dadurch besser wurde, dass ich in der Schulpause die Hofaufsicht hatte. Circa zweihundert Grundschüler machten dort einen Lärm wie achthundert normale Menschen, und ich dachte mir, dass es auf einer Flughafenlandebahn sicherlich leiser wäre, selbst wenn eine Concorde crashlanden würde.
Ich war nur aus Verlegenheit Lehrerin geworden, mein Traum war es eigentlich gewesen, Musicals zu schreiben, seitdem ich mit sieben Jahren bei ‹Arielle, die Meerjungfrau› gehört hatte, wie Sebastian, die Krabbe, ‹Unter dem Meer› sang. Mit fünfzehn hatte ich dann auch tatsächlich mein erstes Musical geschrieben, es hieß ‹Wolfsmond› und handelte von einem jungen Mädchen, das sich in einen Werwolf verliebte und mit ihm im großen Schluss-Duett des Stückes sang: ‹In unsren Herzen wohnt/eine Liebe größer als der Mond› (wie gesagt, ich war fünfzehn). Dummerweise hatte ich das Musical meinem Deutschlehrer gezeigt, der fand, es sei wahrscheinlicher, dass ich zum Mars fliege, als dass ich in Zukunft Musicals schreibe. Das beendete meine Schriftstellerkarriere, bevor sie überhaupt begonnen hatte, und so entschied ich mich nach dem Abi für ein Lehramtsstudium. Für diesen Job war ich, was viele meiner Kollegen auch waren: relativ ungeeignet. Vielleicht hätte ich den Beruf wechseln sollen, aber ich hatte keine Idee, was ich sonst mit meinem Leben anstellen sollte. Zudem war ich ein großer Freund von Ferien und regelmäßigen Gehaltsüberweisungen. Von nervigen Kindern hingegen war ich nicht so ein großer Freund. Von ehrgeizigen Eltern noch viel weniger, von der Schulbehörde mit ihren ständig wechselnden Reformideen ganz zu schweigen (ob die dort eigentlich alle LSD nahmen?).
Während ich gerade über mein verkorkstes Leben im Allgemeinen und meinen peinlichen Auftritt bei Jan im Speziellen nachdachte, kam der kleine Max, ein lockiger Zweitklässler, auf mich zu und schimpfte: «Kevin ist ein Micker!»
«Micker?», fragte ich irritiert.
«Ja, ein echter Muttermicker.»
Der Kleine hatte ganz offensichtlich eine Konsonantenschwäche.
«Und warum ist er das?», fragte ich, obwohl es mich nicht sonderlich interessierte.
«Er hat Leon mit Handschellen an die Heizung im Klassenzimmer gekettet.»
«WAS?»
Jetzt hatte er doch meine Aufmerksamkeit.
«Mit den Handschellen von seinem Papa. Der ist Polizist. Er hat sie heimlich mit in die Schule genommen.»
«Micker!», fluchte ich.
«Sag ich doch», meinte Max und führte mich in den Klassenraum, wo der kleine Leon – Typ dickes Opferkind – tatsächlich an die Heizung gekettet war und jammerte: «Ich muss Pipi!»
Ich rüttelte an den Handschellen, hatte aber keine Ahnung, wie ich sie aufkriegen sollte. Gerade wollte ich den Hausmeister rufen, da kam der Sportlehrer Axel hinzu und erklärte: «Ich mach das schon. Ich hab mit Handschellen Erfahrung …»
«… von der man in Anwesenheit von Zweitklässlern vielleicht besser nicht reden sollte», unterbrach ich ihn.
Er grinste, öffnete die Handschellen geschickt mit einem Draht, und Leon rannte schnell aufs Klo, um Pipi zu machen. Von Kevin keine Spur. Der kleine Max verkündete: «Jetzt mach ich Kevin fertig.»
«Du solltest nicht streiten», versuchte ich halbherzig, einen Streit zu verhindern, obwohl ich eigentlich fand, dass der kleine Kevin ein bisschen Kloppe verdient hatte.
«Kevin ist aber ein Mixer», schimpfte Max und rannte los.
«Mixer?», fragte Axel irritiert.
«Konsonantenschwäche», erklärte ich.
«Ach, deswegen rief er gestern: ‹Timmy ist ein Schwanzkutscher!›»
Ich seufzte und schlug dann vor: «Wir sollten ihn in einen Förderunterricht geben.»
«Und wir beide sollten heute Abend endlich mal was unternehmen», grinste Axel breit. Er hatte mich das seit dem Kuss-Desaster vor zwei Jahren immer mal wieder gefragt. Aber jedes Mal hatte ich abgelehnt, was mich für ihn anscheinend von Mal zu Mal noch interessanter machte.
«Ich habe Freikarten für den Zirkus», lächelte er. «Hast du nicht Lust, mich zu begleiten?»
Normalerweise hätte ich ihm wieder einen Korb gegeben, aber in meinem Kopf hörte ich plötzlich Holgis Stimme: «One-Night-Stand, One-Night-Stand …»
7
Axel trug an diesem Abend ein besonders körperbetontes Shirt und darüber eine coole Lederjacke. Er hatte so gar keine Ähnlichkeit mit meinem intellektuellen, stilsicheren Jan; und das war auch gut so. Bei Axel musste man auch kein schlechtes Gewissen haben, ihn nur für belanglosen Sex auszunutzen, schließlich war für ihn eine Beziehung, die länger als eine Woche hielt, schon ein Langstreckenrekord.
Die Vorstellung begann. Eine chinesische Akrobatin betrat die Manege. Sie konnte ihren Körper so kunstvoll verdrehen, dass Axel meinte: «So eine Liebhaberin würde mir Angst einjagen.»
Ich dachte mir, dass er bei mir deswegen nachher im Bett keine Angst haben musste, war ich doch eher unterdurchschnittlich beweglich.
Nachdem die chinesische Akrobatin ihre Darbietung, bei deren bloßem Anblick ich schon Gelenkschmerzen bekam, beendet hatte, kündigte der Conférencier den großen Akt an: «Gleich, meine Damen und Herren, erleben Sie den unvergleichlichen, den einzigartigen, den mystischen Magier Prospero!»
Sphärische Musik ertönte, und ein Mann betrat die Manege, der aussah wie ein Komparse aus einem Vampirfilm: Er war von großer, hagerer Gestalt, hatte dunkle, durchdringende Augen und trug schwarze Klamotten. Darüber einen wehenden schwarzen Umhang. Man konnte sich gut vorstellen, dass er in einem Sarg mit Heimaterde aus Transsylvanien schlief. In der Mitte der Manege angekommen, verkündete er mit einer mystisch klingenden Stimme: «Die Seele des Menschen ist unsterblich und wird immer wieder neu geboren.»
«Hoffentlich nicht jedes Mal als Lehrer», alberte Axel.
Hoffentlich nicht immer als ich, ergänzte ich in Gedanken.
«Ich habe», fuhr Prospero fort, «die altehrwürdige Kunst der Rückführung bei den Shinyen-Mönchen in Tibet erlernt. Sie haben mir gezeigt, dass ich einst ein mächtiger Krieger beim Mongolenfürsten Ablai Khan war.»
«Und nachher haben sie sich hinter seinem Rücken vor Lachen abgerollt», scherzte Axel weiter.
Aber ich lachte nicht mit, dieser Mann in der Manege beeindruckte mich. Irgendetwas bewegte er in meinem Inneren, als würde er von einer tieferen Wahrheit künden.
«Ich werde nun», erklärte Prospero mit großer Geste, «einen von Ihnen in ein früheres Leben zurückversetzen. Und dieser Zuschauer wird das ganze Potenzial seiner unsterblichen Seele entdecken und fortan nutzen können. Er wird also zu sich selber finden!»
Das war ein ziemlich beeindruckendes Versprechen, wie ich fand.
«Wer meldet sich freiwillig?», wollte Prospero wissen und stolzierte dabei wehenden Umhangs durch die Manege.
«Freiwillig ist nie gut», kommentierte Axel.
Prospero ging in das Publikum, und ich wurde plötzlich unruhig. Der würde doch nicht ausgerechnet mich in die Manege holen, oder? Ich stand nicht so darauf, im Mittelpunkt zu stehen, und hatte mit dem Zahnarztbesuch meinen Bedarf an peinlichen Auftritten für dieses Leben übererfüllt. Merkwürdigerweise verspürte ich aber noch ein viel tiefer sitzendes Gefühl: Irgendetwas rumorte in mir, hatte Angst davor, in ein früheres Leben abzutauchen. Verrückt, hatte ich doch nie zuvor über Wiedergeburt ernsthaft nachgedacht. Außerdem wusste mein Verstand doch, dass es so was wohl gar nicht gab und der Kerl, der durch die Zuschauerreihen ging, ähnlich seriös war wie ein albanischer Hütchenspieler. Oder ein Finanzproduktverkäufer.