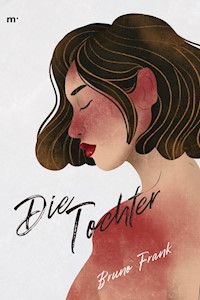Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der ehemalige Minister Ferdinand Carmer verbringt seinen Urlaub in der süditalienischen Hafenstadt Ravello. Es ist die Zeit der Weimarer Republik. Wahrscheinlich wird Carmer bald wieder ein Ministeramt übernehmen. Vor der erneuten beruflichen Bindung kostet er seine Freiheit auf Reisen voll aus. Er gerät in eine Kundgebung, auf der Mussolini als Redner auftritt. Gerne verlässt er nach dieser Erfahrung Italien und folgt einer Einladung des französischen Außenministers Achille Dorval zum Gespräch ins französische Cannes. Als sich Dorval wegen einer Autopanne mehrere Stunden verspätet, verbringt Carmer seine Zeit im Spielcasino. Dort begegnen ihm der Wohlstand und die Internationalität, aber auch der Snobismus und die Vergnügungssucht der 20er Jahre in übersteigerter Form. In dem langen Gespräch mit Dorval erörtert Carmer die Möglichkeiten zur Aussöhnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg. Nachdem er sich von Dorval verabschiedet hat, setzt Carmer seine Reise spontan fort. Er fährt nach Marseille. Ein letztes Mal will er sich vor der Rückkehr nach Berlin richtig amüsieren. Dabei unterschätzt er die Gefahren eines großstädtischen Vergnügungsviertels. Die »Politische Novelle« von Bruno Frank erschien erstmals 1928. Vorbild für den Romancharakter des Achille Dorval ist der französische Außenminister Aristide Briand. Thomas Mann besprach die »Politische Novelle« 1930 in einem längeren Essay, das die hohe literarische Bedeutung des Werkes betonte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Politische Novelle
Politische NovelleIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIImpressumBruno Frank
Politische Novelle
I
Der Reisende aus Deutschland, der in der Pension Palumbo die Zimmer 14 und 15 bewohnte, erwachte wie alle Tage pünktlich um halb sieben. Er stand augenblicklich auf, wusch sich, und kaum bekleidet, mit nacktem Oberleib, trat er in den kleinen Wohnraum, der an sein Schlafzimmer stieß. Auch hier standen beide Fenster weit offen, mit voller Flut strömte ihm süditalischer Frühling entgegen. Das Gärtchen unten brannte von Farben, weiterhin in der Tiefe strahlte und rauschte der Golf; aber der Gast vergönnte sich noch keinen Blick, sondern begann unverweilt seine Körperübungen.
Es waren zuerst die herkömmlichen Drehungen des Rumpfes und Beugungen der Kniee, durchgeführt nach offenbar vorgezeichneter Ordnung. Dann aber wandte er sich einem Lederball zu, der zwischen senkrecht gespannten elastischen Schnüren in einer Ecke des Gemachs kopfgroß in Kopfhöhe schwebte, und begann diesem Phantom mit kunstgerechten und gewaltigen Fauststößen zu Leibe zu gehen.
Er sah nicht aus wie ein Boxer. Sein Gesicht, schmal und fest, von blasser wenn auch keineswegs kranker Farbe, wirkte verfeinert, wirkte geistig, und vollends sein Körper schien von der Natur nicht auf brutale Leistung angelegt. Sonderbar fremd, nicht recht zugehörig, wie ertrotzt und erzwungen traten an diesen fast gebrechlich geformten Schultern und Armen Muskelschwellung und starke Sehne hervor.
Er arbeitete still, methodisch; in unermüdlicher Abwechslung schnellten seine Fäuste gegen den Ball. Endlich aber, als der Schläger abließ von ihm, zitterte er nur ganz wenig noch nach und schwebte sogleich unverwandt, Abbild einer stumpfen und toten Masse, der kein Wille, kein Vorstoß der Welt etwas anhaben kann.
Der Reisende nahm nun ein paar Hanteln hervor, Federhanteln, im Innern mit starker Stahlspirale versehen. Abwechselnd presste er sie zusammen in seinen Fäusten und ließ wieder locker. Er endete nach zehn Minuten, kleidete sich an und begab sich über die dunkle Steinstiege des alten Bischofshauses in das Gärtchen.
Er wurde erwartet. Doktor Erlanger stand an die Balustrade gelehnt und blickte über die obst- und weinbepflanzten Terrassen hinunter aufs Meer. Sie nahmen ihre Plätze ein. Vor dem des Gastes von Zimmer 14 lag ein Brief, ein Riesenexemplar von einem Brief, ein wahres Paket in starkem, rotbraunem Umschlag. Solch eine Sendung traf an jedem Morgen hier ein.
Sie frühstückten. Der Aufwärter, bejahrt, in Hemdärmeln und grüner Schürze, ging ab und zu, die Inhaberin des Hauses Palumbo, eine stille Schweizer Dame, kam durch das Gärtchen, grüßte aus kleiner Entfernung und sah mit einem erfahrenen Blick nach dem Rechten. Gäste waren noch nicht zu sehen. Morgenstille. Kein Laut. Kein Vogel sang in dem Garten.
Doktor Erlanger, jung, groß, sehr brünett, mit auffallend engstehenden Augen, frühstückte mit Appetit. Aber der Gast von Zimmer i4 nahm sehr wenig, eine Tasse Tee, eine Scheibe trocknes geröstetes Brot und ein Ei schienen ihm zu genügen.
„Sie essen wieder gar nichts,“ sagte sein Gefährte in einem achtungsvollen, dabei fast zärtlichen Ton, „ein Fremder müßte glauben, Sie wollten schlank bleiben.“
„Schlank nicht, Erlanger, aber nüchtern.“ Und mit einem kleinen spöttischen Lächeln hob er das Gestell mit dreierlei süßem Gelee in die Höhe, um es dem Hungrigen hinzureichen. Er setzte es unvermittelt nieder und besah seine Hand.
„Das ist doch erstaunlich,“ sagte er. „Diese Übungen mit der Hantel strengen die Muskeln so an, daß sie zuerst nicht das Leichteste bewältigen. Ein Kind könnte einen umbringen.“
„Nun machen Sie auch noch Hantelübungen, Herr Carmer? Warum tun Sie das alles; es verwundert mich immer. Ich weiß doch zu genau, wie Sie über Sport und Sportleidenschaft denken. Mit welchem Hohn haben Sie mir einmal ein Zeitungsblatt vorgewiesen, das in riesigen Lettern die Überschrift trug: ›Ehrt Eure deutschen Meister‹ – und es waren Fußballmeister gemeint!“
„Da verwechseln Sie zwei Dinge. Sport? Nein, mit Sport hat das gar nichts zu tun. Man muß kräftig sein zu ganz andern Zwecken.“
„Zu andern?“
„Nun, es hat jemand ausgesprochen, der Mensch sei ein prügelndes Tier. Danach muß man sich richten.“
„Oh, mich dünkt aber, niemand sei auf solche primitiven Kampfmittel weniger angewiesen als gerade Sie. Zwanzig Worte von Ihnen, eine einzige ironische Pointe, mit Ihrer leisesten Stimme vorgebracht . . .“
Der Andere hob seine wenig brutale Hand. „Recht falsch,“ sagte er, „recht falsch. Logik ist gut, Erlanger, Vortrag ist brauchbar, Ironie tut ihren Dienst. Aber im Grunde läuft doch alles auf das Körperliche hinaus, die Faust ist letzte Instanz. Politik, Guter, ist keine Sache des Denkens und des geistigen Wettstreits. Seien Sie überzeugend, seien Sie witzig, seien Sie sublim – da unten sitzen die, Leib an Leib, und hören zu mit einem Drittel Bewußtsein, und ihre Körperlichkeit murrt: dem möchten wirs zeigen! Man bändigt sie anders, Erlanger, wenn man sich seines eigenen Leibes sicher fühlt. Es ist lächerlich und beschämend. Aber es ist wahr.“
„Voltaire konnte nicht boxen“, sagte Doktor Erlanger.
„Darum hat ihn der Rittmeister Beauregard auch blutig geschlagen. Lassen Sie Ihre Kinder nur trainieren, Erlanger, wenn Sie einmal welche kriegen. Wenn Ihr Juden einmal alle Bescheid wisst mit Kinnhaken und Uppercuts, dann wird es bald keinen Antisemitismus mehr geben, glauben Sie nur!“ Und er blickte den jungen Mann brüderlich an.
Ihr Frühstück war beendet, der Aufseher mit der Schürze trug ab. Herr Carmer öffnete sein Briefpaket. Es enthielt Aktenstücke, Handschreiben und sehr viele Ausschnitte aus deutschen Tageszeitungen. Doktor Erlanger war hinter ihn getreten, willens offenbar, der Durchsicht stehend beizuwohnen; ein Stuhl wurde für ihn herbeigezogen.
„Das kann nur Tage noch dauern,“ sagte der Mitlesende nach einer Weile. Stille dann wiederum. Mit dem Stift wurden kurze Weisungen notiert und das kommentierte Blatt dem Sekretär weitergegeben. Der schichtete es sorgsam zum Übrigen.
„Es kann unmöglich dauern,“ sagte er von Neuem. „Die Entschlüsse, die jetzt bevorstehen, werden die Anderen nicht verantworten wollen. Man wird froh sein, vor der Entscheidung die Bürde weiterzugeben. Sie werden sich bereithalten müssen, Herr Carmer!“
Stille. Ein Nicken. Ein Lächeln. Nun blieben die Zeitungsblätter noch übrig. Mit buntem Stift waren viele Stellen angekreuzt oder eingewandert, die nach dem Urteil der Einsender Beachtung verdienten. Mit rasch gleitenden Blicken unterrichtete sich der Geübte.
Gäste betraten den Frühstücksgarten. Die Beiden standen auf, reichten einander die Hand und trennten sich.
II
Carl Ferdinand Carmer war unter der Republik dreimal Minister gewesen, einmal Minister in Preußen und zweimal Minister des Reichs. Seiner Laufbahn nach war er ein Richter. Er entstammte der Familie jenes Freiherrn von Carmer, der als Großkanzler König Friedrichs das Preußische Landrecht schuf, das erste moderne Gesetzbuch Europas und also der Erde. Die Linie des Hauses, der Ferdinand Carmer angehörte, war bürgerlich geblieben, obgleich ihr unter mehreren Königen die Nobilitierung leicht erreichbar gewesen wäre. In diesem Widerstreben sprach sich Selbstgefühl aus, ein Bürger- und Geistesstolz, der in der untadelhaften Verwaltung verantwortungsvoller Ämter sein eigenes, besonderes Patriziat sah und vererbte.
Namentlich Ferdinand Cramers Vater, Justizminister und dann Oberpräsident von Westfalen unter dem ersten Wilhelm, lebte in solcher Gesinnung. Seine Männer waren jene Patrioten, die dem siegreichen Preußenkönig rieten, sich nicht Kaiser, vielmehr Herzog der Deutschen zu nennen, da von äußerem Hoheitsprunk nur Überspannung und Gefahr zu gewärtigen sei. Er hatte auch die lauten Zeiten des Enkels noch erlebt, und Ferdinand Carmer erinnerte sich mit hellster Deutlichkeit eines Tages, da sie miteinander in Berlin einer Denkmalsenthüllung beigewohnt hatten, einer schmetternden und blitzenden Festivität, und wie auf dem Heimweg der Vater an Blüchers Standbild Halt gemacht und mit der weißbekleideten Rechten hinaufgedeutet hatte:
„Dieser Herr da, nicht wahr, hat seinerzeit Preußen gerettet. Außerdem hat er die Welt von Napoleon befreit. Manche mißbilligen das, aber Tatsache bleibt es. Nun, dafür hat er sein Denkmal. Aber weißt du auch, wie es bei so etwas zuging im alten Deutschland, im richtigen Deutschland? Da kamen in der Frühe zwei Arbeiter hierher und nahmen die Hülle herunter. Publikum war auch da, gewiß, drei Männer standen auf diesem Platz morgens um sechs: der Bildhauer Rauch, Hegel und Gneisenau.“
Ferdinand, der Sohn, war mit Hingebung Jurist. Es dünkte ihn schön, mit leisem Scharfsinn das geschriebene Gesetz nach dem Bedürfnis der mächtig sich wandelnden Gegenwart auszulegen und sinnvoll zu erhalten. In der späten Stille seines Arbeitszimmers an den Grundlagen von Staat und Gesellschaft mauernd, war er oft glücklich. Da er Zivilrichter war, blieben seiner Empfindlichkeit Verantwortungsnöte beinahe völlig erspart. Als der Krieg losbrach, war er, ein Fünfunddreißigjähriger, Rat am Kammergericht in Berlin.
Unvermittelt, mit eisernem Zugriff, nahm ihm der Krieg alles Glück. Er nahm ihm, als Erstes, die Frau. Seit einigen Jahren lebte er in einer wahrhaft seligen Ehe mit einer Tochter aus altem süddeutschem Kaufmannshause, einem geisteslebendigen, pikanten, heitern Geschöpf. Gleichzeitig mit ihm ging sie in jenem August als Pflegerin zur Front. Sechs Wochen später starb sie an einer Infektion; Carmer sah nur noch ihren entstellten Leichnam. Er wankte, er meinte nicht länger zu leben. Aber er richtete sich auf. Noch hob und trug ihn die Welle von heroischer Unvernunft, die alles Land überrollte. Zwei Monate später hätte er dem Schlag nicht widerstanden.
Denn dies war der zweite, für einen Mann seiner Art schwer tragbare Verlust: ihn brachten die Ereignisse um allen Frieden mit sich selbst.
Die Vernunft hatte nicht standgehalten! Alle lebenslang geübte Klarheit, Nüchternheit und Kritik war zum Teufel gegangen vor dem Anprall einer tobenden Stunde. Wie der Letzte und Dumpfste, blind und taub, hatte er geglaubt und gewütet, mit hochrotem Kopfe – oh ewige Scham! – hatte er auf einem öffentlichen Platze mit der fanatisierten Menge geschrien und die Arme geschwenkt, er, der doch wusste, was Krieg bedeutete und wie er entstand: nicht aus einem Zusammenprall von Edelmut und Gemeinheit wahrhaftig, sondern aus ganz unheroischen Tatsachen von trister Greifbarkeit, über die man bunte Tücher deckte, um das Volk zu verführen. Das Volk, ja – aber auch ihn? Wie nahmen sich eigentlich die Worte Erbfeind, Blutsbrüderschaft, Rache aus im Munde Eines, den seine Herkunft, seine Anlage, seine Erziehung zu Wahrheit und Klarheit verpflichteten! Oh ewige Scham! Nach Jahren noch kehrte die Vorstellung bei ihm wieder, daß der Tod seiner geliebten Frau Strafe gewesen sei für seinen Verrat am Geiste.
Die angestaute Erkenntnis brach hervor in ihm und wurde zum Entschluß an einem Nachmittag in Flandern, als er, für wenige Tage zurückgenommen von der Front, an einem Feldrain saß und ruhte. Ein Militärzug fuhr an ihm vorbei, der neues Kanonenfleisch heranrollte. An den offenen Schiebetüren der Viehwagen drängten sich die Gezeichneten und brüllten ihr Lied in die Herbstluft.
„Ganz so ist mein Gesicht“, sagte er auf einmal vor sich hin und wurde dunkelrot, obwohl er allein war. Er stand auf, er ging zur Abteilung zurück. Er hatte ein verbranntes, zerschossenes Dorf zu durchqueren. Vor einem wenig versehrten Hause sah er die angesengte, halbnackte Leiche eines Mannes liegen, an der ein hungriges Schwein fraß.
Er tat, was ihm Recht schien. Er warf die Waffe hin. Er meldete sich krank, mit einer Dringlichkeit, die Kopfschütteln hervorrief. Er ließ sich anfordern von seinem Gericht, er betrieb diese Anstalten mit solchem Eifer, daß er sich alsbald von den Offizieren gemieden sah.
Er fand daheim, was er jetzt wünschte. Der Posten als Präsident einer Strafkammer wurde ihm zugeteilt, Menschenschicksal in unmittelbarer Nacktheit ging Tag um Tag unabsehbar durch seine Hände. Auch als Verwalter der Wissenschaft pflügte er nun dieses Feld. Reform war nötig, Besserung war nötig; dies Strafrecht, das den Eigentumsschädiger grausam büßte, aber den Rohen, den Herzensbösen wenig bedrohte, das in Gespinste persönlichster Lebenshaltung dumm täppisch hineingriff und Leben verwirrte statt Leben zu schützen, – es sollte die Generation nicht mehr beleidigen, die aus dem Elend dieser Jahre hervortauchte.
Carmer arbeitete mit gewaltiger Energie, mit doppelter, weil so allein die Einsamkeit seines verödeten Hauses ertragbar wurde. Er fand Beachtung, er erweckte ein Echo weit über den Ring der Berufsgenossen hinaus. Denn mit währendem Kriege schärfte sich in mancher Schicht das soziale Gewissen – ein Ergebnis halb dumpfer Angst, halb einer durch ertragenes Leid gesteigerten Fähigkeit, mitzufühlen. Diese Aufsätze nun eines hohen Richters, eindringlich, klar, voller Kenntnis, Sagazität und einer Menschlichkeit, die sich zuchtvoll noch das geringste Pathos versagte, wurden begierig aufgenommen und von der Tagespresse diskutiert. Man nötigte ihren Urheber, als das Schreckensende schon näher drohte, zu persönlichem Hervortreten. Sein vom Geist und vom Leid gekerbtes Gesicht, die glänzende Trockenheit seiner Rede, prägten sich ein. Die Partei des bürgerlichen Fortschritts versicherte sich seiner. Der Nationalversammlung, dem ersten Reichstag gehörte er als Mitglied an. Im dritten Jahr nach dem Umschwung legte er sein Richteramt nieder und tat seinen Schritt zur entschiedenen Linken. Man begann ihn zu hassen, zu beschimpfen, zu verdächtigen, zu bedrohen, – sodass er schon nach kurzer Laufbahn zu staatsmännischer Tätigkeit auf deutsche Art völlig legitimiert erschien.
III
Carmer ging seinen täglichen Weg. Er hatte ihn nicht einmal versäumt in den nahezu drei Wochen, die er nun hier verweilte.
Er ging die Gasse hinunter, über den Platz, vorbei an der uralten Erztür der Kathedrale, er durchquerte den Ort und stieg jenseits hinan, um zur Villa Cembrone zu gelangen. Seltsamer Weg, erregend immer von Neuem! Dies Ravello war ein Ruinengrab, über dem dürftiges Leben sich rührte. Was heute nicht mehr war als ein Dörfchen, nach Menschenzahl und Bedeutung, das war einst eine mächtige Stadt gewesen, beherrschend rundum gelagert auf der Bergkuppe, Residenz eines Bischofs und großer üppiger Herren. Volksmäßige maurische Rauten waren geblieben, aus schwarzem Tuffstein alles, schwach besiedelt, verwahrlost, verfallen; von den Wundersitzen aber jener Afflitti, Castaldi, Ruffoli, mit ihrer alhambrischen Pracht, ihren sarazenischen Saalfluchten, ihren Lusthöfen, Fontänen und Marmorbassins nichts Andres mehr übrig als die Gärten voll tobender Blütenfülle, eine stehengebliebene Marmorwand einmal mit zierlich enggeordneten Säulchen, ein Bogen, als Hufeisen köstlich geschwungen, gefüllt mit Myrte und Lorbeer, das abgesprengte Stück von einem Brunnenrand.
Dies alles war schön und war seltsam; es war nicht das, was er liebte. An jedem Morgen stieg er zu jener Höhe hinauf.
Eine Art Treppenweg führte hin, schmutzig, schlechtgehalten auch er. Vor den Häusern aus Tuff spielten Kinder, halbnackt, im sonderbarsten Typengemisch, so daß man zurücksank durch die Jahrhunderte und es einem taumelig, traumhaft zu Mut werden konnte. Knaben waren da, die aussahen wie Beduinen Nordafrikas, ein schlankes Dirnchen zeigte Stirn und Haaransatz der hergeruderten Hellenin, wieder eins trug einen Helm aus goldenem Haar, vom normannischen Urahn leuchtend überkommen. Und in manchem Gesichtchen stieß das alles zusammen: die ganze wirre Geschichte dieses fruchtprangenden Küstenstrichs mochte man aus ihm ablesen, dem die Völker Europas und Afrikas nacheinander, miteinander, verlangend ihre Schiffsschnäbel zugekehrt hatten. Sie waren fröhlich und freundlich, die vorzeitlich Gemischten. Sie kannten den Fremden, der allmorgendlich ihre Gassenstufen erstieg, viele grüßten. Bald war er außerhalb.