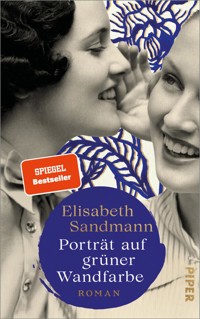
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Porträt auf grüner Wandfarbe | bewegender Generationenroman Elisabeth Sandmanns großartiges Romandebüt über eine außergewöhnliche Familie im 20. Jahrhundert 1918 trifft die bodenständige Ella im oberbayerischen Schloss Elmau auf die glamouröse Ilsabé. Es entsteht eine ebenso unzerbrechliche wie komplizierte Freundschaft, die Kriege übersteht, Jahrzehnte überdauert und dramatische Geheimnisse bewahrt. Schon als Mädchen träumt Ella Blau aus Bad Tölz von eigenen Schuhen aus Leder, die ihr den Weg in ein unabhängiges Leben ermöglichen sollen. Jahrzehnte später liest die junge Londoner Übersetzerin Gwen die roten Hefte, die Ella bis 1938 mit ihren Erinnerungen gefüllt hat. Ellas Aufzeichnungen führen Gwen in das legendäre Hotel Schloss Elmau, zu einem Gutshof bei Köslin und in das Berlin der 1920er-Jahre. Ellas Schicksalsfreundin Ilsabé, Gwens inzwischen 94-jährige und reichlich kapriziöse Großmutter, scheint ihr Wichtiges aus der Vergangenheit zu verschweigen. Geht es nur um verlorene Bilder oder doch um viel größere Verluste? Auf ihrer Reise in die aufwühlende Geschichte ihrer Familie versucht Gwen, das Geheimnis zu entschlüsseln. Wer Susanne Abels Gretchen-Romane oder Alena Schröders »Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid« mochte, wird Elisabeth Sandmanns wunderbares Jahrhundertporträt und seine einzigartigen Heldinnen lieben. Für »Porträt auf grüner Wandfarbe« hat Elisabeth Sandmann sich von zahllosen Büchern, Briefen, Postkarten und Reiseführern aus der Vergangenheit inspirieren lassen. So ist ein hinreißender Roman entstanden, der Orte, Schicksale und Begebenheiten zu einer faszinierenden und vielschichtigen Geschichte verwebt, die man nicht mehr aus der Hand legen kann. Das perfekte Geschenk für die beste Freundin, packende Urlaubslektüre, kluge Unterhaltung, spannend erzählte Zeitgeschichte. Elisabeth Sandmann, Verlagsbuchhändlerin, Autorin und Verlegerin, hat in ihrem Roman »Porträt auf grüner Wandfarbe« Figuren erschaffen, die einen weit über die Lektüre hinaus begleiten und die man für immer im Herzen behält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Porträt auf grüner Wandfarbe« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: H. Armstrong Roberts / Getty Images und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Der Anruf
London, 1992
Besuch in Ipswich
Die roten Hefte
Die Lederschuhe
Jola
Kriegsausbruch
Zukunftspläne
Familiengetuschel
Der Code
Die Liste
Bei Fräulein Schönlein
Die Hamsterfahrt
Die Metamorphose
Ankunft in Elmau
Die Begegnung
Ruths Geschichte
Schonungslos
Das fünffache Echo
Das Marterl
Die Entscheidung
Die Ausrede
Späte Offenbarung
Das kleine Haus am See
Besuch bei Theo
Das Bild im Katalog
Die neue Frisur
Reizende Gesellschaft
Paul
Die Verlobung
Das R-Gespräch
Anruf von Ed
Der Koffer
Das Geschenk
Ausgeplaudert
Bei Käthe
Die fehlenden Jahre
Schachzüge
Die Schauspielerinnen
Die losgelassene Hand
Mosaiksteinchen
Ellas Brief
Das Versteck
Der feine Faden
Peripetie
Das Kistchen
Der richtige Moment
Über die Grenze
Die Stecklinge
Die enttäuschte Hoffnung
Frankfurter Jahre
Der Malerfreund
Keine Gutenachtgeschichte
Ein falsches Wort
Die Erkrankung
Im Glück
Am Mondsee
Ilsas Ankunft
Remis
Die Hochzeit
Patiencen und Wahrheiten
Voralpenland
Balthasar
Tomatenbrote
Nur nett?
Das Schicksalsjahr
Porträt auf grüner Wandfarbe
Das Glasnegativ
Wiedersehen mit Sepp
Margas Weg
Die Schenkung
Das Fest
Anfang und Ende
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meinen Sohn Philipp
***
Für meine Freundin Laura
Der Anruf
London, 1992
Die Schuhe waren völlig durchnässt. Gwen zog sie vor der Haustür aus und hörte schon den Kater miauen. Sie hatte vergessen, sein Näpfchen zu füllen, und nun war er in seiner Ungeduld nicht mehr zu bremsen. Er würde dennoch warten müssen, sie wollte erst duschen, denn ihr war kalt vom Joggen durch den lausigen Regen. Da klingelte das Telefon, und Gwen sah auf die Uhr. Es war halb neun, der Verlag konnte es nicht sein. Als es hartnäckig weiterläutete, nahm sie etwas genervt den Hörer ab.
»Hallo, Gwenny Love, hier ist Lily. Störe ich dich? Aber du bist ja sicher noch nicht am Schreibtisch.« Noch bevor Gwen antworten konnte, redete ihre Tante weiter.
»Hör zu, Gwenny, ich möchte zu Lotte nach Berlin, dort ein paar Tage bleiben und dann gemeinsam mit ihr weiter in die DDR, also das, was davon übrig geblieben ist, und dann nach Polen. Man kann jetzt überallhin reisen. Du weißt ja. Man kann sich ein Auto leihen und dann einfach losfahren, habe ich gehört.«
»Lily, ich muss unter die Dusche, ich bin pitschnass.«
»Entschuldige, ja, aber in zwei Wochen möchte ich fahren – und zwar mit dir. Allein kann ich das nicht mehr, und Lotte ist so alt wie ich. Du hast doch Zeit? Sag Ja!«
Gwen hatte sich nach dem grauen Winter in London auf zwei Wochen im Süden Italiens gefreut und war wenig begeistert von der Idee, mit ihrer alten Tante und deren kommunistischer Freundin in die ehemalige DDR und weiter nach Polen zu reisen. Sie stellte sich vor, wie sie bei schlechtem Wetter auf misstrauische Menschen traf, die mehr oder weniger berechtigt Angst davor hatten, die ehemaligen Besitzer wollten nun ihre heruntergekommenen Gutshöfe zurückhaben.
»Lily, ich überlege es mir, ich rufe dich wieder an.«
»Ruf mich heute Abend zurück, ich bin vorher unterwegs. Bitte lass uns diese Reise zusammen machen. Heute kann ich das noch, morgen womöglich schon nicht mehr«, meinte Lily bestimmt. Und Gwen wusste genau, was jetzt kam, weil sie das immer sagte. »Gwenny, du weißt: Der Regen kehrt nicht mehr nach oben zurück.«
Lily hatte ihr Vorhaben mit solchem Nachdruck vorgebracht, dass Gwen geneigt war, über eine Reise, zu der sie gerade überhaupt keine Lust verspürte, nachzudenken. Sie füllte das Näpfchen von Sloppy und ging unter die heiße Dusche.
Der Urlaub mit Laura nach Italien war längst geplant. Sie wollten nach Neapel fliegen und von dort aus mit dem Schiff nach Ischia und an der Amalfiküste entlang zurück. Laura war ihre beste Freundin, sie hatten sich während des Studiums kennengelernt. Als Musikwissenschaftlerin hatte Laura über einen Komponisten aus dem 17. Jahrhundert promoviert. Sie hatte seine italienischen und lateinischen Texte transkribiert, war zu Forschungszwecken immer wieder in Italien gewesen und sprach die Landessprache fließend. Außerdem verstanden sie sich ausgezeichnet auf gemeinsamen Reisen, hatten die gleichen Interessen an Kunst und Kirchen, aber auch immer große Lust auf analytische Tauchgänge in die Untiefen der Psyche ebenso wie auf etwas Tratsch über Familienmitglieder und Ex-Freunde, am liebsten bei einem kleinen Aperitivo.
Die Liebe zu Italien hatte Gwen von ihrer Mutter geerbt. Häufig waren sie in den Ferien in die Toskana gereist, und von jeder dieser Reisen brachte ihre Mutter Oliven- oder Zitronenbäumchen mit, die sie dann auf ihrer Terrasse in Terrakottakübel einpflanzte. Auch hatte sie die Kochbücher von Elizabeth David verschlungen, die in den Fünfzigerjahren versucht hatte, den Engländern mediterrane Genüsse näherzubringen.
Gwen fragte sich, wie sie Laura erklären sollte, dass sie jetzt mit ihrer betagten Tante und deren Freundin in die ehemalige DDR und nach Polen reisen würde, wo es weder guten Wein noch Bruschetta oder Sardellen in Olivenöl gäbe.
Die Sache ließ sie dennoch nicht los, und so suchte sie im Regal nach den alten Baedekern, die ihr Großvater gesammelt hatte, und wurde fündig. Wo genau war dieser Gutshof überhaupt? Sie erinnerte sich, dass er sich in der Nähe von Köslin befand, dem heutigen Koszalin.
Ihr Großvater Jakob, der als Kaufmann zu Wohlstand gekommen war, hatte das Anwesen einst in Pommern an der Ostsee erworben. Gwen hatte ihn nicht mehr kennengelernt, er war in der Emigration gestorben. Sie kannte zwar einige Geschichten vor und nach seiner Flucht, aber immer hatte sie den Eindruck gehabt, als würde eine hermetische Kruste der Verdrängung auf allen Erinnerungen liegen. Auf den ohnehin spärlichen Familientreffen war selten von früher die Rede gewesen, und auf Beerdigungen beließ man es dabei, sich etwas oberflächlich über den Ehrgeiz des Alltags auszutauschen.
Sie hatte Köslin auf der Karte gefunden. Die Karten waren aus hauchdünnem Papier, das mehrfach zusammengefaltet war und in ausgeklapptem Zustand eine präzise Orientierung vermittelte. Der Baedeker beschrieb, wie man 1920 von Berlin mit der Eisenbahn an die Ostsee reisen konnte, wie lange die Fahrt dauerte und was die Fahrkarte kostete. Wie zivilisiert das alles klang und wie unkompliziert.
Gwen machte sich einen starken schwarzen Tee, für den sie vorher die Kanne mit heißem Wasser ausgespült hatte. Das Silber speicherte die Wärme, so wie die Morgensonne ihren Backsteinboden im Wintergarten noch wärmte, nachdem der Schatten die Luft bereits merklich abgekühlt hatte. Der Tee musste eine ganz bestimmte Temperatur haben, wenn sie nachher einen Schuss kalte Milch in ihren Becher gab, damit Tee und Milch sich vermischten wie die Farbreste von Pinseln, die man in einem Glas Wasser auswusch.
Sie nahm ihren Earl Grey mit zum Schreibtisch und wollte an einer Übersetzung weiterarbeiten, von der sie froh war, wenn sie abgeschlossen sein würde. Es war ein schwieriger Text, den sie aus dem Deutschen ins Englische übertragen sollte. Sie war fast fertig, und die Arbeit an diesem Buch hatte ihr keine große Freude bereitet. Es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren – ihre Gedanken wanderten unfreiwillig immer wieder zu Lilys Vorschlag zurück.
In gewisser Weise hatte ihre Tante recht, sie jetzt mit Nachdruck auf die Fährte ihrer Vorfahren zu schicken. Sie suchte das Fotoalbum, das sie von ihrer Mutter geerbt hatte: ein schmales Büchlein mit kleinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, von denen manche gestochen scharf waren und andere stark verblichen. Irgendjemand hatte das Album begonnen und weitergeführt, aber nicht, bis kein Blatt mehr frei gewesen wäre, sondern die Bilderseiten hörten plötzlich auf. Auf den frühen Fotografien, die wohl um 1900 entstanden sein mochten, gruppierten sich fein gekleidete Damen und Herren vor einem Gebäude, das die Engländer untertrieben als Country House bezeichnen würden. Auf einem Foto, das Gwen schon immer sehr imponiert hatte, sah man eine schöne Frau im Damensitz auf einem prächtigen schwarzen Pferd. Es war Ruth, die erste Frau ihres Großvaters Jakob, die nach der Geburt ihres jüngsten Kindes, Gwens Tante Lily, an einer Streptokokkeninfektion gestorben war. Von Penizillin wusste man damals noch nichts.
Weitere Bilder zeigten Ruth und ihre Freundinnen, oder waren es Cousinen, in mädchenhaften dünnen Musselinkleidern mit Spitzenkragen und weiten Ärmeln. Ruth trug einen großen Hut, unter dem die Haare hochgesteckt und doch locker fallend reizvoll und anmutig zugleich wirkten. Auf einer weiteren Aufnahme blickte Jakobs stattlicher Vater selbstbewusst in die Kamera. Er trug einen Sommerhut zu einem hellen Leinenanzug und hielt die Gerte in der Hand, wahrscheinlich kam er von einem Reitausflug und würde sich im nächsten Moment in einen der geflochtenen Korbsessel fallen lassen, die man im Garten kunstvoll verstreut platziert hatte.
Pferde zu haben, war ein Statussymbol, das bald schon von Automobilen abgelöst wurde, und so sah man denn auch die Familie auf späteren Aufnahmen um eine geräumige Limousine gruppiert. Jakobs zweite Frau Ilsabé, Gwens Großmutter, galt als verwegene Autofahrerin, die, wenn sie Lust darauf hatte, einfach losfuhr, um dann von Berlin, Prag oder Paris ein Telegramm zu schicken, dass sie gut angekommen war.
Auf einem Bild, es war das letzte in dem kleinen Album, war Ella zu sehen. Ach, Ella. An Ella hatte Gwen immer wieder gedacht, und jeder Gedanke an sie hatte ihr einen kleinen Stich versetzt. Für Marga war Ella die »Ellamammi« gewesen, im Unterschied zu ihrer leiblichen Mutter Ilsabé, die sie stets nur mit Vornamen erwähnt hatte. Die Fotografie zeigte Ella zusammen mit einem kleinen Mädchen, das in ein Handtuch gewickelt war und sich ausschüttete vor Lachen. Ein Schnappschuss, den jemand während der Sommermonate an einem See oder Badestrand aufgenommen haben musste. Es gab keine Ortsangabe, nur die Jahreszahl 1938. Das kleine Mädchen war Marga.
Gwen konnte sich nicht erinnern, ihre Mutter so fröhlich erlebt zu haben, nicht einmal mit Robert, Gwens Vater. Ihre Eltern hatten sich bei ihrem Onkel Theo kennengelernt, das wusste sie aus Erzählungen. Theo war in den Zwanzigerjahren zum Studium der Altphilologie nach Oxford gegangen und dort geblieben. Nach dem Krieg hatte er bemerkt, wie unglücklich seine jüngere Halbschwester Marga in Deutschland war, und sie zu sich nach England eingeladen. In seinem viktorianischen Reihenhaus trafen sich regelmäßig Studenten, darunter Robert. Hin und wieder aber waren auch Damen eingeladen, und dann durfte Marga dabei sein, die mit Theos Hilfe in der Bodleian Library eine Aushilfsanstellung gefunden hatte.
Robert zählte zu jenen Studenten, die mit besonders vielen Begabungen gesegnet waren und in die man sich einfach verlieben musste. Er konnte Dramentexte von Shakespeare bis Oscar Wilde deklamieren, war ein blitzgescheiter und witziger Diskussionspartner, und er gehörte auch noch dem Team von acht Ruderern an, die ausgewählt worden waren, um im Wettkampf gegen Cambridge den Pokal zu holen. Aber Roberts Stimmungen konnten schnell wechseln, und so zeigte er an manchen Tagen eine nicht zu bremsende Energie und lag an anderen Tagen im verdunkelten Zimmer. Damals sprach man nur selten von Depressionen, man wusste einfach zu wenig.
Gwen sah auf die Uhr. Kurz nach zehn. Jetzt würde er bereits gefrühstückt haben. Sie wählte seine Nummer, und Roberts Lebensgefährtin Sue nahm ab. Nach einem freundlich-oberflächlichen Wortwechsel gab Sue den Hörer weiter.
»Gwen, Darling, wie schön, dass du dich meldest. Wie geht es dir?«, fragte ihr Vater, hörbar erfreut.
Etwas umständlich erzählte Gwen von ihrer Arbeit und der mühevollen Übersetzung, um schließlich zum Punkt zu kommen.
»Lily hat mich angerufen, sie möchte, dass ich mit ihr nach Deutschland und weiter nach Polen reise. Sie will unbedingt, dass ich mitfahre. Sie hat sich mit Lotte in Berlin verabredet.«
»Mit der Kommunistin?«
»Ja, genau die. Sie ist doch Lilys beste Freundin.«
»Da kommen ja zwei zusammen. Wenn ich nicht so alt wäre, käme ich sofort mit. Das klingt nach einer vergnüglichen Landpartie. Aber wahrscheinlich wird das Essen miserabel sein, und guten Wein gibt es ohnehin nicht. Andererseits machen die Polen prima Schnäpse.«
»Sehr witzig.«
Wie immer schaffte es ihr Vater, seine Alkoholsucht in seinem eigenen Charme buchstäblich zu ertränken.
»Ich habe mir das kleine Album noch einmal angesehen und mich gefragt, ob du noch irgendwelche Fotos, Briefe oder Aufzeichnungen von Mum hast. Lily hat mit ihrem Anruf etwas in mir ausgelöst, und vielleicht ist es jetzt tatsächlich die letzte Gelegenheit, um mit ihr nach Pommern zu reisen.«
Gwen sprach mit ihrem Vater Englisch, aber »Pommern« hatte sie nicht übersetzt. Es gab Wörter, die in ihrer Familie immer auf Deutsch ausgesprochen wurden. Und auch ihr englischer Vater hielt sich an dieses ungeschriebene Gesetz.
»Deine Mutter hat sich ja irgendwann nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen wollen, was ihr nicht wirklich gelungen ist, aber ich erinnere mich, dass Ella ihr einiges überlassen hat.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Na ja, ich weiß nichts Genaues, aber Marga hat einmal erzählt, wie überladen das Auto war, als sie von der Ostsee nach Oberbayern fuhren.«
»Die Geschichte kenne ich gar nicht, aber schau doch mal nach, was du so findest, dann komme ich am Wochenende zum Tee, wenn es dir passt.«
»Darling, das wäre schön. Du kannst natürlich auch Theo anrufen, er weiß sicher mehr. Und bring doch eine Flasche von dem alten College-Port mit, wenn du noch eine hast.«
Als Gwen auflegte, dachte sie, dass es tatsächlich eine gute Gelegenheit wäre, sich wieder einmal bei ihrem alten Onkel Theo zu melden. Als emeritierter Professor lebte er noch immer in seinem schönen Haus in Oxford. Es war in den letzten Jahren schwierig geworden, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Er telefonierte nicht gerne und freute sich über wenig Besuch, anders als andere Menschen in seinem Alter. Immerhin aber beantwortete er in seiner kalligrafisch anmutenden Handschrift jeden Brief sofort. Sie beschloss, ihm im Laufe der Woche ein Lebenszeichen zu schicken. Vorher aber wollte sie Laura anrufen und heraushören, ob sie sehr enttäuscht wegen der Italienreise wäre.
Sie verbrachte den Nachmittag mit der mühseligen Übersetzung. Als es anfing zu dämmern, fand sie, dass sie eine Tasse Tee verdient habe und auch ein Stückchen des köstlichen Sponge Cake, den ihre Nachbarin mit der extra feinen Himbeermarmelade gebacken hatte. Sie ließ Sloppy in den Garten, obwohl es geregnet hatte und er vorwurfsvoll miaute, weil er seine sanften Pfoten nicht in den nassen Rasen setzen wollte.
Laura war sofort am Telefon. Sie hatte die glockenhelle Stimme eines jungen Mädchens, dabei war auch sie schon Mitte dreißig. Sie arbeitete für ein internationales musikwissenschaftliches Journal, und gerade quälte sie sich mit einem mittelmäßigen Essay, den ein hochrenommierter Professor aus den USA verfasst hatte, der es nicht ertrug, von einer Frau korrigiert zu werden.
»Laura, ich muss dir etwas sagen – Lily hat mich gefragt, ob ich sie auf eine Reise nach Berlin und weiter nach Polen begleiten würde. Sie möchte den Gutshof noch einmal sehen, wo sie aufgewachsen ist. Oder was davon übrig ist. Sie will mir unbedingt alles zeigen. Jetzt, wo die Grenzen offen sind. Sie klang so bestimmt, du kennst sie ja. Es scheint ihr sehr viel zu bedeuten.« Gwen machte eine kurze Pause, um Laura Gelegenheit zu geben, diese Neuigkeiten zu verarbeiten, doch Laura reagierte prompt.
»Na ja, sie ist in einem Alter, in dem man solche Reisen nicht jedes Jahr wiederholen kann. Und jetzt, wo es möglich ist – Berlin nach dem Mauerfall, das würde mich selbst interessieren.«
»Dann komm doch mit!«, rief Gwen euphorisch.
»Ja, warum nicht, nach Italien können wir auch noch im September. Ich schau mir alles mal auf der Karte an. Ich kenne einen Bach-Forscher, den ich gerne treffen würde und mit dem ich mir seit Jahren schreibe. Vielleicht könnte ich von Berlin aus einen Abstecher nach Leipzig unternehmen. Und dir wird die Reise sicher guttun. Wir haben in den letzten Jahren so oft über deine Mutter gesprochen. Das ist doch eine gute Gelegenheit, mehr zu erfahren.«
Gwen war geradezu beglückt darüber, dass Laura mit von der Partie sein würde. Sie könnten sich nicht nur auf den langen Strecken im Auto ablösen, es würden sich gewiss auch manche Schrulligkeiten der alten Damen besser ertragen lassen.
Jetzt musste sie nur noch Lily erreichen, die immer und besonders für ihr Alter sehr beschäftigt war. Ihre Tante besuchte fast jede Aufführung der Royal Shakespeare Company, die sie für das beste Ensemble der Welt hielt; sie verpasste kaum eine Ausstellungseröffnung, zu der sie eingeladen wurde; sie leistete sich Mitgliedschaften in diversen Freundeskreisen namhafter Museen und immer wieder eine der sündhaft teuren Karten für Opernabende in Covent Garden.
»Lily, ich bin’s, Gwen. Also, ich komme mit. In drei bis vier Wochen kann ich los, bis dahin bin ich mit meiner Übersetzung fertig und Laura mit ihren Aufträgen«, brachte Gwen entschieden hervor, als ihre Tante endlich ans Telefon ging.
»Wie schön, Gwenny Darling, aber was hat Laura denn damit zu tun?«, fragte Lily etwas argwöhnisch.
»Laura fährt mit.« Und als würde sie die Gedanken ihrer Tante ahnen, fügte sie hinzu: »Wir werden trotzdem genug Zeit für uns haben. Du weißt ja, wie einfühlsam sie ist. Für mich ist es viel angenehmer, wenn mich jemand begleitet, der mir beim Kartenlesen helfen kann und immer guter Laune ist. Außerdem kennt sie ja die ganze Familiengeschichte.«
»Na ja, die ganze Familiengeschichte kennst ja noch nicht einmal du, aber deshalb fahren wir ja zusammen hin«, bemerkte ihre Tante spitz. »Ich mag Laura. Sie hat diesen trockenen Humor, und sie ist doch so sprachbegabt, kann sie denn Deutsch?«
»Motetten-Deutsch!«
»Was ist das denn?«
»Sie kennt die Texte von Bachs Motetten und vom Weihnachtsoratorium.«
»Na, das wird lustig, wenn die eine Bach-Kantaten summt und die andere Marx zitiert.«
»Das meinte Robert auch. Ich fahre nächstes Wochenende übrigens nach Suffolk. Ich war lange nicht da. Ich habe ihn auch gefragt, ob er noch etwas von Mummy hat, und er meinte, dass das gut möglich wäre, es gäbe noch irgendeine Kiste mit Erinnerungskram, wie er es nannte.«
»Aha«, sagte Lily nur, und beim Verabschieden klang ihre Stimme ungewohnt angespannt. Warum, konnte sich Gwen nicht erklären, aber sie schob den Gedanken schnell beiseite.
Bis zur Abreise war nun einiges zu tun. Sie musste die Übersetzung abschließen und vorzeitig dem Verlag schicken, denn sie wollte sichergehen, dass es keine Rückfragen gab. Vielleicht würde sie auch noch bei Marks & Spencer ein paar leichte Schuhe und eine dünne Jacke für die Reise kaufen. Für schlechtes Wetter waren sie ja hier auf der Insel bestens ausgerüstet. Außerdem wollte sie Tee mitnehmen, Earl Grey und English Breakfast erwiesen sich immer als beliebte Mitbringsel. Sie würde einige Stunden ihres Italienischkurses ausfallen lassen müssen, was ihr leidtat, denn Theresa, ihre römische Lehrerin, hatte ein mitreißendes Temperament.
Plötzlich erschienen ihr die verbleibenden Wochen bis zur Abreise als sehr kurzer Zeitraum, zumal sie ja auch noch den Sonntagsausflug zu ihrem Vater geplant hatte. Und Theo wollte sie unbedingt noch schreiben, er würde es ihnen übel nehmen, wenn er hinterher erfuhr, dass Lily und seine Nichte in seiner alten Heimat gewesen waren. Das würde sie am besten gleich erledigen, bevor sie es vergaß.
Gwen suchte in ihrer kleinen Sammlung eine Kunstpostkarte mit einem seltenen Motiv. Sie wusste, dass ihr Onkel solche Gesten schätzte. Sie fand ein Porträt, das Franz von Stuck von seiner schönen Tochter im Jahr 1915 gemalt hatte. Es fiel ihr ein bisschen schwer, sich von der Postkarte zu trennen, die sie vermutlich einmal in München in der Villa Stuck gekauft hatte, aber Theo würde sich freuen. In wenigen Sätzen teilte sie ihm mit, dass sie mit Lily nach Polen reisen und den Gutshof aufsuchen würde und ihn gerne vorher kurz gesprochen hätte.
Besuch in Ipswich
Gwen nahm den Zug bis Ipswich, wo ihr Vater sie abholen wollte. Sie freute sich darauf, die Fahrt allein mit ihm zu verbringen. Umso enttäuschter und zugleich auch besorgter war sie, als nicht Robert, sondern Sue am Bahnsteig stand.
Robert sei seit zwei Tagen in einer sehr trüben Stimmung und könne sich nicht aufraffen aufzustehen, erklärte Sue die Situation. Hoffentlich wäre es am Nachmittag schon besser. Gwen müsste also doch übernachten, was sie nur im Notfall vorgehabt hatte. Sue, die sonst nicht durch analytische Beobachtungen hervorstach, war sich sicher, dass Roberts innere Unruhe mit Gwens Reiseplänen zu tun haben musste. Die verdrängte Erinnerung an Marga sei mit voller Wucht aufgebrochen. Er habe viel getrunken und dann alle Schubladen durchsucht und ausgeleert, um ihre Briefe zu finden.
»Er hat eine Schachtel gefunden«, schloss Sue ihre etwas vorwurfsvoll klingenden Ausführungen. »Er hat sie dir in dein Zimmer gestellt. Dein Vater muss seinen Rausch ausschlafen, und wenn er hört, dass du da bist, geht es ihm hoffentlich besser. Ich habe nicht gedacht, dass es ihn so mitnehmen würde.«
»Danke, Sue, auch fürs Abholen. Ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht immer leicht für dich ist«, bemühte sich Gwen einfühlsam hervorzubringen.
»Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse«, meinte Sue trocken, »und Robert ist trotz allem das Beste, was mir passieren konnte. Ich muss mit den grauen Wölfen leben, die ihn immer wieder aufsuchen und bedrängen.«
Sue war klein, drahtig und patent und hatte stets alles im Griff. Sie wusste, was am besten gegen Schnecken im Garten half und wann man bestimmte Zwiebeln setzen musste, sie organisierte den Gemeindechor und kümmerte sich um die alten Damen im Dorf, vor allen Dingen aber bewahrte sie in der Regel ihren Vater vor größeren Abstürzen.
Das Cottage, in dem die beiden lebten, war dreihundert Jahre alt. Sie hatten es gemeinsam liebevoll renoviert, die Balken freigelegt, die alten Holzböden abgeschliffen, die Wände vom Putz der Jahrhunderte befreit und jedes Zimmer in einer anderen, pudrigen Farbe gestrichen. Der große Kamin im Wohnzimmer konnte wieder benutzt werden, und eine Heizung wärmte zusätzlich, die allerdings nur waschechte Engländer als ausreichend empfinden konnten. Das alte Haus war schön und romantisch, aber zugig und kalt, und man war gut beraten, mit einer Wärmflasche und einer dicken Jacke anzureisen. Ein mit Weidezäunen eingefasster Garten säumte das Anwesen, in dem schon bald prachtvolle Rosen und Klematis blühen würden. Keiner, der das Cottage zum ersten Mal sah, hätte sich gewundert, wenn Jane Austen persönlich aus der Tür getreten wäre und zum Tee eingeladen hätte.
Sue hatte einen kleinen Blumenstrauß in Gwens Zimmer gestellt und frische Handtücher auf ihr Bett gelegt. Sie war eine sehr gute Gastgeberin, musste Gwen unumwunden zugeben. Auf dem alten Waschtisch stand tatsächlich die erwähnte Kiste, die noch zugeklebt war. Ihr Name war groß und deutlich in der Handschrift ihrer Mutter zu lesen. Sie fand es seltsam, dass ihr Vater all die Jahre nach Margas Tod nicht mehr an diese Schachtel gedacht hatte. Sie musste ihm doch spätestens beim Umzug aus dem alten Haus in die Hände gefallen sein. Aber ebenso merkwürdig fand sie es, dass ihre Mutter zwar ihren Namen auf die Schachtel geschrieben, sie ihr aber nie persönlich überreicht hatte. Vielleicht hatte sie vorgehabt, zu einem späteren Zeitpunkt mit ihr über den Inhalt zu sprechen, war aber nicht mehr dazu gekommen.
Gwen war aufgeregt und löste vorsichtig die Klebstreifen, die so getrocknet waren, dass sie wie von selbst abfielen. Auf den ersten Blick waren es Fotografien, Briefe, einige offizielle Dokumente, dann aber entdeckte sie einen Stapel identisch aussehender Schreibhefte, die mit einer roten Schleife zusammengebunden waren. Sie waren beschriftet mit Jahreszahlen und Ortsangaben. Auf dem Etikett des ersten Heftes war zu lesen »Bad Tölz und München 1911–1918«, auf dem nächsten »Schloss Elmau 1918–1919«, dann »Köslin und Florenz 1923–1925« und so weiter. Die Hefte hatten einen festen roten Einband mit einem ebenfalls roten Farbschnitt. Zuoberst lag ein bereits geöffneter Umschlag. Gwen zog den Brief darin vorsichtig heraus und erkannte Ellas Handschrift. Sie las:
5. September 1948
Meine liebe Marga,
ich hoffe, es geht Dir gut in Oxford bei Theo. Du schreibst, dass Du in einer Bibliothek arbeitest. Weißt Du, dass ich noch nie in einer öffentlichen Bibliothek war? Was genau musst Du denn dort machen, und bereitet Dir die Tätigkeit Freude? Hast Du schon Freundinnen gefunden?
Es ist für uns alle eine schwierige Zeit, die Währungsreform hat hier allerdings überall die Versorgung verbessert. Es waren so viele Städter noch bis vor Kurzem hier draußen, die tauschen oder hamstern wollten. Das hat sich jetzt fast über Nacht gelegt. Ich glaube, es gibt keinen Bauern hier im Tölzer Land, der jetzt nicht ein Geschirr mit Goldrand oder alten Familienschmuck hat.
Ich wollte Dir schreiben, dass Du bitte nicht so sehr mit Deiner Mutter ins Gericht gehen darfst. Ich kenne Ilsa nun schon so lange und weiß, wie schwer sie es selbst hatte. Wir werden alle in eine bestimmte Zeit hineingeboren, und Deine Mutter hat in schlimmen Zeiten gegeben, was sie geben konnte. Sie wusste, dass sie nicht zu mehr fähig war, und darum hat sie Dich auch später in meine Obhut gebracht. Das hat sie nicht aus Verantwortungslosigkeit getan, sondern, im Gegenteil, weil sie Dich liebt. Nicht jede Frau ist eine geborene Mutter. Das Schicksal wollte es, dass ich keine Kinder habe, aber gerne welche bekommen hätte, und Deine Mutter hat mir Dich als kleines Mädchen in den Arm gedrückt und mir damit ein Lebensglück beschert. Das wollte ich Dir sagen. Außerdem hast Du mich gebeten, dass ich Dir ein bisschen von meinem Leben erzählen solle, weil du so wenig wüsstest über meine frühen Tölzer Jahre.
Nun, ich habe die letzten Monate damit verbracht, meine Tagebuchaufzeichnungen zu sichten und aufzuschreiben, was in den vergangenen fünfzig Jahren geschehen ist.
Es war eine gleichermaßen schmerzvolle und beglückende Reise in die Vergangenheit, meine liebe Marga. Ich habe viel Schönes erlebt, ebenso wie Verluste und enttäuschte Hoffnungen.
Ich habe auch ein paar alte Fotografien in das Buch hineingeklebt. Sie sind nicht besonders gut, aber man erkennt doch die Menschen und die Umgebung. Ich hoffe, es freut Dich, und Du kannst dann, wenn Du dies alles gelesen hast, auch unsere Zeit, in der wir aufgewachsen sind, besser verstehen.
Unsere Generation hat viel erlebt, und am wenigsten selbstverständlich war, dass wir überlebt haben. Besonders wir Frauen hatten es schwer, und dabei spielte es oft keine Rolle, ob man arm oder reich war.
Schick mir doch bitte ein Foto von Dir, und erzähl mir, was es bei Theo zu essen gibt. Ihr habt ja sogar eine Köchin.
Vielen Dank auch für den guten Tee, der hier eingetroffen ist wie ein Wunder, und auch für die schöne Dose, in der er verpackt war. Das sind hier Kostbarkeiten.
Ich soll Dich von allen grüßen. Anton vermisst Dich und fragt jeden Tag nach Dir. Er ist gewachsen und eine Freude. Stell Dir vor, Nücki hat geschrieben, sie hat sich zusammen mit Knüvel in den Westen retten können. Das Haus duftet gerade nach Jolas Apfelstrudel.
Bitte schreib bald, und grüß Theo recht herzlich.
Sei Du fest umarmt, von allen hier im Gästehaus,
Deine Ellamammi
Was für ein unglaublicher Schatz lag in ihren Händen. Ella hatte sich die Mühe gemacht, für Marga, ihre geliebte Ziehtochter, ihr eigenes Leben aufzuschreiben. Und Marga hatte diesen Schatz wiederum für ihre Tochter aufgehoben, damit sie, Gwen, einmal in den Besitz dieser Erinnerungen kommen würde. Marga schien aus Sprachlosigkeit, Trauer und heftigen Selbstzweifeln nie herausgefunden zu haben, und dann war sie auch noch so unerwartet früh gestorben.
Gwen öffnete behutsam das erste Heft. Ellas Handschrift war klein und dennoch gut lesbar. Die Seiten waren eng beschrieben, und Gwen glaubte zu erkennen, wann sie eine Pause eingelegt und den Füllfederhalter neu befüllt hatte, denn die blauschwarze Tinte hatte dann eine andere Färbung und der Schriftzug eine sich verändernde Stärke. Immer wieder gab es Seiten, auf denen Ella Fotografien, Eintrittskarten oder Postkarten eingeklebt hatte. Das Datum auf dem ersten Heft reichte in Ellas Kindheit zurück. Gwen rechnete nach, 1911, da musste Ella dreizehn Jahre alt gewesen sein. Das war nun über achtzig Jahre her.
Die roten Hefte
»Sie hat rote Haar, feuerrote Haar sogar«, schmetterten fünf etwa zwölfjährige Buben und verfolgten dabei zwei Mädchen, die so schnell davonliefen, wie sie nur konnten. Ihre Zöpfe, die mit großen Schleifen zusammengebunden waren, wurden mit jedem Schritt rhythmisch in die Höhe geworfen und fielen wieder schwer auf die Schultern der Mädchen herab. Unter ihren Kleidern sah man rutschende Wollstrümpfe, sie hatten die langen Röcke nach oben gerafft, um schneller rennen zu können.
»Sie hat rote Haar, feuerrote Haar sogar«, begann der Kräftigste von Neuem, der den beiden Mädchen immer näher kam. Doch völlig unerwartet blieb eines der Mädchen plötzlich stehen, sodass es fast mit ihm zusammenprallte, boxte ihn mit voller Wucht in den Magen und rief dabei: »Wenn du nicht aufhörst, mich und die Franzi zu ärgern, kannst du was erleben.«
Was das sein würde, erklärte es nicht. Den anderen Jungen blieb der Mund offen stehen. Hatten sie gerade richtig gesehen, da hatte die Ella dem Quirin furchtlos einen Schlag versetzt, den sie sich selbst nicht zugetraut hätten? Und noch unglaublicher war, dass der Quirin stehen geblieben war und keinen Mucks machte. Vermutlich ahnte er, dass das eine Schmach war, von der er sich lange nicht erholen würde. Ein Mädchen hatte ihn, ausgerechnet ihn, vor den anderen geboxt und damit bloßgestellt.
»Du hast ihm richtig eine verpasst«, meinte Franzi später anerkennend. »Pfundig war das. Das erzähl ich dem Vater.« Dabei sprach sie Vater aus, als würde es mit zwei dd und ohne e geschrieben.
Franzi hieß eigentlich Franziska Gumpelmayer und war die einzige Tochter des ortsansässigen Metzgermeisters und Schlachters. Ihre Haare leuchteten rot, und ihre helle Haut war mit Sommersprossen übersät. Über Mädchen mit roten Haaren wurde überall ausgiebig gespottet, aber die Franzi war die beste Freundin von der Ella, und das schützte sie vor schlimmeren Übergriffen. Franzis Vater steckte der treuen Freundin daher immer mal wieder eine Wurst zu, die in Ellas Familie dankbar angenommen wurde.
Ellas Eltern Sepp und Maria lebten nämlich in großer Bescheidenheit, man könnte auch sagen Armut. Vier Kinder, drei Buben und ein Mädchen, mussten versorgt werden. Der Vater hatte eine Arbeit am Bahnhof gefunden, wo er half, die Isartalbahn mit Flößerhölzern oder anderen Gütern zu beladen. Seine eigenen Wünsche hatte er längst begraben. Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als läge eine passable Zukunft vor ihm. Ein Stipendium hatte dem kleinen Sepp Blau den Besuch einer Klosterschule ermöglicht, in der musiziert und die Begabungen der Schüler in bescheidenem Rahmen gefördert wurden. Als dann der Vater starb, brachen die schulischen Leistungen ein, das Stipendium wurde aufgekündigt, und der vierzehnjährige Bub musste plötzlich Geld verdienen. Nun ging es nicht mehr um Neigungen, sondern darum, die Notlage der verwitweten Mutter und der jüngeren Geschwister zu lindern. Als Sepp später heiratete, hatte dies mehr mit dem kleinen Hof zu tun, den seine Braut Maria mit in die Ehe brachte, als mit echter Zuneigung.
Auch für Maria waren die Träume früh ausgeträumt, dabei hatte sie sich viel von der Ehe mit Sepp versprochen, der ihr gut gefiel in seiner für einen Mann selten sensiblen Art. Aber nachdem das erste Kind gestorben war und danach das zweite und dritte, entwickelte Maria eine Härte, die sich zunächst gegen sie selbst und dann gegen die ganze Familie richtete. Das mochte auch daran gelegen haben, dass es in ihrer Umgebung niemanden gab, der für ihre Trauer, Verzweiflung und Einsamkeit Verständnis gezeigt hätte. Es wurde ja ständig gestorben und geboren, und so quittierte man ein Zuviel an Empfindlichkeit eher mit Häme.
Maria kümmerte sich um die kleine Landwirtschaft, die der Selbstversorgung diente. Nur hin und wieder kam es vor, dass sie etwas Gemüse oder Fleisch auf dem Markt verkaufen konnten, aber selten genug. Sie hatte sich eine profunde Kenntnis über heilende Pflanzen angeeignet, mit der sie ihre kleine Tochter Ella begeisterte, die mit ihrem Weidenkörbchen nur zu gerne auf die Almwiesen ging, um mit der Mama seltene Kräuter zu suchen.
Maria sprach wenig, lachte nie, aber erfüllte ihre Pflichten zuverlässig wie ein Uhrwerk. Schließlich mussten die Schulgebühren bezahlt werden. An Kleidung herrschte Dauermangel, und nur zwei Kinder hatten einigermaßen brauchbare Schuhe, die anderen liefen im Sommer barfuß. Ella konnte nicht die Hosen und Hemden ihrer Brüder auftragen, obwohl sie das gerne getan hätte, sodass für sie, selten genug, ein Stück Stoff erworben werden musste, aus dem die Mutter dann ein einfaches Dirndlkleid nähte. Es waren Festtage, wenn so ein Kleid endlich nach all dem Stillstehen, Maßnehmen und Anprobieren fertig war.
Nachdem Ludwig Gumpelmayer von Ellas Fausthieb in Quirin Wachtveitls Magengrube gehört hatte, fragte er sie, ob sie einen Wunsch habe. Er war zutiefst beeindruckt vom Schneid dieses kleinen Mädchens.
Ja, einen Wunsch hatte sie. »Ich wünsche mir ein paar Stiefel zum Schnüren«, antwortete Ella gedehnt, so als würde sie es genießen, diesen Wunsch erstmals in Worten laut auszusprechen und sich dabei selbst zuzuhören, »so welche, wie sie die Franzi hat«, ergänzte sie.
Das war ein ziemlich großer Wunsch, und Ella hatte für einen Moment das Gefühl, ihr Glück doch zu stark herausgefordert zu haben. Schuhe aus Leder waren unerreichbarer Luxus. Aber Franzis Vater nickte nur und meinte, sie solle sich auf einen Pappdeckel stellen. Dann zeichnete er die Umrisse ihrer Füße ab und versprach, sich um die Stiefel zu kümmern.
Für Ella waren die Schuhe von außerordentlicher Wichtigkeit und ein elementarer Bestandteil ihres Plans, den sie in jungen Jahren heimlich für sich geschmiedet hatte. Bald würde sie die Schule verlassen müssen, und sie wollte auf gar keinen Fall auf einem Bauernhof als Magd arbeiten. Das Schulgeld konnte nicht länger bezahlt werden, obwohl sie besser lesen und rechnen konnte als alle in ihrer Klasse. In ein Mädchen zu investieren, galt zudem ohnehin als Verschwendung.
Ihren Eltern gegenüber hatte sie sich nicht getraut, den Wunsch nach Schuhen zu äußern. Es war nicht erlaubt, sich etwas zu wünschen, was jenseits der Möglichkeiten lag. Und Schuhe gehörten in diese Kategorie. Eigentlich lag alles jenseits der Möglichkeiten, und Wünsche laut auszusprechen, war daher immer ein gefährliches Unterfangen, das der Vater vielleicht mit einer Watschn quittieren würde. Jedenfalls war das ihren Brüdern oft so ergangen. Gefühle und Sehnsüchte, Freude und Vorfreude waren in ihrer Familie irgendwann verschwunden, wie die Murmeln eines Spiels. Niemand wusste mehr, wer wann und wo die Kugeln verloren hatte.
Aber Ella ließ sich vom Wünschen nicht abbringen, und wenn sie in ihrem Bett lag, träumte sie davon, einmal eigenes Geld zu verdienen und so unabhängig zu sein, dass sie niemanden mehr um Erlaubnis würde bitten müssen. Ihr Vater hatte eines Abends erzählt, dass immer mehr Städter mit der Isartalbahn von München nach Tölz reisten, um Erholung zu finden. Ella hatte seine Schilderungen mit großem Interesse verfolgt, und obwohl sie dies in jenem Moment noch nicht bewusst fassen konnte, formierte sich in ihr ein Vorhaben.
Seit einigen Jahren durfte sich das kleine Städtchen Tölz nun schon als Kurort bezeichnen und den Titel »Bad« führen. Man hatte heilende Jodquellen gefunden, die Reisende aus der näheren und weiteren Region anzogen. Der Schriftsteller Thomas Mann hatte sich eine moderne Villa erbauen lassen und verbrachte die Sommer mit seiner Frau Katia und den Kindern im Voralpenland. Der renommierte Architekt Gabriel von Seidl liebte das kleine Tölz. Seine Pläne, die Fassaden der heruntergekommenen Häuser in der Marktstraße umzugestalten oder sie gleich neu zu bauen, hatte man aufgegriffen, und nun wirkte es, als hätte jemand ein verblichenes Sepiafoto in leuchtenden Farben aquarelliert. Der alte Muff war verschwunden, und das Städtchen sah wie frisch gewaschen aus. Erste Kurhotels eröffneten ebenso wie kleinere Pensionen, in denen vor allem die Sommerfrischler Kost und Logis suchten, um von dort aus Spaziergänge an der Isar oder Wanderungen in die Voralpen zu unternehmen.
In solch einem Gästehaus wollte Ella arbeiten, aber dafür brauchte sie drei Dinge, zumindest behauptete das ihr älterer Bruder Gustl: Man sollte nach der Schrift sprechen können, also Hochdeutsch, wenigstens einigermaßen; man brauchte unbedingt vorzeigbares Schuhwerk, was die kleine Schwester so schnell nicht bewerkstelligen würde; und man musste die Wünsche der feinen Gäste kennen. Gustl gab kräftig an mit seinem Wissensvorsprung, denn er half am Bahnhof, das Gepäck der Reisenden zu tragen, und kam so ins Gespräch mit Kurgästen und Wanderern.
Die Lederschuhe
Als Ella eines Tages mit ein paar neuen Schnürstiefeln nach Hause kam und ihr Glück selbst kaum fassen konnte, staunte ihr Bruder nicht schlecht. Es waren Schuhe aus hellem, weichem Leder, aber das Besondere an ihnen war der Schaft aus einem dünnen und durchlässigen Stoff, der aussah wie gehäkelt. Mit einem Lederband musste man die Häkchen links und rechts über Kreuz zubinden. Ella kannte keinen besseren Vergleich, aber es war, als ob man mit der Fußsohle in einen noch warmen Kuhfladen treten würde. So weich und angenehm fühlten sich diese Schuhe an, wenn sie mit der Hand die innere Form erkundete. Gustl nahm sie das Versprechen ab, den Eltern nichts von den Schuhen zu verraten, dabei sollte er aufstehen und schwören. Ella musste im Gegenzug den Stalldienst für zwei Wochen übernehmen. Weil das eine ziemlich lange Zeit war, zeigte sich Gustl entgegenkommender als gewöhnlich und erzählte seiner Schwester, dass Frau Huber neuerdings auch Sommergäste aufnahm. Ella schloss daraus, dass man dort vielleicht eine Hilfe brauchte.
Gwen wurde sofort in Ellas Geschichte hineingezogen. Die Hefte waren für Marga, ihre Mutter, geschrieben worden, und nun kam es ihr vor, als säße sie in einem Film, dessen Sequenzen sich mit ihren eigenen Erinnerungen oder vielmehr Bruchstücken aus Erzählungen ihrer Familie anfüllten. Gebannt las sie weiter.
An einem Sonntag im Frühjahr 1911 beschloss Ella, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Sie wusch sich die immer etwas nach Stall riechenden langen Haare besonders gründlich, flocht sie sich zu dicken Zöpfen und band aus ihren schönsten Bändern Schleifen. Sie zog das Sonntagsdirndl an und die neuen Schuhe. Nun wollte sie zur Frau Huber gehen, es war etwa eine halbe Stunde Fußweg, um nach einer Stellung für sich zu fragen. Ihren Eltern hatte sie nichts von ihren Plänen verraten, sie fürchtete, man würde sich über sie lustig machen und ihr den Mut nehmen.
Josefa Huber hatte die Anteile an einer Brauerei verkauft, die ihr von ihrem verstorbenen Mann, dem Doktor der Medizin Herrn Alois Huber, vererbt worden waren. Mit dem Geld hatte sie das bäuerliche alte Haus abreißen und ein neues im hochaktuellen Jugendstil erbauen lassen. Sie träumte davon, dass die Sonne durch größere Fenster ins Innere dringen würde. Auch hatte sie konkrete Vorstellungen von der Gestaltung des Gartens. Das Walmdach zog sich über die zweite Etage, und die Gauben wurden flankiert von blauen Fensterläden und Faschen. Hellgraue Holzpaneele waren der Länge nach auf die Vorderseite vom zweiten Stock bis unter das Dach angebracht worden und ergaben einen interessanten Kontrast zu dem sandfarben gestrichenen Sockel im Erdgeschoss. Ein Bauerngarten und ein Kräuterbeet hinter der Küche waren angelegt worden, und unter den Obstbäumen standen einzelne Tische und Korbmöbel.
Das Haus war mit allem Komfort ausgestattet, es gab sogar Zimmer mit Badewanne und Toilettenwasserspülung. Eine mit Glas überdachte Loggia ermöglichte den Gästen auch bei schlechtem Wetter einen Aufenthalt fast wie in der freien Natur. Außerdem hatte Frau Huber eine exzellente Köchin eingestellt, deren Entenbraten mit Rotkraut und Knödeln ebenso wie ihre Hefebuchteln bereits nach kurzer Zeit einen legendären Ruf genossen. Das Huber’sche Gästehaus war zu einem Geheimtipp avanciert und zog wohlhabende Städter an, die in der Natur Erholung suchten.
Im Garten sah Ella einen Jungen, der gerade den Zaun reparierte. Selbstbewusst fragte sie, ob sie die Frau Huber sprechen könne.
»Was willst du denn von ihr?«
»Das will ich dir nicht sagen«, meinte Ella bestimmt.
»Aha, ein Geheimnis«, spöttelte der Junge.
»Nein, aber ich muss es dir ja nicht gleich sagen.«
Der Junge war mit seinen achtzehn Jahren eigentlich ein junger Mann, und er sah aus wie ein Handwerksbursche. Er trug ein kariertes Hemd, das ihm viel zu groß war, und eine verbeulte Leinenhose mit Hosenträgern. Er war groß und dünn, hatte dunkelblondes, zerzaustes Haar und einen etwas schlaksigen Gang. Er war nicht so leicht zu beeindrucken, aber Ella gefiel ihm.
»Ich hole meine Mutter«, sagte er und lächelte amüsiert.
Ella versank, sie hatte nicht damit gerechnet, so unvermittelt mit dem Sohn der Pensionswirtin zusammenzutreffen.
»Was willst du?«, fragte Frau Huber kurz angebunden, denn sie hatte sich gerade hingesetzt, um eine Handarbeit wiederaufzunehmen. Sie war eine resolute Frau und erahnte sogleich, was dieses junge Ding von ihr wollte. Man musste dem Mädchen sicher alles erklären, weil es doch aus recht einfachen Verhältnissen zu kommen schien.
»Ich heiße Ella Blau und bin die Tochter vom Sepp Blau, ich bin dreizehn Jahre alt und sehr gut in der Schule, aber da darf ich jetzt bald nicht mehr hingehen, weil das Schulgeld zu teuer ist. Ich möchte fragen, ob Sie jemanden brauchen, der Ihnen hilft, wenn Sie jetzt so viele Gäste haben«, erläuterte Ella ihr Anliegen, das sie sich immer wieder vorgesagt und fast auswendig gelernt hatte.
»Was kannst du denn?«, fragte Frau Huber etwas freundlicher.
»Ich kann alles, was man mir aufträgt. Ich bin schnell und geschickt. Ich kann in der Küche helfen oder im Garten oder im Stall«, antwortete Ella selbstbewusst.
»Na ja, einen Stall haben wir hier nicht, aber du kannst vielleicht wirklich in der Küche helfen, und wenn dort nichts zu tun ist, müsstest du in der Waschküche mitarbeiten oder wo halt sonst jemand gebraucht wird. Und es gibt nur Arbeit während der Saison. Im Winter brauche ich niemand«, betonte Frau Huber mit Nachdruck, überrascht über ihr eigenes so schnelles Einlenken.
Was eine Saison war, wusste Ella nicht. Frau Huber sprach es aus wie Säsong. Ella sah auf den Kräutergarten und hatte einen Blitzgedanken. »Ich kenne mich auch gut mit Kräutern aus und mit Pflanzen, und wenn jemand krank ist, weiß ich auch Bescheid.«
Der Sohn von Frau Huber nickte seiner Mutter aufmunternd zu, und sein Blick sagte: Nimm die!
»Also gut. Du kannst auf Probe anfangen, und dann schau’n wir weiter. Ich muss erst sehen, ob du eine Hilfe und keine Last bist. Und bring eine Bescheinigung von deinem Vater mit, oder er soll selbst vorbeikommen. Du bist ja noch ein halbes Kind.«
Frau Huber verschwand, und Ella blieb unschlüssig im Garten stehen, als der junge Mann sich ihr vorstellte: »Ich bin der Korbinian, und mich interessieren übrigens auch alle Kräuter und Heilpflanzen. Ich will nämlich Medizin studieren und später Arzt werden.«
»Ach wirklich?«, meinte Ella bewundernd, und dann fügte sie hinzu: »Ich habe ein ganzes Album mit getrockneten Heilpflanzen. Das zeig ich dir, wenn ich jetzt zu euch ziehe. Ich muss nur in der Schule Bescheid geben, dass ich nicht mehr komme, die werden staunen.«
Und dann hüpfte Ella mit ihren Lederstiefelchen davon.
So kam es, dass Ella bei Josefa Huber eine Anstellung fand. Ihre Eltern waren erstaunt, aber zufrieden, denn nun gab es eine Esserin weniger am Tisch. Bevor Ella mit ihrem kleinen Koffer aufbrach, in dem nicht viel mehr als ein Nachthemd, wenig Wäsche, ein Rock und eine warme Jacke lagen, bürstete Maria ihrer Tochter zart und kräftig zugleich die glänzenden dunkelbraunen Haare. Sie hatte dies ein ums andere Mal getan, wenn sie ihre Zuneigung zeigen wollte.
Bald schon trafen die ersten Sommergäste ein und erfreuten sich an Zimmern mit Aussicht, an einem weit überdurchschnittlichen Komfort, einer besonders guten Küche und an Josefa Hubers großer Gabe, Probleme zu lösen, statt sie zu schaffen.
Jola
Das Zimmermädchen wies Ella an, wie man die Betten bezog, dass die Laken stramm auf der Matratze lagen, und wie man die Kissen aufschüttelte. Frau Huber selbst unterrichtete sie im Tischdecken, Besteckauflegen, Serviettenfalten und wie man, ohne mit dem Geschirr zu klappern, wieder abräumte. Ella hatte in ihrem jungen Leben noch keine Stoffserviette in der Hand gehabt und keine Vorstellung, wie kompliziert es sein konnte, Messer, Gabel und Löffel in der richtigen Reihenfolge aufzulegen. Bei ihnen zu Hause hatte man oft genug aus einer Schüssel gegessen.
Die Köchin Jola hatte Ella sofort ins Herz geschlossen. Sie brachte ihr nicht nur bei, wie man Mehlspeisen zubereitete, die Wäsche und sich selbst wusch, sondern sie erzählte ihr auch, woher sie kam.
»Du klingst irgendwie seltsam, wenn du redest. Du kommst nicht von hier, oder?«, fragte Ella, denn Jola sprach keine Umlaute, und so wurden aus Söckchen Sockchen und aus einem Süppchen ein Suppchen.
»Ich komme aus Westpreußen. Aus einem kleinen Dorfchen mit einem kleinen Bahnhof namens Boguschau. Wir sind Kaschuben, wir haben eigene Sprache und eigene Traditionen. Wir haben auch eine sehr gute Kuche«, erklärte Jola in ihrer warmherzigen Art.
»Wo ist denn dieses Boguschau und wo ist Westpreußen?«, fragte Ella, die von beidem noch nie gehört hatte.
»Ist sehr weit weg und Berge sind niedriger, aber dafür haben wir viele Seen und einen Fluss, die Weichsel. Ist fruchtbare Erde und die Hauptstadt ist Danzig an der Ostsee«, beschrieb Jola mit einer gewissen Rührung in der Stimme ihre alte Heimat.
»Aber wieso bist du jetzt hier in Tölz?«, fragte Ella aufgeregt, die gerne mehr erfahren wollte von diesem fernen Westpreußen am Meer.
»Die Liebe«, antwortete Jola kurz angebunden.
Ella kümmerte sich mit Hingabe um den Kräutergarten. In der reichen Flora des Voralpenlandes suchte sie wilde Heilpflanzen, um sie dann auszugraben und in Frau Hubers Garten wieder einzupflanzen. Sie hatte herausgefunden, dass man Samen auch postalisch beziehen konnte, und so bestellte sie hin und wieder von ihrem ersparten Geld bei einem Händler und war überglücklich, wenn die mit Hand beschrifteten kleinen Tütchen eintrafen. Sie fand in der Bibliothek des verstorbenen Doktor Huber ein Buch über die alte Klosterheilkunde, das sie verschlang. Bald wusste sie alles über heilende Teemischungen und dass Lavendelblüten Frau Hubers Schlafstörungen lindern, ein Hopfentee bei Jolas Verdauungsproblemen und eine Mischung aus Kamillenblüten, Schafgarbe und Johanniskraut bei Unterleibsschmerzen halfen. Korbinian war fasziniert davon, wie Ella die Kräuter trocknete, Mischungen und Wickel ausprobierte, Salben anrührte, die Gläser ordnete und beschriftete, und wie so im Laufe der Zeit eine kleine Apotheke entstand. Gemeinsam suchten sie in alten Büchern nach Rezepten und Rezepturen und überraschten sich gegenseitig mit ihren Entdeckungen.
Anders als zunächst geplant, blieb Ella auch über die Herbst- und Wintermonate bei Frau Huber im Gästehaus. In dieser Zeit wurde genäht und gestopft, gestrichen und repariert, Vorräte gekocht und eingeweckt. Ella schlief in einer kleinen Kammer unter dem Dach mit Blick auf den Kalvarienberg. Bescheiden zwar, und dennoch hatte sie nie schöner gewohnt. Im Winter wurde es sehr kalt, aber mit der Bettflasche aus Kupfer, den wollenen Socken und dem warmen Flanellnachthemd, das ihr Frau Huber aus ihrem eigenen Bestand überlassen hatte, ließ es sich aushalten.
Gegenüber von ihrer Kammer befand sich das sehr viel geräumigere Zimmer von Jola, in dem sogar eine kleine Sitzgruppe Platz gefunden hatte. Unter der Glasplatte des Tischs lag ein von Hand feinmaschig gehäkeltes Deckchen. Die Sessel hatten eine Polsterung aus dunkelviolettem Samt, wobei die Rückenlehne aus Peddigrohr geflochten war. Auf einer Kommode hatte Jola Fotografien aufgestellt, die Ella immer wieder gerne betrachtete. Sie traute sich jedoch nicht zu fragen, wer die Menschen in den Bilderrahmen waren.
Jola war füllig, kleiner als Ella und schien alterslos. Oft trug sie ihre flachsblonden Haare zu einem festen Zopf gebunden, den sie einmal einschlug und dann mit Haarnadeln feststeckte. Sie war, wie Frau Huber kommentierte, stets tadellos frisiert. Jola war herzlich, lustig und großzügig, sie hatte aber auch Tage, an denen sie irgendeine große Traurigkeit mit sich herumschleppte. Hin und wieder erreichte sie ein Brief aus der fernen Heimat, der sie zunächst beglückte und dann vollkommen kraftlos zurückließ. Josefa Huber kommentierte diese Gefühlsausbrüche dann nüchtern mit: »Die Jola hat’s nicht leicht gehabt.« Was auch immer das heißen mochte.
Ella war in den letzten Jahren gewachsen. Ihre dunklen Brauen, graublauen Augen, die schönen, dichten Haare, das ovale Gesicht und ihre schlanke Figur, aber vor allem ihr fröhliches und einnehmendes Wesen hatten sie in ein junges Mädchen mit einer ganz eigenen Ausstrahlung verwandelt.
Kriegsausbruch
Korbinian hatte unterdessen die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium bestanden und in München im Haus von Otto Pachmayrs Mineralwasservertrieb in der Theresienstraße ein kleines Zimmer angemietet. Er kam nun nicht mehr so oft nach Hause.
Im Juli 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und veränderte das Leben für alle. Selbst auf dem Land jubelten die jungen Burschen über das bevorstehende Abenteuer, auch wenn in Preußen noch nie etwas Gutes für Bayern entschieden worden war. Militärkonzerte sollten die erhabene siegesgewisse Stimmung steigern. Jola meinte indes nüchtern, man müsse jetzt einen Stall bauen, um vorzusorgen.
»Aber Jola, alle außer dir glauben, dass der Krieg in ein paar Monaten gewonnen ist. Was sollen wir mit einer Kuh hier auf dem Land?«, entgegnete Frau Huber.
»Krieg ist Krieg. Und wenn alles so schnell vorbei, können wir Kuhchen wieder verkaufen. Außerdem haben wir dann eigene Milch, eigene Butter und bauen am besten noch einen Stall für Schafchen und Schwein«, beharrte Jola.
Das fand Frau Huber nun wirklich »gspinnert«, aber sie ließ im Herbst tatsächlich einen Stall bauen, kaufte zwei Kühe und zwei Schafe, ein Schwein wollte sie nicht. Allerdings mussten Jola und Ella hoch und heilig versprechen, sich um die Tiere zu kümmern, ohne die andere Arbeit zu vernachlässigen.
Es gab niemanden in Tölz, der Josefa Huber, die Witwe des verstorbenen Landarztes, nicht für verrückt gehalten hätte. Die Huberin war jetzt also eine Landfrau und roch nicht mehr nach gestärkter Wäsche und Lavendel, sondern nach Odel und Mist. Ein paar Monate später bereits lachte niemand mehr.
Korbinian war zur Sanitätsausbildung in einem Militärkrankenhaus verpflichtet worden, Gott sei Dank nicht in einem Lazarett an der Front. Das erste Weihnachtsfest sollte ohne ihn stattfinden, denn er hatte keinen Urlaub bekommen. Frau Huber wollte ihrem Sohn aber ein Weihnachtspaket bringen und dafür mit dem Zug nach München fahren.
Sie packte einen großen Korb mit Wurst, Käse, Marmelade und Brot zusammen. Ellas erster selbst genähter Schal war gerade noch rechtzeitig fertig geworden, auch wenn ihr die Monogrammstickerei nicht richtig gut gelungen war. Sie hatte noch kleine Tütchen mit Teemischungen abgefüllt und eine Karte geschrieben, darüber würde sich Korbinian gewiss freuen. Jola, die viel mehr Geschick in der Handarbeit besaß, hatte eine Jacke gestrickt und ein Paar Sockchen.
Schwer bepackt, aber voller Vorfreude, fuhr Frau Huber mit der Vicinalbahn von Tölz über Holzkirchen nach München. Vom Bahnhof lief sie zu Fuß zum Odeonsplatz, wo ihr Sohn auf sie wartete. Zwei Stunden blieben ihnen, und in diesen Stunden erzählte Korbinian seiner Mutter, die bereits einiges bei ihrem Mann in der Praxis gesehen hatte, von den schweren Verletzungen der meist sehr jungen Männer. Aber schlimm seien nicht nur die körperlichen Wunden, sondern die panischen Angstattacken und überhaupt die seelischen Leiden. Manche würden heftig zittern, und es gäbe Ärzte, aber auch Vorgesetzte, die glaubten, die Soldaten seien Simulanten. Dabei habe er noch längst nicht das Schlimmste gesehen, endete Korbinian, denn in den Lazaretten an der Front, so habe er gehört, würde es furchtbar zugehen.
Sie verabschiedeten sich in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Mutter und Sohn verband ein inniges Verhältnis, und als Frau Huber die schwere Tür der Theatinerkirche, die sie immer so gerne besuchte, öffnete und allein auf die Kirchenbank sank, weinte sie so leise, wie es ihr möglich war. Sie zündete eine Kerze für ihren Sohn an, kniete nieder und betete für ihn und für all die anderen Söhne, die man bereits in den Heldentod geschickt hatte oder noch schicken würde. Der Krieg, so fand sie, war eine Erfindung geltungssüchtiger Männer, die den ahnungslosen Jungen ein großes Abenteuer versprachen, dem sie sich selbst meist nicht aussetzen wollten.
Das Weihnachtsfest rückte näher, und Frau Huber hatte Ella überraschend vorgeschlagen, ihre Eltern und Brüder für den 24. Dezember zum Essen einzuladen. Sie würden unten im großen Speisesaal den Tisch schön decken. Ein Weihnachtsbaum sollte geschlagen und geschmückt werden, und Jola würde ihren Entenbraten »mit Knodelchen« zubereiten. Nächstes Weihnachten, so waren sich noch immer alle einig, würde man bereits wieder in Frieden feiern können. Nur jetzt müssten diese schweren Stunden gemeinsam überstanden werden.
Ella war ein wenig nervös und unsicher, ob ihre Eltern sich nicht zu sehr ihrer Einfachheit schämen und gar nicht kommen würden. Gustl war eingezogen und nach Westflandern abkommandiert worden, sodass nur die zwei kleineren Brüder Seppi und Franz mitfeiern konnten. Vor allem aber für die Buben freute sich Ella, denn sie würden erstarren, wenn sie das Haus und den Lichterbaum sahen. Wider Erwarten zeigte sich ihre Mutter dankbar, und selbst die angespannten Züge ihres Vaters schienen sich für einen Moment zu lösen, als sie die Einladung überbrachte.
Im ersten Kriegswinter trafen also die Eltern Blau mit den beiden Söhnen bei Josefa Huber ein, um den Heiligen Abend gemeinsam zu feiern. Sie staunten über das schöne und komfortable Haus, das nach Entenbraten und Tannenzweigen roch. Sie zogen als Erstes ihre nassen Schneeschuhe aus und ihre Wollsocken an. Die sonst schwer zu bändigenden Brüder schlichen eingeschüchtert durch die Räume, staunten, rempelten sich an, um auf etwas zu zeigen, und als fürchteten sie, ihre Stimmen könnten das feine Kristall zum Platzen bringen, flüsterten sie leise.
Frau Huber hatte die weiße Damastdecke, Leinenservietten und das beste Geschirr aufgelegt. Der Tisch war mit kleinen Tannenzweigen und Nüssen geschmückt, und die brennenden Kerzen verbreiteten eine festliche Atmosphäre. Die anfängliche Steifheit wich einer zunehmenden Fröhlichkeit, auch weil Jola mit Ellas Vater in einer Ungezwungenheit umzugehen verstand, die ihn selbst erstaunte. Seppi und Franz waren längst aufgetaut und im Haus unterwegs, um sich die Wasserspülung des Klosetts einmal genauer anzusehen. Sie sprachen das Wort aus, als würde es sich um eine vornehme französische Gouvernante handeln, und kicherten um die Wette. Ella war auch ein bisschen stolz auf sich, und sie spürte, wie sehr sie sich bereits selbst verändert hatte und nicht mehr das einfache Landmädel war, das von Tischkultur und verfeinerter Küche so gar keine Vorstellung gehabt hatte.
Nachdem der Nachtisch serviert war, wünschte sich Frau Huber, dass der kleine Kreis gemeinsam O du Fröhliche singen würde. »Der Korbinian hat jetzt immer die Zither gespielt oder sich ans Klavier gesetzt. Und wir haben dann dazu gesungen.« Bei diesem Gedanken liefen Frau Huber Tränen über die Wangen, und auch Jola erfasste ein heftiger Gefühlsausbruch. Sepp Blau, der mit solch seelischen Eruptionen noch nie konfrontiert gewesen war, wusste sich nicht anders zu helfen, er setzte sich ans Klavier und spielte O Tannenbaum, dass die Tasten bebten. Alle erstarrten, und allen blieb der Mund offen stehen, weil niemand auch nur geahnt hatte, welche musikalische Leidenschaft in Sepps Adern pulsierte. Er spielte, als wären seine schwieligen Hände, die sonst schwere Hölzer schleppten, durch einen wundersamen Zauber verwandelt und gleichsam geheilt worden. Lange Finger glitten mit einer Leichtigkeit über die Tasten, als wäre Mühelosigkeit Sepps Lebensmotto.
Danach gab es kein Halten mehr, ein Weihnachtslied nach dem anderen wurde gesungen, und Frau Huber öffnete eine weitere Flasche Rotwein. Später kredenzte sie noch einen Schnaps, an dem die Buben nippen durften. Wehmütig, aber glückselig verabschiedeten sich zu später Stunde Sepp und Maria Blau mit den beiden Söhnen und machten sich auf den Weg durch den hohen Schnee nach Hause. Ein so schönes Fest hatten sie noch nie erlebt.
Zukunftspläne
Sie mussten aber nicht nur das Weihnachtsfest ohne Korbinian überstehen, was ihnen letztlich unerwartet gut gelungen war, sondern auch noch Geduld bis in das Frühjahr hinein haben, bis Korbinian endlich wieder ein paar Tage Urlaub bekam. Ella freute sich auf seine Rückkehr und die Zeit, die sie miteinander verbringen würden. Lange Wanderungen in die Berge schienen ihm gutzutun. Er war ernst geworden, hatte Zuflucht in der Literatur gefunden, die ihn, wie er Ella erklärte, von dem ablenkte, was er täglich zu sehen bekam. Ella hatte von den Schriftstellern, die er nannte, noch nie gehört, mit Ausnahme von Thomas Mann, dessen Haus in Tölz ja nicht weit entfernt stand, geschweige denn eine Zeile gelesen.
Eines Tages fragte Korbinian, ob sie mit ihm hinauf zum Blomberg gehen würde. Frau Huber war einverstanden, und sie zogen los. Beide empfanden eine große Vertrautheit und eine unbeschwerte Verliebtheit, und dabei sollte es, wenn es nach Ella ginge, vorerst auch bleiben. Zu mehr war sie mit ihren nunmehr siebzehn Jahren noch nicht bereit, so gerne sie ihn hatte. Umso erleichterter war sie, als Korbinian das Gespräch mit einem für sie überraschenden Satz begann.
»Ella, du kannst nicht immer hier bei meiner Mutter bleiben. Es verändert sich gerade alles. In München sitzen jetzt die Frauen im Fahrerhäusl und steuern die Trambahn, stell dir das mal vor, sie tragen Uniform; andere arbeiten bei der Post oder im Telegrafenamt. Sie machen jetzt die Arbeit, die die Männer nicht mehr machen können. Du siehst es ja auch hier auf dem Land, plötzlich sind die Frauen gut genug, um auf den Höfen allein das Sagen zu haben. In den Lazaretten versorgen sie eiternde Geschwüre und ersetzen die fehlenden Ärzte. Nach dem Krieg wird alles anders werden, und deshalb kannst du nicht ewig hier Mädchen für alles sein.«
Bevor Ella etwas einwenden konnte, fuhr er fort und strich sich dabei durch die strubbeligen Haare. »Genau gegenüber von mir, in der Theresienstraße, ist ein neues Institut, in dem man Stenografie lernen kann und mit einer Maschine zu schreiben. Es gibt da eine spezielle Technik, sie wird die Zukunft sein.« Korbinian brachte alles sehr entschlossen hervor, so als ob er seit einiger Zeit bereits darüber nachgedacht hätte.
»Was ist das denn, Ste-no-gra-fie?«, fragte Ella belustigt, indem sie jede einzelne Silbe betonte.
»Das ist eine Art Kurzschrift. Es gibt Kürzel für Wörter, und damit kann man sehr schnell einen diktierten Text mitschreiben«, antwortete Korbinian.
»Aber was kostet so was, und wo soll ich wohnen, und überhaupt weiß ich gar nicht, ob ich das kann, mit dem Stenodings schreiben.«
Sie mussten beide lachen.
»Wenn das jemand versteht und schnell lernt, dann DU! Und wohnen kannst du bei mir im Haus. Da gibt es Zimmer, die an junge Damen vermietet werden. Ich habe schon gefragt.« Korbinian schien an alles gedacht zu haben, und es war ihm ernst.
»Ich bin doch gar keine Dame. Und deine Mutter, was wird die sagen?«, erwiderte Ella, nun doch unsicher geworden.
»Du wirst immer die Ella bleiben, aber auch eine Dame werden, nur nicht so eine verwöhnte, die sich bedienen lässt, sondern eine, die weiß, was sie will. Und ich rede mit meiner Mutter, sie wird das verstehen. Du willst doch unabhängig sein und dein eigenes Geld verdienen«, erwiderte er leidenschaftlich und fuhr sich dabei erneut durch die Haare. »Aber wenn du später dann«, und nun machte er eine längere Atempause, »die Frau eines Landarztes werden möchtest, dann sag mir bitte zuallererst Bescheid.«
Dabei lächelte er sie verschmitzt an und küsste sie auf die Wange. Ella ahnte in diesem Moment vielleicht, dass sie niemals einem feinfühligeren Mann begegnen würde, der noch dazu nur ihr Bestes im Sinn hatte.
Während sie den Ausblick genossen, überschlugen sich Ellas Gedanken. In ihrer Fantasie reiste sie bereits mit ihrem kleinen Koffer nach München und sah sich in einem Raum mit anderen jungen Frauen vor diesen fremdartigen schwarzen Maschinen aufrecht sitzen. Sie stellte sich vor, wie sie sich einen kleinen Hut und neue Schuhe kaufen würde, die sie in einem echten Schuhgeschäft anprobieren wollte.
»Ella, du träumst ja. Was sagst du dazu?«, fragte Korbinian, der sich auf Ellas verklärtes Gesicht keinen Reim machen konnte.
Ella erfasste eine nie gekannte Sehnsucht nach Leben. Sie erinnerte sich an Momente des Glücks in ihrer Kindheit, wenn sie im Sommer in den Kirchsee gesprungen war und das zarte Schilf ihren Körper leicht berührt oder wenn im eisigen Winter ihr warmer Atem sich in der kalten Luft in einen Nebelhauch verwandelt hatte. In diesen Momenten hatte sie sich selbst gespürt. Aber dieses Gefühl jetzt war anders, es war größer als sie selbst.
»Ich überleg’s mir«, antwortete Ella und drückte Korbinians Hand fest. Aber insgeheim wusste sie, dass sie sich bereits entschieden hatte.





























