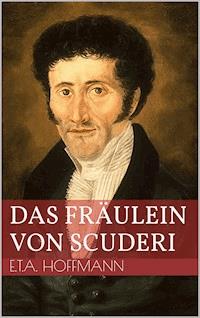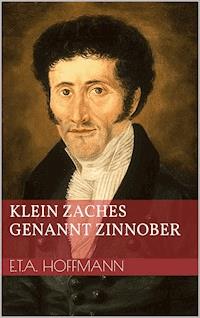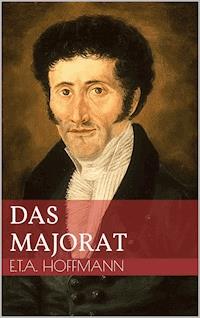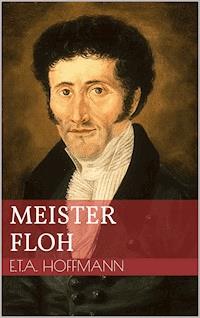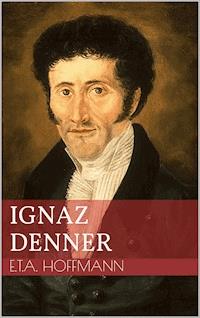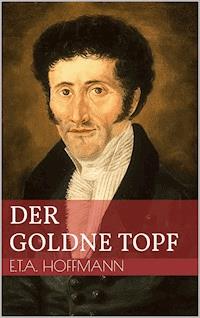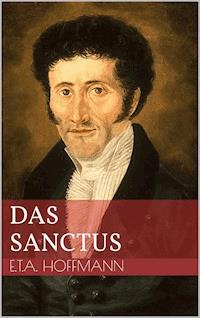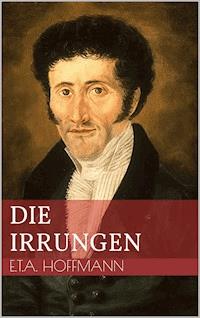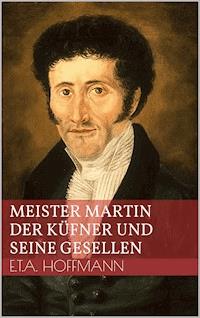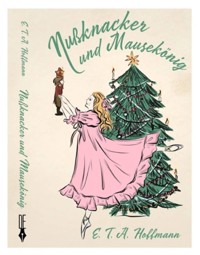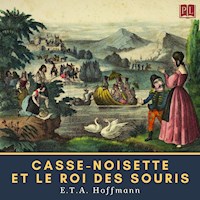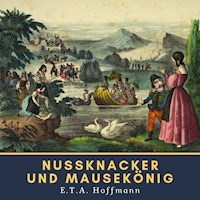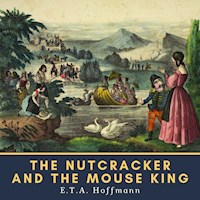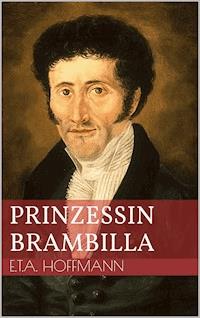
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Prinzessin Brambilla" ist ein 1820 in Berlin von E. T. A. Hoffmann nach acht Kupferstichen von Jacques Callot geschriebenes literarisches Capriccio. In der ironischen Erzählung wird vom mäßig talentierten Schauspieler Giglio und der Giacinta erzählt, die anfangs in die kuriose Prinzessin Brambilla beziehungsweise den Prinzen Cornelio verliebt sind. Am Ende der turbulenten Geschichte erkennen Giglio und Giacinta, dass sie ineinander verliebt sind. Eine der Figuren der Erzählung, der Maler Reinhold, fasst den turbulenten Wirbel anschaulich zusammen: "Mich will es bedünken, als hetze das bunte Maskenspiel eines tollen, märchenhaften Spaßes allerlei Gestalten in immer schnelleren und schnelleren Kreisen dermaßen durcheinander, daß man sie gar nicht mehr zu erkennen, gar nicht mehr zu unterscheiden vermag."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Impressum
Vorwort
Das Märchen Klein-Zaches, genannt Zinnober (Berlin bei F. Dümmler 1819) enthält nichts weiter, als die lose, lockre Ausführung einer scherzhaften Idee. Nicht wenig erstaunte indessen der Autor, als er auf eine Rezension stieß, in der dieser zu augenblicklicher Belustigung ohne allen weitern Anspruch leicht hingeworfene Scherz, mit ernsthafter wichtiger Miene zergliedert und sorgfältig jeder Quelle erwähnt wurde, aus der der Autor geschöpft haben sollte. Letzteres war ihm freilich insofern angenehm, als er dadurch Anlaß erhielt, jene Quellen selbst aufzusuchen und sein Wissen zu bereichern. – Um nun jedem Mißverständnis vorzubeugen, erklärt der Herausgeber dieser Blätter im voraus, daß ebensowenig, wie Klein-Zaches, die Prinzessin Brambilla ein Buch ist für Leute, die alles gern ernst und wichtig nehmen. Den geneigten Leser, der etwa willig und bereit sein sollte, auf einige Stunden dem Ernst zu entsagen und sich dem kecken launischen Spiel eines vielleicht manchmal zu frechen Spukgeistes zu überlassen, bittet aber der Herausgeber demütiglich, doch ja die Basis des Ganzen, nämlich Callots fantastisch karikierte Blätter nicht aus dem Auge zu verlieren und auch daran zu denken, was der Musiker etwa von einem Capriccio verlangen mag.
Wagt es der Herausgeber an jenen Ausspruch Carlo Gozzis (in der Vorrede zum Ré de’ geni) zu erinnern, nach welchem ein ganzes Arsenal von Ungereimtheiten und Spukereien nicht hinreicht, dem Märchen Seele zu schaffen, die es erst durch den tiefen Grund, durch die aus irgendeiner philosophischen Ansicht des Lebens geschöpfte Hauptidee erhält, so möge das nur darauf hindeuten, was er gewollt, nicht was ihm gelungen.
Berlin im September 1820.
Erstes Kapitel
Zauberische Wirkungen eines reichen Kleides auf eine junge Putzmacherin. – Definition des Schauspielers, der Liebhaber darstellt. – Von der Smorfia italischer Mädchen. – Wie ein kleiner ehrwürdiger Mann in einer Tulpe sitzend den Wissenschaften obliegt und anständige Damen zwiscben Maultierohren Filet machen. – Der Marktschreier Celionati und der Zahn des assyrischen Prinzen. – Himmelblau und Rosa. – Pantalon und die Weinflasche mit wunderbarem Inhalt. –
Die Dämmerung brach ein, es läutete in den Klöstern zum Ave: da warf das holde hübsche Kind, Giacinta Soardi geheißen, das reiche Frauenkleid von rotem schweren Atlas, an dessen Besatz sie emsig gearbeitet, beiseite und schaute aus dem hohen Fenster unmutig hinab, in die enge, öde, menschenleere Gasse.
Die alte Beatrice räumte indessen die bunten Maskenanzüge jeder Art, die in dem kleinen Stübchen auf Tischen und Stühlen umherlagen, sorglich zusammen und hing sie der Reihe nach auf. Beide Arme in die Seiten gestemmt, stellte sie sich dann hin vor den offenen Schrank und sprach schmunzelnd: „In der Tat, Giacinta, wir sind diesmal fleißig gewesen; mich dünkt, die ich sehe halbe lustige Welt des Korso hier vor Augen. – Aber auch noch niemals hat Meister Bescapi bei uns solch reiche Bestellungen gemacht. – Nun, er weiß, daß unser schönes Rom dieses Jahr wieder recht aufglänzen wird, in aller Lust, Pracht und Herrlichkeit. Gib acht, Giacinta, wie der Jubel morgen, an dem ersten Tage unsers Karnevals, sich erheben wird! Und morgen – morgen schüttet uns Meister Bescapi eine ganze Hand voll Dukaten in den Schoß – Gib acht, Giacinta! Aber was ist dir, Kind? du hängst den Kopf, du bist verdrießlich – mürrisch? und morgen ist Karneval?“
Giacinta hatte sich in den Arbeitssessel gesetzt und starrte, den Kopf in die Hand gestützt, zum Boden nieder, ohne auf die Worte der Alten zu achten. Als diese aber gar nicht aufhörte, von der bevorstehenden Lust des Karnevals zu schwatzen, da begann sie: „Schweigt doch nur, Alte, schweigt doch nur von einer Zeit, die für andere lustig genug sein mag, mir aber nichts bringt als Verdruß und Langeweile. Was hilft mir mein Arbeiten bei Tag und Nacht? was helfen uns Meister Bescapis Dukaten? – Sind wir nicht bitterarm? müssen wir nicht sorgen, daß der Verdienst dieser Tage vorhalte, das ganze Jahr hindurch uns kümmerlich genug zu ernähren? was bleibt uns übrig für unser Vergnügen?“
„Was hat“, erwiderte die Alte, „was hat unsere Armut mit dem Karneval zu schaffen? Sind wir nicht voriges Jahr umhergelaufen vom Morgen bis in die späte Nacht, und sah ich nicht fein aus und stattlich als Dottore? – Und ich hatte dich am Arm und du warst allerliebst als Gärtnermädchen – hihi! und die schönsten Masken liefen dir nach und sprachen zu dir mit zuckersüßen Worten. Nun, war das nicht lustig? Und was hält uns ab, dieses Jahr dasselbe zu unternehmen? Meinen Dottore darf ich nur gehörig ausbürsten, dann verschwinden wohl alle Spuren der bösen Konfetti, mit denen er beworfen und deine Gärtnerin hängt auch noch da. Ein paar neue Bänder, ein paar frische Blumen – was bedarf es mehr für Euch, um hübsch und schmuck zu sein?“ – „Was sprecht Ihr“, rief Giacinta, „was sprecht Ihr, Alte? – In den armseligen Lumpen sollt ich mich hinauswagen? – Nein! – ein schönes spanisches Kleid, das sich eng an den Leib schließt und dann hinabwallt in reichen dicken Falten, weite geschlitzte Ärmel, aus denen herrliche Spitzen hervorbauschen – ein Hütlein mit keck wehenden Federn, ein Gürtel, ein Halsband von strahlenden Diamanten – so möchte Giacinta hinaus in den Korso und sich niederlassen vor dem Palast Ruspoli. – Wie die Kavaliere sich hinandrängen würden – ‚wer ist die Dame? – Gewiß eine Gräfin – eine Prinzessin‘, und selbst Pulcinella würde ergriffen von Ehrfurcht und vergäße seine tollsten Neckereien!“ – „Ich höre“, nahm die Alte das Wort, „ich höre Euch zu, mit großer Verwunderung. Sagt, seit wann ist denn solch ein verwünschter Hochmutsteufel in Euch gefahren? – Nun, wenn Euch denn der Sinn so gar hoch steht, daß Ihr es Gräfinnen, Prinzessinnen nachtun wollt, so seid so gut und schafft Euch einen Liebhaber an, der um Eurer schönen Augen willen tapfer in den Fortunatussäckel zu greifen vermag und jagt den Signor Giglio fort, den Habenichts, der, geschieht es ihm, daß er ein paar Dukaten in der Tasche verspürt, alles vertrödelt in wohlriechenden Pomaden und Näschereien und der mir noch zwei Paoli schuldig ist für den neugewaschnen Spitzenkragen.“ –
Während dieser Reden hatte die Alte die Lampe in Ordnung gebracht und angezündet. Als nun der helle Schein Giacinten ins Gesicht fiel, gewahrte die Alte, daß ihr die bittren Tränen aus den Augen perlten: „Giacinta“, rief die Alte, „um aller Heiligen, Giacinta, was ist dir, was hast du? – Ei Kind, so böse habe ich es ja gar nicht gemeint. Sei nur ruhig, arbeite nicht so emsig; das Kleid wird ja doch wohl noch fertig zur bestimmten Zeit.“ – „Ach“, sprach Giacinta, ohne von der Arbeit, die sie wieder begonnen, aufzusehen, „ach eben das Kleid, das böse Kleid ist es, glaub ich, das mich erfüllt hat mit allerlei törichten Gedanken. Sagt, Alte, habt Ihr wohl in Euerm ganzen Leben ein Kleid gesehen, das diesem an Schönheit und Pracht zu vergleichen ist? Meister Bescapi hat sich in der Tat selbst übertroffen; ein besonderer Geist waltete über ihn, als er diesen herrlichen Atlas zuschnitt. Und dann die prächtigen Spitzen, die glänzenden Tressen, die kostbaren Steine, die er zum Besatz uns anvertraut hat. Um alle Welt möcht ich wissen, wer die Glückliche ist, die sich mit diesem Götterkleide schmücken wird.“ „Was“, fiel die Alte dem Mädchen ins Wort, „was kümmert uns das? wir machen die Arbeit und erhalten unser Geld. Aber wahr ist es, Meister Bescapi tat so geheimnisvoll, so seltsam – Nun, eine Prinzessin muß es wenigstens sein, die dieses Kleid trägt und, bin ich auch sonst eben nicht neugierig, so wär mir’s doch lieb, wenn Meister Bescapi mir den Namen sagte und ich werde ihm morgen schon so lange zusetzen, bis er’s tut.“ „Ach nein, nein“, rief Giacinta, „ich will es gar nicht wissen, ich will mir lieber einbilden, keine Sterbliche werde jemals dies Kleid anlegen, sondern ich arbeite an einem geheimnisvollen Feenschmuck. Mir ist wahrhaftig schon, als guckten mich aus den glänzenden Steinen allerlei kleine Geisterchen lächelnd an und lispelten mir zu: ‚Nähe – nähe frisch für unsere schöne Königin, wir helfen dir – wir helfen dir!‘ – Und wenn ich so die Spitzen und Tressen ineinanderschlinge, dann dünkt es mich, als hüpften kleine liebliche Elflein mit goldgeharnischten Gnomen durcheinander und – O weh!“ – So schrie Giacinta auf; eben den Busenstreif nähend, hatte sie sich heftig in den Finger gestochen, daß das Blut wie aus einem Springquell hervorspritzte. „Hilf Himmel“, schrie die Alte, „hilf Himmel, das schöne Kleid!“ nahm die Lampe, leuchtete nahe hin, und reichliche Tropfen Öls flossen über. „Hilf Himmel, das schöne Kleid!“ rief Giacinta, halb ohnmächtig vor Schreck. Unerachtet es aber gewiß, daß beides, Blut und Öl, sich auf das Kleid ergossen, so konnte doch weder die Alte, noch Giacinta auch nur die mindeste Spur eines Flecks entdecken. Nun nähte Giacinta flugs weiter, bis sie mit einem freudigen: „Fertig – fertig!“ aufsprang und das Kleid hoch in die Höhe hielt.
„Ei wie schön“, rief die Alte, „ei wie herrlich – wie prächtig! – Nein, Giacinta, nie haben deine lieben Händchen so etwas gefertigt – Und weißt du wohl, Giacinta, daß es mir scheint, als sei das Kleid ganz und gar nach deinem Wuchs geschnitten, als habe Meister Bescapi niemandem anders als dir selbst das Maß dazu genommen?“ „Warum nicht gar?“ erwiderte Giacinta über und über errötend, „du träumst, Alte; bin ich denn so groß und schlank, wie die Dame, für welche das Kleid bestimmt sein muß? – Nimm es hin, nimm es hin, verwahre es sorglich bis morgen! Gebe der Himmel, daß beim Tageslicht kein böser Fleck zu entdecken! – Was würden wir Ärmste nur anfangen? – Nehmt es hin!“ – Die Alte zögerte.
„Freilich“, sprach Giacinta, das Kleid betrachtend, weiter, „freilich, bei der Arbeit ist mir manchmal es so vorgekommen, als müsse mir das Kleid passen. In der Taille möcht ich schlank genug sein, und was die Länge betrifft –“ „Giacinina“, rief die Alte mit leuchtenden Augen, „Giacinina, du errätst meine Gedanken, ich die deinigen – Mag das Kleid anlegen, wer da will, Prinzessin, Königin, Fee, gleichviel, meine Giacinina muß sich zuerst darin putzen –“ „Nimmermehr“, sprach Giacinta; aber die Alte nahm ihr das Kleid aus den Händen, hing es sorglich über den Lehnstuhl und begann des Mädchens Haar loszuflechten, das sie dann gar zierlich aufzunesteln wußte: dann holte sie das mit Blumen und Federn geschmückte Hütchen, das sie auf Bescapis Geheiß zu dem Anzuge aufputzen müssen, aus dem Schranke und befestigte es in Giacintas kastanienbraunen Locken. – „Kind, wie dir schon das Hütchen allerliebst steht! Aber nun herunter mit dem Jäckchen!“ So rief die Alte und begann Giacinta zu entkleiden, die in holder Verschämtheit nicht mehr zu widersprechen vermochte.
„Hm“, murmelte die Alte, „dieser sanft gewölbte Nacken, dieser Lilienbusen, diese Alabasterärme, die Mediceerin hat sie nicht schöner geformt, Giulio Romano sie nicht herrlicher gemalt – Möcht doch wissen, welche Prinzessin nicht mein süßes Kind darum beneiden würde!“ – Als sie aber nun dem Mädchen das prächtige Kleid anlegte, war es, als ständen ihr unsichtbare Geister bei. Alles fügte und schickte sich, jede Nadel saß im Augenblick recht, jede Falte legte sich wie von selbst, es war nicht möglich zu glauben, daß das Kleid für jemanden anders gemacht sein könnte, als eben für Giacinta.
„O all ihr Heiligen“, rief die Alte, als Giacinta nun so prächtig geputzt vor ihr stand, „o all ihr Heiligen, du bist wohl gar nicht meine Giacinta – ach – ach – wie schön seid Ihr, meine gnädigste Prinzessin! – Aber warte – warte! hell muß es sein, ganz hell muß es sein im Stübchen!“ – Und damit holte die Alte alle geweihte Kerzen herbei, die sie von den Marienfesten erspart, und zündete sie an, so daß Giacinta dastand von strahlendem Glanz umflossen.
Vor Erstaunen über Giacintas hohe Schönheit und noch mehr über die anmutige und dabei vornehme Weise, womit sie in der Stube auf und ab schritt, schlug die Alte die Hände zusammen und rief: „O wenn Euch doch nur jemand, wenn Euch doch nur der ganze Korso schauen könnte!“
In dem Augenblick sprang die Türe auf, Giacinta floh mit einem Schrei ans Fenster, zwei Schritte ins Zimmer hineingetreten blieb ein junger Mensch an den Boden gewurzelt stehen, wie zur Bildsäule erstarrt.
Du kannst, vielgeliebter Leser, den jungen Menschen, während er so laut- und regungslos dasteht, mit Muße betrachten. Du wirst finden, daß er kaum vier- bis fünfundzwanzig Jahre alt sein kann und dabei von ganz artigem hübschen Ansehen ist. Seltsam scheint wohl deshalb sein Anzug zu nennen, weil jedes Stück desselben an Farbe und Schnitt nicht zu tadeln ist, das Ganze aber durchaus nicht zusammenpassen will, sondern ein grell abstechendes Farbenspiel darbietet. Dabei wird, unerachtet alles sauber gehalten, doch eine gewisse Armseligkeit sichtbar; man merkt’s der Spitzenkrause an, daß zum Wechseln nur noch eine vorhanden, und den Federn, womit der schief auf den Kopf gedrückte Hut fantastisch geschmückt, daß sie mühsam mit Draht und Nadel zusammengehalten. Du gewahrst es wohl, geneigter Leser, der junge also gekleidete Mensch kann nichts anders sein, als ein etwas eitler Schauspieler, dessen Verdienste eben nicht zu hoch angeschlagen werden; und das ist er auch wirklich. Mit einem Wort – es ist derselbe Giglio Fava, der der alten Beatrice noch zwei Paoli für einen gewaschenen Spitzenkragen schuldet.
„Ha! was seh ich?“ begann Giglio Fava endlich so emphatisch, als stände er auf dem Theater Argentina, „ha! was seh ich – ist es ein Traum, der mich von neuem täuscht? – Nein! sie ist es selbst, die Göttliche – ich darf es wagen sie anzureden mit kühnen Liebesworten? – Prinzessin – o Prinzessin!“ – „Sei kein Hase“, rief Giacinta, sich rasch umwendend, „und spare die Possen auf für die folgenden Tage!“
„Weiß ich denn nicht“, erwiderte Giglio, nachdem er Atem geschöpft mit erzwungenem Lächeln, „weiß ich denn nicht, daß du es bist, meine holde Giacinta, aber sage, was bedeutet dieser prächtige Anzug? – In der Tat, noch nie bist du mir so reizend erschienen, ich möchte dich nie anders sehen.“
„So?“ sprach Giacinta erzürnt; „also meinem Atlaskleide, meinem Federhütchen gilt deine Liebe?“ – Und damit entschlüpfte sie schnell in das Nebenstübchen und trat bald darauf alles Schmucks entledigt in ihren gewöhnlichen Kleidern wieder hinein. Die Alte hatte indessen die Kerzen ausgelöscht und den vorwitzigen Giglio tüchtig heruntergescholten, daß er die Freude, die Giacinta an dem Kleide gehabt, das für irgendeine vornehme Dame bestimmt, so verstört und noch dazu ungalant genug zu verstehen gegeben, daß solcher Prunk Giacintas Reize zu erhöhen und sie liebenswürdiger, als sonst, erscheinen zu lassen vermöge. Giacinta stimmte in diese Lektion tüchtig ein, bis der arme Giglio ganz Demut und Reue endlich so viel Ruhe errang, um wenigstens mit der Versicherung gehört zu werden, daß seinem Erstaunen ein seltsames Zusammentreffen ganz besonderer Umstände zum Grunde gelegen. „Laß dir’s erzählen!“ begann er. „Laß dir’s erzählen, mein holdes Kind, mein süßes Leben, welch ein märchenhafter Traum mir gestern nachts aufging, als ich ganz müde und ermattet von der Rolle des Prinzen Taer, den ich, du weißt es, ebenso die Welt, über alle Maßen vortrefflich spiele, mich auf mein Lager geworfen. Mich dünkte, ich sei noch auf der Bühne und zanke sehr mit dem schmutzigen Geizhals von Impresario, der mir ein paar lumpichte Dukaten Vorschuß hartnäckig verweigerte. Er überhäufte mich mit allerlei dummen Vorwürfen; da wollte ich, um mich besser zu verteidigen, einen schönen Gestus machen, meine Hand traf aber unversehends des Impresario rechte Wange, so daß dabei Klang und Melodie einer derben Ohrfeige herauskam; der Impresario ging ohne weiteres mit einem großen Messer auf mich los, ich wich zurück und dabei fiel meine schöne Prinzenmütze, die du selbst, mein süßes Hoffen, so artig mit den schönsten Federn schmücktest, die jemals einem Strauß entrupft, zu Boden. In voller Wut warf sich der Unmensch, der Barbar über sie her und durchstach die Ärmste mit dem Messer, daß sie sich im qualvollen Sterben winselnd zu meinen Füßen krümmte. – Ich wollte – mußte die Unglückliche rächen. Den Mantel über den linken Arm geworfen, das fürstliche Schwert gezückt, drang ich ein auf den ruchlosen Mörder. Der floh aber schnell in ein Haus und drückte vom Balkon herunter Truffaldinos Flinte auf mich ab. Seltsam war es, daß der Blitz des Feuergewehrs stehenblieb und mich anstrahlte wie funkelnde Diamanten. Und so wie sich mehr und mehr der Dampf verlor, gewahrte ich wohl, daß das, was ich für den Blitz von Truffaldinos Flinte gehalten, nichts anders war, als der köstliche Schmuck am Hütlein einer Dame – O all ihr Götter! ihr seligen Himmel allesamt! – eine süße Stimme sprach – nein! sang – nein! hauchte Liebesduft in Klang und Ton – ‚O Giglio – mein Giglio!‘ – Und ich schaute ein Wesen in solch göttlichem Liebreiz, in solch hoher Anmut, daß der sengende Schirokko inbrünstiger Liebe mir durch alle Adern und Nerven fuhr und der Glutstrom erstarrte zur Lava, die dem Vulkan des aufflammenden Herzens entquollen – ‚Ich bin‘, sprach die Göttin sich mir nahend, ‚ich bin die Prinzessin –‘“ „Wie?“ unterbrach Giacinta den Verzückten zornig; „wie? du unterstehst dich von einer andern zu träumen, als von mir? du unterstehst dich in Liebe zu kommen, ein dummes einfältiges Traumbild schauend, das aus Trufialdinos Flinte geschossen?“ – Und nun regnete es Vorwürfe und Klagen und Scheltworte und Verwünschungen, und alles Beteuern und alles Versichern des armen Giglio, daß die Traumprinzessin gerade so gekleidet gewesen, wie er eben seine Giacinta getroffen, wollte ganz und gar nichts helfen. Selbst die alte Beatrice, sonst eben nicht geneigt, des Signor Habenichts, wie sie den Giglio nannte, Partie zu nehmen, fühlte sich von Mitleid durchdrungen und ließ nicht ab von der störrischen Giacinta, bis sie dem Geliebten den Traum unter der Bedingung verzieh, daß er niemals mehr ein Wörtlein davon erwähnen sollte. Die Alte brachte ein gutes Gericht Makkaroni zustande und Giglio holte, da, dem Traum entgegen, der Impresario ihm wirklich ein paar Dukaten vorgeschossen, eine Tüte Zuckerwerk und eine mit in der Tat ziemlich trinkbarem Wein gefüllte Phiole aus der Manteltasche hervor. „Ich sehe doch, daß du an mich denkst, guter Giglio“, sprach Giacinta, indem sie eine überzuckerte Frucht in das Mündchen steckte. Giglio durfte ihr sogar den Finger küssen, den die böse Nadel verletzt und alle Wonne und Seligkeit kehrte wieder. Tanzt aber einmal der Teufel mit, so helfen die artigsten Sprünge nicht. Der böse Feind selbst war es nämlich wohl, der dem Giglio eingab, nachdem er ein paar Gläser Wein getrunken, also zu reden: „Nicht geglaubt hätt ich, daß du, mein süßes Leben, so eifersüchtig auf mich sein könntest. Aber du hast recht. Ich bin ganz hübsch von Ansehn, begabt von der Natur mit allerlei angenehmen Talenten; aber mehr als das – ich bin Schauspieler. Der junge Schauspieler, welcher so wie ich, verliebte Prinzen göttlich spielt, mit geziemlichen O und Ach, ist ein wandelnder Roman, eine Intrige auf zwei Beinen, ein Liebeslied mit Lippen zum Küssen, mit Armen zum Umfangen, ein aus dem Einband ins Leben gesprungenes Abenteuer, das der Schönsten vor Augen steht, wenn sie das Buch zugeklappt. Daher kommt es, daß wir unwiderstehlichen Zauber üben an den armen Weibern, die vernarrt sind in alles, was in und an uns ist, in unser Gemüt, in unsre Augen, in unsre falschen Steine, Federn und Bänder. Da gilt nicht Rang, nicht Stand; Wäschermädchen oder Prinzessin – gleichviel! – Nun sage ich dir, mein holdes Kind, daß, täuschen mich nicht gewisse geheimnisvolle Ahnungen, neckt mich nicht ein böser Spuk, wirklich das Herz der schönsten Prinzessin entbrannt ist in Liebe zu mir. Hat sich das begeben, oder begibt es sich noch, so wirst du, mein schönstes Hoffen, es mir nicht verdenken, wenn ich den Goldschacht, der sich mir auftut, nicht ungenützt lasse, wenn ich dich ein wenig vernachlässige, da doch ein armes Ding von Putzmacherin –“ Giacinta hatte mit immer steigender Aufmerksamkeit zugehört, war dem Giglio, in dessen schimmernden Augen sich das Traumbild der Nacht spiegelte, immer näher und näher gerückt; jetzt sprang sie rasch auf, gab dem beglückten Liebhaber der schönsten Prinzessin eine solche Ohrfeige, daß alle Feuerfunken aus jener verhängnisvollen Flinte Truffaldinos vor seinen Augen hüpften und entsprang schnell in die Kammer. Alles fernere Bitten und Flehen half nun nichts mehr. „Geht nur fein nach Hause, sie hat ihre Smorfia und dann ist’s aus“, sprach die Alte und leuchtete dem betrübten Giglio die enge Treppe hinab. – Es muß mit der Smorfia, mit dem seltsam launischen, etwas ungescheuten Wesen junger italischer Mädchen eine eigne Bewandtnis haben; denn Kenner versichern einmütiglich, daß eben aus diesem Wesen sich ein wunderbarer Zauber solch unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit entfalte, daß der Gefangene, statt unmutig die Bande zu zerreißen, sich noch fester und fester darin verstricke, daß der auf schnöde Weise abgefertigte Amante, statt ein ewiges Addio zu unternehmen, nur desto inbrünstiger seufze und flehe, wie es in jenem Volksliedlein heißt: Vien quà, Donna bella, non far la smorfiosella! – Der, der mit dir, geliebter Leser, also spricht, will vermuten, daß jene Lust aus Unlust nur erblühen könne in dem fröhlichen Süden, daß aber solch schöne Blüte aus friedlichem Stoff nicht aufzukommen vermöge in unserm Norden. Wenigstens an dem Orte, wo er lebt, will er denjenigen Gemütszustand, wie er ihn oft an jungen, eben der Kindheit entronnenen Mädchen bemerkt hat, gar nicht mit jener artigen Smorfiosität vergleichen. Hat ihnen der Himmel angenehme Gesichtszüge verliehen, so verzerren sie dieselben auf ungeziemliche Weise; alles ist ihnen in der Welt bald zu schmal, bald zu breit, kein schicklicher Platz für ihr kleines Figürlein hienieden, sie ertragen lieber die Qual eines zu engen Schuhs, als ein freundliches, oder gar ein geistreiches Wort und nehmen es entsetzlich übel, daß sämtliche Jünglinge und Männer in dem Weichbilde der Stadt sterblich in sie verliebt sind, welches sie denn doch wieder meinen, ohne sich zu ärgern. – Es gibt für diesen Seelenzustand des zartesten Geschlechts keinen Ausdruck. Das Substrat der Ungezogenheit, die darin enthalten, reflektiert sich hohlspiegelartig bei Knaben in der Zeit, die grobe Schulmeister mit dem Wort: Lümmeljahre bezeichnen. – - Und doch war es dem armen Giglio ganz und gar nicht zu verdenken, daß er, auf seltsame Weise gespannt, auch wachend von Prinzessinnen und wunderbaren Abenteuern träumte. – Eben denselben Tag hatte, als er im Äußern schon halb und halb, im Innern aber ganz und gar Prinz Taer, durch den Korso wandelte, sich in der Tat viel Abenteuerliches ereignet.
Es begab sich, daß bei der Kirche S. Carlo, gerade da, wo die Straße Condotti den Korso durchkreuzt, mitten unter den Buden der Wurstkrämer und Makkaroniköche, der in ganz Rom bekannte Ciarlatano, Signor Celionati geheißen, sein Gerüst aufgeschlagen hatte und dem um ihn her versammelten Volk tolles Märchenzeug vorschwatzte, von geflügelten Katzen, springenden Erdmännlein, Alraunwurzeln u.s.w. und dabei manches Arkanum verkaufte für trostlose Liebe und Zahnschmerz, für Lotterienieten und Podagra. Da ließ sich ganz in der Ferne eine seltsame Musik von Zimbeln, Pfeifen und Trommeln hören, und das Volk sprengte auseinander und strömte, stürzte durch den Korso der Porta del popolo zu, laut schreiend: „Schaut, schaut! – ei ist denn schon der Karneval los? – schaut – schaut!“
Das Volk hatte recht; denn der Zug, der sich durch die Porta del popolo langsam den Korso hinaufbewegte, konnte füglich für nichts anders gehalten werden, als für die seltsamste Maskerade, die man jemals gesehen. Auf zwölf kleinen schneeweißen Einhörnern mit goldnen Hufen saßen in rote atlasne Talare eingehüllte Wesen, die gar artig auf silbernen Pfeifen bliesen und Zimbeln und kleine Trommeln schlugen. Beinahe nach Art der büßenden Brüder waren in den Talaren nur die Augen ausgeschnitten und ringsum mit goldnen Tressen besetzt, welches sich wunderlich genug ausnahm. Als der Wind dem einen der kleinen Reiter den Talar etwas aufhob, starrte ein Vogelfuß hervor, dessen Krallen mit Brillantringen besteckt waren. Hinter diesen zwölf anmutigen Musikanten zogen zwei mächtige Strauße eine große auf einem Rädergestell befestigte goldgleißende Tulpe, in der ein kleiner alter Mann saß mit langem weißen Bart, in einen Talar von Silberstoff gekleidet, einen silbernen Trichter als Mütze auf das ehrwürdige Haupt gestülpt. Der Alte las, eine ungeheure Brille auf der Nase, sehr aufmerksam in einem großen Buche, das er vor sich aufgeschlagen. Ihm folgten zwölf reichgekleidete Mohren mit langen Spießen und kurzen Säbeln bewaffnet, die jedesmal, wenn der kleine Alte ein Blatt im Buche umschlug und dabei ein sehr feines scharf durchdringendes: „Kurri – pire – ksi – li – i i i“ vernehmen ließ, mit gewaltig dröhnenden Stimmen sangen: „Bram – bure – bil – bal – Ala monsa Kikiburra – son – ton!“ Hinter den Mohren ritten auf zwölf Zeltern, deren Farbe reines Silber schien, zwölf Gestalten, beinahe so verhüllt wie die Musikanten, nur daß die Talare auf Silbergrund reich mit Perlen und Diamanten gestickt und die Arme bis an die Schulter entblößt waren. Die wunderbare Fülle und Schönheit dieser mit den herrlichsten Armspangen geschmückten Arme hätten schon verraten, daß unter den Talaren die schönsten Damen versteckt sein mußten; überdem machte aber auch jede reitend sehr emsig Filet, wozu zwischen den Ohren der Zelter große Samtkissen befestigt waren. Nun folgte eine große Kutsche, die ganz Gold schien und von acht der schönsten, mit goldnen Schabracken behängten Maultieren gezogen wurde, welche kleine sehr artig in bunte Federwämser gekleidete Pagen an mit Diamanten besetzten Zügeln führten. Die Tiere wußten mit unbeschreiblicher Wurde die stattlichen Ohren zu schütteln und dann ließen sich Töne hören der Harmonika ähnlich, wozu die Tiere selbst, so wie die Pagen, die sie führten, ein paßliches Geschrei erhoben, welches zusammenklang auf die anmutigste Weise. Das Volk drängte sich heran und wollte in die Kutsche hineinschauen, sah aber nichts, als den Korso, und sich selbst; denn die Fenster waren reine Spiegel. Mancher, der auf diese Art sich schaute, glaubte im Augenblick, er säße selbst in der prächtigen Kutsche und kam darüber vor Freuden ganz außer sich, so wie es mit dem ganzen Volk geschah, als es von einem kleinen äußerst angenehmen Pulcinella, der auf dem Kutschendeckel stand, ungemein artig und verbindlich begrüßt wurde. In diesem allgemeinen ausgelassensten Jubel wurde kaum mehr das glänzende Gefolge beachtet, das wieder aus Musikanten, Mohren und Pagen, den ersten gleich gekleidet, bestand, bei welchen nur noch einige in den zartesten Farben geschmackvoll gekleidete Affen befindlich, die mit sprechender Mimik in den Hinterbeinen tanzten und im Koboldschießen ihresgleichen suchten. So zog das Abenteuer den Korso herab durch die Straßen bis auf den Platz Navona, wo es stillstand vor dem Palast des Prinzen Bastianello di Pistoja.
Die Torflügel des Palastes sprangen auf und plötzlich verstummte der Jubel des Volks und in der Totenstille des tiefsten Erstaunens schaute man das Wunder, das sich nun begab. Die Marmorstufen hinauf durch das enge Tor zog alles, Einhörner, Pferde, Maultiere, Kutsche, Strauße, Damen, Mohren, Pagen, ohne alle Schwierigkeit hinein und ein tausendstimmiges „Ah!“ erfüllte die Lüfte, als das Tor, nachdem die letzten vierundzwanzig Mohren in blanker Reihe hineingeschritten, sich mit donnerndem Getöse schloß.
Das Volk, nachdem es lange genug vergebens gegafft und im Palast alles still und ruhig blieb, bezeigte nicht üble Lust, den Aufenthalt des Märchens zu stürmen und wurde nur mit Mühe von den Sbirren auseinandergetrieben.