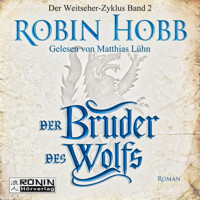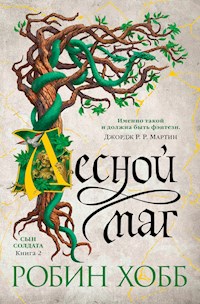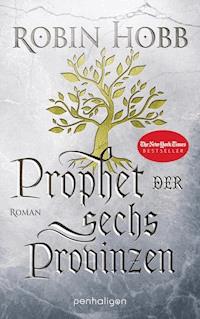
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Erbe der Weitseher
- Sprache: Deutsch
Ein alter Feind, ein neues Bündnis – doch niemand vertraut dem anderen.
Fitz Weitseher hat Prinz Pflichtgetreu befreit und ist mit ihm nach Bocksburg zurückgekehrt. Nun steht der Heirat des Prinzen mit Prinzessin Elliania von den Roten Korsaren scheinbar nichts mehr im Weg. Doch die Anspannung im Volk der Sechs Provinzen und der Widerstand der Adligen wächst stetig, und selbst Bocksburg ist nicht mehr sicher. Widerstrebend willigt Fitz ein, den Prinzen zu beschützen und ihn in der Gabe zu unterrichten. Da trifft er auf einen Anwender dieser magischen Fähigkeit, der sie weit effektiver als er selbst einzusetzen vermag; von dem niemand wusste – und der Haus Weitseher zu Grunde richten könnte …
Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Der goldene Narr« im Bastei-Lübbe Verlag erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1286
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Fitz Weitseher hat Prinz Pflichtgetreu befreit und ist mit ihm nach Bocksburg zurückgekehrt. Nun steht der Heirat des Prinzen mit Prinzessin Elliania von den Roten Korsaren scheinbar nichts mehr im Weg. Doch die Anspannung im Volk der Sechs Provinzen und der Widerstand der Adligen wachsen stetig, und selbst Bocksburg ist nicht mehr sicher. Widerstrebend willigt Fitz ein, den Prinzen zu beschützen und ihn in der Gabe zu unterrichten. Da trifft er auf einen Anwender dieser magischen Fähigkeit, der sie weit effektiver als er selbst einzusetzen vermag; von dem niemand wusste – und der Haus Weitseher zugrunde richten könnte …
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, ging jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit Die Gabe der Könige, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz-Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Diener der Alten Macht
2. Prophet der Sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Prophet der Sechs Provinzen
Das Erbe der Weitseher 2
Roman
Deutsch von Eva Bauche-Eppers
Prolog
ERLITTENEVERLUSTE
Den Verlust eines Geschwistertieres kann man jemandem, der nicht über die Alte Macht verfügt, nur schwer erklären. Jene, die beim Tod eines Tieres sagen: »Es war doch nur ein Hund«, werden nie verstehen können, wie es sich anfühlt. Andere, mitfühlendere Naturen können es sich wie den Tod eines geliebten Haustieres vorstellen. Aber selbst jene, die meinen, »es muss wie der Verlust eines Kindes oder einer Ehefrau sein«, sehen nur eine Facette des wahren Schmerzes. Der Verlust eines Lebewesens, mit dem man verschwistert war, ist viel schlimmer als der Verlust eines Gefährten oder eines geliebten Menschen. In meinem Fall war es, als hätte man mir plötzlich die Hälfte meines Selbst amputiert. Mein Sehvermögen war eingeschränkt und mein Appetit gedämpft, das Essen roch einfach nur langweilig. Mein Gehör hatte stark nachgelassen, und …
Das Manuskript, das ich so vor vielen Jahren begonnen hatte, endet in einem Gewirr von Klecksen und wütenden Strichen. Ich kann mich genau an den Augenblick erinnern, an dem ich erkannt habe, dass ich von einer allgemeinen Beschreibung zu einem Bericht über meinen persönlichen Schmerz übergegangen war. Es gibt Kniffe und Falten in der Schriftrolle, die daher rühren, dass ich sie vor Wut immer wieder auf den Boden geworfen habe und darauf herumgetrampelt bin. Das Wunder dabei ist, dass ich sie zum Glück nur zur Seite getreten und nicht direkt ins Kaminfeuer befördert habe. Ich weiß nicht, wer schließlich Mitleid mit dem elenden Ding bekam und es in mein Regal einreihte. Vielleicht war es Dick mit seiner methodischen, gedankenlosen Art. Ich selbst jedenfalls kann zwischen meinen eigenen Texten keinen finden, der es verdient hätte, gerettet zu werden. Meine literarischen Bemühungen scheinen mir in der Regel mehr schlecht als recht zu sein.
Meine verschiedenen Versuche, eine Geschichte der Sechs Provinzen zu verfassen, verwandelten sich häufig zu einer Geschichte über meine Welt und mein Leben. Bei einer Abhandlung über Kräuterkunde wanderte meine Feder zu den unterschiedlichen Behandlungsmethoden bei Gabenleiden. Meine Studien über die Weißen Propheten verloren sich völlig in deren Beziehungen zu ihren Katalysten. Ich weiß nicht, ob es mein Dünkel ist, der meine Gedanken immer wieder auf mein eigenes Leben lenkt, oder ob mein Schreiben nur meinen armseligen Versuch darstellt, mir selbst das Leben zu erklären. Die Jahre sind zu Dutzenden gekommen und wieder gegangen, und noch immer nehme ich Nacht für Nacht die Feder in die Hand und schreibe. Noch immer strebe ich danach zu verstehen, wer ich bin. Der Vorsatz »das nächste Mal werde ich es besser machen« ist nicht viel mehr als die Selbsttäuschung, dass es auch ein »nächstes Mal« geben wird.
Als ich Nachtauge verloren hatte, hatte ich nicht an dieses nächste Mal geglaubt. Ich hatte mir nie fest vorgenommen, wieder eine Bindung einzugehen und es mit dem nächsten Geschwistertier besser zu machen. Solch ein Gedanke wäre Verrat gewesen. Nach Nachtauges Tod war ich vollkommen leer. In den darauffolgenden Tagen ging ich verwundet durchs Leben, ohne überhaupt zu bemerken, wie verstümmelt ich war. Ich war wie ein Mann, der über das Jucken in seinem amputierten Bein klagt. Das Jucken lenkt vom ungeheuerlichen Wissen ab, dass man fortan durchs Leben humpeln wird. So verbarg die unmittelbare Trauer über Nachtauges Tod das wahre Ausmaß des Schadens, den ich erlitten hatte. Ich war verwirrt, hielt meinen Schmerz und meinen Verlust für ein und dasselbe, wo in Wirklichkeit das eine doch das Symptom des anderen war.
Auf seltsame Art war es wie ein zweites Mündigwerden. Diesmal hatte es jedoch nichts mit dem Erreichen des Mannesalters zu tun, sondern mit der langsamen Erkenntnis, dass ich ein Individuum war. Die Umstände hatten mich wieder zu einem Teil der Hofintrigen von Bocksburg gemacht. Ich hatte die Freundschaft mit dem Narren und mit Chade wiederbelebt. Ich stand am Rande einer echten Beziehung mit Jinna, der Krudhexe, und mein Junge, Harm, hatte sich kopfüber in die Lehre und in eine Romanze gestürzt und schien nun in beiden Angelegenheiten wenig glücklich umherzustolpern. Prinz Pflichtgetreu hatte mich kurz vor seiner Verlobung mit der Fernholmerin Narcheska Elliania gebeten, sein Mentor zu sein – nicht nur als Lehrer in Fragen der Gabe, sondern auch um ihn durch die wilden Wasser der Mannwerdung zu führen. Es mangelte mir nicht an Menschen, die sich um mich sorgten, und auch nicht an solchen, für die ich viel empfand; aber trotz alledem war ich einsamer denn je zuvor.
Das Seltsamste daran war jedoch die langsame Erkenntnis, dass ich diese Isolation selbst gewählt hatte.
Nachtauge war unersetzlich. In all den Jahren, die wir miteinander geteilt hatten, hatte er mich verändert. Er war nicht einfach nur ein Teil von mir, zusammen hatten wir erst ein Ganzes ergeben. Selbst als Harm in unser Leben getreten war, betrachteten wir ihn als unsere gemeinsame Verantwortung. Der Wolf und ich, es war unsere Einheit gewesen, die die Entscheidungen traf. Wir waren Partner. Nach Nachtauges Tod hatte ich das Gefühl, als könnte ich nie wieder eine solche Bindung zu einem anderen Lebewesen haben, sei es nun Mensch oder Tier.
Als ich noch ein Junge war und meine Zeit in Gesellschaft von Prinzessin Philia und Litzel verbrachte, habe ich oft gehört, wie sie offen die Männer bei Hofe begutachteten. Eine Grundannahme von Philia und Litzel war, dass jeder – sei er nun Mann oder Frau – , der bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr nicht verheiratet war, dies auch bleiben würde. »Der ist viel zu sehr in seiner Art verhaftet«, pflegte Philia zu erklären, wann immer ihr Gerüchte zu Ohren kamen, dass ein grau gewordener Fürst einem jungen Mädchen den Hof machte. »Der Frühling hat ihm den Kopf verdreht, aber sie wird schon bald genug herausfinden, dass es in seinem Leben keinen Platz für eine Partnerin gibt. Viel zu lange hat er sein eigenes Leben gelebt.«
Ich begann sehr, sehr langsam auch mich selbst so zu sehen. Oft war ich einsam. Ich wusste, dass ich nach einem neuen Gefährten hinausspürte. Doch dieses Gefühl und dieses Suchen waren mehr ein Reflex, das Jucken eines abgetrennten Glieds. Niemand, egal ob Mensch oder Tier, würde je die Lücke füllen, die Nachtauge in meinem Leben hinterlassen hatte.
Etwas Ähnliches habe ich auch zum Narren gesagt, bei einem unserer Gespräche auf dem Weg zurück nach Bocksburg. Es war in einer jener Nächte gewesen, da wir neben der Straße gelagert hatten, die uns nach Hause führen sollte. Ich hatte ihn am Feuer bei Prinz Pflichtgetreu und Laurel, der Jagdmeisterin der Königin, zurückgelassen. Sie hatten sich um das Feuer gekauert und das Beste aus der kalten Nacht und dem wenigen Essen gemacht. Der Prinz war verschlossen und verdrießlich gewesen; er litt noch immer unter dem Verlust seiner Geschwisterkatze. In seiner Nähe zu sein war für mich, als würde ich eine verbrannte Hand an eine Flamme halten: Mein eigener Schmerz wurde wieder in voller Stärke geweckt. Mit der Entschuldigung, Feuerholz sammeln zu wollen, war ich aufgestanden und davongegangen.
An jenem dunklen kalten Abend hatte der Winter sein Kommen angekündigt. Nicht eine einzige Farbe war in dieser trüben Welt noch übrig, und abseits des Feuerscheins tastete ich wie ein Maulwurf umher, während ich nach Holz suchte. Schließlich gab ich es auf, setzte mich auf einen Stein am Bachufer und wartete darauf, dass meine Augen sich an das Zwielicht gewöhnten. Doch während ich dort saß und die Kälte um mich herum spürte, verlor ich allen Ehrgeiz, Holz zu finden oder überhaupt etwas zu tun. Ich saß einfach nur da und starrte; ich lauschte auf das Geräusch des fließenden Wassers und ließ die Nacht mich mit ihrer Düsterkeit erfüllen.
Der Narr kam zu mir, bewegte sich leise durch die Dunkelheit. Er setzte sich auf die Erde neben mich, und eine Zeit lang schwiegen wir. Dann legte er mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Ich wünschte, es gäbe einen Weg, wie ich dich in deiner Trauer trösten könnte.«
Das waren sinnlose Worte gewesen, und es schien, als fühle er das auch, denn anschließend schwieg er. Vielleicht war es Nachtauges Geist, der mich für mein säuerliches Schweigen unserem Freund gegenüber tadelte, denn nach einiger Zeit suchte ich nach ein paar Worten, um die Dunkelheit zwischen uns zu überwinden. »Es ist wie mit der Wunde an deinem Kopf, Narr. Mit der Zeit wird sie sicherlich langsam heilen, doch alle Wünsche der Welt können den Prozess nicht beschleunigen. Selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Schmerz zu zerstreuen, irgendein Kraut oder Trunkenheit, die ihn betäuben, ich könnte sie nicht nutzen. Nichts wird seinen Tod vergessen machen. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, mich an die Einsamkeit zu gewöhnen.«
Trotz meiner Bemühungen klangen meine Worte wie ein Tadel. Schlimmer noch, sie schienen von Selbstmitleid durchsetzt zu sein. Es spricht sehr für meinen Freund, dass er sich davon nicht beleidigt fühlte. »Dann werde ich dich in Ruhe lassen. Ich denke, du hast dich entschieden, allein zu trauern, und wenn das deine Entscheidung ist, werde ich sie respektieren. Ich glaube zwar nicht, dass es eine besonders weise Wahl ist, aber nichtsdestoweniger werde ich sie respektieren.« Er hielt kurz inne und seufzte leise. »Ich habe inzwischen etwas über mich selbst erkannt: Ich bin gekommen, weil ich dich wissen lassen wollte, dass ich von deinem Schmerz weiß. Nicht weil ich dich davon heilen könnte, sondern weil du wissen sollst, dass ich ihn durch unsere Verbindung mit dir teile. Eine Last zu teilen kann sie nicht nur leichter machen, sie kann auch ein Band zwischen jenen knüpfen, die sie teilen, sodass niemand gezwungen ist, sie allein zu tragen.«
Ich fühlte, dass ein Körnchen Wahrheit in diesen Worten lag, etwas worüber ich nachdenken sollte, doch mir war zu elend, um danach zu greifen. »Ich werde gleich wieder zum Feuer zurückkehren«, sagte ich, und der Narr wusste, dass er entlassen war. Er nahm die Hand von meiner Schulter und ging davon.
Erst als ich später tatsächlich über seine Worte nachdachte, habe ich sie verstanden. In jenem Augenblick wählte ich das Alleinsein; das war keine unausweichliche Folge des Todes des Wolfs, ja noch nicht einmal eine sorgfältig überlegte Entscheidung. Ich umarmte meine Einsamkeit und hofierte meinen Schmerz. Es war nicht das erste Mal, dass ich diesen Kurs einschlug.
Ich ging äußerst vorsichtig mit diesem Gedanken um, denn er war scharf genug, um mich zu töten. Ich hatte die Jahre der Isolation mit Harm in meiner Hütte verbracht. Niemand hatte mich in dieses Exil gezwungen. Die Ironie war nur, dass dies die Erfüllung meines so oft geäußerten Wunsches gewesen war. Meine ganze Jugend hindurch hatte ich stets erklärt, mein größter Wunsch sei es, ein Leben zu führen, in dem ich meine eigene Wahl treffen konnte, losgelöst von den »Pflichten« meiner Geburt und meiner Position. Erst als das Schicksal mir diesen Wunsch erfüllte, erkannte ich den Preis dafür. Ich konnte meine Verantwortung anderen gegenüber beiseiteschieben und leben, wie ich wollte, wenn ich alle Verbindungen zu ihnen kappte. Beides zu behalten, Freiheit und Freunde, war unmöglich. Teil einer Familie zu sein oder einer Gemeinschaft bedeutet Pflicht und Verantwortung, man ist durch die Regeln dieser Gruppen gebunden. Ich hatte lange Zeit abseits aller Verpflichtungen gelebt, doch erst jetzt erkannte ich, dass das meine freie Wahl gewesen war. Ich hatte beschlossen, die Verantwortung für meine Familie abzugeben, und dafür mit Einsamkeit bezahlt. Damals hatte ich mir eingeredet, dass das Schicksal mich in diese Rolle gezwungen hatte. Genauso traf ich auch jetzt eine Entscheidung, auch wenn ich versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass dies der unausweichliche Weg des Schicksals sei.
Zu erkennen, dass man die Quelle seiner eigenen Einsamkeit ist, ist keine Heilung dafür; aber es war ein Schritt in die richtige Richtung zu verstehen, dass es nicht unausweichlich war und dass solch eine Entscheidung nicht unwiderruflich ist.
Kapitel 1
DIEGESCHECKTEN
Die Gescheckten haben stets behauptet, sie wollten nur frei von Verfolgung sein, wie sie seit Generationen in den Sechs Provinzen das Schicksal jener mit der Alten Macht war. Diese Behauptung kann man getrost als Lüge und kluge Täuschung bezeichnen. Die Gescheckten wollten Macht. Ihre Absicht war es, alle, die in den Sechs Provinzen über die Alte Macht verfügten, zu einer Einheit zu verschmelzen, die aufstehen und die Kontrolle über das Königtum übernehmen würde. Eine Facette dieser Verschwörung war die Behauptung, alle Könige seit der Abdankung von König Chivalric seien nur Prätendenten, und die Bastardabstammung Fitz-Chivalric Weitsehers sei lediglich konstruiert, um ihn davon abzuhalten, den Thron zu besteigen. Legenden vom »Treuherzigen Bastard«, der aus dem Grabe auferstanden sei, um König Veritas bei seiner Queste zu helfen, verbreiteten sich gegen den gesunden Menschenverstand, und man schrieb Fitz-Chivalric Kräfte zu, die den Bastard fast in den Status eines Gottes erhoben. Aus diesem Grund waren die Gescheckten auch als »Kult des Bastards« bekannt.
Diese lächerlichen Behauptungen sollten den Versuchen der Gescheckten, das Haus Weitseher zu stürzen und einen der ihren auf den Thron zu setzen, eine gewisse Legitimität verleihen. Zu diesem Zweck begannen die Gescheckten mit einer cleveren Kampagne: Sie drohten jenen mit der Alten Macht mit der Enthüllung ihres Geheimnisses, sollten sie sich nicht mit ihnen vereinen. Diese Taktik war vielleicht von Kebal Raubart inspiriert, dem Anführer der Fernholmer während des Kriegs der Roten Schiffe. Denn es heißt, dass er Männer nicht durch seine Ausstrahlung dazu bewogen habe, ihm zu folgen, sondern durch Furcht davor, was er ihrem Heim und ihren Familien antun würde, sollten sie sich seinen Plänen verweigern.
Die Vorgehensweise der Gescheckten war recht einfach: Entweder schlossen sich Familien mit dem Makel der Alten Macht ihnen an, oder aber sie wurden öffentlich angeklagt, was unweigerlich ihre Hinrichtung zur Folge hatte. Es heißt, die Gescheckten hätten heimtückische Angriffe gegen die Ränder einflussreicher Familien geführt. Erst stellten sie einen Diener oder einen weniger bedeutenden Vetter bloß, dann machten sie dem Oberhaupt des Hauses klar, dass die gesamte Familie dieses Schicksal erleiden würde, sollte sie sich nicht den Wünschen der Gescheckten beugen.
Dies waren nicht die Taten von Leuten, die der Verfolgung von ihresgleichen ein Ende machen wollten. Dies waren die Taten einer ruchlosen Gruppierung, die nach Macht für sich selbst gierte und dies erreichen wollte, indem sie zuerst ihresgleichen gefügig machte.
ROWELL: »DIEVERSCHWÖRUNGDERGESCHECKTEN«
Die Wache hatte gewechselt. Die Wachglocke und der Ruf klangen dünn durch den Sturm, aber ich hörte sie. Die Nacht war offiziell vorüber; es ging auf den Morgen zu, und ich saß noch immer in Jinnas Hütte und wartete auf Harms Rückkehr. Jinna und ich teilten uns die Annehmlichkeit ihres gemütlichen Kamins. Jinnas Nichte war vor einiger Zeit hereingekommen und hatte kurz mit uns geplaudert, bevor sie ins Bett gegangen war. Jinna und ich verbrachten die Zeit damit, Feuerholz nachzulegen und über belanglose Dinge zu plappern. Das kleine Haus der Krudhexe war warm und gemütlich, ihre Gesellschaft angenehm, und auf meinen Jungen zu warten war für mich die Entschuldigung zu tun, was ich wollte, nämlich einfach nur ruhig dazusitzen.
Jinna und ich hatten über die verschiedensten Dinge gesprochen. Sie hatte sich erkundigt, wohin meine Reise geführt hatte. Ich antwortete ihr, das sei die Angelegenheit meines Herrn, ich hätte ihn lediglich begleitet. Um nicht zu brüsk zu klingen, fügte ich hinzu, dass Fürst Leuenfarb auf der Reise ein paar Federn für seine Sammlung erworben hatte; dann sprach ich mit ihr über Meine Schwarze. Ich wusste, dass Jinna nicht wirklich daran interessiert war, etwas über mein Pferd zu hören, aber sie hörte freundlich zu. Die Worte füllten den Raum zwischen uns auf angenehme Art.
In Wahrheit hatte der Zweck unserer Reise nichts mit Federn zu tun gehabt. Es hatte sich eigentlich mehr um meine Angelegenheit gehandelt als um die von Fürst Leuenfarb. Gemeinsam hatten wir Prinz Pflichtgetreu vor den Gescheckten gerettet, die zuerst Freundschaft mit ihm geschlossen und ihn dann gefangen genommen hatten. Wir hatten ihn nach Bocksburg zurückgebracht, und keiner der Edelleute hatte Verdacht geschöpft. Heute Nacht feierte und tanzte der Adel der Sechs Provinzen, und morgen würde Prinz Pflichtgetreus Verlobung mit der fernholmischen Prinzessin Narcheska Elliania formell besiegelt werden. Nach außen hin war alles wie eh und je.
Nur wenige würden je erfahren, welchen Preis der Prinz und ich für den ungestörten Ablauf der höfischen Geschäfte gezahlt hatten. Die Geschwisterkatze des Prinzen hatte ihr Leben für ihn geopfert. Ich hatte meinen Wolf verloren. Fast zwanzig Jahre lang war Nachtauge mein anderes Ich gewesen, das Gefäß für einen Teil meiner Seele. Nun war er nicht mehr. Das stellte solch eine gründliche Veränderung für mein Leben dar wie das Löschen der Kerzen in einem dunklen Zimmer. Seine Abwesenheit wirkte wie ein festes Ding, eine Last, die mir zu meiner Trauer zusätzlich aufgebürdet wurde. Die Nächte waren dunkler. Niemand schützte meinen Rücken. Und doch wusste ich, dass ich weiterleben würde. Manchmal schien dieses Wissen der schlimmste Teil meines Verlustes zu sein.
Ich riss mich zusammen, bevor ich endgültig in Selbstmitleid versank. Schließlich war ich nicht der Einzige, der einen Verlust erlitten hatte. Obwohl die Bindung des Prinzen mit der Katze weit kürzer gewesen war, wusste ich, wie sehr er litt. Die magische Bindung, welche die Alte Macht zwischen einem Menschen und einem Tier herstellt, ist äußerst komplex. Sie zu durchtrennen ist nie belanglos. Doch der Junge hatte sein Leid gemeistert und erfüllte nun entschlossen seine Pflichten. Wenigstens musste ich mich morgen Abend nicht verloben.
Der Prinz war sofort wieder von seinen Pflichten eingeholt worden, kaum dass wir gestern Nachmittag in Bocksburg eingetroffen waren. So hatte er abends bereits wieder an den Zeremonien zum Empfang seiner zukünftigen Braut teilgenommen. Heute Abend musste er lächeln und essen, Konversation betreiben, gute Wünsche annehmen, tanzen und zu allem Zufriedenheit zeigen, was das Schicksal und seine Mutter ihm auferlegt hatten. Mitleidig schüttelte ich den Kopf.
»Und weshalb schüttelst du so den Kopf, Tom Dachsenbless?«
Jinnas Stimme riss mich aus meinen Gedanken, und ich erkannte, dass mein Schweigen wohl schon sehr lange gewährt hatte. Ich atmete tief durch und fand schnell eine Ausrede. »Es sieht nicht so aus, als ob der Sturm sich bald legen würde, nicht wahr? Ich habe Mitleid mit jenen, die heute Nacht da rausmüssen, und ich bin dankbar dafür, nicht zu ihnen zu gehören.«
»Nun. Was das betrifft, möchte ich sagen, dass ich wiederum dankbar für deine Gesellschaft bin«, sagte Jinna und lächelte.
»Ich ebenfalls«, erwiderte ich verlegen.
Die Nacht in der ruhigen, friedlichen Gesellschaft einer angenehmen Frau zu verbringen war eine neue Erfahrung für mich. Jinnas Kater lag schnurrend auf meinem Schoß, während sie mit Stricken beschäftigt war. Der gemütlich warme Feuerschein spiegelte sich auf Jinnas rötlich braunen Locken und den Sommersprossen auf ihrem Gesicht und den Unterarmen. Sie besaß ein angenehmes Gesicht, nicht schön, aber mit ruhigen und freundlichen Zügen. Wir hatten über alles Mögliche an diesem Abend gesprochen, von den Kräutern, aus denen sie ihren Tee aufbrühte, über Treibholz, das manchmal farbig brennt, bis hin zu uns selbst. Ich hatte herausgefunden, dass sie gut sechs Jahre jünger war, als ich in Wirklichkeit war, und sie hatte sich überrascht gezeigt, als ich ihr erklärte, ich sei zweiundvierzig. Das war sieben Jahre über meinem wahren Alter; die Extrajahre waren Teil meiner Rolle als Tom Dachsenbless. Es gefiel mir, als sie sagte, sie hätte mich für wesentlich jünger gehalten. Doch keiner von uns sprach wirklich aus, was er dachte und fühlte. Es herrschte eine interessante kleine Spannung zwischen uns, während wir vor dem Feuer saßen und leise miteinander sprachen. Die Neugier war wie ein Faden zwischen uns, so straff gespannt, dass er leise summte, wenn man daran zupfte.
Bevor ich zu meiner Reise mit Fürst Leuenfarb aufgebrochen war, hatte ich einen Nachmittag mit Jinna verbracht. Sie hatte mich geküsst. Kein Wort hatte diese Geste begleitet, keine Liebesschwüre und keine romantischen Komplimente. Da war nur dieser eine Kuss gewesen, den ihre Nichte unterbrochen hatte, als sie vom Markt zurückgekehrt war. Im Augenblick wusste keiner von uns beiden, wie wir zu jenem Ort zurückkehren sollten, an dem solch eine Intimität möglich gewesen war. Was mich betraf, so war ich nicht sicher, ob ich überhaupt noch einmal dorthin reisen wollte. Mein Herz war eine offene Wunde. Dennoch wollte ich hier sein und vor dem Kamin sitzen. Das klingt wie ein Widerspruch, und vielleicht war es das auch. Ich wollte die unvermeidlichen Komplikationen nicht, zu denen Zärtlichkeiten unweigerlich führen würden, doch in meiner Trauer fand ich Trost in der Gesellschaft dieser Frau.
Aber Jinna war nicht der Grund, warum ich heute Nacht hierhergekommen war. Ich musste Harm sehen, meinen Ziehsohn. Er war gerade erst in Burgstadt eingetroffen und wohnte bei Jinna. Ich wollte sichergehen, dass seine Lehre bei Gindast, dem Schreiner, gut verlief. Außerdem – und sosehr ich mich auch davor fürchtete – musste ich ihm die Nachricht von Nachtauges Tod überbringen. Der Wolf hatte einen genauso großen Anteil an der Erziehung des Jungen gehabt wie ich. Aber auch wenn ich schon bei dem Gedanken daran zusammenzuckte, es ihm mitteilen zu müssen, so hoffte ich doch, dass es mir, wie der Narr gesagt hatte, einen Teil meines Kummers von der Seele nehmen würde. Mit Harm konnte ich meine Trauer teilen, so selbstsüchtig das auch sein mochte. Harm hatte die vergangenen sieben Jahre zu mir gehört. Wir hatten ein Leben geteilt und die Freundschaft des Wolfs. Falls ich überhaupt noch zu irgendetwas oder irgendjemandem gehörte, dann zu meinem Jungen. Ich wollte unbedingt fühlen, dass diese Einschätzung auch der Wirklichkeit entsprach.
»Noch Tee?«, fragte mich Jinna.
Eigentlich wollte ich keinen Tee mehr. Wir hatten schon drei Kannen getrunken, und ich hatte ihren Abort bereits zweimal aufgesucht. Dennoch bot sie mir Tee an, um mich wissen zu lassen, dass ich stets willkommen war und bleiben konnte, solange ich wollte. Also sagte ich: »Ja, bitte«, und Jinna legte ihre Strickarbeit beiseite, um einen neuen Kessel mit Wasser über das Feuer zu hängen. Draußen hatte der Sturm wieder an Wut gewonnen und ließ die Fensterläden klappern. Dann war es Harm, der wild an die Tür klopfte. »Jinna?«, rief er. »Bist du noch wach?«
»Ich bin wach«, antwortete sie und drehte sich vom Kessel weg. »Und du kannst von Glück sagen, dass ich das noch bin, sonst müsstest du jetzt im Schuppen bei deinem Pony schlafen. Ich komme.«
Als sie den Riegel hob, stand ich auf und schob sanft den orangefarbenen Kater von meinem Schoß.
Schwachkopf. Dem Kater war bequem, beschwerte sich Finkel, als er sich zu Boden gleiten ließ, doch er war von der Wärme viel zu benommen, als dass er sich großartig hätte aufregen können. Stattdessen sprang er auf Jinnas Stuhl und rollte sich zusammen, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen.
Der Sturm kam mit Harm herein, als dieser die Tür aufschob. Eine Windbö wehte Regen in den Raum. »Hui. Schieb den Riegel wieder vor, Junge.« Jinna tadelte Harm, als er hereinschlurfte. Gehorsam schloss der Junge die Tür hinter sich, verriegelte sie und stand dann tropfend im Raum.
»Es ist wild und nass da draußen«, verkündete er. Sein Lächeln war das eines glücklich Betrunkenen, doch seine Augen leuchteten von mehr als nur vom Wein. Vernarrtheit war dort zu sehen, so unverkennbar wie der Regen, der ihm aus dem nassen Haar und übers Gesicht lief. Es dauerte einen Augenblick, bis er bemerkte, dass ich da war und ihn beobachtete. »Tom? Tom, du bist endlich zurückgekommen!« In trunkenem Überschwang breitete er die Arme aus, und ich lachte und ging auf ihn zu, um seine nasse Umarmung entgegenzunehmen.
»Verteil nicht überall Wasser auf Jinnas Boden!«, ermahnte ich ihn.
»Nein, das sollte ich nicht. Dann werde ich wohl erst mal die nassen Sachen ausziehen«, erklärte er und hängte seinen durchnässten Mantel zusammen mit seiner Wollkappe zum Trocknen an einen Haken neben der Tür. Anschließend versuchte er, sich die Stiefel im Stehen auszuziehen, verlor aber das Gleichgewicht. Also setzte er sich auf den Boden und zog sie sich dort aus. Er lehnte sich weit zurück, um sie neben die Tür unter seinen Mantel zu stellen; dann setzte er sich mit einem seligen Lächeln wieder auf. »Tom. Ich habe ein Mädchen kennengelernt.«
»Hast du? Deinem Geruch nach dachte ich eher, du hättest dich mit einer Flasche getroffen.«
»Oh, ja«, gab er unumwunden zu. »Das auch. Aber wir mussten auf das Wohl des Prinzen trinken, weißt du? Und auf das seiner Zukünftigen. Und auf eine glückliche Ehe. Und auf viele Kinder. Und auf viel Glück für uns selbst.« Er lächelte breit und albern. »Sie sagt, dass sie mich liebt. Sie mag meine Augen.«
»Nun. Das ist gut.« Wie oft in seinem Leben hatten Menschen seine unterschiedlichen Augen gesehen, eins braun, das andere blau, und hatten das Zeichen zum Schutz vor Bösem gemacht? Es musste Balsam für seine Seele sein, ein Mädchen gefunden zu haben, das sie anziehend fand.
Ich wusste plötzlich, dass dies nicht die rechte Zeit war, ihn mit meinem Kummer zu belasten. Ich sprach sanft, aber mit fester Stimme. »Ich glaube, du solltest jetzt vielleicht besser ins Bett gehen, Sohn. Erwartet dein Meister dich morgen nicht in aller Frühe?«
Harm blickte drein, als hätte ich ihn mit einem Fisch geschlagen. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. »Oh. Ja. Ja, das ist wahr. Er erwartet mich. Der alte Gindast erwartet von seinen Lehrlingen, dass sie noch vor den Gesellen da sind, und seine Gesellen sind schon lange bei der Arbeit, wenn er endlich erscheint.« Langsam rappelte er sich auf. »Tom, diese Lehre ist ganz und gar nicht, was ich erwartet habe. Ich putze, trage Bretter durch die Gegend und drehe das Holz um, das zum Trocknen ausgelegt ist. Ich schärfe Werkzeuge und putze Werkzeuge und öle Werkzeuge. Und dann putze ich wieder. Ich reibe Öl in die fertigen Stücke. Aber in all den Tagen habe ich nicht ein Werkzeug benutzen dürfen. Es heißt immer nur: ›Schau dir an, wie das gemacht wird, Junge‹, oder: ›Wiederhole, was ich dir gerade gesagt habe‹, und: ›Das ist nicht, wonach ich gefragt habe. Bring das ins Holzlager zurück und hol die fein gemaserte Kirsche. Und mach schnell.‹ Und Tom, sie geben mir böse Spitznamen. Landjunge und Dummkopf.«
»Gindast gibt all seinen Lehrjungen Spitznamen, Harm.« Jinnas gelassene Stimme war beruhigend und tröstend zugleich, aber ich empfand es trotzdem als seltsam, dass eine dritte Person unser Gespräch mit anhörte. »Das ist allgemein bekannt«, fuhr sie fort. »Einer von ihnen hat den Spitznamen sogar behalten, als er von ihm fortgegangen ist und sein eigenes Geschäft aufgemacht hat. Jetzt zahlt man gute Preise für einen Einfaltspinsel-Tisch.« Jinna war zu ihrem Stuhl zurückgekehrt. Sie hatte wieder zu stricken begonnen, sich aber nicht gesetzt. Der Stuhl gehörte noch immer dem Kater.
Ich versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr Harms Worte mich verzweifeln ließen. Ich hatte zu hören erwartet, wie sehr er seine Stellung liebte und wie dankbar er dafür war, dass ich sie für ihn aufgetrieben hatte. Ich hatte geglaubt, dass diese Lehre die eine Sache war, die richtig laufen würde. »Nun. Ich habe dich ja gewarnt, dass du hart würdest arbeiten müssen«, versuchte ich es.
»Darauf war ich auch vorbereitet. Tom, das war ich wirklich. Ich bin bereit, den ganzen Tag Holz zuzuschneiden und anzupassen, aber ich habe nicht erwartet, dass ich mich zu Tode langweilen würde. Putzen und fegen und Botengänge … Für das, was ich hier lerne, hätte ich genauso gut zu Hause bleiben können.«
Nur wenige Dinge besitzen eine solch scharfe Schneide wie die unbedachten Worte eines Jungen. Seine Verachtung für unser altes Leben, die er so offen aussprach, verschlug mir die Sprache.
Vorwurfsvoll blickte er mir in die Augen. »Und wo warst du, und warum warst du so lange weg? Hast du nicht gewusst, dass ich dich gebraucht habe?« Dann kniff er die Augen zusammen. »Was hast du mit deinem Haar gemacht?«
»Ich habe es abgeschnitten«, antwortete ich und strich mir über die aus Trauer kurz geschnittenen Locken. Plötzlich vertraute ich mir selbst nicht mehr genug, um noch mehr zu sagen. Er war nur ein Junge, das wusste ich, und als solcher neigte er dazu, alle Dinge erst einmal daraufhin zu betrachten, wie sie ihn selbst betrafen. Aber die Knappheit meiner Antwort rüttelte ihn wach und ließ ihn vermuten, dass ich vieles noch nicht gesagt hatte.
Sein Blick wanderte über mein Gesicht. »Was ist passiert?«, verlangte er zu wissen.
Ich atmete tief durch. Jetzt konnte ich nichts mehr verschweigen. »Nachtauge ist tot«, sagte ich leise.
»Aber … Ist das meine Schuld? Er ist mir weggelaufen, Tom, aber ich habe ihn gesucht, das schwöre ich, Jinna wird dir bestätigen …«
»Es war nicht deine Schuld. Er ist mir gefolgt und hat mich gefunden. Ich war bei ihm, als er gestorben ist. Es hatte nichts mit dem zu tun, was du getan hast, Harm. Er war einfach nur alt. Seine Zeit war gekommen, und er ist von mir gegangen.« Trotz aller Bemühungen, meine Trauer zu unterdrücken, zog sich mein Hals bei diesen Worten zusammen.
Die Erleichterung im Gesicht des Jungen darüber, dass er keine Schuld trug, versetzte meinem Herz einen weiteren Stich. War schuldlos zu sein wichtiger für ihn als der Tod des Wolfs? Doch als er sagte: »Ich kann einfach nicht glauben, dass er weg ist«, verstand ich ihn plötzlich. Er sprach die unverhohlene Wahrheit. Es würde einen Tag dauern, vielleicht auch mehrere, bis er wirklich begriff, dass der alte Wolf nie wieder zurückkehren würde. Nachtauge würde sich nie wieder neben ihn vor den Kamin legen, ihn nie wieder an die Hand stupsen, um hinter den Ohren gekrault zu werden, und nie wieder mit ihm auf Hasenjagd gehen. Mir traten Tränen in die Augen.
»Du wirst schon damit zurechtkommen. Es braucht nur seine Zeit«, versicherte ich ihm mit belegter Stimme.
»Lass uns das hoffen«, erwiderte er in schwerem Tonfall.
»Geh ins Bett. Du kannst immer noch eine Stunde schlafen, bevor du wieder aufstehen musst.«
»Ja«, stimmte er mir zu. »Ich nehme an, das wäre besser.« Dann trat er einen Schritt auf mich zu. »Tom. Es tut mir so leid«, sagte er, und seine unbeholfene Umarmung linderte viel von dem Schmerz, den er mir zuvor zugefügt hatte. Dann blickte er mir in die Augen und fragte ernst: »Du wirst doch morgen Abend vorbeikommen, oder? Ich muss mit dir reden. Es ist sehr wichtig.«
»Ich werde vorbeikommen – falls es Jinna nichts ausmacht.« Ich blickte zu ihr hinüber, als ich mich aus der Umarmung des Jungen löste.
»Jinna macht das ganz und gar nichts aus«, versicherte sie mir, und ich glaubte, einen besonders warmen Unterton in ihrer Stimme zu hören.
»Nun denn. Dann sehe ich dich also abends, wenn du wieder nüchtern bist. Aber jetzt ins Bett mit dir, Junge.« Ich zerzauste ihm das nasse Haar, und er murmelte Gute Nacht. Dann verließ er den Raum in Richtung seiner Kammer, und ich war plötzlich wieder allein mit Jinna. Ein Holzscheit brach im Feuer zusammen, und sein Knistern war das einzige Geräusch im Raum. »Wohlan. Ich muss gehen. Ich danke dir, dass ich hier bei dir auf Harm warten durfte.«
Jinna legte ihre Strickarbeit beiseite. »Du bist hier immer willkommen, Tom Dachsenbless.«
Mein Mantel hing an einem Haken neben der Tür. Ich nahm ihn herunter, schlang ihn um meine Schultern und sah zu, wie Jinna ihn für mich schloss. Dann zog sie die Kapuze über meinen geschorenen Kopf und lächelte, als sie mein Gesicht zu ihrem zog. »Gute Nacht«, sagte sie atemlos. Sie hob das Kinn. Ich legte die Hände auf ihre Schultern und küsste sie. Ich wollte es und wunderte mich gleichzeitig doch darüber, dass ich mich auf diese Versuchung einließ: Wozu sollte dieser Austausch von Küssen führen, wenn nicht zu Komplikationen und Ärger?
Fühlte sie meine Zurückhaltung? Als ich meinen Mund von ihrem nahm, schüttelte sie sanft den Kopf. »Du machst dir zu viele Gedanken, Tom Dachsenbless.« Sie hob meine Hand an ihren Mund und gab mir einen warmen Kuss auf den Handteller. »Einige Dinge sind weit weniger kompliziert, als du sie dir vorstellst.«
Ich war verlegen, aber es gelang mir zu sagen: »Wenn das stimmt, wäre das wirklich schön.«
»Eine Zunge wie ein Höfling.« Ihre Worte wärmten mich, bis sie hinzufügte: »Aber schöne Worte werden Harm nicht davon abhalten, auf Grund zu laufen. Du wirst den jungen Mann bald mit fester Hand führen müssen. Harm muss seine Grenzen aufgezeigt bekommen, oder du wirst ihn an Burgstadt verlieren. Er wäre nicht der erste gute Junge vom Land, der in der Stadt vom rechten Weg abkommt.«
»Ich glaube, ich kenne meinen eigenen Sohn«, erwiderte ich ein wenig gereizt.
»Vielleicht kennst du das Kind. Es ist aber der junge Mann, um den ich Angst habe.« Dann wagte sie ob meines mürrischen Gesichts zu lachen und fügte hinzu: »Spar dir diesen Gesichtsausdruck für Harm. Gute Nacht, Tom. Ich sehe dich dann morgen.«
»Gute Nacht, Jinna.«
Sie ließ mich hinaus und wartete kurz in der Tür, um mir hinterherzusehen. Ich blieb stehen, blickte mich noch einmal um, und wir winkten uns zu, bevor sie die Tür wieder schloss. Dann seufzte ich und zog den Mantel enger um die Schultern. Der schlimmste Regen war vorüber, und der Sturm beschränkte sich auf Windböen, die allerdings hinter jeder Straßenecke zu lauern schienen. Er hatte seinen Spaß mit dem Festschmuck der Stadt gehabt. Die Böen wehten heruntergefallene Girlanden über die Straße und rissen Banner in Stücke. Für gewöhnlich hatten Tavernen Fackeln vor der Tür, um Kunden anzulocken, doch um diese Zeit waren sie entweder heruntergebrannt oder hereingeholt worden. Die meisten Tavernen und Gasthöfe hatten ihre Tore für die Nacht geschlossen. Alle ordentlichen Leute waren ohnehin schon lange im Bett, und alle nicht ganz so ordentlichen inzwischen auch. Ich eilte durch die kalten, dunklen Straßen und ließ mich dabei mehr von meinem Richtungssinn denn von meinen Augen leiten. Es würde sogar noch dunkler werden, sobald ich die Klippenseite der Stadt hinter mir gelassen hatte und den langen, gewundenen Aufstieg zur Bocksburg begann, aber das war eine Straße, die ich seit meiner Kindheit kannte. Meine Füße würden mich automatisch nach Hause führen.
Ich bemerkte die Männer, die mir folgten, als ich die letzten Häuser von Burgstadt hinter mir gelassen hatte. Ich wusste, dass sie mich verfolgten und nicht schlicht Leute waren, die zufällig den gleichen Weg hatten, denn wenn ich langsamer wurde, wurden auch sie langsamer. Offensichtlich wollten sie mich nicht einholen, bevor die letzten Häuser nicht hinter mir lagen. Das ließ auf keine guten Absichten schließen. Ich hatte die Burg unbewaffnet verlassen; meine ländlichen Gewohnheiten hatten mich dazu verführt. Nur das Messer hatte ich bei mir, das jeder Mann für tägliche Aufgaben im Gürtel trägt. Mein hässliches Arbeitsschwert in seiner zerschlissenen Scheide hing an der Wand meiner kleinen Kammer. Ich sagte mir, dass die Männer vermutlich nur einfache Straßenräuber waren, die nach leichter Beute suchten. Ohne Zweifel hielten sie mich für betrunken und glaubten, ich hätte sie nicht gesehen. Sobald ich Widerstand leistete, würden sie sicherlich fliehen.
Das war jedoch nur ein schwacher Trost. Ich verspürte nicht den geringsten Wunsch zu kämpfen. Ich war des Kämpfens müde, und ich war es leid, vorsichtig zu sein. Ich bezweifelte allerdings, dass die Männer das kümmerte. Also blieb ich stehen, wo ich war, drehte mich auf der dunklen Straße um, und stellte mich meinen Verfolgern. Ich zog mein Messer, nahm eine ausbalancierte Haltung ein und wartete.
Hinter mir war alles still mit Ausnahme des seufzenden Windes in den Bäumen, die die Straße säumten. Irgendwann hörte ich dann auch die Brandung an den Klippen in der Ferne. Ich lauschte auf jedes Geräusch von Männern, die sich durchs Unterholz bewegten, oder auf Schritte auf der Straße, doch ich hörte nichts dergleichen. Ich wurde ungeduldig. »Kommt schon!«, brüllte ich in die Nacht hinein. »Ich habe nur wenig, was ihr mir nehmen könntet, außer meinem Messer, und das werdet ihr mit der Klinge zuerst bekommen. Lasst es uns zu Ende bringen!«
Schweigen folgte meinen Worten, und meine Schreie in der Nacht wirkten plötzlich albern. Doch als ich gerade zu glauben begann, dass ich mir meine Verfolger nur eingebildet hatte, rannte irgendwas über meinen Fuß. Es war ein kleines Tier, schlank und schnell, eine Ratte, ein Wiesel oder vielleicht ein Eichhörnchen. Aber es war kein wildes, scheues Tier, denn es schnappte im Vorbeilaufen nach meinem Bein. Das machte mich nervös, und ich sprang einen Schritt zurück. Zu meiner Rechten hörte ich ein ersticktes Lachen. Im selben Augenblick, als ich mich in die entsprechende Richtung umdrehte und versuchte, etwas zu erkennen, hörte ich plötzlich die Stimme von jemandem ganz in meiner Nähe.
»Wo ist dein Wolf, Tom Dachsenbless?«
Sowohl Spott als auch Herausforderung lagen in diesen Worten. Hinter mir hörte ich Krallen im Kies: ein größeres Tier, vielleicht ein Hund, aber als ich herumwirbelte, war die Kreatur bereits wieder in der Dunkelheit verschwunden. Als das Lachen erneut ertönte, drehte ich mich wieder um. Mindestens drei Männer, sagte ich mir selbst, und zwei Geschwistertiere. Ich versuchte, nur an die Umstände des bevorstehenden Kampfes zu denken und an nichts anderes. Was diese Begegnung zu bedeuten hatte, darüber würde ich später nachdenken. Ich atmete tief und langsam und wartete auf sie. Ich öffnete meine Sinne für die Nacht und unterdrückte die Sehnsucht nach Nachtauges schärferer Wahrnehmung und dem beruhigenden Gefühl, ihn im Rücken zu wissen. Dieses Mal hörte ich das Huschen des kleinen Wesens, als es näher kam. Ich trat danach, wilder, als ich beabsichtigt hatte, aber ich streifte es nur, dann war es wieder verschwunden.
»Ich werde es töten!«, rief ich in die Nacht, doch nur spöttisches Lachen folgte auf meine Drohung. Dann schämte ich mich für meine Wut. »Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Frieden!«
Der Wind trug die Echos dieser kindischen Frage zu mir herüber. Die schreckliche Stille, die darauf folgte, war der Schatten meiner Einsamkeit.
»Wo ist dein Wolf, Tom Dachsenbless?«, rief eine Stimme, und diesmal war es die einer Frau, melodisch und mit einem lachenden Unterton. »Vermisst du ihn, Abtrünniger?«
Die Furcht, die durch mein Blut geströmt war, wandelte sich plötzlich in eisigen Zorn. Ich würde hier stehen bleiben, und ich würde sie alle töten und ihre Eingeweide auf der Straße dampfen lassen. Meine Faust, die sich um das Messer verkrampft hatte, löste sich plötzlich wieder, und eine entspannte Bereitschaft ergriff von mir Besitz. In Kampfhaltung wartete ich auf sie. Der Angriff würde als plötzlicher Sturm aus allen Richtungen kommen; die Tiere würden mich tief angreifen und die Menschen mit ihren Waffen oben. Ich hatte nur das Messer. Ich würde warten müssen, bis sie nahe genug herangekommen waren. An Flucht war nicht zu denken: Wenn ich wegrannte, würden sie mich von hinten packen. Es war besser zu warten. Sie sollten zu mir kommen, dann würde ich sie alle töten, jeden Einzelnen.
Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich dort gestanden habe. Wenn man für etwas bereit ist und gespannt wartet, steht die Zeit entweder still, oder sie vergeht wie im Flug. Ich hörte einen Morgenvogel rufen und dann noch einen, der ihm antwortete, und ich wartete noch immer. Als die ersten Lichtstrahlen am Nachthimmel erschienen, atmete ich tief durch. Ich blickte mich ausgiebig um, spähte zwischen die Bäume, sah aber nichts. Die einzige Bewegung war die eines Schwarms kleiner Vögel, die durch die Äste huschten, und die silbernen Regentropfen, die sie von den Blättern schüttelten. Meine Verfolger waren verschwunden. Das kleine Tier, das nach mir geschnappt hatte, hatte keinerlei Spuren seines Auftauchens auf der nassen Straße hinterlassen, und von dem größeren Tier, das hinter mir gewesen war, war nur ein einziger Abdruck am Straßenrand zu sehen. Es war ein kleiner Hund. Und das war alles.
Ich drehte mich um und machte mich wieder auf den Weg zur Burg hinauf. Während ich ging, begann ich zu zittern. Nicht aus Angst, sondern weil die Spannung von mir abfiel und Wut sie ersetzte.
Was hatten sie von mir gewollt? Wollten sie mir Angst einjagen? Wollten sie mich von ihrer Anwesenheit in Kenntnis setzen und mir zu verstehen geben, dass sie wussten, was ich war und wo ich lebte? Nun, das hatten sie getan und noch weit mehr. Ich brachte meine Gedanken wieder in Ordnung und versuchte kühl abzuschätzen, welche Bedrohung sie darstellten. Meine Gedanken und Sorgen kreisten dabei nicht nur um mich selbst: Wussten sie von Jinna? Waren sie mir von ihrer Tür aus gefolgt, und falls ja, wussten sie auch über meinen Jungen Bescheid?
Ich fluchte über meine eigene Dummheit und Sorglosigkeit. Wie hatte ich mir jemals einbilden können, dass die Gescheckten mich in Frieden lassen würden? Sie wussten, dass Fürst Leuenfarb aus Bocksburg stammte und dass sein Diener Tom Dachsenbless über die Alte Macht gebot. Sie wussten auch, dass Tom Dachsenbless Lutwin den Arm abgeschlagen und ihnen ihre königliche Geisel geraubt hatte. Ohne Zweifel sannen die Gescheckten auf Rache. Und die konnten sie schnell und einfach haben, indem sie eine ihrer feigen Schriftrollen verbreiteten und mich als jemanden mit der Alten Macht denunzierten. Dafür würde man mich hängen, vierteilen und verbrennen. Hatte ich geglaubt, dass ich in Burgstadt sicher vor ihnen sein würde?
Ich hätte wissen müssen, dass dies geschehen würde. Nachdem ich mich einmal mehr auf Bocksburgs Hofpolitik eingelassen hatte, hätte mir klar sein müssen, dass ich für jedwede Intrige anfällig war, die damit einherging. Ich hatte gewusst, dass das geschehen würde, räumte ich bitter ein. Und für fast fünfzehn Jahre hatte mich dieses Wissen von Bocksburg ferngehalten. Nur Chade und seine Bitte um Hilfe bei der Suche nach Prinz Pflichtgetreu hatten mich zurückgelockt. Nun hatte mich die kalte Wirklichkeit wieder. Mir standen nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder musste ich all meine Bindungen kappen und fliehen, wie ich es schon einmal getan hatte, oder ich musste mich voll und ganz in die Intrigen stürzen, die schon immer Teil des Weitseher-Hofs von Bocksburg gewesen waren. Wenn ich blieb, musste ich wieder wie ein Assassine denken, der sich stets der Risiken und Bedrohungen für sein eigenes Leben bewusst ist. Meine Taten konnten aber auch die Menschen, die mir lieb waren, in Gefahr bringen.
Ich suchte in Gedanken nach dem richtigen Weg, als ich die Wahrheit erkannte. Ich musste wirklich wieder ein Assassine sein, nicht nur wie einer denken. Wenn ich Menschen begegnete, die meinen Prinzen oder mich bedrohten, musste ich bereit sein zu töten. Die Verbindung war nämlich nicht zu leugnen: Jene, die gekommen waren, Tom Dachsenbless ob der Alten Macht und des Todes seines Wolfs zu reizen, waren Menschen, die ganz genau wussten, dass auch Prinz Pflichtgetreu über die verabscheuungswürdige Tiermagie verfügte. Das war ihre Möglichkeit, auf den Prinzen Einfluss zu nehmen. Sie würden ihr Druckmittel nicht nur dazu benutzen, die Verfolgung jener mit der Alten Macht zu beenden, sondern auch, um Macht für sich persönlich zu gewinnen. Die Konfrontation mit ihnen wurde nicht leichter dadurch, dass ich teilweise mit ihnen sympathisierte. Auch in meinem Leben hatte ich unter dem Makel der Alten Macht gelitten. Ich verspürte nicht den Wunsch, irgendjemand anderen mit dieser Last zu sehen. Hätten sie nicht solch eine Bedrohung für meinen Prinzen dargestellt, ich hätte mich ihnen vielleicht sogar angeschlossen.
Meine wütenden Schritte trugen mich bis zum Wachhaus an den Toren von Bocksburg. Als ich mich ihm näherte, hörte ich aus dem Inneren Männerstimmen und das Klappern von Geschirr. Einer der Wachsoldaten, ein Junge von ungefähr zwanzig, räkelte sich auf einem Stuhl an der Tür, Käse in der einen Hand und einen Krug Morgenbier in der anderen. Er blickte zu mir hinauf und bedeutete mir mit vollem Mund, ich könne passieren. Ich blieb stehen; Zorn strömte wie Gift durch meine Adern.
»Weißt du, wer ich bin?«, verlangte ich von dem Jungen zu wissen.
Er zuckte unwillkürlich zusammen und betrachtete mich dann genauer. Offensichtlich hatte er Angst, einen niederen Adligen beleidigt zu haben, doch ein Blick auf meine Kleidung beruhigte ihn.
»Du bist ein Diener in der Burg. Stimmt’s?«
»Wessen Diener?«, hakte ich nach. Es war dumm, derart die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, doch ich konnte die Worte einfach nicht aufhalten. Waren andere vergangene Nacht auf diesem Weg gekommen, und befanden sie sich noch in der Burg? Hatte ein sorgloser Wächter Leute hineingelassen, die den Prinzen zu töten beabsichtigten? Alles schien im Augenblick möglich zu sein.
»Nun … ich weiß es nicht!«, platzte der Junge heraus. Er richtete sich auf, musste aber noch immer zu mir aufschauen, um mir in die Augen zu sehen. »Woher soll ich das denn wissen? Und was kümmert es mich überhaupt?«
»Weil du den Haupteingang zur Bocksburg bewachst, du verdammter Narr. Deine Königin und dein Prinz verlassen sich auf deine Wachsamkeit. Du sollst ihre Feinde davon abhalten, einfach hineinzuspazieren. Deshalb bist du hier. Habe ich nicht recht?«
»Nun, ich …« Wütend und frustriert schüttelte der Junge den Kopf, dann drehte er sich plötzlich zum Wachhaus um. »Kespin! Kannst du mal rauskommen?«
Kespin war größer und älter als der Junge. Er bewegte sich wie ein Schwertkämpfer, und die Augen über dem verfilzten Bart blickten scharf. Er versuchte einzuschätzen, ob ich eine Bedrohung darstellte. »Was ist hier das Problem?«, fragte er uns beide. Sein Tonfall war keine Warnung, sondern eine Versicherung, dass er auch mit uns beiden zugleich fertigwerden konnte, sollten wir Schwierigkeiten machen.
Der Wachsoldat deutete mit dem Bierkrug auf mich. »Er ist wütend, weil ich nicht weiß, wessen Diener er ist.«
»Was?«
»Ich bin Fürst Leuenfarbs Diener«, stellte ich klar. »Und es bereitet mir Sorgen, dass die Wachen an diesem Tor offenbar nichts anderes tun, als zuzusehen, wie Leute hinein- und hinausgehen. Ich gehe nun schon seit vierzehn Tagen in Bocksburg ein und aus, und ich bin nicht ein Mal angesprochen worden. Das kommt mir nicht richtig vor. Als ich vor gut zwanzig Jahren hier war, haben die Wachen ihre Aufgabe ernst genommen. Es gab eine Zeit, da …«
»Es gab eine Zeit, da das nötig war«, unterbrach mich Kespin. »Während des Kriegs der Roten Schiffe. Aber jetzt leben wir in Frieden, Mann, und Burg und Stadt sind voller Fernholmer und Edelleute aus anderen Provinzen, die uns zur Verlobung des Prinzen besuchen. Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir sie alle kennen.«
Ich schluckte und wünschte, ich hätte den Streit nicht begonnen, doch ich war entschlossen, jetzt nicht klein beizugeben. »Es bedarf nur eines Fehlers, und das Leben des Prinzen schwebt in Gefahr.«
»Oder eines Fehlers und ein fernholmischer Edelmann ist beleidigt. Ich erhalte meine Befehle direkt von Königin Kettricken, und sie sagt, wir sollen jeden willkommen heißen und gastfreundlich sein, nicht misstrauisch und unhöflich. Allerdings wäre ich bereit, für dich eine Ausnahme zu machen.« Sein Grinsen nahm seinen Worten etwas von ihrer Schärfe, dennoch war klar, dass es ihm nicht gefiel, wie ich sein Urteil infrage stellte.
Ich nickte ihm zu. Ich war die Sache vollkommen falsch angegangen. Vielleicht sollte ich besser mit Chade darüber sprechen und zusehen, ob er die Wachen ein wenig aufmerksamer machen könnte. »Ich verstehe«, lenkte ich ein. »Nun. Ich habe mich nur gewundert …«
»Wenn du das nächste Mal auf dieser großen schwarzen Stute hier rausreitest, erinnere dich daran, dass ein Mann nicht viel sagen muss, um viel zu wissen. Und wo du mich schon zum Denken gebracht hast … Wie lautet dein Name?«
»Tom Dachsenbless. Diener von Fürst Leuenfarb.«
»Ah. Sein Diener.« Er lächelte wissend. »Und sein Leibwächter, richtig? Ja, ich habe eine Geschichte darüber gehört. Und das ist nicht alles, was ich über ihn gehört habe. Du bist nicht gerade das, was ich in seinem Umfeld erwartet hätte.« Er blickte mich seltsam an, als erwartete er, dass ich etwas darauf erwidern würde, doch ich hielt meine Zunge im Zaum; ich wusste genau, worauf er hinauswollte. Nach einem Augenblick zuckte er mit den Schultern. »Nun denn. Ein Fremder, der glaubt, seine eigene Wache zu brauchen, während er in Bocksburg lebt … Mach, dass du weiterkommst, Tom Dachsenbless. Wir kennen dich jetzt, und ich hoffe, das lässt dich nachts besser schlafen.«
Sie ließen mich in die Burg hinein, und ich kam mir dumm vor und fühlte mich unzufrieden. Ich musste mit Kettricken sprechen und sie davon überzeugen, dass die Gescheckten eine echte Gefahr für Pflichtgetreu darstellten. Doch ich bezweifelte, dass meine Königin in den kommenden Tagen auch nur einen Augenblick Zeit für mich haben würde. Die Verlobungszeremonie fand heute Abend statt. Ihre Gedanken waren sicherlich voll von den Verhandlungen mit den Äußeren Inseln.
In der Küche herrschte reger Betrieb. Zofen und Pagen bereiteten ganze Reihen von Teekesseln und Haferbreiterrinen vor. Die Gerüche weckten meinen Hunger. Ich hielt inne, um ein Frühstückstablett für Fürst Leuenfarb vollzuladen. Auf einem Teller stapelte ich Räucherschinken und frische Brötchen sowie einen Topf mit Butter und Erdbeermarmelade. Es gab einen Korb mit Birnen, und ich suchte mir ein paar besonders feste aus. Als ich die Küche verließ, begrüßte mich eine Gartendienerin mit einem Tablett voll Blumen auf dem Arm. »Bist du nicht Fürst Leuenfarbs Mann?«, fragte sie, und auf mein Nicken hin winkte sie mir, stehen zu bleiben, damit sie meinem Tablett ein Gebinde frisch geschnittener Blüten und einen kleinen Strauß weißer Blumen hinzufügen konnte. »Für Seine Gnaden«, sagte sie mir unnötigerweise und machte sich dann wieder auf den Weg.
Ich stieg die Treppe zu Fürst Leuenfarbs Gemächern hinauf, klopfte und trat ein. Die Tür zu seinem Schlafgemach war geschlossen, doch bevor ich das Frühstück anrichten konnte, kam er angekleidet heraus. Sein schimmerndes Haar war zurückgekämmt und im Nacken mit einer blauen Schleife zusammengebunden. Er hatte sich eine blaue Jacke über den Arm gelegt. Dazu trug er ein weißes Seidenhemd, das vorn mit Spitzen verziert war, und eine eng anliegende blaue Hose, einen Farbton dunkler als die Jacke. Mit seinem goldenen Haar und den bernsteinfarbenen Augen erinnerte das Gesamtbild an den Sommerhimmel. Er lächelte mich warm an. »Schön zu sehen, dass du erkannt hast, dass frühes Aufstehen zu deinen Pflichten gehört, Tom Dachsenbless. Wenn doch nur auch dein Geschmack in Sachen Kleidung ebenso erwachen würde.«
Ich verneigte mich ernst vor ihm und zog einen Stuhl zurück. Sanft und gelassen sprach ich mit ihm in einem Tonfall, der eher an einen Freund als an einen Diener gemahnte. »Um die Wahrheit zu sagen, war ich gar nicht im Bett. Harm ist erst am frühen Morgen gekommen. Auf dem Heimweg bin ich auf ein paar Gescheckte gestoßen, die mich ein wenig länger aufgehalten haben.«
Das Lächeln verschwand von seinem Gesicht. Er setzte sich nicht, sondern ergriff mein Handgelenk. »Bist du verletzt?«, fragte er besorgt.
»Nein«, versicherte ich ihm und winkte ihn an den Tisch. Widerwillig setzte er sich hin. Ich trat auf die andere Seite des Tisches und richtete das Frühstück für ihn an. »Das war nicht ihre Absicht. Sie wollten mich nur wissen lassen, dass sie meinen Namen kennen und wissen, wo ich mich aufhalte. Sie wissen auch, dass ich zu den Zwiehaften gehöre und dass mein Wolf tot ist.« Die letzten Worte musste ich mir förmlich abringen. Es war, als könnte ich mit dieser Wahrheit leben, solange ich sie nicht laut aussprach. Ich hustete, griff rasch nach den Schnittblumen und murmelte: »Die stelle ich neben das Bett.«
»Danke«, erwiderte er mit ebenso gedämpfter Stimme wie ich.
In seinem Schlafgemach fand ich eine Vase. Offensichtlich war selbst das Gartenmädchen mit Fürst Leuenfarbs Vorlieben vertrauter als ich. Ich füllte die Vase mit Wasser aus dem Waschkrug und stellte die Blumen auf einen kleinen Tisch neben seinem Bett. Als ich wieder zurückkehrte, hatte er seine Jacke angezogen und einen kleinen Strauß weißer Blüten ins Knopfloch gesteckt.
»Ich muss so schnell wie möglich mit Chade sprechen«, sagte ich, während ich ihm Tee einschenkte. »Aber ich kann wohl kaum einfach an seine Tür hämmern.«
Fürst Leuenfarb hob die Tasse und nippte am Tee. »Hast du nicht über die Geheimgänge Zugang zu seinen Gemächern?«
Ich blickte ihn an. »Du kennst den alten Fuchs. Seine Geheimnisse gehören ihm allein, und er wird nicht riskieren, dass irgendjemand ihn in einem unbedachten Augenblick ausspioniert. Er muss Zugang zu den Gängen haben, aber ich weiß nicht, wie. War er vergangene Nacht lang auf?«
Fürst Leuenfarb zuckte zusammen. »Er hat noch immer getanzt, als ich beschlossen habe, mein Bett aufzusuchen. Für einen alten Mann besitzt er eine beachtenswerte Energie, wenn er erst einmal beschlossen hat, sich zu amüsieren. Aber ich werde einen Pagen mit einer Nachricht zu ihm schicken. Ich werde ihn einladen, heute Nachmittag mit mir auszureiten. Ist das früh genug?« Er hatte die Besorgnis in meiner Stimme bemerkt und stellte keine Fragen. Dafür war ich ihm dankbar.
»Es wird schon gehen«, versicherte ich ihm. »Vermutlich wird er vorher ohnehin noch keinen klaren Kopf haben.« Ich schüttelte den Kopf, als könne ich so wieder Ruhe in meine Gedanken bringen. »Plötzlich gibt es so viel, worüber ich nachdenken muss, so viel, worüber ich mir Sorgen mache. Wenn diese Gescheckten über mich Bescheid wissen, dann wissen sie auch vom Prinzen.«
»Hast du irgendjemanden von ihnen erkannt? Gehörten sie zu Lutwins Bande?«
»Es war dunkel, und sie sind nicht nahe genug an mich herangekommen. Ich habe die Stimmen einer Frau und eines Mannes gehört, aber ich bin sicher, dass es mindestens drei waren. Einer war mit einem Hund verschwistert, ein anderer mit einem kleinen, schnellen Säugetier, einer Ratte oder einem Wiesel vielleicht.« Ich atmete tief durch. »Ich möchte, dass die Wachen am Burgtor in Alarmbereitschaft versetzt werden. Und der Prinz sollte ständig von irgendjemandem begleitet werden. ›Ein Tutor von der muskulösen Sorte‹, wie Chade selbst vorgeschlagen hat. Ich muss Abmachungen mit Chade treffen, wie ich ihn möglichst schnell erreichen kann, sollte ich seine Hilfe oder seinen Rat benötigen. Und man sollte ständig in der Burg nach Ratten suchen, besonders in den Gemächern des Prinzen.«
Fürst Leuenfarb holte Luft, um zu sprechen, schluckte seine Frage aber lieber hinunter. Stattdessen sagte er: »Ich fürchte, ich habe noch etwas, worüber du nachdenken musst. Prinz Pflichtgetreu hat mir gestern einen Brief zugesteckt, in dem er zu wissen verlangt, wann du mit seinem Gabenunterricht zu beginnen gedenkst.«
»Das hat er niedergeschrieben?«
Auf Fürst Leuenfarbs zögerliches Nicken hin war ich entsetzt. Mir war durchaus klar gewesen, dass der Prinz mich vermisste. Da wir durch die Gabe miteinander verbunden waren, mussten mir solche Dinge bewusst sein. Ich hatte meine Gabenmauer errichtet, um meine Gedanken für mich zu behalten, aber so gewandt war der Prinz ohnehin noch nicht. Mehrere Male hatte ich seine schwachen Versuche gefühlt, mich zu erreichen, aber ich hatte sie ignoriert und mir immer wieder gesagt, es würde sich eine bessere Gelegenheit dafür ergeben. Mein Prinz war offensichtlich nicht so geduldig. »Oh, dem Jungen muss man Vorsicht beibringen. Manche Dinge sollte man niemals zu Papier bringen, und diese …«
Plötzlich versagte mir die Stimme. Ich musste blass geworden sein, denn Fürst Leuenfarb stand sofort auf und wurde mein Freund der Narr, als er mir seinen Stuhl anbot. »Alles in Ordnung, Fitz? Droht ein Anfall?«
Ich ließ mich auf den Stuhl fallen. Mein Kopf drehte sich, während ich über das ganze Ausmaß meiner Torheit grübelte. Ich bekam kaum genug Luft, um meine Dummheit einzugestehen. »Narr. All meine Schriftrollen, alles, was ich geschrieben habe. Ich bin Chades Ruf so schnell gefolgt, dass ich sie in meiner Hütte zurückgelassen habe. Ich habe Harm gesagt, er solle die Tür verriegeln, bevor er nach Burgstadt kommt, aber er wird wohl kaum meine Aufzeichnungen versteckt haben. Wenn die Gescheckten klug genug sind, mich mit Harm in Verbindung zu bringen …«
Mehr musste ich dem Narren nicht sagen. Seine Augen waren weit aufgerissen. Er hatte alles gelesen, was ich so tollkühn dem Papier anvertraut hatte. Nicht nur meine wahre Identität war dort festgehalten, sondern auch Weitseher-Angelegenheit, die besser für immer in Vergessenheit geraten wären. Auch meine persönlichen Schwächen standen in den verfluchten Schriftrollen: Molly, meine verlorene Liebe, und Nessel, meine Bastardtochter. Wie hatte ich nur so dumm sein können, solche Gedanken zu Papier zu bringen? Wie hatte ich zulassen können, dass der vermeintliche Trost, den mir das Schreiben bot, mich zu solch einer Torheit verleitete? Kein Geheimnis war sicher, solange es nicht im Geist eines Menschen weggesperrt war. Ich hätte die Schriftrollen schon vor langer Zeit verbrennen sollen.
»Bitte, Narr. Geh für mich zu Chade. Ich muss zu meiner Hütte zurück. Jetzt. Heute.«
Der Narr legte mir vorsichtig die Hand auf die Schulter. »Fitz. Wenn jemand die Schriftrollen bereits entdeckt hat, ist es ohnehin zu spät. Mit der plötzlichen Abreise von Tom Dachsenbless wirst du nur Neugier erregen und deine Verfolger provozieren. Du könntest die Gescheckten direkt zu ihnen führen. Sie werden damit rechnen, dass du fliehst, nachdem sie dich bedroht haben. Sie werden die Tore von Burgstadt beobachten. Denk also in Ruhe nach. Es könnte sein, dass deine Ängste unbegründet sind. Wie sollten sie Tom Dachsenbless mit Harm in Verbindung bringen, geschweige denn wissen, woher der Junge kommt? Handele nicht überstürzt. Sprich erst mit Chade und erzähl ihm von deinen Befürchtungen. Und rede auch mit Prinz Pflichtgetreu. Heute Abend ist seine Verlobung. Der Junge hält sich gut, aber das ist nur eine dünne, brüchige Fassade. Sprich mit ihm und beruhige ihn.« Dann hielt er kurz inne. »Vielleicht könnte man jemand anderen schicken …«
»Nein«, unterbrach ich ihn entschlossen. »Ich muss selbst gehen. Ein paar Sachen dort werde ich mitnehmen, den Rest vernichten.« Meine Gedanken tanzten an dem angreifenden Hirschbock vorbei, den der Narr in meinen Tisch geschnitzt hatte. Fitz-Chivalric Weitsehers Wappen zierte Tom Dachsenbless’ Tisch. Selbst das kam mir jetzt wie eine Bedrohung vor. Verbrennen, beschloss ich. Ich würde die ganze Hütte niederbrennen. Ich durfte nichts hinterlassen, was darauf hinweisen könnte, dass ich einst dort gelebt hatte. Selbst die Kräuter im Garten verrieten zu viel über mich. Ich hätte niemals den Schatten meiner Person und meine Geheimnisse für jeden erreichbar zurücklassen dürfen; ich hätte mir niemals erlauben dürfen, so offensichtliche Spuren zu hinterlassen.
Der Narr klopfte mir auf die Schulter. »Iss etwas«, schlug er vor. »Dann wasch dir das Gesicht und zieh dich um. Triff keine übereilten Entscheidungen. Wenn wir unseren Kurs beibehalten, werden wir das überleben, Fitz.«
»Dachsenbless«, erinnerte ich ihn und stemmte mich wieder in die Höhe. Wir mussten uns bis ins Kleinste an unsere Rollen halten. »Ich bitte Euch um Verzeihung, Euer Gnaden. Einen Augenblick lang fühlte ich mich ein wenig schwach, aber nun habe ich mich erholt. Ich entschuldige mich dafür, Euer Frühstück unterbrochen zu haben.«