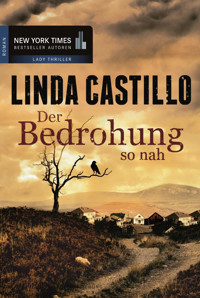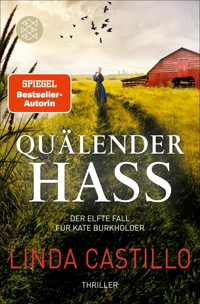
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die schreckliche Vergangenheit einer amischen Familie kommt ans Tageslicht, als die Großmutter der Familie auf brutale Weise ums Leben kommt. Der neue aufwühlende Roman von Bestseller-Autorin Linda Castillo. Das friedliche Städtchen Painters Mill wird zutiefst erschüttert, als eine amische Großmutter auf einer verlassenen Farm brutal ermordet und ihre siebenjährige Enkelin entführt wird. Kate Burkholder versucht mit allen Mitteln, das Kind schnellstens zu finden. Die Familie lebt in einer ultra-konservativen amischen Siedlung am Fluss, sie ist äußerst hilfsbereit, doch Kate merkt schnell, dass sie etwas verschweigen. Aber warum? Als sie die fürchterliche Wahrheit aufdeckt, zweifelt sie an ihrem eigenen Glauben, an den Amischen, an der ganzen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Linda Castillo
Quälender Hass
Über dieses Buch
Das friedliche Städtchen Painters Mill wird zutiefst erschüttert, als eine amische Großmutter auf einer verlassenen Farm brutal ermordet und ihre siebenjährige Enkelin entführt wird. Kate Burkholder versucht mit allen Mitteln, das Kind schnellstens zu finden. Die Familie lebt in einer ultra-konservativen amischen Siedlung am Fluss, sie ist äußerst hilfsbereit, doch Kate merkt schnell, dass sie etwas verschweigen. Aber warum? Als sie die fürchterliche Wahrheit aufdeckt, zweifelt sie an ihrem eigenen Glauben, an den Amischen, an der ganzen Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Bestseller, die immer auch auf der SPIEGEL-ONLINE-Bestenliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Helga Augustin hat in Frankfurt am Main Neue Philologie studiert. Von 1986 - 1991 studierte sie an der City University of New York und schloss ihr Studium mit einem Magister in Liberal Studies, Schwerpunkt Translations, ab. Die Übersetzerin lebt seit 1991 in Frankfurt am Main.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Dank
Ich widme dieses Buch meinen Lesern:
Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Treue. Ich habe das große Glück, tagtäglich tun zu können, was ich am liebsten tue, Geschichten zu erfinden und Charaktere, die von Ihnen gelesen und geliebt werden.
Prolog
Kein Mensch ging mehr zu der alten Schattenbaum-Farm. Seit das Hochwasser vom Painters Creek 1969 die Ernte weggeschwemmt und eine Scheune sowie die Außentoilette mitgerissen hatte, wohnte dort niemand mehr. Es hieß, Mr. Schattenbaums 1960er Chevy Corvair liege noch immer an der tiefen Stelle im Fluss, wo das Wasser ihn zurückgelassen hatte.
Die Farm war nie besonders ansehnlich gewesen. Das Haupthaus mit den rostigen, gewellten Dachschindeln hatte schon in guten Zeiten einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Mr. Schattenbaum wollte es immer streichen, war aber nie dazu gekommen. Auch den Rasen mähte er nur selten. Doch für Mary Yoder war die Schattenbaum-Farm einst, trotz des maroden Zustandes, der Mittelpunkt ihrer Welt gewesen, in der geliebt, gelebt und gelacht wurde.
Die Schattenbaums hatten sechs Kinder, und obwohl sie keine Amischen waren, hatte Marys Mamm ihr erlaubt, dort mit ihnen zu spielen – was Mary so oft wie möglich tat. Und das nicht zuletzt wegen der vier gefleckten Ponys, der Ferkel, der zahlreichen Esel, des großen Truthahns sowie der vielen Ziegen, die schon keiner mehr zählen wollte. In jenem letzten Sommer war Mary zehn Jahre alt gewesen und hatte ganz viel Spaß gehabt.
Dass seither fünfzig Jahre vergangen waren, konnte sie kaum glauben. Sie hatte letzte Woche ihren sechzigsten Geburtstag gefeiert und war schon Großmutter und Witwe. Doch jedes Mal, wenn sie mit dem Buggy an der alten Farm vorbeifuhr, schienen die vielen Jahre wie weggefegt, und sie dachte jedes Mal: Wenn der Ort reden könnte, was für Geschichten würde er dann wohl erzählen?
Mary lebte noch immer im Haus ihrer Kindheit, inzwischen mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Es lag zwar eine halbe Meile weiter unten in der Straße, aber sie nutzte jede Gelegenheit, um an der Farm vorbeizulaufen. Im Frühjahr pflückte sie dort Schwertlilien, die noch immer hinter dem Haus wuchsen, und im Sommer holte sie sich Pfingstrosen. Von Mr. Schattenbaum wusste sie, dass sein Großvater die Dutzend Schwarznussbäume im hinteren Garten gepflanzt hatte. Sie waren jetzt hundert Jahre alt, und jeden Herbst fielen Tausende Walnüsse herab, die Mary ein ganzes Jahr lang für ihre Walnuss-Schichttorten verwenden konnte, die ihre acht Enkel so liebten.
Das Wohnhaus sah noch fast so aus wie vor all den Jahren, aber die Scheune, in der Mary so viele Nachmittage mit den Ponys gespielt hatte, war vor einigen Jahren nach einem heftigen Sturm eingestürzt. Seither nahmen Kletterpflanzen, Gestrüpp und hüfthohes Unkraut die Dachsparren und Holzwände nach und nach in Besitz.
»Großmama! Soll ich das Tor aufmachen?«
Mary sah zu dem Mädchen auf dem Beifahrersitz, und das Herz quoll ihr über. Sie hatte ihre beiden Enkelinnen mitgenommen, damit sie ihr beim Sammeln der Walnüsse halfen. Annie war fünf und sah aus wie ihre Mamm in dem Alter: blondes, meist zerzaustes Haar und blaue Augen, aus denen die Tränen ein bisschen zu leicht rollten. Sie war ein nachdenkliches Mädchen, das schon jetzt davon sprach, einmal Lehrerin in dem Zwei-Zimmer-Schulhaus ihrer Kirchengemeinde zu werden.
Die siebenjährige Elsie war ein besonderes Kind, süß und temperamentvoll, neugierig und herzlich. Sie hatte einen kleinen, plumpen Körper und trug runde Brillengläser so dick wie Flaschenböden. Sie war ein Geschenk Gottes, und Mary liebte sie gerade wegen ihrer Andersartigkeit umso mehr.
»Vielleicht sollte ich den Buggy zuerst anhalten, meinst du nicht?« Mary straffte die Zügel, das Pferd verlangsamte sein Tempo, und sie bogen in den unkrautüberwucherten Schotterweg ein. »Brrr.«
Schon von weitem sah sie die orangerot leuchtenden Baumkronen hinter dem Haus, und sofort überkam sie das vertraute Gefühl von Heimkehr und Nostalgie.
»Jetzt könnt ihr runterhüpfen«, sagte sie den Mädchen. »Öffnet das Tor, aber achtet auf den Stacheldraht, habt ihr gehört?«
Beide Kinder kletterten vom Buggy, rannten mit raschelnden Röcken zu dem Metalltor und öffneten mit flinken Händen die Kette.
Mary fuhr mit dem Buggy durchs Tor, hielt wieder an und wartete auf die Kinder. »Macht schnell, ihr Süßen, und lasst das Tor offen. Ich höre schon, wie die vielen Walnüsse uns rufen.«
Kichernd kletterten die Kinder zurück auf den Buggy.
»Haltet eure Beutel bereit«, forderte Mary sie auf, als sie das Haus passierten. »Heute Nachmittag können wir bestimmt alle unsere mitgebrachten Körbe füllen.«
Lächelnd sah sie zu, wie die beiden Mädchen nach den Leinenbeuteln griffen, die Mary letztes Jahr extra für diesen Zweck genäht hatte. Die Beutel waren groß, mit zwei Trägern, die leicht über eine schmale Schulter geschlungen werden konnten. Auf die Vorderseite von Elsies Beutel waren grüne Walnussblätter gestickt, auf der von Annie prangte eine braune, aufgebrochene Nussschale, die ihren köstlichen Inhalt offenbarte.
Mary fuhr mit dem Buggy hinters Haus, wo einmal der Garten gewesen war. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie die alte Reifenschaukel sah, die es noch immer gab. Sie lenkte das Pferd in den Schatten eines Zürgelbaums, wo das Gras so hoch war, dass die alte Stute daran rupfen konnte. Dann ließ sie den Blick schweifen, und ein vertrautes Glücksgefühl erfüllte ihre Brust.
Sie nahm die drei Paar Handschuhe und ihren eigenen Beutel, stieg vom Buggy und hielt einen Moment inne, um dem Zwitschern eines Kardinals und dem Flüstern des Windes in den Baumkronen zu lauschen.
»Kinder, ich glaube, wir haben den perfekten Tag für die Walnussernte gewählt«, sagte sie.
Elsie kletterte ihr hinterher, den Beutel über der Schulter. Aber Annie war noch zu klein, um selbst auszusteigen, und Mary hob sie vom Wagen herunter. Dann gab sie ihnen ihre kleinen Lederhandschuhe.
»Ich will keine fleckigen Finger sehen«, sagte sie.
»Du auch keine fleckigen Finger, Großmama.«
Lächelnd ging Mary zu der Baumgruppe, wo die Sonne den Boden zu ihren Füßen sprenkelte.
»Guck mal, wie groß der Baum ist, Großmama«, rief Annie aus.
»Das ist mein Lieblingsbaum«, erwiderte Mary.
»Und guck mal, die vielen Walnüsse!«, sagte Elsie mit einer Begeisterung, die nur eine Siebenjährige aufbringen konnte.
»Gott hat uns dieses Jahr eine reiche Ernte beschert«, sagte Mary.
»Machen wir Kuchen damit, Großmama?«
»Aber natürlich«, versicherte ihr Mary.
»Walnussbaumkuchen!«, freute sich Annie.
»Und Kürbisbrot!«, fügte Elsie hinzu.
»Wenn ihr beiden so viel sammeln würdet wie reden, wären wir schon fertig.« Sie milderte die Schelte mit einem Lächeln.
Mary trat unter den Baum, kniete sich hin und nahm ein paar Nüsse in die Hand, inspizierte ihre Schalen. Sie waren grün mit schwarzen Flecken, aber fest und ohne Schimmel. Am besten sammelte man sie im Oktober, und inzwischen war es schon Anfang November. »Nur die festen nehmen, ihr zwei. Sie liegen schon eine Weile auf dem Boden, dieses Jahr sind wir spät mit der Ernte dran.«
Aus dem Augenwinkel sah sie Annie niederknien und eine Walnuss in ihren Beutel stecken. Zehn Meter weiter stand Elsie schon beim nächsten Baum, die Lederhandschuhe an den kleinen Händen. So ein liebes, gehorsames Kind.
In der nächsten halben Stunde arbeitete Mary schweigend vor sich hin. Die Mädchen plapperten munter, und als sie sich mit Nüssen bewarfen, gab sie vor, es nicht zu sehen. Schon bald war ihr Beutel gefüllt, und sie ging zurück zum Buggy, wo sie ihre Ausbeute in den großen Weidenkorb schüttete.
Sie war schon auf dem Weg zurück zu den Mädchen, als etwas im Haus ihre Aufmerksamkeit erregte. Eine Bewegung hinter dem Fenster? Wohl kaum, denn kein Mensch kam mehr hierher. Wahrscheinlich hatten sich nur wehende Zweige in der Scheibe gespiegelt. Aber als sie weiterging, sah sie es wieder. Diesmal bestand kein Zweifel: Da war ein Schatten im Küchenfenster gewesen.
Sie vergewisserte sich, dass die Mädchen eifrig Nüsse sammelten, und legte ihren Beutel auf den Boden. Ein Rabe krähte auf dem Dach, als sie das Haus erreichte und die morschen Stufen der hinteren Veranda hinaufging. Die Tür stand ein paar Zentimeter weit offen, und sie rief: »Hallo?«
»Mit wem sprichst du, Großmama?«
Sie blickte zurück. Annie stand unter dem Baum, sie hatte die Hände in die Hüften gestemmt und beobachtete sie. Hinter ihr machte Elsie einen beherzten Versuch, mit Walnüssen zu jonglieren, doch ohne viel Erfolg.
»Sammelt weiter die Nüsse auf«, rief sie ihnen zu. »Ich sehe nur kurz in Mrs. Schattenbaums Küche.«
»Können wir mitkommen?«
»Es dauert nur eine Minute. Ihr zwei sammelt weiter Nüsse auf, sonst sind wir noch im Dunkeln hier.«
Mary wartete, bis die Mädchen ihre Arbeit wiederaufgenommen hatten, überquerte die Veranda, blieb stehen und stieß mit der Hand die Tür auf. Die Scharniere knarrten. »Hallo? Ist da jemand?«
Sie trat ins Haus, und Erinnerungen stürmten auf sie ein. Sie dachte an den Teller voller Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade, der so oft auf dem Küchentisch gestanden hatte, wie Mrs. Schattenbaum am Ofen stehend in einem Topf rührte, aus dem es himmlisch duftete, und wie sie Kekse mit Schokostücken aus dem Glas im Küchenschrank stibitzte. Die alten Arbeitsplatten aus Resopal waren noch relativ unversehrt, die Keramikspüle hingegen war angeschlagen. Wo einmal der Ofen gestanden hatte, gab es jetzt nur noch die Gasleitung und Rostflecken auf dem Boden. Alles war voller Rattenkot, und das Linoleum an manchen Stellen angefressen.
Mary wollte gerade im Unterschrank nachsehen, ob das alte Plätzchenglas noch da war, als sie im angrenzenden Zimmer ein Geräusch hörte. Etwas – oder jemand – war nebenan. Vermutlich das Tier, das auch das Linoleum angefressen hatte, dachte sie. Ein Waschbär oder Opossum. Oder eine Ratte. Mary war auf einer Farm aufgewachsen und nicht zimperlich, was Tiere anging. Aber Ratten hatte sie nie gemocht …
Sie blickte aus dem Fenster über der Spüle. Annie und Elsie spielten mit einem Stock und Walnüssen Baseball. Mary lächelte kopfschüttelnd. Sie sollte sie besser nicht zu lange allein lassen …
Sie drehte sich um und ging zu der Tür, die nebenan ins Wohnzimmer führte. Drinnen war es düster und voller Schemen, es roch nach Schimmel und verrottetem Holz. Die Bodendielen waren stark gewellt, die Zimmerdecke hatte zahllose Wasserflecken, die Tapete hing von den Wänden wie sonnenverbrannte Haut, und die Vorhänge waren nur noch Fetzen.
»Wer ist da?«, fragte sie ruhig.
Ein Geräusch zu ihrer Rechten ließ sie zusammenzucken. Im Schatten bewegte sich etwas, Schritte kamen näher, auf sie zu …
Der erste Schlag traf sie so hart auf den Brustkorb, dass ihr die Luft wegblieb. Mit flatternden Armen taumelte sie rückwärts. Ein brennender Schmerz breitete sich in ihrer Brust aus. Aber es sollte noch schlimmer kommen.
Rechts von ihr erschien etwas in ihrem Gesichtsfeld, dann stürzte eine Gestalt auf sie zu, sie sah ein bleiches, ovales Gesicht, hielt die Hände hoch und stieß einen Schrei aus.
Der zweite Schlag kam von oben, schlitzte ihre rechte Hand auf und drang tief in ihre Schulter. Schmerz durchzuckte sie, dann war ihr Arm taub. Sie blickte auf das schwarz schimmernde Blut, und erst da wurde ihr klar, dass sie eine schlimme Schnittwunde hatte.
Wimmernd stolperte sie zurück in die Küche, wollte ihrem Angreifer entfliehen, doch er folgte ihr, aggressiv und entschlossen. Als ein Lichtschein auf sein Gesicht fiel, erkannte sie ihn wieder, dachte entsetzt: Das darf nicht wahr sein.
»Du!«, schrie sie.
Das Messer schnellte nach oben, fuhr auf sie hinab und traf ihr Schlüsselbein. Der Schmerz war unsäglich, tiefrotes Blut lief warm und nass an ihren Armen, ihren Händen und ihrem Kleid hinab bis auf den Boden.
Schlagartig erkannte sie, warum er gekommen war. Was als Nächstes passieren würde. Ihr Entsetzen war so groß, dass sie sekundenlang weder sprechen noch sich rühren konnte. Dann schnellte sie herum, wollte zur Tür rennen, doch sie glitt auf ihrem Blut aus und fiel auf die Knie.
Mary drehte ihrem Angreifer das Gesicht zu, sah ihn an. »Lass sie in Ruhe!«, schrie sie. »In Gottes Namen, lass sie in Ruhe!«
Er hob das Messer, sie warf sich nach vorn, bekam seine Hose zu fassen, zerrte daran und schlug auf ihn ein. Hoffnung blitzte auf, als er zur Seite taumelte, aber schon bohrte sich die Klinge in ihren Rücken und traf eine Rippe. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie bekam keine Luft, hatte keine Zeit mehr.
Der Angreifer hob erneut das Messer, das Gesicht wutverzerrt, die Zähne gefletscht.
Sie rappelte sich auf, stürzte zum Fenster über der Spüle und stieß die Faust durchs Glas. Erhaschte einen Blick auf die Mädchen.
»Lauft weg!«, schrie sie. »Da Deivel!« Der Teufel. »Lauft weg! Lauft!«
Hinter ihr knarrte der Boden, sie drehte den Kopf, sah das Messer aufblitzen, das sich keine Sekunde später wieder in ihren Rücken bohrte. Ein explosionsartiger Schmerz durchfuhr sie, ihre Knie wurden weich, und sie sank zu Boden, schlug mit dem Gesicht auf. Über ihr brüllte der Angreifer wie ein wildes Tier.
Da Deivel.
Er kniete sich neben sie, murmelte mit krächzender Stimme gottlose Worte. Erneut bohrte sich das Messer in ihren Körper, doch sie spürte keinen Schmerz mehr. Blut floss in einem Rinnsal über das Linoleum, Blut sammelte sich in ihrem Mund, ihr Atem ging gurgelnd. Zu schwach, um es auszuspucken, öffnete sie den Mund und ließ es rausfließen. Mit letzter Kraft sah sie zu ihrem Angreifer hoch.
Lauf, geliebtes Kind, dachte sie. Lauf um dein Leben.
Das Messer über ihr beschrieb einen Bogen und fuhr dann wie ein Blitz in ihren Leib, heiß wie Feuer. Ihr Oberkörper bäumte sich auf, zuckte einmal, zweimal. Sie hatte keine Kraft mehr zu kämpfen, zu fliehen, und konnte sich nicht mehr bewegen.
Sie nahm das kalte, raue Linoleum an ihrer Wange wahr, das Sonnenlicht, das durchs Fenster fiel, das Krächzen eines Raben, seine Schritte, die in Richtung Tür leiser wurden. Und dann nichts mehr.
1. Kapitel
Als Polizeichefin in einer Kleinstadt habe ich mit Dingen zu tun, von denen die meisten Menschen nichts wissen – nichts wissen wollen –, womit sie vermutlich besser dran sind. In der Regel handelt es sich um kleinere Vorkommnisse wie Verkehrsunfälle, häusliche Auseinandersetzungen, Bagatelldiebstähle oder ausgebrochene Nutztiere. Ich erlebe Menschen in außergewöhnlichen Stresssituationen – Freunde, Nachbarn und Leute, die ich schon fast mein ganzes Leben lang kenne. Manchmal sehe ich sie von ihrer schlimmsten Seite, was dadurch ausgeglichen wird, dass ich auch ihre guten Seiten kenne. Mir begegnen Mut, Charakterstärke, Fürsorglichkeit und die Bereitschaft, das eigene Leben für jemanden zu riskieren, den man gar nicht kennt. Und diese Momente sind es, die mir die Kraft zum Weitermachen geben, selbst wenn der Himmel dunkel ist und es in Strömen regnet.
Mein Name ist Kate Burkholder, ich bin Polizeichefin in Painters Mill, einer hübschen Kleinstadt im Herzen von Ohios Amish Country. Von den etwa fünftausenddreihundert Einwohnern der Stadt sind ein Drittel Amische. Auch ich bin hier geboren und als Amische aufgewachsen, habe die Glaubensgemeinschaft jedoch mit achtzehn Jahren verlassen. Damals habe ich mir nicht vorstellen können, jemals wieder hier zu leben, aber nach zwölf Jahren – und nachdem ich meine Berufung als Polizistin gefunden hatte – hat es mich doch an den Ort meiner Kindheit zurückgezogen. Dabei ist mir das Schicksal zu Hilfe gekommen, denn der Stadtrat bot mir die Stelle als Polizeichefin an. Ich bilde mir gern ein, dass meine Erfahrung im Polizeidienst oder mein guter Ruf als Polizistin ausschlaggebend waren, weiß aber auch, dass meine amischen Wurzeln – die Vertrautheit mit der amischen Lebensweise und Religion und meine Kenntnis von Pennsylvaniadeutsch – eine Rolle bei der Entscheidung spielten. Denn der Tourismus macht in Painters Mill einen Großteil der städtischen Einnahmen aus, und die Stadtoberen konnten davon ausgehen, dass meine Gegenwart helfen würde, die Kluft zwischen der amischen und der »englischen« Bevölkerung zu überbrücken.
Es ist kurz nach sechzehn Uhr, und ich sitze als Beifahrerin in meinem Dienstwagen neben Mona Kurtz, meiner frischgebackenen Streifenpolizistin. Heute Nachmittag ist sie ganz professionell: Sie trägt ihre neue Polizeiuniform, die noch nach Weichspüler duftet, ihr sonst wildes Haar ist in einem Pferdeschwanz gebändigt, und das oft farbenreiche Make-up besteht aus dezenten Braun- und Nude-Pink-Tönen. Momentan arbeitet sie noch hauptsächlich während der Nachtschicht in der Telefonzentrale, aber da Erfahrung beim Streifendienst wichtig ist, fahre ich – wenn unsere Dienstpläne es zulassen – jeden Tag ein paar Stunden mit ihr umher. Sobald ich jemanden für die Telefonzentrale gefunden und eingearbeitet habe, soll sie allein Streife fahren können.
Es ist ein wunderbar sonniger Tag, frisch, aber angenehm für November in diesem Teil von Ohio. Das Radio, in dem die Band X Ambassadors gerade zugibt, sich ein wenig »Unsteady« – unsicher – zu fühlen, ist so leise gedreht, dass wir den Polizeifunk hören können. Unser Coffee to go klemmt in den Kaffeehaltern, und die Verpackung unserer Burger vom Mittagessen steckt in einer Tüte in der Mittelkonsole. Wir fahren gerade auf der County Road 19, als ein Stück vor uns ein Dutzend Heuballen über beide Fahrbahnen verstreut liegen.
»Da hat wohl jemand seine Ladung verloren«, sagt Mona und fährt langsamer.
»Wenn man mit achtzig gegen einen Heuballen fährt, hat man ein echtes Problem.«
Mona macht das Blaulicht an und fährt an den Straßenrand. »Sollen wir Warnleuchten aufstellen?«
Ich blicke die Straße entlang und sehe tatsächlich einen vollbeladenen amischen Heuwagen gen Horizont wanken. »Und da vorn haben wir vermutlich unseren Übeltäter. Wir befördern das Heu auf den Seitenstreifen und schnappen ihn uns dann.«
Nach ein paar Minuten haben wir alle Heuballen an den Straßenrand gezerrt und fahren dem nachlässigen Farmer hinterher. Als wir nahe genug sind, sehe ich, dass es ein alter Leiterwagen ist, dessen seitliche Bretter schon zur Hälfte kaputt sind.
»Wenigstens hat er ein Schild mit dem Hinweis ›Langsam fahrendes Vehikel‹ angebracht«, sage ich. »Das ist gut.«
»Soll ich ihn anhalten, Chief?«
»Ja, tun Sie das.«
Mona scheint mir ein bisschen zu begeistert von der Aussicht, aktiv zu werden, sie fährt auf gleicher Höhe links neben dem Wagen her. Den Fahrer können wir nicht sehen, weil das Heu auf der Ladefläche drei Meter hoch bis vor zum Kutschbock reicht. Aber immerhin lenkt er die beiden alten Ackergäule an den Straßenrand und bleibt stehen. Wir halten dahinter.
Mona holt tief Luft, zieht ihre Uniformjacke glatt, wirft mir einen entschlossenen Blick zu und steigt aus. Ich unterdrücke ein Lächeln und folge ihr zur Fahrerseite des Heuwagens.
Und dort erwartet uns eine Überraschung: Ein etwa fünfzehn Jahre altes Mädchen hält die Zügel des Pferdefuhrwerks in der Hand, ein noch jüngeres Mädchen sitzt ganz rechts auf der Bank und zwischen ihnen ein sechs oder sieben Jahre alter Junge, der uns ein fast zahnloses Grinsen schenkt. An ihrer Kleidung sehe ich, dass es Swartzentruber-Amische sind: Der Junge hat einen schwarzen Mantel, Jeans und schwarze knöchelhohe Turnschuhe an; auf seiner typischen Topffrisur sitzt ein breitkrempiger Hut. Die Mädchen tragen dunkelblaue Kleider, schwarze Mäntel und schwarze Winterhauben.
Die Swartzentruber sind Amische der Alten Ordnung. Sie halten eisern an ihren langjährigen Traditionen fest und verzichten auf viele Annehmlichkeiten, die andere Amische im täglichen Leben nutzen, wie fließend Wasser oder Spülklosetts. Ihre Buggys haben weder Windschutzscheiben noch Gummireifen. Die Frauen tragen lange dunkle Kleider, die meisten von ihnen das ganze Jahr über eine Winterhaube. Die Männer stutzen nie ihren Bart. Und selbst ihre Häuser sind schmucklos.
Als Gemeinschaft haben sie keinen guten Ruf, besonders bei der nicht amischen Bevölkerung, die ihre Traditionen nicht verstehen. Die meisten Beschwerden betreffen die Weigerung, ein Schild mit dem Hinweis »Langsam fahrendes Vehikel« an ihren Fahrzeugen anzubringen, weil es ihrer Ansicht nach Zierrat ist. Ich habe auch schon mitbekommen, dass sich manche Nicht-Amische über die mangelnde Körperpflege einiger Swartzentruber mokieren. Da ich selbst als Amische aufgewachsen bin, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie mühsam es ist, bei zwanzig Grad unter null Wasser zu schleppen, wodurch es praktisch unmöglich ist, jeden Tag ein Bad zu nehmen. Aber ich kenne den Wert alter Traditionen, und obwohl ich manche nicht akzeptiere, respektiere ich sie doch.
Die Kinder sind verstört, weil sie angehalten wurden, und ich bemühe mich, sie zu beruhigen. »Guder nochmiddawks«, sage ich auf Pennsylvaniadeutsch.
»Hi.« Der Blick der Fahrerin huscht von Mona zu mir. »Habe ich etwas Falsches getan?«
Ich nicke Mona zu, gebe ihr zu verstehen, dass sie übernehmen soll. »Nein«, antwortet sie dem Mädchen, »ich wollte euch nur sagen, dass ihr ein paar Heuballen verloren habt.«
Das Mädchen reißt erschrocken die Augen auf. »O nein.« Sie blickt hinter sich, kann aber wegen des hochaufgetürmten Heus nichts sehen. »Wie viele denn?«
»Ungefähr zehn.« Mona zeigt zu den heruntergefallenen Heuballen. »Vierhundert Meter von hier.«
Erst jetzt kann ich einen guten Blick auf die Kinder werfen, und mir wird klar, dass ich sie schon mit ihren Eltern im Ort gesehen habe. Ihren Datt musste ich bereits mehrere Male anhalten, weil er sich weigert, an seinem Buggy das Schild »Langsam fahrendes Vehikel« anzubringen. Ich bin froh zu sehen, dass er meiner Aufforderung endlich nachgekommen ist.
»Seid ihr die Kinder von Elam Shetler?«, frage ich.
Die Fahrerin blickt zu mir. »Ich bin Loretta.« Sie zeigt mit dem Daumen auf ihre Geschwister. »Das ist Lena, und das ist Marvin.«
Ich nehme den Heuwagen genauer in Augenschein, er ist ausgesprochen groß und mächtig überladen. Die Straße ist eng, der Seitenstreifen kaum der Rede wert. Ich will gerade vorschlagen, dass sie nach Hause fahren, den Wagen entladen und mit einem Erwachsenen zurückkommen soll, als sie die Zügel strafft und mit der Zunge schnalzt.
»Kumma druff!«, ruft sie. »Kumma druff!« Weiter geht’s.
In die Pferde kommt Leben, sie heben die Köpfe, richten die Ohren auf und lauschen. Alte Profis, denke ich.
»Bist du sicher, dass du den Wagen hier wenden kannst?«, frage ich.
»Das schaff ich locker«, erwidert das Mädchen. In ihren Worten klingt weder Gereiztheit noch jugendliche Überheblichkeit, sie sind Ausdruck einer Selbstsicherheit, die auf Geschick und Erfahrung beruht.
Ich sehe Mona an. »Stoßen Sie mit dem Explorer zurück, damit wir nicht im Weg sind.«
»Wird gemacht, Chief.«
Ich gehe zur Seite und beobachte nicht ohne Bewunderung, wie das Mädchen beide Pferde in einen anmutigen Seitengang lenkt. Die Köpfe der Tiere sind gleichauf, die Vorderbeine überkreuzen sich in perfektem Einklang. Als der Wagen keinen Platz mehr hat, führt sie die Pferde ein Stück zurück und dann wieder in einen Seitengang. Nach wenigen Minuten ist das Gespann in die Richtung gewendet, aus der sie gekommen sind.
»Mein Respekt für amische Mädchen ist gerade in die Höhe geschnellt«, flüstert Mona.
Ich gehe hinüber zum Heuwagen und sehe zu dem Mädchen hoch. »Gut gemacht«, sage ich.
Sie wendet den Kopf ab, doch ich erhasche zuvor den Ausdruck von Stolz in ihren Augen, die leichte Röte auf ihren Wangen, und denke: Gutes Mädchen.
Ich zeige zu den heruntergefallenen Heuballen. »Fahr dorthin, dann werfen Mona und ich die Ballen auf den Wagen.«
Die Kinder kichern bei der Vorstellung, dass zwei englische Frauen in Polizeiuniform das Heu auf ihren Wagen befördern wollen, doch sie erheben keinen Einspruch.
Kaum habe ich den letzten Heuballen auf den Wagen geworfen, höre ich eine Stimme aus dem Funkgerät an meinem Ausrüstungsgürtel. »Chief?«
Es ist Lois, die morgens in der Telefonzentrale arbeitet, und ich drücke auf mein Ansteckmikro. »Hey, Lois.«
»Ich hab gerade einen Anruf von Mike Rhodehammel entgegengenommen. Er sagt, auf der Township Road 14 befindet sich nahe der alten Schattenbaum-Farm ein Pferd mit einem führerlosen Buggy.«
»Bin auf dem Weg«, sage ich. »Voraussichtlich in zwei Minuten vor Ort.«
Ich schiebe mich zurück auf den Beifahrersitz des Explorers. »Haben Sie’s gehört?«, frage ich Mona.
»Ja.« Sie lässt den Motor an und fährt los.
Kurz darauf biegen wir in die Township Road ab, wo der kaputte Asphalt vor dem sich ausbreitenden Gras des Seitenstreifens und den wuchernden Büschen längst kapituliert hat. An diesem Straßenabschnitt, der kaum noch als Straße zu erkennen ist, stehen zwei Häuser: Das eine gehört zu der mittelgroßen Farm von Ivan und Miriam Helmuth, die Sojabohnen und Mais anbauen und Heu machen, das andere zur ehemaligen Farm der Schattenbaums, die schon leer steht, solange ich zurückdenken kann.
Weiter vorn sehe ich den Buggy und das Pferd. Das Tier ist noch angeschirrt und steht vor einem verrosteten, windschiefen Zaun im Graben, der Buggy hängt halb umgekippt darin fest.
»Kein Fahrer weit und breit.« Mona hält hinter dem Buggy und aktiviert das Blaulicht. »Können Sie sich erklären, wie so etwas passiert?«
»Die Helmuths haben eine Menge Kinder.« Ich zucke mit den Schultern. »Vielleicht hat eines das Pferd nicht richtig festgemacht oder ein Tor offengelassen.« Ich steige aus und gehe zum Buggy.
Das Tier hebt den Kopf und sieht in meine Richtung. Es ist weder verschwitzt, noch atmet es heftig, scheint also nicht ausgebüchst zu sein. Ich werfe einen Blick in den Buggy. Er ist bis auf drei altmodische Weidenkörbe auf der Rückbank leer.
»Hm, seltsam.« Als ich mich umsehe, kommt gerade ein roter Ford-Pick-up auf uns zu.
»Hey, Chief«, sagt Mike Rhodehammel, der örtliche Eisenwarenhändler, nachdem er das Fenster runtergelassen hat. »Haben Sie irgendwo den Fahrer entdeckt?«
Ich schüttele den Kopf. »Der Buggy könnte Mr. Helmuth weiter oben in der Straße gehören. Ich fahre hin und sehe nach.«
Er nickt. »Hab’s gemeldet, weil ich ungern sehe, dass dem Pferd was passiert. Ich muss gleich weiter in den Laden.«
»Danke, dass Sie angerufen haben, Mike.«
»Keine Ursache, Chief.«
Ich blicke ihm nach, dann gehe ich zurück zum Explorer. »Wir reden mit den Helmuths.«
Ich bin gerade im Begriff einzusteigen, als ich einen Schrei höre. Zuerst denke ich, es sind spielende Kinder, aber die Farm der Helmuths ist eine halbe Meile weit weg, Stimmen würden nicht bis hierher getragen. Und etwas an dem Ton macht mich stutzig, also verharre ich kurz und lausche.
Ein weiterer Schrei durchschneidet die Luft, schrill und viel zu lang. Keine spielenden Kinder. Entsetzen und Panik liegen in der Stimme, und mir sträuben sich die Nackenhaare.
Mona sieht mich an. »Was zum Teufel ist das, Chief?«
»Woher kommen die Schreie?«, frage ich.
Sie zuckt mit den Schultern.
Jetzt lauschen wir beide angestrengt. Ich trete vom Explorer weg, um die Richtung der Schreie besser ausmachen zu können, als ich beim nächsten sogar Worte erkenne.
»Großmama! Großmama! Großmama!«
Panik und Entsetzen hallen in der jungen Stimme wider. Ich blicke zum Haus der Schattenbaums und sehe ein kleines Mädchen den Kiesweg entlang auf uns zurennen.
»Großmama! Großmama!«
Mona und ich eilen ihr entgegen. Vielleicht ist ihre Großmutter gestürzt oder hatte gar einen Schlaganfall.
Das Tor zum Grundstück steht offen. Das Mädchen ist jetzt zwanzig Meter davon entfernt und blickt immer wieder hinter sich, als hätte sie einen Geist gesehen – oder ein Ungeheuer. Sie ist etwa fünf Jahre alt und schaut mich direkt an, ohne mich wahrzunehmen.
»Hallo, Kleine, was ist denn los?«, rufe ich schon von weitem auf Deitsch. »Wo ist deine Großmama? Ist etwas passiert?«
Als sie noch drei Meter entfernt ist, bemerke ich das Blut an ihren Händen, in ihrem Gesicht und auf ihrem Kleid. Viel Blut. Zu viel. Sofort schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich sehe Mona an, die ein Stück hinter mir stehen geblieben ist. »Sie ist voller Blut. Halten Sie die Augen offen.«
Das Mädchen wirft sich so heftig an mich, dass ich zurücktaumele. Ihr ganzer Körper zittert, und ein krächzendes Wimmern dringt aus ihrem Mund.
»Ganz ruhig.« Ich lege ihr beide Hände auf die Schultern. »Alles gut. Ich bin bei dir.«
»Großmama!« Schreiend klammert sie sich an meinen Kleidern fest, sieht über die Schulter zurück zum Haus. »Da Deivel hat sie gekriegt!«
»Was ist passiert?« Ich fahre mit den Händen sanft über ihren Körper. »Bist du verletzt?«
Das Mädchen versucht zu sprechen, doch sie bringt nur erstickte Laute heraus und weint heftig. Ich gehe vor ihr in die Hocke, halte sie auf Armeslänge von mir weg, sehe ihr in die Augen und rüttele sie sanft. »Beruhig dich, Schätzchen. Sag mir, was passiert ist.«
»Da Deivel hat Großmama weh getan!«, stößt das Mädchen schluchzend aus. »Sie blutet. Und mir will er auch weh tun!«
»Wo ist deine Großmama?«, frage ich mit fester Stimme.
Wimmernd hebt sie eine zitternde Hand und zeigt zum Haus. »In der Küche, und sie wacht nicht auf!«
Ich blicke zu Mona. »Rufen Sie einen Krankenwagen. Sagen Sie im Sheriffbüro Bescheid, sie sollen einen Deputy schicken.« Ich schiebe das Mädchen sanft zu Mona hin. »Bleiben Sie bei ihr. Ich sehe mal im Haus nach.«
Normalerweise würde ich Mona mitnehmen, aber dieses Kind ist zu jung und zu verängstigt, um es allein zu lassen. Ich gehe nicht von einem Verbrechen aus, wahrscheinlich hatte die Großmutter einen Unfall, einen Herzanfall oder ist aus irgendeinem anderen Grund umgefallen. Das viele Blut lässt sich damit allerdings nicht erklären …
Auf dem Weg zum Haus höre ich noch, wie Mona mit jemandem im Revier telefoniert, gleichzeitig bemerke ich im Staub die Abdrücke von Buggy-Rädern. Und jemand hat einen Leinenbeutel fallen gelassen.
Ich erreiche die Rückseite des Hauses. Drinnen ist alles still. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass jemand hier gewesen ist. Ich gehe zur Veranda, wo ich im Staub einen Schuhabdruck sehe. Die Tür steht halb offen. Die Scharniere quietschen, als ich die Tür ganz aufstoße.
Ich rieche das Blut, noch bevor ich es sehe. Eine riesige rote Lache bedeckt den Boden, die Schränke, Spüle und Wand sind vollgespritzt. Adrenalin durchflutet meinen Körper. Ich ziehe meine .38er aus dem Holster. Auf dem Boden liegt eine Frau. Eine Amische. Blaues Kleid, weiße Kapp. Älter, reglos. Ich sehe keine Waffe. Das hier war weder ein Unfall noch ein Selbstmord, und möglicherweise bin ich nicht allein hier.
»Mist, verdammt.« Ich aktiviere mein Funkgerät und gebe die Polizeicodes für Tötungsdelikte und die Anforderung von Unterstützung durch.
Dann richte ich meine Waffe auf die Tür zum Zimmer nebenan. »Polizei Painters Mill! Hände hoch und rauskommen! Sofort!« Meine Stimme ist angespannt, alle Sinne sind geschärft und in Alarmbereitschaft, mein Adrenalin ist im roten Bereich, und meine Hände zittern.
»Rauskommen! Sofort! Hände hoch, so dass ich Sie sehe! Sofort!«
Den Blick auf die Tür geheftet, trete ich zu der Frau, gehe in die Hocke und sehe zum ersten Mal ihr Gesicht. Wir sind uns schon einmal begegnet. Mein Hirn produziert einen Namen: Mary Yoder. Sie wohnt mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, Miriam und Ivan Helmuth, auf der Farm weiter unten in der Straße. Letzten Herbst habe ich einen Kuchen bei ihr gekauft.
»Verdammt.« Noch bevor ich den Zeigefinger an ihre Halsschlagader lege, weiß ich, dass sie nicht mehr lebt. Doch ihre Haut ist noch warm, ihre Augen sind offen und glasig, der geöffnete Mund ist voll Erbrochenem.
Ich richte mich auf und gehe zur Tür, spähe ins Wohnzimmer. Es ist dunkel. Die Vorhänge sind zugezogen, und überall sind Schatten. Ich ziehe die MagLite aus dem Ausrüstungsgürtel und lausche angestrengt, während mein Herz gegen meine Rippen hämmert. Ich leuchte durchs Zimmer. Die Vordertür ist geschlossen, es scheint niemand im Raum zu sein, ich nehme keine Bewegung wahr, kein Geräusch.
»Chief?«
Ich wirbele herum. Ein Deputy vom Holmes-County-Sheriffbüro kommt durch die Hintertür herein. Ungläubig sieht er das Opfer an. »Heilige Scheiße«, murmelt er.
»Das Haus ist nicht gesichert«, lasse ich ihn wissen. »Das Opfer ist tot.«
»Verdammt.« Er zieht seine Waffe, geht um die Blutlache herum an mir vorbei und ins Wohnzimmer.
»Holmes County Sheriff’s Department!«, dringt eine Stimme von draußen herein, Sekunden später fliegt die Vordertür auf. Ein zweiter Deputy kommt herein, Pistole im Anschlag.
»Haus ist nicht gesichert«, sage ich auch ihm. »Eine Tote in der Küche.«
Sonnenlicht fällt durch die Tür herein, erhellt den Raum. Die Männer blicken sich an. Der erste Deputy geht zu einer Glastür und blickt in den angrenzenden Raum. »Sauber!«
Der andere Deputy fordert Verstärkung an. Sie steigen zusammen die Treppe in den ersten Stock hinauf.
Ich gehe zurück in die Küche, bleibe kurz in der Tür stehen, um den Anflug von Übelkeit niederzuhalten. Als Polizistin habe ich schon viele schlimme Schauplätze gesehen – Verkehrsunfälle, Messerstechereien, brutale Prügeleien und auch Morde. Aber ehrlich gesagt, habe ich noch nie so viel Blut bei einem einzigen Opfer gesehen. Was um Gottes willen ist hier passiert?
»Chief?«
Mona kommt durch die Hintertür herein, erblickt die tote Frau und bleibt wie angewurzelt stehen. Sekunden später zwinkert sie, schüttelt den Kopf, wie um einen schlechten Traum abzuschütteln. Ein Beben durchzuckt ihren Körper.
Meine neue Deputy ist zwar keine Mimose, aber auf so etwas war sie nicht vorbereitet.
»Mona«, sage ich bestimmt. »Gehen Sie. Ich kümmere mich hier drum.«
Ohne mich anzusehen, geht sie rückwärts hinaus auf die Veranda, beugt sich vornüber und übergibt sich in die Büsche.
Auch ich habe ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ganz egal, wie oft man so etwas schon gesehen hat, der Anblick von Blut, von Tod – besonders, wenn er gewaltsam war – ist immer schauderhaft. Aber ich unterdrücke den Würgereiz, weigere mich, ihm nachzugeben.
»Wo ist das Mädchen?«, frage ich Mona.
»Sie sitzt mit einem Deputy in seinem Streifenwagen.« Die Hände in den Hüften, spuckt sie, dann sieht sie mich an. »Chief, die Kleine sagt, ein Mann hat ihre Schwester mitgenommen.«
Ihre Worte sind wie ein Schlag in die Magengrube, machen die schlimme Situation noch viel schlimmer. »Haben Sie einen Namen?«
»Helmuth.«
»Ich kenne die Familie«, sagte ich. »Sie wohnen weiter unten in der Straße.«
»Was, glauben Sie, ist hier passiert?«
Ich schüttele den Kopf. »Schwer zu sagen. Sieht aus, als wurde sie … erstochen.«
Abgeschlachtet, flüstert eine kleine Stimme in meinem Kopf.
Wir denken es beide, aber wir sprechen es nicht aus.
Ich drücke auf mein Ansteckmikro, funke die Telefonzentrale an, gebe den Code für den Verdacht einer Entführung durch.
Ich sehe Mona an. »Wir müssen uns überall umsehen«, sage ich. »Wir müssen mit den Eltern reden, ob das Mädchen wirklich verschwunden ist.«
Hätten wir es nur mit einem Mord zu tun, müssten wir zuallererst den Tatort sichern – also den Zutritt beschränken, die Umgebung weitläufig absperren und absuchen und eine Liste aller Verdächtigen erstellen. Doch die mögliche Entführung eines kleinen Kindes ändert alles. Die Lebenden haben Vorrang vor den Toten.
»Hat die Kleine sonst noch etwas gesagt?«, frage ich.
»Ich konnte nicht viel aus ihr herausbekommen, Chief. Sie ist zutiefst erschüttert.«
Ich werfe einen letzten Blick auf das Opfer, unterdrücke einen Schauder. »Kommen Sie, reden wir noch mal mit ihr.«
2. Kapitel
Das kleine Mädchen kauert auf der Rückbank eines Streifenwagens des Holmes-County-Sheriffbüros. Jemand hat ihr eine Rettungsdecke über die Beine gelegt, eine Flasche Wasser und einen Teddybär gegeben. Für solche Situationen – wenn wir ein Kind beruhigen und trösten wollen – haben einige Polizisten, so auch die meines kleinen Reviers, immer mindestens ein Stofftier im Kofferraum ihres Polizeiautos.
Als ich mich dem Wagen nähere, steigt der Deputy aus. Ich kenne ihn, wir hatten letzten Sommer zusammen Dienst bei der Parade zum Unabhängigkeitstag. Er ist selbst Vater, ein guter Mann und respektabler Polizist. Wir schütteln uns zur Begrüßung die Hand. »Hat sie noch irgendetwas gesagt?«
»Sie weint die meiste Zeit, Chief. Nur auf Pennsylvaniadeutsch hat sie etwas gesagt.« Er zuckt mit den Schultern. »Ich glaube, sie will zu ihrer Mom.«
Ich erzähle ihm, dass möglicherweise eine Schwester vermisst wird. »Im günstigsten Fall hat sie Angst bekommen und ist nach Hause gelaufen.«
Die Autotür steht offen. Ich gehe davor in die Hocke, so dass ich auf Augenhöhe mit dem Mädchen bin. »Hallo«, sage ich. »Ich heiße Katie und ich bin Polizistin. Kannst du mir erzählen, was passiert ist?«
Sie sieht mich an, das Gesicht tränenüberströmt. »Ich will meine Mamm.«
Sie trägt ein blaues Kleid, hat blaue Augen und helles Haar und ist noch ganz klein. Ihre Händchen sind voller Blut, wie die Wasserflasche, aus der sie nicht trinkt. Ich sehe ihre Beine unter der Decke zittern und spreche sie auf Pennsylvaniadeutsch an, was ihr wohl vertrauter ist und sie vielleicht eher zum Reden bringt. »Wer hat deiner grossmammi das angetan?«
»Da Deivel.«
Ihre Worte lassen mich schaudern. Es sind Worte, die zu sagen ein Kind niemals Grund haben dürfte – ebenso wenig, wie es ein solches Verbrechen jemals miterleben und obendrein noch davon erzählen sollte. »Ein Mann?«
Sie nickt.
»Weißt du, wie er heißt? Hast du den Mann schon einmal gesehen?«
Sie schüttelt den Kopf.
»War deine Schwester bei dir?«
»Elsie.« Sie flüstert den Namen, als habe sie Angst, ihn laut zu sagen. »Er hat sie mitgenommen.«
»Weißt du, wo sie hingegangen sind?«
Sie schließt die Augen, verzieht das Gesicht. »Ich will meine Mamm.«
Ich ignoriere die Tränen, denn mir ist allzu bewusst, dass uns die Zeit davonläuft. »Nur ein Mann?«, frage ich weiter.
Ein Nicken.
»Wie hat er ausgesehen?«
Sie starrt mich an.
»War er englisch? Oder war er amisch?«
»Ich will meine Mamm.«
»Schätzchen, weißt du, wohin er gegangen ist?«
Sie schüttelt den Kopf.
Ich frage weiter. »Hatte er einen Buggy oder ein englisches Auto?«
Das Mädchen weint, herzzerreißende Schluchzer kommen aus ihrem Mund. Ich überlege weiterzumachen, verzichte dann aber darauf. Jedenfalls für den Moment.
Ich strecke die Hand aus und tätschele ihr kleines Knie. »Ich hole jetzt deine Mamm und deinen Datt.«
Ich richte mich auf, hole die Schlüssel aus der Tasche und wende mich Mona und dem Deputy zu. »Wir müssen das Mädchen suchen, den Tatort sichern und die Umgebung weitläufig absperren. Es geht um einen Mann, der möglicherweise ein kleines Mädchen entführt hat. Alle verfügbaren Kräfte müssen mobilisiert werden.« Ich wende mich an Mona. »T.J. und Pickles sollen die Gegend hier weitläufig durchforsten.« Ich nenne die beiden Officer bei ihrem Spitznamen. »Glock und Skid sollen die Scheune und die Nebengebäude unter die Lupe nehmen und von dort ausgehend die Umgebung. Fragen Sie im Sheriffbüro nach, ob sie uns jemanden mit einem Spürhund schicken können. Das Grundstück muss sorgfältig abgesucht werden, wobei noch das kleinste Beweisstück wichtig ist. Alles muss gekennzeichnet und gesichert werden.«
»Wird gemacht.«
Auf dem Weg zum Explorer ziehe ich mein Telefon hervor und drücke die Kurzwahltaste für John Tomasetti. Er ist Agent beim Ohio Bureau of Criminal Investigation, kurz BCI, aber auch mein Lebensgefährte und die Liebe meines Lebens. Painters Mill fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Wir haben schon bei verschiedenen Fällen zusammengearbeitet und uns auf diese Weise auch kennengelernt. Er ist tough und gründlich und ein guter Polizist. Im Moment bin ich froh, mich auf jemanden wie ihn verlassen zu können.
Er nimmt nach dem zweiten Klingeln ab. »Du hast es anscheinend mit einer Leiche und einem verschwundenen Kind zu tun«, sagt er ohne Umschweife.
»Das hat ja schnell die Runde gemacht.« Beim Klang seiner Stimme lässt die Anspannung in meiner Brust ein wenig nach. Ich erzähle ihm das Wenige, was wir wissen. »Ich glaube, die Fünfjährige hat den Mörder gesehen und womöglich auch, wie er ihre Schwester mitgenommen hat.«
»Ein Mann?«
»Hat sich so angehört. Das Kind ist traumatisiert, ich brauche jemanden, der auf solche Fälle spezialisiert ist und herkommt, um mit ihr zu reden. Ich muss wissen, was sie alles gesehen hat, und am besten sofort.«
»Ich kümmere mich gleich darum«, sagt er.
»Tomasetti, die Frau wurde nicht einfach nur erstochen. Sie wurde …« Ich habe das Bild von Mary Yoders niedergemetzeltem Körper vor Augen. »Sie wurde abgeschlachtet.«
»Klingt nach einem persönlichen Motiv.«
»Und er hat vielleicht ein kleines Mädchen in seiner Gewalt. Aber das müssen die Eltern erst noch bestätigen, bevor wir alle Hebel in Bewegung setzen.« Von weitem drücke ich den Türöffner vom Explorer.
»Ich bin in zwanzig Minuten dort«, sagt er.
Ich lege auf, stecke das Handy zurück in die Tasche und habe die Autotür gerade geöffnet, als ein amischer Mann in meine Richtung gerannt kommt, einen etwa neun Jahre alten Jungen dicht auf den Fersen. Es ist Ivan Helmuth, ich erkenne ihn sofort. Bestimmt hat er das Martinshorn gehört oder die Polizeifahrzeuge in die Straße einbiegen sehen und fragt sich, was passiert ist. An seinem Gesichtsausdruck sehe ich, dass er sich große Sorgen macht.
»Chief Burkholder!«, ruft er.
Ich gehe ihm entgegen. »Mr. Helmuth –«
»Was ist passiert?«, fragt er. »Warum ist hier so viel Polizei? Wo sind meine Kinder? Meine Schwiegermutter?«
»Ein Mädchen sitzt im Streifenwagen, sie ist unversehrt.«
»Eins? Aber …« Ohne den Satz zu Ende zu sagen, eilt er zum Auto, vorbei an Mona und dem Deputy, und blickt hinein. »Annie.« Er nimmt das Mädchen in die Arme.
»Datt!« Schluchzend klammert sie sich an ihn.
»Wo ist deine shveshtah?«, fragt er. Deine Schwester. »Deine großmammi?«
»Da Deivel hat Großmama gekriegt!«, sagt die Kleine schluchzend. »Und Elsie hat er mitgenommen!«
»Was?« Die Aussage erschreckt den amischen Mann so sehr, dass er die Hand auf die Brust drückend zurücktaumelt. »Mitgenommen? Da Deivel?« Er sieht mich an. »Wo sind die beiden, Chief Burkholder? Was ist hier passiert?«
»Mr. Helmuth.« Ich lege ihm die Hand auf den Arm, deute mit dem Blick zu Annie. »Ich muss mit Ihnen allein sprechen.«
Er starrt mich an; dann sieht er hinab auf den Jungen, der hinter ihm hergekommen ist. »Bleiva mitt die shveshtah.« Bleib bei deiner Schwester.
Offensichtlich erschüttert, folgt er mir. Als wir außer Hörweite der Kinder sind, bleibe ich stehen und drehe mich zu ihm um. Es gibt keine schonende Möglichkeit zu sagen, was ich zu sagen habe. Es ist unmöglich, den Schock abzumildern oder den Schmerz, der zwangsläufig darauf folgt, erträglicher zu machen.
»Mr. Helmuth, Mary Yoder ist tot. Sie liegt im Haus.« Ich zeige auf das hundert Meter entfernte Gebäude, wo ein halbes Dutzend Polizisten umherläuft.
»Was?« Er starrt mich ungläubig an, als hätte ich ihm einen üblen Streich gespielt und würde ihm gleich auf den Rücken klopfen und zugeben, dass es ein Scherz war.
»Aber … tot? Wie –« Er bricht den Satz ab, sieht mir in die Augen. »Das ist unmöglich. Mary ging es gut, als sie vorhin weggefahren ist.«
Ich suche nach den richtigen Worten, um das Geschehen so zu vermitteln, dass er nicht die Fassung verliert, doch mir fallen nur Fakten ein, die äußert schmerzhaft für ihn sein werden. »Im Moment weiß ich nur, dass Mary Yoder nicht mehr lebt und wir Ihre andere Tochter nicht finden können.«
»Elsie?« Er bemüht sich, ruhig zu bleiben. »Wir müssen sie finden«, sagt er gereizt. »Sie muss hier irgendwo sein.«
»Im Haus ist sie nicht, und wir suchen gerade das Grundstück ab. Kann es sein, dass sie zu Hause ist?«
»Nein. Sie war mit ihrer Schwester und Großmutter zusammen.«
»Mr. Helmuth, Ihre Schwiegermutter wurde Opfer eines Verbrechens –«
»Was? Jemand hat ihr etwas angetan?«
Ich nicke. »Annie hat mir erzählt, ein Mann hätte Elsie mitgenommen. Wir haben Grund zu der Befürchtung, dass es derselbe Mann ist, der Ihre Schwiegermutter überfallen hat.«
»Er hat sie mitgenommen? Mein Gott.« Erst jetzt versteht er die ganze Dimension des Geschehens. Sein Mund geht auf, aber kein Wort kommt heraus. Er starrt mich an; seine Hutkrempe beginnt zu zittern. »Wer?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wir müssen Elsie finden«, sagt er. »Sie ist noch ein Kind.«
Er zittert am ganzen Körper, kann sein Entsetzen nicht länger kontrollieren. Er hebt die Hand, drückt Daumen und Mittelfinger auf die Augen. »Chief Burkholder, was ist mit meiner Schwiegermutter passiert? Wie ist sie …«
Da ich ihn nicht noch mehr aus der Fassung bringen will, solange ich nicht alle Fakten habe, weiche ich aus. »Ich bin mir nicht sicher, aber es ist schlimm.«
Er nickt, sieht verwirrt und überrascht aus, aber hauptsächlich entsetzt. »Miriam will es sicher wissen.«
Ich verdächtige den Mann in keiner Weise, und doch checke ich während der Unterhaltung, ob er irgendwelche Wunden oder Blut an Kleidung oder Händen hat. Aber ich entdecke nichts. »Mr. Helmuth, ist es möglich, dass ein Nachbar oder jemand aus der Familie Elsie abgeholt und mit nach Hause genommen hat?«
»Nein«, fährt er mich zunehmend ungeduldig an. »Meine Kinder waren mit ihrer großmuder hier, um Walnüsse aufzusammeln, und sonst nirgends.«
»Kann es sein, dass Elsie Angst bekommen hat und heimgerannt ist?«
»Ich habe sie nicht gesehen, aber …«
»Wir müssen das schnellstens überprüfen.« Ich zeige zum Explorer, und wir gehen zum Auto. »Haben Sie Telefon zu Hause?«
»Nein.«
»Ich weiß, Sie haben gerade eine Menge zu verkraften, aber Zeit ist jetzt ein wichtiger Faktor, und wir müssen uns beeilen. Holen Sie Annie, und kommen Sie mit mir.«
Der amische Mann erwacht aus seiner momentanen Starre und sieht zu dem Jungen. »Bringa da waegly haymet«, fordert er ihn auf. Fahr mit dem Buggy nach Hause.
»Nimm nur das Pferd mit«, wende ich ein. »Der Buggy muss noch nach Spuren untersucht werden.«
Der Mann nickt dem Jungen zu, dann machen wir uns auf den Weg.
Eine Minute später biege ich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kiesweg zur Farm der Helmuths ein und presche bis hinter das Haus. Helmuth öffnet die Beifahrertür, noch bevor der Wagen zum Halten kommt, und springt hinaus.
»Miriam!«, ruft er und eilt zur hinteren Veranda. »Finna Elsie! Finna Elsie!« Finde Elsie.
Die Fliegengittertür geht knarrend auf. Eine korpulente amische Frau mit ausladenden Hüften und einem freundlichen, erschöpften Gesichtsausdruck sieht zu dem Mann, der ihr entgegenrennt. »Was der schinner is letz?« Was ist denn los?
»Elsie ist verschwunden«, sagt er und bleibt vor ihr stehen. »Ist sie nach Hause gekommen?«
»Nein«, sagt die Frau verwundert. »Sie ist doch mit –«
Er schneidet ihr das Wort ab. »Sieh im Haus nach, ich gucke in der Scheune.«
Er läuft zur Scheune. Die Frau wirft mir einen besorgten, fragenden Blick zu, dann verschwindet sie im Haus.
Ich steige aus dem Explorer und öffne der Kleinen auf der Rückbank die Hintertür. Sie gibt keinen Ton von sich, aber ihre Wangen sind tränennass. Wieder fällt mir das getrocknete Blut an ihren Händen auf, und ich würde sie lieber tröstend in den Arm nehmen, als sie zu befragen. »Komm, wir gehen ins Haus, Schätzchen.«
Ich nehme sie an die Hand und gehe mit ihr zur Hintertür, durch die wir einen Vorraum mit verschmutztem Holzboden betreten. Zu meiner Rechten sind mehrere Fenster, in der Ecke steht eine alte Wäschemangel und an der Wand ein Waschtisch. Eine Wäscheleine mit zahlreichen Hosen teilt den Raum in der Mitte.
Annie und ich sind gerade weiter in die Küche gegangen, als hinter uns die Fliegentür zuschlägt. Ich höre Schritte, und dann kommt Ivan Helmuth hinein. »In der Scheune ist sie nicht«, sagt er atemlos.
Kurz darauf erscheint Miriam. »Elsie ist nicht oben und auch nicht im Keller. Warum suchen wir sie? Was ist passiert? Wo ist Mamm?«
»Elsie ist verschwunden.« Ivans Stimme bricht. »Mary ist … von uns gegangen.«
»Von uns gegangen? Aber … Wie meinst du das? Du weißt nicht, wo sie ist? Aber Ivan, Mamm ist bei den Kindern. Sie sind –« Jetzt wandert ihr Blick zu Annie, sie entdeckt das Blut und reißt die Augen auf. »Mein Gott.« Sie eilt zu Annie, fällt auf die Knie und nimmt sie in die Arme. »Bist du verletzt? Woher kommt denn das Blut?«, fragt sie auf Deitsch.
»Da Deivel«, flüstert das kleine Mädchen.
Miriam erbleicht. Selbst ihre Lippen sind ganz weiß. »Was redest du da?« Sie schiebt ihre Tochter auf Armeslänge von sich, um sie genauer zu betrachten. »Von wem ist das Blut? Wo ist das her?« Sie drückt die Kleine fest an sich, wirft ihrem Mann und dann mir einen fragenden Blick zu. »Chief Burkholder, was ist passiert?« Ihre Stimme wird mit jedem Wort lauter.
»Mrs. Helmuth, ich muss mit Ihnen und Ihrem Mann sprechen, allein.« Ich deute mit den Augen zu ihrer Tochter.
Sie erhebt sich von den Knien, nimmt das Mädchen bei der Hand, eilt aus der Küche hinaus und bleibt unten an der Treppe stehen. »Irma!«, ruft sie nach oben.
Ein etwa zehn Jahre altes Mädchen kommt polternd die Treppe herunter, verlangsamt aber den Schritt, als sie mich sieht. Ihr Blick huscht zurück zu ihrer Mutter. »Was ist passiert?«
»Kümmer dich um Annie. Wasch sie.«
Als sie das Blut entdeckt, reißt sie die Augen auf. »Oh!«
»Geh jetzt. Wasch sie, schnell.«
Nachdem die Kinder fort sind und wir uns gesetzt haben, berichte ich ihr alles.
»Mamm ist tot? Aber …« Miriam beugt sich vornüber, bedeckt das Gesicht mit den Händen und beginnt, vor und zurück zu schaukeln. »Elsie verschwunden? Mein Gott. Das kann ich nicht glauben, das ist zu viel.«
Ivan sieht mich an. »Wer macht denn so etwas Furchtbares?«
»Hatte Ihre Schwiegermutter vielleicht Feinde?«, frage ich. »Hatte sie mit jemandem Streit oder eine Meinungsverschiedenheit?«
Das Paar sieht sich an, als wäre die Antwort im Gesicht des Ehepartners zu finden. »Nein«, sagt Ivan kurz darauf.
»Ist vielleicht früher etwas passiert, was zu der Zeit nicht wichtig schien?«, dränge ich weiter, damit sie ihren Kummer und die Angst um ihre Tochter einen Moment beiseiteschieben und nachdenken.
»Nein.« Der amische Mann zuckt die Schultern. »Nichts.«
»Ist Annie oder Elsie vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Irgendein merkwürdiger Vorfall? Vielleicht als Sie zusammen in der Stadt einkaufen waren? Oder Erledigungen gemacht haben? Vielleicht hat ja jemand etwas gesagt, was Ihnen merkwürdig vorkam?«