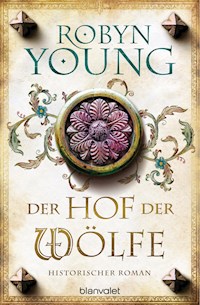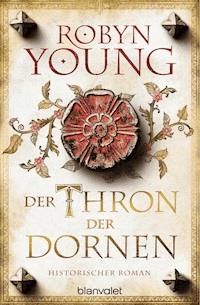4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Robert The Bruce
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Schottlands größter Freiheitskämpfer Robert the Bruce – Kämpfer im Krieg, König im Exil, Ehemann der Feindestochter, Freund, Mörder und eine Legende
Robert the Bruce – Schottlands größter Krieger im Kampf um die Unabhängigkeit – verlor alles, was er liebte, Familie, Freunde, seine Heimat und sein Land! Doch er gab niemals auf, brach seinen Treueschwur gegenüber Englands Krone, und zog aus, sein Volk in die Freiheit zu führen … Die neue Trilogie von Bestsellerautorin Robyn Young erzählt die packende Legende dieses Mannes, der vom Krieger und umjubelten Anführer der aufrührerischen Schotten zum Eroberer des Thrones wurde – ein Held, der die Geschichte einer ganzen Nation prägte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 962
Ähnliche
Robyn Young
Rebell der Krone
Roman
Aus dem Englischenvon Nina Bader
Buch
Schottland im Jahre 1286. Ein ganzes Volk trauert, denn ihr König, Alexander III., kam bei einem Reitunfall tragisch ums Leben. Doch sein Tod war kein Unfall, und seine Mörder schmieden bereits eifrig Pläne, die Herrschaft über das geschwächte Land zu ergreifen, dessen einzige Thronfolgerin ein kleines Mädchen ist. Der gewiefte englische König Edward holt sich jedoch vom Papst die Erlaubnis, seinen kleinen Sohn mit der schottischen Kronprinzessin zu vermählen. Der skrupellose Engländer sieht hier eine Möglichkeit, den schottischen Thron unblutig an sich zu bringen. Doch die Schotten wollen mit aller Macht verhindern, dass ein Engländer ihre Krone ergreift und kämpfen unter sich um die Nachfolge des Königs. Der junge Robert Bruce, Enkel eines der mächtigsten Adligen des Landes, ist einer der Anwärter auf den Thron. Als die Infantin auf der Reise nach England jedoch an einer mysteriösen Krankheit stirbt, bricht in Schottland endgültig das Chaos aus. Mit Hilfe des englischen Königs besteigt schließlich John Balliol den Thron. Was Edward zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Balliols Männer sorgten für die »Krankheit«, der die Infantin zum Opfer fiel. Der Konflikt spitzt sich zu und wird zu einem offenen Krieg, als die schottischen Lords Balliol zwingen, eine Rebellion gegen den englischen König zu initiieren.
Robert und sein Vater beziehen Stellung, indem sie Edward die Treue schwören. Doch bereits ein Jahr danach bricht Robert seinen Schwur und schließt sich den rebellierenden Schotten an. Vorerst, denn es wird der Tag kommen, an dem Robert eine unglaubliche Entscheidung trifft, die für eine ganze Nation alles aufs Spiel setzt …
Autorin
Mit ihrem Debüt Die Blutschrift gelang der Britin Robyn Young in Großbritannien und den USA ein großartiger Durchbruch, der sie auf die Bestsellerlisten schnellen ließ. Geboren 1975 in Oxford, begann sie schon früh, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben. Aber erst während eines Seminars in Kreativem Schreiben, fand sie den Mut, ihre Ideen zu Die Blutschrift zu Papier zu bringen. Heute lebt Robyn Young in Brighton und wenn sie nicht gerade an einer historischen Trilogie schreibt, unterrichtet sie Kreatives Schreiben an verschiedenen Colleges.
Bei Blanvalet von Robyn Young bereits erschienen:
Die Blutschrift (36657) · Die Blutritter (36658) · Die Blutsfeinde (36659)
Ah, Gott!Wie oft sprach Merlinin seinen Prophezeiungen die Wahrheit, wenn dusie lasest.Nun sind die beiden Ströme vereint,die von mächtigen Bergen getrennt wurden.Und aus zwei verschiedenen Reichen entstand eines,das von zwei Königen regiert wurde.Jetzt haben die Bewohner der Inseln wieder zueinander-gefunden,Und Alba ist vereint unter den Herrschern,über denen allen König Edward steht.Cornwall und Wales befinden sich in seiner Hand,und das stolze Irland beugt sich seinem Willen.Es gibt keinen König oder Prinzen in all diesen Ländernaußer König Edward, der sie zusammenbrachte …
Peter Langtoft (englischer Chronist, ca. 1307)
Prolog
A.D. 1262
König Artus selbst wurde tödlich verwundet, und als er zu der Insel Avalon gebracht wurde, um dort geheilt zu werden, übergab er die Krone Britanniens im Jahr 542 der Menschwerdung unseres Herrn seinem Verwandten Konstantin, dem Sohn des Cador und Herzog von Cornwall.
Geoffrey of Monmouth,»Die Geschichte der Könige Britanniens«
Gascogne, FrankreichA.D. 1262
Die Pferde wieherten schrill. Klingen durchschnitten die Luft, fraßen sich in Schilde und prallten auf Helme. Männer stießen durch ihre Visiere heisere Drohungen und Verwünschungen aus; sengende Schmerzen schossen bei jedem Hieb durch ihre Arme und Schultern. Von der ausgedörrten Erde stiegen Staubwolken auf und färbten die Luft über den Weingärten gelblich. Der Geruch der in der Hitze angeschwollenen Trauben brannte bitter in ihren trockenen Kehlen, salziger Schweiß tropfte ihnen in die Augen und blendete sie.
Mitten im Kampfgetümmel hob ein Mann in einem rotgoldenen Überwurf gerade seinen Schild, um einen weiteren Hieb abzuwehren. Sein Pferd bäumte sich unter ihm auf, doch er brachte es mit seinen Sporen zur Ruhe, ging zum Gegenangriff über und rammte sein Schwert in die Seite seines Gegners, durchbohrte Leinen und Polster und traf auf das Kettenhemd darunter. Neben ihm ließ ein hochgewachsener Mann in einem blau-weiß gestreiften Umhang seine Waffe mit voller Wucht auf den Rücken eines Ritters niedersausen, wobei er vor Anstrengung Speichel in sein Visier sprühte. Der Getroffene kippte vornüber, sein Schwert entglitt ihm, und als sein Pferd stolperte, wurde er aus dem Sattel geschleudert. Er schlug hart auf dem vom Saft geplatzter Trauben schwarz verfärbten Boden auf und rollte sich in dem Versuch, den Hufen der Schlachtrösser ringsum auszuweichen, von einer Seite zur anderen. Eines traf ihn seitlich am Kopf und zermalmte seinen Helm, danach trampelten die anderen über seinen Körper, während der Kampf seinen Fortgang nahm.
Der Mann in Rotgold schwang sein Schwert mit einem wilden Kriegsruf durch die Luft, der sogleich von seinen Gefährten aufgenommen wurde.
»Artus!«, donnerten sie. »Artus!«
Neue Kraft strömte in erschöpfte Glieder, neue Luft in ausgepumpte Lungen. Die Männer kämpften jetzt erbarmungslos, gewährten keine Gnade. Nachdem weitere Gegner zu Boden gegangen oder von ihren Pferden gestoßen worden waren, wurde über dem Schlachtfeld ein Banner gehisst und flatterte im Wind. Es war blutrot, und darauf prangte ein sich aufbäumender, Feuer speiender Drache.
»Artus! Artus!«
Der Mann in dem blau-weißen Umhang hatte sein Schwert verloren, kämpfte aber, seinen Schild als Waffe einsetzend, mit unverminderter Heftigkeit weiter, traf mit dem oberen Rand den Kiefer eines Widersachers, fuhr herum und schmetterte den Schild gegen das Visier eines anderen. Über einen Ritter verärgert, der sich weigerte, sich zu ergeben, packte er den Mann am Hals und zerrte ihn aus dem Sattel. Als sein Gegner zwischen den Pferden hinabglitt und vor Wut brüllend nach Halt suchte, ertönten Fanfaren.
Bei diesen Tönen ließen die berittenen Männer einer nach dem anderen langsam ihre Schwerter sinken und versuchten nach Atem ringend, ihre aufgeregten Schlachtrösser zu bändigen. Die am Boden Liegenden rappelten sich auf und gaben sich Mühe, sich einen Weg durch das Gewühl zu bahnen, wurden aber augenblicklich von wartenden Fußsoldaten umringt, die Krummschwerter schwangen. Ein Mann, der zwischen den Weinreben hindurch zu entkommen versuchte, wurde zurückgeschleift und durch Tritte zur Kapitulation gezwungen. Knappen begannen die reiterlosen Pferde einzufangen.
Der Mann in Rotgold nahm seinen mit silbernen Drachenflügeln verzierten Helm ab. Ein junges Gesicht mit markanten Zügen und hellen grauen Augen kam zum Vorschein. Ein Lid hing ein wenig herab, was ihm ein leicht verschlagenes Aussehen verlieh. Edward sog die staubige Luft tief ein, während sein Blick über die besiegten Männer schweifte, von denen die letzten gerade entwaffnet wurden. Eine ganze Anzahl war im Kampf verwundet worden, zwei von ihnen schwer. Einer schwankte im Griff seiner Kameraden und stöhnte laut, weil ihm die Schneide- und Vorderzähne ausgeschlagen worden waren.
»Ein weiterer Sieg, Neffe.«
Die barsche Feststellung kam von dem Mann in dem blauweiß gestreiften Umhang, welcher hie und da mit kleinen roten Vögeln bestickt war. William de Valence hatte seinen Helm abgenommen und sein Visier heruntergeklappt, sodass es über den eisernen Kragen hing, der dafür sorgte, dass der Helm nicht verrutschte. Schweiß strömte über sein rundes Gesicht.
Ehe Edward etwas erwidern konnte, rief einer der Knappen: »Hier ist ein Toter, Mylord!«
Edward drehte sich um und sah, dass sich der junge Mann über einen Leichnam beugte. Der Überwurf des Toten war mit Staub bedeckt, sein Helm wies eine tiefe Delle auf. Blut war aus einer seiner Augenhöhlen gequollen. Andere Männer blickten gleichfalls zu dem Leichnam hinüber, während sie sich den Schweiß aus dem Gesicht wischten.
»Nimm ihm Rüstung und Schwert ab«, befahl Edward dem Knappen nach einer kurzen Pause.
»Lord Edward!«, protestierte einer der Männer, die zusammengetrieben und entwaffnet worden waren. Er trat vor, aber die ihn umringenden Fußsoldaten versperrten ihm sogleich den Weg. »Ich erhebe Anspruch auf die sterblichen Überreste meines Kameraden!«
»Nachdem die Lösegeldforderungen ausgehandelt und die Summen entrichtet worden sind, könnt Ihr ihn begraben, darauf habt Ihr mein Wort. Aber seine Ausrüstung gehört mir.« Edward reichte einem anderen Knappen seinen Drachenflügelhelm und seinen Schild, griff nach den Zügeln und trieb sein Pferd zwischen den Weinstöcken hindurch.
»Bringt die Gefangenen«, gebot William de Valence den Fußsoldaten.
Der Rest von Edwards Männern folgte ihm. Das Drachenbanner erhob sich wie eine Faust über ihren Köpfen und zeichnete sich dunkel von der einsetzenden Dämmerung ab. Der Trupp ritt davon, überließ es den Knappen, zerbrochene Waffen und verwundete Pferde einzusammeln, und achtete nicht auf die Arbeiter, die angerannt kamen und angesichts der zerstörten Weingärten entsetzte Rufe ausstießen. Das in der vergangenen Nacht errichtete Turnierfeld lag wie gewöhnlich zwischen zwei Städten, aber es ließ sich nicht vermeiden, dass Äcker, Weideland und gar Dörfer in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Als er sein Pferd im Schritt über die Felder gehen ließ, streifte Edward seine Handschuhe ab. Trotz des Lederpolsters wiesen seine Handflächen Blasen auf. Hinter sich hörte er das Gemurmel einiger seiner Männer. Vermutlich sprachen sie von dem Toten und seiner schroffen Reaktion auf den Vorfall – immerhin war dies nur ein Spiel, und die Gegner waren keine echten Feinde. Aber Turniere währten nicht ewig. Bald würden das Schlachtfeld und die Feinde darauf nur allzu gegenwärtig sein. Dann mussten sie gewappnet sein.
Er öffnete und schloss seine schmerzenden Hände und sah den neben ihm reitenden de Valence an. Der Mann saß entspannt auf seinem Pferd, den massigen Körper gegen die hohe Sattellehne gestützt. Die miteinander verbundenen Ringe seines Kettenhemdes klirrten leise. Im Gegensatz zu den jüngeren Rittern schien er sich an dem Zwischenfall nicht zu stören, sondern säuberte in aller Ruhe die abgenutzte Klinge seines Schwertes, die wesentlich schärfer wirkte als die stumpfen Waffen, derer sich Edward und der Rest der Männer bedient hatten.
Valence, der Edwards Blick auffing, lächelte wissend. »Wo gehobelt wird, da fallen Späne, Neffe. Das ist immer so.«
Edward sagte nichts dazu, nickte aber, als er sich wieder zur Straße drehte. Er hatte nicht die Absicht, über Turnierregeln zu streiten, nicht, nachdem ihm sein Halbonkel geholfen hatte, die meisten Turniere zu gewinnen, die er während dieser Saison mit seiner Truppe bestritten hatte. Das hatte ihm genug Pferde und Rüstungen eingetragen, um eine ganze Armee damit auszustatten, von den Dutzenden junger Männer ganz zu schweigen, die von seinem wachsenden Ruhm angelockt worden waren. Bei einem Siegesfest vor einigen Monaten hatte einer von ihnen ihn Artus genannt, und der Name war haften geblieben – mehr und mehr Freiwillige schlossen sich der unter dem Drachenbanner kämpfenden Truppe an. Valence mochte ein ungehobelter Klotz sein, dessen Ruf äußerster Grausamkeit weit über die Grenzen seiner französischen Geburtsstadt hinausgedrungen war, aber sein Geschick auf dem Turnierfeld verlieh ihm zusammen mit dem Umstand, dass er zu den wenigen Mitgliedern von Edwards Familie gehörte, die sich nicht von ihm abgewandt hatten, einen unschätzbaren Wert, und so ließ Edward seinem Onkel freie Hand und ignorierte dessen Wutausbrüche und zahlreichen Indiskretionen.
Als ein paar der älteren Ritter ein zotiges Siegeslied anstimmten, in das andere bald einfielen, drehte sich Edward um, um die Reihen grinsender, schweißglänzender Gesichter zu mustern. Die meisten waren wie er Anfang zwanzig, viele jüngere Söhne des französischen Adels, die von der Aussicht auf Beute und Ruhm angelockt worden waren. Nach Monaten voller Turniere kannte Edward sie gut. Alle würden jetzt bedingungslos für ihn kämpfen. Nur noch ein paar Wochen Training, dann wären sie bereit. Dann würde er an der Spitze einer Armee nach England zurückkehren, um seine Ehre und sein Land zurückzugewinnen.
Neun Monate zuvor hatte sein Vater, der König, ihn ins Exil geschickt. Sogar seiner Mutter hatte das Urteil die Sprache verschlagen: die Zurücknahme seiner Ländereien in Wales und England, die ihm mit fünfzehn als Teil des Heiratskontrakts übertragen worden waren. König Henry hatte in grimmigem Schweigen zugesehen, wie sein Sohn den Palast von Westminster verlassen und sich auf den Weg nach Portsmouth und zu dem Schiff gemacht hatte, das ihn zu seinem einzig noch verbliebenen Landsitz in der Gascogne bringen würde. Edward erinnerte sich daran, sich noch ein Mal umgedreht zu haben, nur um festzustellen, dass sich sein Vater bereits abgewandt hatte und durch die Palasttore schritt. Mit zusammengepressten Lippen verdrängte er das Bild und richtete sein Augenmerk auf den Anblick der Ritter, die ihm in Hochstimmung auf ihren erschöpften Tieren folgten und dabei den Namen Artus sangen. Sein Vater würde sich gezwungen sehen, sich zu entschuldigen, wenn er erfuhr, was für ein Krieger aus seinem Sohn geworden war – von seinen Männern nach dem größten König benannt, der je gelebt hatte.
Das Abendrot verblasste, und die ersten Sterne funkelten am Himmel, als die Gruppe in den Hof des von Nebengebäuden umgebenen und vom Wald eingeschlossenen Jagdhauses ritt. Edward stieg ab, übergab sein Pferd einem Stallburschen und wies William de Valence an, die Gefangenen gut zu bewachen, sobald sie eingetroffen sein würden. Dann steuerte er auf das Haupthaus zu, um sich den Staub aus dem Gesicht zu waschen und seinen Durst zu stillen, bevor die anderen Kommandanten erschienen und die Lösegeldsummen festgelegt werden konnten. Er musste sich aufgrund seiner Statur unter dem Türsturz hinwegducken, betrat das Haus und schritt an den Dienstboten vorbei zu den oberen Räumen und seinem Privatgemach.
Sein Kettenhemd und seine Sporen klirrten, als er über den Holzfußboden schritt. Er löste den Gurt, an dem sein Breitschwert hing, warf die Waffe auf das Bett und genoss es, den Druck an seiner Hüfte nicht mehr zu spüren. Der Raum lag im Dämmerlicht da, nur eine einzige Kerze brannte auf einem Tisch am Fenster. Dahinter hing ein Spiegel. Als er in den Kerzenschein trat, sah Edward sich selbst aus den Tiefen des Glases auftauchen. Ein Wasserkrug und eine Waschschüssel standen bereit, daneben lag ein Leinentuch. Er beförderte den Stuhl vor dem Tisch mit einem Tritt zur Seite, goss Wasser in die Schüssel, beugte sich darüber und schöpfte etwas davon in seine Hände. Es fühlte sich wie Eis auf seinem erhitzten Gesicht an. Er schöpfte mehr, spürte, wie es über seine Haut rann und Schweiß und Blut fortwusch. Als er fertig war, griff er nach dem Tuch und betupfte damit seine Augen. Und als er es wieder sinken ließ, sah Edward seine Frau vor sich stehen. Ihr dichtes Haar fiel ihr in Wellen bis zur Taille hinab. Allzu oft war es aufgesteckt und unter Schleiern und Hauben versteckt. Er liebte es, es offen zu sehen, und sonnte sich in dem Wissen, dass er der einzige Mann war, der dieses Vorrecht genoss.
Eleanor von Kastiliens Mandelaugen verengten sich, als sie lächelte. »Du hast gewonnen.«
»Woher weißt du das?« Er zog sie an sich.
»Ich habe die Männer schon aus einiger Entfernung singen hören. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich es dir vom Gesicht abgelesen.« Sie strich über seine stoppelige Wange.
Edward nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände, zog sie noch enger an sich und küsste sie. Sie duftete nach der Honig- und Kräuterseife aus dem Heiligen Land, die sie stets benutzte.
Eleanor machte sich lachend von ihm los. »Du bist nass!«
Edward grinste, küsste seine junge Frau erneut, presste sie trotz ihrer Proteste an sich und besudelte ihr fleckenloses Hemd mit Schmutz von seinem Überwurf und Kettenhemd. Endlich gab er sie frei und hielt nach Wein Ausschau. Eleanor stellte sich auf die Zehenspitzen, legte die Hände auf seine Schultern, drückte ihn auf den Stuhl am Tisch nieder und bat ihn, sitzen zu bleiben, während sie ihm Wein einschenkte.
Edward war zu erschöpft, um seine hinderliche Rüstung abzulegen. Stocksteif saß er da und beobachtete im Spiegel, wie Eleanor aus einem glasierten Krug mit Pfauenfedermuster Rotwein eingoss. Als sie den Krug abstellte und einen Finger rasch unter den Rand legte, um einen Tropfen aufzufangen, den sie dann ableckte, durchzuckte ihn ein Stich der Zuneigung. Es war die Art von Liebe, die mit der Erkenntnis möglichen Verlustes einhergeht. Abgesehen von seinem Onkel war sie die Einzige, die ihm in die Verbannung gefolgt war. Sie hätte in London, im Luxus und der Sicherheit von Windsor oder Winchester bleiben können, denn das Urteil erstreckte sich nicht auch auf sie. Aber sie hatte diese Möglichkeit nicht ein einziges Mal angesprochen.
Als er in Portsmouth an Bord des Schiffes gegangen war, hatte Edward allein im Laderaum gesessen. Dort hatte er, den Kopf in den Händen geborgen, zum ersten Mal geweint, seit er ein Junge gewesen war und sein Vater von denselben Docks aus ohne ihn nach Frankreich gesegelt war. Als er sich die Tränen der Demütigung und, wie er sich eingestand, der Furcht abwischte und sich damit abzufinden versuchte, alles verloren zu haben, kam Eleanor zu ihm. Sie kniete sich vor ihn, nahm seine Hände zwischen die ihren und sagte ihm, sie bräuchten weder den König noch die Königin noch seinen Ränke schmiedenden Paten Simon de Montfort, den Grund seiner Verbannung. Sie brauchten niemanden. Sie hatte entschieden gesprochen, mit festerer Stimme, als er es je zuvor von ihr gehört hatte. Später liebten sie sich in dem säuerlich riechenden Laderaum unter Deck. Sie waren seit sieben Jahren verheiratet, und bislang waren ihre Umarmungen zumeist sanft, fast höflich ausgefallen. Jetzt waren sie hungrig, verströmten ihren Zorn und ihre Furcht ineinander, bis sie beide ausgepumpt liegen blieben, während rings um sie herum die Planken knarrten und das Meer sie von der Küste Englands forttrug.
Ihr Kind – das erste, vielleicht das Ergebnis jenes wilden Liebesaktes – wuchs jetzt in Eleanors Leib heran, der von ihrem bauschigen Hemd verborgen wurde.
Eleanor trat hinter ihn und drückte ihm den Becher in die Hand. Edward trank einen großen Schluck. Der Wein brannte in seiner ausgedörrten Kehle. Als er den Becher abstellte, heftete sich sein Blick auf ein Buch, das am Rand des Tisches, gerade außerhalb des Kerzenlichtkreises lag, wo er es an diesem Morgen zurückgelassen hatte.
»Ich werde die Diener anweisen, dir etwas zu essen zu bringen.«
Als er ihre Hand auf seiner Schulter spürte, erblickte Edward sein Gesicht im Spiegel. Jetzt wirkte es nachdenklich zerfurcht. Er berührte ihre Finger; dankbar dafür, dass sie ihn gut genug kannte, um zu verstehen, dass er allein sein wollte. Sie wandte sich ab und schlang einen Mantel um die Schultern. Edward sah ihr im Spiegel nach, als sie sich zurückzog und ihr schwarzes Haar mit den Schatten verschmolz. Sobald sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, betrachtete er das Buch, dann zog er es über das verschrammte Holz zu sich heran. Es war jetzt alt, denn er besaß es seit seiner Kindheit, der Einband löste sich auf, die Seiten waren fleckig. Die in das Leder eingebrannten Worte waren größtenteils abgewetzt, aber er konnte noch immer die Umrisse erkennen.
Geoffrey of Monmouth, »Die Prophezeiungen des Merlin«
Es gehörte zu den wenigen persönlichen Besitztümern, die er aus England mitgebracht hatte. Im Laufe der Jahre hatte er es viele Male gelesen, zusammen mit Monmouth’ anderen Werken, dem Leben des Zauberers Merlin und der Geschichte der Könige Britanniens, von der gemunkelt wurde, es gäbe mittlerweile mehr Ausgaben davon als von der Bibel. Edward kannte die Heldentaten des trojanischen Kriegers Brutus auswendig, der nach dem trojanischen Krieg gen Norden gesegelt war und Britannien gegründet hatte; er kannte die Geschichte von König Lear und der Ankunft Cäsars. Aber es waren die Sagen von König Artus, die ihn am meisten in ihren Bann geschlagen hatten, von der ersten Prophezeiung, in der Merlin Uther Pendragon weissagte, er werde König werden und sein Sohn nach ihm über ganz Britannien herrschen bis hin zu Artus’ verheerender Niederlage bei Camblam, nach der er seine Krone seinem Vetter Konstantin übergeben hatte, bevor er nach Avalon gesegelt war, um dort geheilt zu werden. Als Edward bei Smithfield in London sein erstes Turnier gesehen hatte, hatte er tiefe Ehrfurcht vor den wie Männer an Artus’ Hof gekleideten Rittern verspürt, von denen einer den legendären König selbst verkörperte.
Als Edward das Buch zur Hand nahm, öffnete es sich wie von selbst an einer Stelle, wo ein Stück Papier zwischen zwei Seiten geschoben worden war. Er starrte die Handschrift des Schreibers an; hörte im Geist die mit der gebieterischen Stimme des Königs diktierten Worte. Er hatte diesen Brief häufig gelesen, seit er ihm überbracht worden war – der erste Kontakt, den er seit seiner Abreise aus London mit seinem Vater hatte. Der Zorn, den er anfangs verspürt hatte, war verflogen. Was blieb, war brennende, freudige Erregung.
Der Brief berichtete von dem Erdboden gleichgemachten Burgen und geplünderten Städten, verwüsteten Feldern und Weiden, verbrannter Erde, Leichen, die in den Straßen und auf den Wiesen verstreut lagen, und Gestank, der die Luft erfüllte wie eine Wolke des Todes. Männer unter dem Befehl des Kriegsherrn Llewelyn ap Gruffud waren aus ihren Bollwerken in den Bergen des alten walisischen Königreichs Gwynedd heruntergeströmt und hatten eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Bei seiner Hochzeit mit Eleanor hatte sein Vater Edward große Ländereien übertragen, zu denen auch ein ausgedehntes Gebiet entlang der Nordküste von Wales, von der Grenze bei Chester bis hin zu den Ufern des Flusses Conwy, gehörte. Laut des Briefes war es dieser Landstrich, der jetzt brannte. Und das nicht zum ersten Mal.
Vor sechs Jahren, als Edward sechzehn gewesen war, hatte Llewelyn die Männer von Gwynedd in einem Aufstand gegen die englische Besatzung seines Herrschaftsgebietes angeführt. Der Überfall erwies sich als unerwartet erfolgreich, und innerhalb weniger Tage befand sich die Region unter Llewelyns Kontrolle, englische Burgen standen in Flammen, Garnisonen waren zur Flucht gezwungen. Edward, dem es an Geldmitteln fehlte, hatte sich an seinen Vater gewandt, sobald die ersten Berichte eingetroffen waren. Der König hatte ihm seine Bitte mit der Begründung abgeschlagen, dies sei für Edward eine gute Gelegenheit, sich als Krieger und Befehlshaber seiner Männer zu bewähren. Doch Edward kannte die Wahrheit. Henry war zu sehr damit beschäftigt, seinen jüngsten Sohn Edmund zum König von Sizilien krönen zu lassen, um ihm Geld oder Unterstützung zu gewähren. Am Ende war er, nachdem ihm einer seiner Onkel eine größere Summe geliehen hatte, alleine mit seinen Männern aufgebrochen, um seine walisischen Ländereien zu retten. Llewelyn hatte ihn vernichtend geschlagen. Er war nach einer einzigen Schlacht zum Rückzug gezwungen gewesen; seine Armee war dezimiert, sein Ruf schwer angeschlagen. Edward erinnerte sich noch immer an die Spottlieder, die über ihn gesungen worden waren. Die siegreichen Waliser hatten sich an seiner Niederlage geweidet.
Inzwischen hatte sich Henry mit seinen absurden Bestrebungen bezüglich Sizilien und der ständigen Begünstigungen seiner Halbbrüder, den berüchtigten Valences, die kürzlich in England eingetroffen waren, bei Hof zunehmend unbeliebt gemacht. Der Anführer der Proteste gegen den König war Edwards Pate, Simon de Montfort, der Earl of Leicester. Montfort hatte viele Anhänger um sich geschart und sich gemeinsam mit ihnen gegen Henry aufgelehnt, was zur Einberufung eines Parlaments in Oxford geführt hatte, bei dem der König den Rückhalt der meisten seiner Edelleute verlor. Über Henrys törichte Handlungsweise und die Niederlage ergrimmt, die Llewelyn ihm beigebracht hatte, hatte sich Edward auf die Seite seines Paten geschlagen und ihn davon überzeugt, sich mit ihm gegen seinen Vater zu verbünden. Nachdem der König von diesem Verrat erfahren hatte, hatte er ihm sein Erbe aberkannt und ihn in die Verbannung geschickt.
Edward las den Brief ein letztes Mal, überflog die letzten Absätze. Dieser Aufstand unterschied sich von früheren dadurch, dass Llewelyn ap Gruffudd das Unvorstellbare gelungen war – er hatte alle Waliser unter seinem Oberbefehl vereint. Bis jetzt waren der Norden und der Süden durch mehr als nur die Berggrenze von Snowdonia getrennt gewesen. Jahrhundertelang hatten die Kriegsherren der drei alten Königreiche von Wales die Alleinherrschaft angestrebt, ständig gegeneinander und gegen die englischen Lords gekämpft, deren Ländereien südlich und östlich an ihr Reich grenzten. Das Land hatte sich stets in Aufruhr befunden. Nun hatte Llewelyn die sich untereinander grollenden streitsüchtigen Menschen zusammengebracht, und ihre Speere und Bögen richteten sich fortan nicht mehr gegeneinander, sondern Richtung Osten auf England. Henry schrieb, dass Llewelyn sich eine goldene Krone aufs Haupt gesetzt und sich zum Prinzen von Wales ausgerufen hatte. Allerdings handelte es sich bei dieser Krone nicht um irgendeinen gewöhnlichen Stirnreif, sondern um die von König Artus.
Edward starrte das Pergament noch einen Moment lang an, dann hielt er es über die Kerze. Die Flammen züngelten wild um das Versprechen seines Vaters, ihm seinen gesamten Landbesitz zurückzugeben, wenn er wiederkam und Llewelyn besiegte. Edward lächelte in sich hinein: Er war bereit. Bereit, mit den unter seinem Banner versammelten Männern heimzukehren, den ihm angestammten Platz in England wieder einzunehmen und die Entschuldigung seiner Eltern zu akzeptieren. Bereit, Llewelyn entgegenzutreten. Die Waliser mochten zum ersten Mal vereint sein, aber darin lag auch ihr Schwachpunkt, wie Edward dem Brief entnahm. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, welche Macht es mit sich brachte, das Gewand einer Legende anzulegen. Auch Llewelyn musste das begriffen haben, denn er hätte kein wirksameres Symbol wählen können, um die Völker von Wales zu vereinen. Artus war für sie nicht nur ein herausragender Krieger, sondern der letzte große britische König vor den Sachsen und den Normannen. Aber wenn etwas so Mächtiges wie diese Krone Völker vereinen konnte, ließ sich daraus nicht folgern, dass es sie auch zu zerstören vermochte?
Als das Pergament zu schwarzer Asche zerfiel, klopfte es an der Tür. Sie öffnete sich, und die massige Gestalt von William de Valence füllte den Türrahmen aus.
»Die Kommandanten sind eingetroffen, um über die Lösegeldsummen für ihre Männer zu verhandeln.«
Edward erhob sich und ließ die Reste des Briefes sowie das Buch zurück. Die Worte auf den Seiten schimmerten schwarz.
Erster Teil
A.D. 1286
Es war Nacht, und die Mondsichel schien hell …Vom Gipfel eines luftigen Berges aus betrachtete der Prophet den Lauf der Sterne und sprach laut zu sich selbst: »Was hat dieser Strahl des Mars zu bedeuten? Sagt mir seine junge Röte, dass ein König tot ist und ein anderer seinen Platz einnehmen wird?«
Geoffrey of Monmouth, »Das Leben des Zauberers Merlin«
1
Es war die Stimme Gottes. Und Gott ließ sie seinen Zorn spüren.
Der Kellermeister des Königs, der sich zwischen den Tischen und Bänken hindurchzwängte, zuckte zusammen, als erneut ein greller Blitz über den Himmel zuckte und ein dröhnendes Donnergrollen in der Ferne erklang. Auf der anderen Seite der überfüllten Halle neigte einer der jüngeren Diener den Kopf. Der alte Kellermeister nahm an, dass er ein kurzes Gebet sprach. Direkt über ihnen tobte der Sturm, fegte über die Türme und Brustwehren, verdunkelte das fahle Nachmittagslicht und tauchte die Burg in ein frühes Mitternachtsdunkel. Die Atmosphäre von Furcht, vor einigen Monaten durch unheilvolle Gerüchte ausgelöst, hatte jetzt eine so greifbare Spannung erzeugt, dass sich sogar Guthred – der für all das Gerede nur Hohn und Spott übrig gehabt hatte – dem allgemeinen Unbehagen nicht zu entziehen vermochte.
Beim nächsten Blitz blickte er zu den Balken hoch über dem flackernden Fackelschein empor und fragte sich, was wohl geschehen würde, falls der Blitz in das Dach einschlug. Er stellte sich eine biblische Szene vor: Weißes Feuer regnete auf sie herab, verkohlte Leichen, die noch Messer und Becher umklammert hielten, lagen auf dem Boden verstreut. Würden sie wieder auferstehen? Er betrachtete den Krug in seinen altersfleckigen Händen. Würde ihm diese Gnade gewährt werden? Mit halb geschlossenen Augen begann Guthred ein Bittgebet zu murmeln, brach dann jedoch abrupt ab. So ein Unsinn! Es waren diese furchtbaren Märzstürme, die die alten Weiber von Unglück zetern und die Geistlichen das nahe Ende prophezeien ließen. Aber als er seinen Weg durch die Halle fortsetzte, fiel es ihm dennoch schwer, die Stimme zu ignorieren, die ihm zuraunte, dass die Gerüchte, lange bevor der Norden seinen Rachen geöffnet und Schnee, Unwetter und Donner über Schottland ausgespien hatte, im Umlauf gewesen waren.
Den Krug fest umklammernd, um keinen Tropfen der darin enthaltenen kostbaren Flüssigkeit zu verschütten, erklomm der Kellermeister die hölzernen Stufen des Podests am Ende der großen Halle. Mit jedem Schritt erhob er sich über die Köpfe der Lords, königlichen Beamten, Diener, Hunde und Höflinge, die unter ihm um Platz und Aufmerksamkeit kämpften. Guthred hatte bereits bemerkt, dass die Türhüter auf Geheiß des Haushofmeisters mehrere junge Burschen aus der Halle gewiesen hatten, denen es gelungen war, sich uneingeladen einzuschleichen. Festtage verliefen immer chaotisch: die Ställe waren überfüllt, die Unterkünfte mancher Lords nicht bereit, Botschaften wurden falsch ausgerichtet, Diener verrichteten ihre Tätigkeiten in ihrer Eile ungeschickt und wurden von ihren Herren ungehalten angefahren. Doch trotz all dieser Widrigkeiten und des schlechten Wetters schien sich der König in guter Stimmung zu befinden. Er lachte über irgendetwas, das der Bischof von Glasgow gerade gesagt hatte, als Guthred zu ihm trat. Alexanders Gesicht war vom Wein und der Hitze, die die Feuer in den Kaminen der Halle verströmten, gerötet, und er hatte irgendetwas über seinem Gewand verschüttet. Das Stroh rund um den Tisch auf dem Podest, heute Morgen frisch ausgelegt, klebte jetzt vor Honigkuchenkrümeln, vergossenem Wein und blutigem Fleischsaft. Guthred musterte die kostbaren silbernen Platten und Becher und erfasste mit einem diskreten Nicken sofort, wem er nachschenken musste. Die Stimmen der acht Männer zu beiden Seiten des Königs wurden in dem Versuch, den Sturm und einander zu übertönen, immer lauter, und der alte Kellermeister musste sich vorbeugen, um sich verständlich zu machen.
»Noch Wein, Mylord?«
Ohne sein Gespräch zu unterbrechen, hielt ihm König Alexander seinen Kelch hin, der größer als die anderen und mit Juwelen besetzt war. »Ich dachte, diese Angelegenheit wäre endgültig geklärt«, brummte er, an den Mann zu seiner Linken gewandt. Nachdem der Kellermeister ihm den blutroten Wein eingeschenkt hatte, nahm der König einen großen Schluck.
»Verzeiht mir, Mylord«, erwiderte der Mann, dabei hielt er eine Hand über seinen eigenen Kelch, als der Kellermeister sich anschickte, ihn erneut zu füllen. »Aber die Bitte um …«
»Danke, Guthred«, sagte der König, als der Kellermeister zu dem Bischof von Glasgow trat, der seinen Becher bereits gehoben hatte.
Die Kiefermuskeln des Mannes spannten sich an. »Mylord, die Bitte um die Freilassung des Gefangenen kommt direkt von meinem Schwager, und als sein Verwandter sowie in meiner Eigenschaft als Justiziar wäre es eine Nachlässigkeit von mir, seinem Anliegen nicht die Aufmerksamkeit zu widmen, die ihm zukommt.«
König Alexander runzelte die Stirn, als John Comyns dunkle Augen ihn forschend musterten. Das Gesicht des Lords of Badenoch wirkte im Fackelschein wächsern, sein Ausdruck war so streng wie seine Kleidung: ein schwarzer wollener Umhang, mit dem grauen Pelz eines Wolfes gesäumt, der so genau zu seinem Haar passte, dass es sich schwer feststellen ließ, wo seine Mähne endete und die des Wolfs begann. Das Wappen auf dem Überwurf, den er darunter trug, war gerade eben sichtbar: ein roter, mit drei weißen Weizengarben bestickter Schild. Der König war von der Ähnlichkeit des Roten Comyn mit seinem Vater fasziniert – dasselbe kalte Gebaren, dieselbe freudlose Miene. Waren alle männlichen Comyns so? Lag es ihnen im Blut? Alexanders Blick schweifte über den Tisch zu dem Earl of Buchan, dem Oberhaupt der Schwarzen Comyns, der wie der Rote Comyn nach den Farben seines Wappens benannt worden war: einem schwarzen Schild mit gleichfalls drei Weizengarben darauf. Er erntete ein wachsames Aufflackern misstrauischer Augen in einem langen, verkniffenen Gesicht. Wären die beiden keine so fähigen Beamten gewesen, hätte er sie vielleicht schon vor Jahren vom Hof verbannt. Wenn er ehrlich war, musste er zugeben, dass die Comyns ihm Unbehagen einflößten. »Wie ich schon sagte – ich werde darüber nachdenken. Thomas of Galloway wurde vor über fünfzig Jahren eingekerkert. Er wird zweifellos noch ein paar Jahre in seiner Zelle überstehen.«
»Selbst ein Tag muss einem unschuldigen Mann wie eine Ewigkeit vorkommen.« John Comyn bemühte sich um einen beiläufigen Ton, aber die Herausforderung war unmissverständlich.
»Unschuldig?« Alexanders blaue Augen wurden schmal. Er stellte seinen Kelch ab. Seine gute Laune war verflogen. »Der Mann hat sich gegen meinen Vater aufgelehnt.«
»Der Mann war damals nur ein Junge, Mylord. Es war das Volk von Galloway, das ihn zu seinem Anführer gewählt hat.«
»Und mein Vater hat dafür gesorgt, dass sie mit Blut dafür bezahlt haben.« Alexanders Ton wurde scharf, der Wein erhitzte ihn, und rote Flecken begannen in seinem Gesicht aufzulodern. »Thomas Galloway war ein Bastard. Er hatte kein Recht, die Rolle eines Lords zu bekleiden, und die Leute wussten das.«
»Sie standen vor einer unangenehmen Wahl – entweder von einem Bastard regiert zu werden oder ihr Land zwischen drei Töchtern aufgeteilt zu sehen. Sicherlich könnt Ihr ihre Zwangslage verstehen, Majestät?«
Etwas Verschlagenes schwang in Comyns Stimme mit, registrierte Alexander. Versuchte der Lord of Badenoch anzudeuten, seine eigene Situation sei vergleichbar mit dem, was sich vor über einem halben Jahrhundert in Galloway ereignet hatte? Bevor er sich Gewissheit verschaffen konnte, erklang eine kühle Stimme vom anderen Ende des Tisches her.
»Ihr haltet unseren großmütigen Gastgeber mit Eurem Gerede von seiner Mahlzeit ab, Sir John. Die Ratsversammlung ist vorüber.«
John Comyns Blick wanderte zu dem Sprecher. Als er die ruhigen Augen von James Stewart, dem Großhofmeister, auf sich ruhen sah, ließ er seine undurchdringliche Maske einen Moment lang fallen, und nackte Feindseligkeit malte sich auf seinen Zügen ab, doch bevor er antworten konnte, ertönte die gebieterische Stimme von Robert Wishart, dem Bischof von Glasgow.
»Wohl gesprochen, Sir James. Unsere Münder sind jetzt dazu bestimmt, diese Speisen zu verzehren und Gott dem Herrn für seine üppigen Gaben zu danken.« Wishart hob seinen Kelch. »Dieser Wein ist ausgezeichnet, Mylord. Aus der Gascogne, nicht wahr?«
Die Antwort des Königs ging in einem ohrenbetäubenden Donnerschlag unter, der die Hunde aufschreckte und den Bischof von St. Andrews derart zusammenzucken ließ, dass er seinen Wein verschüttete.
Wishart grinste breit. »Wenn dies tatsächlich der Tag des Jüngsten Gerichts ist, dann werden wir wenigstens mit vollen Bäuchen wiederauferstehen.« Er trank einen großen Schluck, der rote Flecken an seinen Mundwinkeln hinterließ. Der Bischof von St. Andrews, so hager und ernst, wie Wishart stämmig und lebhaft war, setzte zu Protesten an, doch Wishart schnitt ihm das Wort ab. »Ihr wisst so gut wie ich, Eure Exzellenz, dass wir bereits ein Dutzend Mal wiederauferstanden wären, wenn jeder zum Jüngsten Tag erklärte Tag tatsächlich selbiger gewesen wäre!«
Der König wollte etwas einwerfen, hielt jedoch inne, als er in der Menge unter ihm ein bekanntes Gesicht entdeckte. Es gehörte einem der Knappen des Hofes der Königin, einem fähigen Franzosen namens Adam. Sein Reiseumhang glänzte im Fackelschein, und sein dunkles Haar klebte ihm nass am Kopf. Als Adam an einem der Kamine vorbeikam, konnte der König die Kälte sehen, die ihn wie Nebel umgab. Der Knappe hastete die Podeststufen herauf.
»Mylord.« Adam blieb vor dem König stehen, um sich zu verneigen und Atem zu schöpfen. »Ich bringe eine Botschaft aus Kinghorn.«
»In diesem Unwetter?«, wunderte sich Wishart, als sich der Knappe vorbeugte und leise auf den König einzureden begann.
Als Adam geendet hatte, spielte ein Lächeln um Alexanders Lippen, und die vom Wein hervorgerufene Röte auf seinen Wangen breitete sich über seinen Hals aus. »Adam, geh und hol Tom aus seiner Unterkunft. Sag ihm, er soll meinen Umhang bringen und mein Pferd satteln lassen. Wir brechen unverzüglich nach Kinghorn auf.«
»Wie Ihr wünscht, Mylord.«
»Ist etwas geschehen?«, erkundigte sich der Bischof von St. Andrews, während der Knappe über das Podest davoneilte. »Die Königin … ist sie …?«
»Der Königin geht es gut«, erwiderte Alexander breit lächelnd. »Sie verlangt nach meiner Gesellschaft.« Er erhob sich. Bänke wurden gerückt, und Füße scharrten, als alle anderen Gäste in der Halle gleichfalls aufsprangen. Einige stießen ihre berauschten Nachbarn an und bedeuteten ihnen, es ihnen gleichzutun. Der König hob die Hände und wandte sich an sie. »Behaltet bitte Platz. Ich muss mich leider verabschieden, bitte euch aber, zu bleiben und das Fest auch weiterhin zu genießen.« Er gab seinem Harfner ein Zeichen, woraufhin dieser sofort zum Tanz aufzuspielen begann. Die metallischen Klänge erhoben sich über das Tosen des Windes.
Als der König vom Tisch zurücktrat, verstellte ihm James Stewart den Weg. »Mylord, wartet bis morgen früh«, murmelte er. »Es ist ein gefährlicher Tag für eine Reise, besonders auf dieser Straße.«
Die Besorgnis im Gesicht des Großhofmeisters ließ den König zögern. Als er sich umdrehte, las er dieselbe Sorge in den Augen der anderen Männer an seiner Tafel, abgesehen von John Comyn, der sich vorgebeugt hatte, um sich leise mit seinem Verwandten, dem Earl of Buchan, zu unterhalten. Einen Moment lang erwog der König, zu seinem Platz zurückzukehren und Guthred anzuweisen, ihm Wein nachzuschenken. Aber ein anderer Drang war stärker. Die letzten Worte John Comyns hatten einen bitteren Nachgeschmack bei ihm hinterlassen. Sicherlich könnt Ihr ihre Zwangslage verstehen? Das konnte Alexander nur allzu gut, denn die Thronfolgefrage lastete seit zwei Jahren schwer auf ihm – seit dem Tag, an dem sein Erbe, in den er all seine Hoffnungen gesetzt hatte, seiner Frau, seiner Tochter und seinem jüngsten Sohn mit erbarmungsloser Endgültigkeit ins Grab gefolgt war. Nach dem Tod seines Ältesten war Alexanders Blutlinie abgeschnitten worden wie ein Lied, das vor dem Refrain endete. Es klang jetzt nur als schwaches Echo über die Nordsee, in Gestalt seiner dreijährigen Enkelin Margaret, des Kindes seiner ältesten Tochter und des Königs von Norwegen. Ja, Alexander verstand die Zwangslage sehr gut, in die das Volk von Galloway vor fünfzig Jahren geraten war, als ihr Lord ohne männlichen Erben das Zeitliche gesegnet hatte.
»Ich muss gehen, James.« Die Stimme des Königs klang ruhig, aber bestimmt. »Meine Hochzeitsnacht liegt fast sechs Monate zurück, und Yolande ist noch immer nicht in Hoffnung – nicht, dass wir nicht alles dafür getan hätten. Wenn sie heute Nacht mein Kind empfängt, könnte ich, so Gott will, um diese Zeit im nächsten Jahr einen Erben haben. Dafür nehme ich auch einen Sturm in Kauf.« Alexander nahm den Goldreif ab, den er während der Ratsversammlung und des Festes getragen hatte, und reichte ihn dem Großhofmeister. Dann fuhr er sich mit der Hand durch das Haar, das der Reif flachgedrückt hatte. »Ich werde bald zurückkehren.« Sein Blick heftete sich auf John Comyn. »In der Zwischenzeit könnt Ihr dem Lord of Badenoch ausrichten, dass ich der Bitte seines Schwagers stattgeben werde.« Alexanders Augen glitzerten. »Aber wartet damit bis morgen.«
James’ Mundwinkel zuckten leicht. »Sehr wohl, Mylord.«
Alexander schritt über das Podest, folgte den schlammigen Fußspuren des Knappen. Die Goldverzierung seiner scharlachroten Robe schimmerte im Licht. Als die Türhüter sich verneigten und die Flügeltür der Halle öffneten, rauschte der König hindurch. Die Harfenklänge verhallten hinter ihm.
Draußen traf ihn die Wucht des Sturms wie ein Faustschlag. Eisregen stach wie Nadeln in sein Gesicht und blendete ihn, als er die Stufen zum Hof hinunterstieg. Er zuckte zusammen, als ein Blitz den Himmel zerriss. Die Wolken hingen so tief, dass sie die Dächer der Gebäude zu streifen schienen, die sich vor ihm bis zu den inneren Mauern erstreckten, hinter denen der Boden steil zu den äußeren Verteidigungsanlagen abfiel. Von seinem hoch gelegenen Aussichtspunkt aus konnte der König über die Reihe der Außenmauern hinweg bis zu der korporierten Stadt Edinburgh blicken, die sich in östlicher Richtung an dem mächtigen Felsen hinunterzog, auf dem die Burg thronte.
In der Ferne vermochte er am Fuß des Hügels die fahle Silhouette von Holyrood Abbey auszumachen, hinter der schwarze Felsblöcke sich zu windumtosten Klippen erhoben, die in den Wolken verschwanden. Im Norden lagen Weiden und Getreidefelder, dann Marschen, die in die weitläufige Fläche des Firth of Forth übergingen, den die Engländer den schottischen See nannten. Hinter dem von Wetterleuchten erleuchteten Wasser befanden sich die bewaldeten Hügel von Fife und der Weg, den er einschlagen musste. Das zwanzig Meilen entfernte Kinghorn schien in weiterer Ferne zu liegen denn je. Die unheilschwangere Bemerkung des Bischofs von St. Andrews über den Jüngsten Tag kam ihm wieder in den Sinn. Alexander blieb auf der untersten Stufe stehen. Der Regen durchweichte ihn. Doch als er Adam auf sich zueilen sah, zwang er sich, die Füße in den Schlamm zu setzen, und dachte an seine junge Frau, die in einem warmen Bett auf ihn wartete. Dort würde es gewürzten Wein und ein hell prasselndes Feuer geben.
»Mylord, Tom ist krank geworden.« Adam erhob die Stimme über den Sturm. Er hielt den Reiseumhang des Königs in den Händen.
»Krank?« Alexander zog die Brauen zusammen, als der Knappe ihm das pelzgefütterte Kleidungsstück um die Schultern legte. Tom, der ihm seit über dreißig Jahren diente, reiste immer mit ihm. Adam mochte ein fähiger Mann sein, aber er war ein Günstling der Königin und erst im letzten Herbst mit ihrem Gefolge nach Schottland gekommen. »Heute Nachmittag ging es ihm doch noch gut. War der Arzt bei ihm?«
»Er sagt, das wäre nicht nötig.« Adam führte den König über den nassen Untergrund. »Passt auf, wo Ihr hintretet, Sire.«
Vor ihnen brannten Laternen, die Flammen darin glichen kleinen Vögeln in Käfigen, die flatternd gegen das Glas schlugen. Der Wind trug Pferdegewieher und Männerstimmen zu ihnen herüber.
»Wer wird mich an seiner Stelle begleiten?«
»Tom hat Master Brice geschickt.«
Alexanders Stirn furchte sich tiefer, als Adam die Ställe betrat. Der beißende Geruch nach Stroh und Mist stieg ihm in die Nase.
»Majestät«, grüßte der Stallmeister ehrerbietig. Er führte einen prächtigen grauen Hengst am Zügel. »Ich habe Winter eigenhändig für Euch gesattelt, obwohl ich es kaum glauben konnte, als Master Brice mir sagte, Ihr wolltet bei diesem Wetter ausreiten.«
Alexanders Blick wanderte zu Brice, einem wortkargen, etwas begriffsstutzigen Mann, der seit weniger als einem Monat in seinen Diensten stand und als Hilfe für Tom angeheuert worden war. Alexander hatte beabsichtigt, den Haushofmeister zu bitten, ihn zu ersetzen, aber wegen der Vorbereitungen für die Ratsversammlung keine Zeit dazu gefunden. Brice verbeugte sich, sagte aber nichts. Mit einem verdrossenen Grunzen und sich plötzlich allzu nüchtern fühlend streifte Alexander die Reithandschuhe über, die der Stallmeister ihm reichte. Als er auf den Block kletterte und sich in den Sattel schwang, rutschte sein Gewand an seiner Hose hoch. Es war bereits am Saum mit erdigem Schlamm besudelt. Er hätte sich umgekleidet, hätte er nicht befürchtet, das Wenige einzubüßen, das vom Tag noch übrig war. Während der Stallmeister den Sattelgurt mit einem Ruck festzurrte, der Winter veranlasste, ungeduldig aufzustampfen, bestiegen die beiden Knappen die Pferde, die für sie aus dem Stall geholt worden waren. Beide waren kleiner und leichter als das mächtige Schlachtross des Königs. Adam saß auf einem frischen Pferd; sein eigenes war nach dem Ritt nach Edinburgh völlig erschöpft.
Die Stimme des Stallmeisters folgte ihnen durch den Regen. »Gute Reise, Mylord.«
Adam ritt an der Spitze der kleinen Gruppe über den Burghof. Es war noch nicht Abend, trotzdem brannten hinter den Fenstern des Torhauses bereits Fackeln und kämpften gegen die Dunkelheit an. Die Wächter öffneten das Tor, und die drei Männer ritten den dahinter liegenden steilen Pfad hinunter. Bald ragte das Torhaus über ihnen auf dem schwarzen Felsen auf; der Fackelschein verwandelte die Fenster in bernsteinfarbene Augen. Als sie ein zweites Tor in der unteren Mauer passierten, grüßten die Wächter den König voller Überraschung.
Über die durch die Stadt führende Hauptstraße strömte Regenwasser, aber weder Menschen noch Karren waren zu sehen, sodass der König und seine Knappen ihre Geschwindigkeit beschleunigen konnten. Der Wind zerrte an ihren Umhängen und Haaren, und als sie die Stadtgrenze erreichten, waren sie durchnässt und durchgefroren. Von dort aus jagten sie über die Meilen offenen Landes auf den Firth of Forth zu und ließen Edinburgh weit hinter sich.
In Dalmenty stiegen sie vor dem Quartier des Fährmanns ab. Windböen peitschten von der Flussmündung zu ihnen herüber. Es war jetzt vollkommen dunkel. Während Adam an die Tür hämmerte, starrte der König über die sich über zwei Meilen erstreckende angeschwollene tintenschwarze Wasserfläche. Blitze zuckten über die fernen Hügel, und Donner rollte wie eine Welle auf ihn zu. Der Sturm zog Richtung Norden über Fife hinweg.
Der Fährmann öffnete mit einer Laterne in der Hand die Tür. »Ja?«, fragte er in barschem Schottisch. »Ah, Ihr seid es wieder.« Der Mann spähte an Adam vorbei und stutzte verwirrt, als er im Schein seiner Laterne das Gesicht des Königs erkennen konnte. »Mylord!« Er zog die Tür weiter auf. »Ich bitte um Verzeihung. Bitte tretet ein.«
»Ich will nach Kinghorn.« Alexander wechselte rasch von dem Französisch, das er den ganzen Tag über bei der Ratsversammlung gesprochen hatte, in den rauen schottisch-englischen Dialekt.
»Bei diesem Sturm?« Der Fährmann blickte mit sorgenvoller Miene über den Sandstreifen hinter seinem Haus, hinter dem seine Fähre auf den Wellen tanzte. »Ich halte das nicht für klug.«
»Der König hat dir einen Befehl erteilt«, wies ihn Adam scharf zurecht. »Es interessiert ihn nicht, wie du darüber denkst.«
Der Fährmann schlug seine Kapuze hoch und drängte sich an Adam vorbei zu dem König hinüber. »Mylord, ich flehe Euch an, wartet bis zum Morgen. Ich kann Euch und Eure Männer hier beherbergen. Es ist nicht sonderlich komfortabel, aber trocken.«
»Ihr habt meinen Diener etwas früher bereitwillig genug hinübergerudert.«
»Das war lange, bevor der Sturm mit voller Kraft losgebrochen ist. Jetzt – nun, Mylord, es ist einfach zu gefährlich.«
Alexander machte seiner Ungeduld Luft. Es schien, das alles und jeder ihn daran hindern wollten, zu seiner Frau zu gelangen. »Wenn du Angst hast, werden meine Knappen rudern. Aber was immer auch kommt, ich werde heute Abend übersetzen!«
Der Fährmann senkte resigniert den Kopf. »Jawohl, Mylord.« Er machte Anstalten, ins Haus zurückzugehen, drehte sich dann jedoch wieder um. »Gott der Herr weiß, dass ich nicht besser sterben könnte als in der Gesellschaft des Sohnes Eures Vaters.«
Alexander biss die Zähne zusammen, als der Mann im Inneren des Hauses verschwand.
Kurz darauf kehrte er mit sechs Männern zurück, alles Mönche aus Dunfermline Abbey, denen seit den lange zurückliegenden Tagen der Heiligen Margaret das Recht zustand, die Fähre zu rudern. Ihre wollenen Kutten und Sandalen konnten nicht viel Schutz vor dem schneidenden Wind bieten, aber sie beklagten sich nicht, als sie den König zum Wasserrand hinuntergeleiteten. Hinter ihnen kamen Brice und Adam, der die eisernen Steigbügel an den Lederriemen befestigt hatte, damit sie während der Überfahrt nicht gegen die Leiber der Pferde schlugen.
Die Reise dauerte lange und war höchst unbequem; die Männer duckten sich unter dem endlosen Hämmern des Regens auf ihren Kapuzen, die Pferde störte das Schwanken des Schiffes. Gischt stob auf und benetzte ihre Lippen mit Salz, als die Fähre von den Wellen auf und ab geschleudert wurde. Alexander saß, in einen durchweichten Pelz gehüllt, den ihm der Fährmann gegeben hatte, zusammengekauert im Heck. Der Donner war zu einem fernen Grollen abgeebbt, aber der Wind machte keine Anstalten, endlich abzuflauen, und das wehmütige Lied, das die Mönche beim Rudern sangen, war in dem Tosen kaum zu vernehmen. Doch trotz der Befürchtungen des Fährmanns legte das Schiff sicher bei der königlichen Burg von Inverkeithing an.
»Wir nehmen den Küstenpfad«, beschied Alexander Adam, als dieser Winter von der Fähre auf den nassen Sand führte. In manchen der Häuser hinter dem Strand brannten einladende Feuer. »Dort sind wir geschützter.«
»Nicht heute Nacht, Mylord«, warnte der Fährmann, als er dem König den nassen Pelz abnahm. »An manchen Stellen spülen die Springtiden das Wasser bis zu den Klippen hoch. Euch könnte der Weg abgeschnitten werden.«
»Ich schlage vor, wir reiten über die Klippen, Sire«, rief Adam, der gerade Winters Steigbügel wieder herunterzog. »Das geht auch schneller.«
Der König stimmte zu und ritt mit seinen Knappen den Pfad hinauf, der die bewaldeten Hänge hinter Inverkeithing empor zu dem Klippenweg führte. Im Dunkel des Baumkronenbaldachins kamen sie nur langsam voran, aber zumindest bot das Geäst etwas Schutz vor dem Regen. Doch sobald sie den Wald verließen, waren sie dem Sturm wieder hilflos ausgeliefert, der auf sie einhämmerte, während sie dem gewundenen Pfad durch die Klippen folgten. Der Untergrund war schlammig; die Hufe der Pferde sanken tief ein und zwangen sie zu einer kräftezehrenden Gangart. Adam bildete die Vorhut, wies Brice an, sich hinter ihm zu halten, und rief dem König Warnungen zu, wenn sie trügerische Stellen erreichten. Alexander war ein erfahrener Reiter, aber seinem Schlachtross, um einiges größer und wuchtiger als die Pferde der Knappen, fiel der Aufstieg durch den zähen Schlamm zunehmend schwerer, und bald hatte der König den Anschluss an seine Gefährten verloren. Er konnte die Rufe der Männer im Wind hören, sie aber in der undurchdringlichen Finsternis nicht erkennen. Mit zusammengebissenen Zähnen schalt er sich einen Narren, weil er den Rat des Großhofmeisters nicht befolgt hatte, und trieb Winter fluchend und schimpfend weiter, bis das Pferd gereizt schnaubte. Immer wieder beschwor er vor seinem geistigen Auge das Bild seiner jungen Frau in ihrem warmen Bett herauf, aber jetzt haftete dieser Vision die Verheißung naher Rettung an.
Alexander kämpfte auf dem Hang mit seinem Pferd; das Tier wehrte sich heftig gegen den starken Druck der Zügel. Die ganze Situation war Irrsinn. Er hätte auf James hören und bis zum Morgen warten sollen! Alexander schickte sich an, seine Knappen zu rufen und umzukehren. Sie konnten in Inverkeithing Zuflucht suchen, bis der Sturm abflaute. Doch als ein weiterer Blitz die Nacht erhellte, sah der König die Klippen, die sich vor ihm über dem Pfad erhoben. Hinter dieser Landzunge lag Kinghorn. Es war nicht mehr weit, vielleicht noch eine Meile. Der König beugte sich im Sattel vor, stieß Winter die Fersen in die Flanken und trieb das erschöpfte Tier weiter. Der Weg stieg noch steiler an, und Alexander vernahm im Heulen des Sturms das Kreischen von Möwen. Die Stimmen seiner Männer konnte er nicht mehr hören. Der Pfad wurde schmaler, links von ihm ragten hohe Felsen auf, rechts gähnte ein schwarzer Abgrund. Er wusste, dass er nicht mehr als hundert Fuß zum Ufer abfiel, aber er hätte sich genauso gut bis in den tiefsten Schlund der Hölle erstrecken können. Als sein Pferd ausglitt, zog er die Zügel scharf an. Seine Hände schmerzten vor Anstrengung. »Weiter!«, donnerte er, als das Schlachtross erneut ausglitt, vor Angst wieherte und kehrtzumachen versuchte. »Weiter!«
Ein schwarzer Schatten türmte sich vor ihm auf. »Sire!«
Tiefe Erleichterung durchströmte Alexander. »Nimm meine Zügel«, brüllte er Adam über das Tosen des Sturms hinweg zu. »Ich muss absteigen. Winter kann mich nicht hier hochtragen.«
»Wartet, Mylord, ich werde mich neben Euch halten. Weiter vorn ist der Untergrund fester. Ich kann Euch führen.«
»Vorsicht, ich befinde mich hier nah am Rand«, warnte der König, der den Regen in seinen Umhang rinnen spürte; ein eisiger Strom, der ihn erschauern ließ. »Wo ist Brice?«
»Ich habe ihn vorausgeschickt.« Adam lenkte sein Pferd zwischen den König und die Felsen neben dem Pfad. Ein Blitz beleuchtete sein Gesicht, auf dem ein seltsam eindringlicher Ausdruck lag, als er eine Hand ausstreckte, nach Winters Zügeln griff und sein eigenes Pferd mit den Knien dirigierte.
»Gut, Mann.« Alexander holte tief Atem. »Jetzt steht uns nur noch ein letzter Kraftakt bevor.«
»Ein letzter Kraftakt, Mylord«, echote Adam und drängte sich gegen ihn.
Das Erste, was Alexander spürte, war ein Stoß, als sein Pferd ins Taumeln geriet. Er vermutete sofort, dass das Tier lahmte, und sein schmerzliches Schnauben bestätigte diesen Verdacht. Sein eigener Schrei verklang in einem erstickten Grunzen, als er nach vorne kippte und sein Magen auf den hölzernen Sattelknauf traf. Er krallte sich Halt suchend an Winters Hals fest und verspürte in diesem Moment einen neuerlichen Schmerz, diesmal in seinem Bein, als etwas seitlich gegen ihn prallte. Ihm blieb gerade noch Zeit, um zu begreifen, dass es Adams Pferd war und dass der Knappe die Zügel des Schlachtrosses losgelassen hatte, dann stürzten er und Winter in den Abgrund.
Adam hatte Mühe, sein in Panik geratenes Pferd zu beruhigen, während der Schrei des Königs allmählich verhallte. Nach einer Weile hatte er es so weit unter Kontrolle, dass er absteigen konnte. Er hielt die Zügel in einer Hand und bückte sich, um mit dem nassen Gras, das auf dem Pfad spross, das Blut von seinem Dolch zu wischen. Danach hob er seine kurze Hose und schob die Waffe in die um seine Wade geschnallte Lederscheide zurück. Vorsichtig trat er zum Klippenrand und wartete einige Momente, dabei tupfte er sich Regentropfen von seiner Nasenspitze. Nach ein paar Minuten flammte erneut ein Blitz auf. Adams scharfe Augen konnten unten am Ufer einen großen grauen Schatten ausmachen. Er wartete weiter. Heute Nacht hätte der Mond scheinen sollen, aber der Sturm hatte ihn verdunkelt. Trotzdem würden Regen und Wind den Schrei des Königs übertönt haben, und dieser Narr Brice sollte weit genug vor ihm sein, um nichts von dem Geschehen mitzubekommen. Erneut blitzte es drei Mal. Das Pferd blieb dort liegen, wo es aufgeschlagen war, und diesmal erkannte Adam eine ganz in der Nähe liegende kleinere Gestalt. Die scharlachrote Robe des Königs leuchtete wie eine Flagge. Zufrieden schob der Knappe den Fuß in den Steigbügel und schwang sich in den Sattel. Selbst wenn der König den Sturz überlebt hatte, würde er in der Kälte sterben, bevor ihn jemand fand, denn Adam gedachte, den Suchtrupp in die falsche Richtung zu schicken. Er stieß dem Pferd die Sporen in die Flanken und setzte seinen Weg nach Kinghorn fort, wobei er schon über die Lügen nachdachte, die er der jungen Königin auftischen würde.
Unten am Ufer drehte das sterbende Pferd den Kopf. Blut strömte aus der tiefen Schnittwunde in seinem Vorderbein, die die Sehnen durchtrennt und es aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, aber die Wunde unterschied sich nicht mehr von den Verletzungen, die von dem Sturz herrührten. Ein paar Schritte entfernt lag sein königlicher Reiter mit ausgebreiteten Armen und grotesk verrenktem Hals. Der Wind vom Forth hob eine Ecke des Umhangs des Königs an und ließ sie gegen den Sand schlagen, aber ansonsten rührte sich nichts mehr.
Die Toten würden in dieser Nacht nicht auferstehen.
2
Die Atemzüge des Jungen kamen schnell und abgehackt, als das Schlachtross über den Strand donnerte, nasse Sandklumpen in die Höhe schleuderte und ihn immer weiter von den Rufen forttrug, die hinter ihm erklangen. Der Junge umklammerte mit einer Hand die Zügel, lehnte sich weit im Sattel zurück und stand fast in den Steigbügeln, während er sich bemühte, das Pferd zum Stehen zu bringen, bis seine Muskeln von der Anstrengung schmerzten. Der schneidende Wind wehte ihm das Haar in die Augen und blendete ihn, und die Lanze in seiner rechten Hand hüpfte wild auf und ab. Ohne Vorwarnung schoss das Pferd plötzlich vorwärts, sodass die Zügel schmerzhaft durch die geballte Faust des Jungen gezogen wurden. Als das Tier in wildem Galopp auf die Brandung zujagte, entglitt seinem Reiter die Lanze und fiel in den Sand, wo sie unter einem der Hufe des Pferdes zersplitterte. In der Ferne hörte er, wie sein Name gebrüllt wurde.
»Robert!«
Der Junge packte die Zügel jetzt mit beiden Händen, kämpfte gegen das Tier an und schrie vor hilfloser Wut und Furcht, als es auf das tosende Wasser zustürmte. Das im Sonnenlicht weiß schimmernde Meer kam rasend schnell näher und erfüllte seine Welt mit Dröhnen und Brausen. Plötzlich spürte er unter sich einen heftigen Ruck. Der Himmel schien sich um ihn zu drehen, und eine Sekunde lang erblickte er Wolken und eine ihre Kreise ziehende Möwe. Dann wurde er kopfüber in die Wellen geschleudert.
Die Kälte traf ihn wie ein Schlag. Salzwasser drang in seine Lungen, als er in der Brandung versank. Er wurde in den Wellen umhergewirbelt; wusste vor Schreck und aufkeimender Panik nicht mehr, wo oben und wo unten war. Seine Brust zog sich zusammen, er vermochte nicht mehr zu atmen. Dann traf sein Fuß mit einem Mal auf festen Untergrund. Er richtete sich auf und kämpfte sich keuchend an die Oberfläche. Die nächste Welle traf ihn in den Rücken, aber obwohl sie ihn in die Knie zwang, gelang es ihm, den Kopf über Wasser zu halten. Den Blick fest auf das Ufer gerichtet, stapfte er mühsam an Land. Seine Tunika klebte ihm am Körper. Als er über den Sand taumelte und dabei Meerwasser aushustete, bemerkte er, dass er seine Schuhe verloren hatte. Kies und zersplitterte Muscheln schnitten ihm in die bloßen Füße, als er sich vorbeugte und Wasser aus Nase und Ohren rinnen ließ.
»Robert!«
Der Junge straffte sich, als der Ruf erklang, und beobachtete die Gestalt, die über den Strand auf ihn zukam. Sein Herz wurde schwer, als er die zerbrochene Lanze, eine kleinere Version der großen Waffen der Männer, in der Hand seines Ausbilders sah.
»Warum hast du die Zügel nicht angezogen?« Der Mann blieb vor dem durchnässten Jungen stehen und schwenkte die zersplitterte Lanze. »Ruiniert! Und alles nur, weil du selbst einfache Anordnungen nicht befolgen kannst!«
Der im Wind fröstelnde Robert hielt dem grimmigen Blick seines Ausbilders unverwandt stand. Der stämmige Bulle von einem Mann war hochrot im Gesicht und schwitzte vor Anstrengung und Wut. Zumindest dies verschaffte ihm eine boshafte Befriedigung. »Ich habe es versucht, Master Yothre«, erwiderte er gepresst und schielte zu dem Schlachtross hinüber, das inzwischen aus freien Stücken stehen geblieben war, den Kopf hochwarf und schnaubte, als würde es ihn auslachen. Ärger stieg in Robert auf, als er sich daran erinnerte, wie er vor vier Wochen zu den Ställen geführt worden und seine Freude über diese neue Phase seiner Ausbildung schlagartig verflogen war, nachdem er gesehen hatte, dass das einzige gesattelte Pferd im Stall seines Vaters dieses mächtige Schlachtross war. Er hatte auf einem gutmütigen Pony reiten gelernt und vor kurzem ein lebhaftes junges Pferd bezwungen, aber das schwarze Ungeheuer ließ sich mit keinem von beiden vergleichen. Es war, als würde man versuchen, den Teufel selbst zu reiten. Roberts Blick wanderte wieder zu Yothre. »Mein Vater hat über dreißig Pferde in seinen Ställen stehen. Warum habt Ihr ausgerechnet Ironfoot ausgewählt? Noch nicht einmal die Stallburschen wagen sich in seine Nähe. Er ist zu wild und zu stark.«
»Das Problem ist nicht deine mangelnde Kraft«, grunzte Yothre. »Sondern dein mangelndes Geschick. Das Pferd wird dir gehorchen, wenn du meine Anweisungen befolgst. Außerdem«, fügte er etwas weniger beißend hinzu, »habe nicht ich ihn für dich ausgesucht, sondern dein Vater.«
Robert verstummte. Das Sonnenlicht schimmerte auf seinen nassen Wangen, als er auf das Meer hinausblickte. Sein blasses Gesicht unter dem dunklen Haarschopf wirkte angespannt. Hinter den krachenden Brechern glänzte das Wasser tiefgrün. Noch weiter hinten, bei dem Ailsa Craig, dem Feenfelsen, verdunkelte es sich zu schiefergrau, und in Richtung der fernen Insel Arran wurde es tintenschwarz. Hier an der Küste von Carrick war es ein heller, windiger Frühlingstag, aber hinter den Hügeln von Arran hatte sich im Laufe des Morgens eine Wolkenbank aufgebaut; ein Überbleibsel der heftigen Stürme, die Schottland seit Jahresbeginn plagten. Roberts Blick blieb an dem Fleck am südlichen Horizont hängen, der die Nordspitze von Irland bildete. Beim Anblick der schwachen, so oft von Nebel oder Dunst verschleierten Linie durchzuckte ihn ein Gefühl des Verlusts.
Sein Bruder befand sich noch immer irgendwo dort, in der Obhut eines irischen Lords, eines Vasallen ihres Vaters, der sie beide als Ziehsöhne aufgenommen hatte. Zweifellos hatte Edward sein Tagesprogramm bereits absolviert. Vielleicht ließ er zusammen mit seinen Ziehbrüdern die kleinen Holzschiffchen schwimmen, die sie unten am Fluss vor dem Herrenhaus von Antrim geschnitzt hatten. Am Abend würden sie Lachs essen und in der Halle des Lords am Feuer süßes Bier trinken und seinen Geschichten von irischen Helden, großen Schlachten und Schatzsuchen lauschen. Die zwölf Monate, die Robert in Antrim verbracht hatte, waren die schönsten seines Lebens gewesen. Sein Ziehvater hatte ihm alles beigebracht, was er als ältester Sohn einer der mächtigsten Familien Schottlands wissen musste. Robert war davon ausgegangen, dass er heimkehren würde, um den ihm angestammten Platz an der Seite seines Vaters einzunehmen – kein Junge mehr, sondern ein junger Mann auf dem Weg zu Ritterwürden. Die Realität hatte ihm eine herbe Enttäuschung beschert.
»Los, wir fangen noch einmal von vorne an.« Yothre bedeutete Robert, ihm zu folgen, als er über den Strand hinweg auf Ironfoot zustapfte. »Und wenn du tust, was ich sage, können wir einen weiteren Zwischenfall dieser Art …« Ein heller Schrei schnitt seine Worte ab.
Ein kleiner Junge kam quer durch die Dünen auf sie zugerannt. Hinter ihm thronte die Burg Turnberry auf ihrem Felsvorsprung über dem tosenden Meer. Die Zinnen der Brustwehr wurden von Kormoranen und Möwen umkreist.
Robert lächelte, als der Junge noch schneller zu laufen begann. Seine kurzen Beine wirbelten Sandwolken auf. »Niall!«