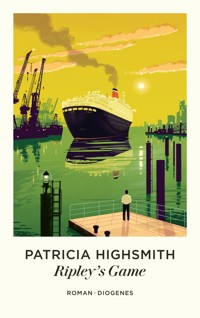
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ripley
- Sprache: Deutsch
Tom Ripley ist ein sympathisch-unmoralischer Exil-Amerikaner, der südlich von Paris ein luxuriöses Leben führen will – um jeden Preis. Immer wieder gelingt es dem erfolgreichen Serienhelden, sich vor der Polizei und seinen Verfolgern hakenschlagend aus dem Staub zu machen und dem erwartbaren Verbrecherschicksal eine Nase zu drehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Patricia Highsmith
Ripley’s Game oder Der amerikanische Freund
Roman
Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis
Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay
Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta
Diogenes
Ripley’s Game oder Der amerikanische Freund
1
»Den perfekten Mord, den gibt es nicht«, sagte Tom zu Reeves. »Man kann sich einen ausdenken, aber das ist nur ein Gesellschaftsspiel. Natürlich kann man sagen, es gebe so viele ungelöste Mordfälle. Doch das ist etwas anderes.« Tom langweilte sich. Er ging vor dem großen Kamin auf und ab, in dem ein kleines Feuer anheimelnd prasselte. Daß er gespreizt und herablassend geklungen hatte, wußte er. Aber er konnte Reeves nun einmal nicht helfen und hatte ihm das auch schon gesagt.
»Ja, klar«, erwiderte Reeves. Er saß in einem der gelbseidenen Sessel, den schlanken Körper vorgebeugt, die Hände zwischen den Knien verschränkt: ein ausgemergeltes Gesicht, kurzes, hellbraunes Haar und kalte, graue Augen – kein angenehmes Gesicht, aber es könnte gut aussehen, wäre da nicht die zehn Zentimeter lange Narbe, die sich von der rechten Schläfe über die Wange fast bis zu seinem Mund hinabzog. Die Narbe war etwas dunkler gerötet als sein Gesicht; sie wirkte wie eine schlecht oder gar nicht genähte Wunde. Tom hatte nie danach gefragt, aber Reeves hatte einmal von sich aus erklärt: »Das war ein Mädchen, mit ihrer Puderdose. Ist das zu glauben?« (Nicht für Tom.) Er hatte Tom ein kurzes, trauriges Lächeln geschenkt, eines der wenigen, an das sich Tom von ihm erinnern konnte. Und ein andermal: »Ein Pferd hat mich abgeworfen, hat mich ein paar Meter am Steigbügel mitgeschleift.« Das hatte Reeves jemand anderem erzählt, doch Tom war dabeigewesen. Tom tippte auf ein stumpfes Messer, bei irgendeinem heimtückischen Kampf.
Reeves Minot wollte, daß Tom ihm jemanden nannte oder an die Hand lieferte, der einen oder zwei »einfache Morde« begehen konnte, dazu vielleicht noch einen Diebstahl, ebenfalls einfach und ungefährlich. Er war aus Hamburg nach Villeperce gekommen, um mit Tom darüber zu reden, wollte über Nacht bleiben, morgen in Paris mit noch jemandem sprechen und dann nach Hamburg zurückkehren, wo er wohnte und wo er wohl weiter nachdenken wollte, falls er nichts erreicht hatte. Reeves arbeitete vor allem als Hehler; in letzter Zeit hatte er sich aber in Hamburg in der Halbwelt des illegalen Glücksspiels versucht, und diese wollte er nun schützen. Vor wem? Vor schweren Jungs aus Italien, die ihren Teil vom Kuchen wollten. Reeves vermutete, daß der eine Hamburger Italiener ein Fußsoldat der Mafia war, der als Minenhund vorgeschickt wurde, der andere womöglich ebenfalls, wenn auch für eine andere Familie. Und er hoffte, einen Eindringling oder beide auszuschalten und dadurch die Mafia von weiteren Vorstößen abzuschrecken; außerdem wollte er die Hamburger Polizei auf die Mafia-Gefahr aufmerksam machen und alles weitere, das heißt die Verdrängung der Mafia aus der Stadt, ihr überlassen. »Diese Hamburger sind anständige Jungs«, hatte Reeves beteuert. »Kann sein, daß sie etwas Ungesetzliches tun, wenn sie ein paar private Clubs betreiben, aber die sind an sich nicht illegal, und ihre Gewinne halten sich in Grenzen. Nicht wie in Las Vegas, das durch und durch mafiaverseucht ist, direkt unter den Augen der amerikanischen Polizei!«
Tom schob die Glut mit dem Schürhaken zusammen und legte ein sauber gespaltenes Holzscheit nach. Kurz vor sechs: bald Zeit für einen Drink. »Wie wär’s mit –«
In diesem Moment kam Madame Annette, die Haushälterin der Ripleys, aus dem Flur herein, der zur Küche führte. »Pardon, Messieurs. Monsieur Tomme, hätten Sie jetzt gern Ihre Drinks, da der Herr doch keinen Tee wollte?«
»Vielen Dank, Madame Annette. Gerade hatte ich daran gedacht. Und bitten Sie doch Madame Héloïse dazu, ja?« Sie sollte die Stimmung ein bißchen auflockern. Bevor Tom um drei Uhr nach Orly gefahren war, um Reeves abzuholen, hatte er zu Héloïse gesagt, Reeves habe etwas mit ihm zu bereden; deshalb hatte sie den ganzen Nachmittag über im Garten gearbeitet oder war oben geblieben.
»Und Sie würden die Sache nicht selbst übernehmen?« drängte Reeves mit letzter Hoffnung. »Sehen Sie, da gäbe es keine Verbindung zu uns, genau das wollen wir, Sicherheit. Außerdem ist das Geld auch nicht schlecht: sechsundneunzigtausend Dollar.«
Tom schüttelte den Kopf. »Aber mit Ihnen bin ich gewissermaßen verbunden.« Verdammt, er hatte einige unbedeutende Aufträge für Reeves Minot erledigt, zum Beispiel gestohlene Kleinigkeiten weitergeleitet oder winzige Gegenstände, wie etwa Mikrofilmrollen, aus Zahnpastatuben herausgeklaubt, die Reeves präpariert hatte, ohne daß deren Überbringer etwas ahnten. »Was glauben Sie, wie viele dieser Räuberpistolen ich mir noch leisten kann? Ich habe einen Ruf zu wahren, verstehen Sie?« Fast hätte er bei diesen Worten gelächelt, doch zugleich schlug sein Herz höher, denn das Gefühl war echt. Er richtete sich auf, dachte an das schöne Haus, in dem er wohnte, an das sichere Leben, das er jetzt führte, ganze sechs Monate nach der Derwatt-Episode – einer Beinahkatastrophe, der er heil entronnen war, mit nichts als dem Hauch eines Verdachts. Das Eis war dünn, ja, doch noch war er nicht eingebrochen. Tom hatte den englischen Inspector Webster und ein paar gerichtsmedizinische Fachleute in die Wälder um Salzburg begleitet, wo er die Leiche eines Mannes, angeblich des Malers Derwatt, verbrannt hatte. Warum er den Schädel zertrümmert habe, hatte die Polizei gefragt. Wenn Tom daran dachte, erschauerte er immer noch; er hatte es getan, um die oberen Zähne herausschlagen und im Wald verstreuen zu können. Der Unterkiefer hatte sich leicht vom Schädel lösen lassen. Tom hatte ihn in einiger Entfernung vergraben. Die Zähne des Oberkiefers dagegen … Die Männer von der Gerichtsmedizin hatten einige gefunden, aber kein Zahnarzt in London besaß Unterlagen zu Derwatts Gebiß, weil der Maler, so glaubte man, die letzten sechs Jahre in Mexiko gelebt hatte. »Das gehörte für mich zu der Verbrennung dazu, zu der Vorstellung, ihn zu Asche werden zu lassen«, hatte Tom erwidert. Der eingeäscherte Körper war Bernards Leiche gewesen. Ja, heute noch konnte er erschauern bei der Erinnerung an jenen gefährlichen Augenblick wie auch an das Grauen jener Tat, als er den verkohlten Schädel mit einem großen Stein zertrümmerte. Doch wenigstens hatte er Bernard nicht getötet. Bernard Tufts hatte Selbstmord begangen.
Tom sagte: »Sie werden doch sicher unter all Ihren Bekannten jemanden finden, der das erledigen kann.«
»Ja, und das wäre dann die Verbindung – deutlicher als zu Ihnen. Leider sind die Leute, die ich kenne, sozusagen keine unbeschriebenen Blätter.« Reeves klang traurig, wie ein geprügelter Hund. »Sie dagegen kennen eine Menge angesehener Leute, Tom, Männer mit reiner Weste, die über jeden Verdacht erhaben sind.«
Tom lachte. »Und wie wollen Sie solche Leute für so etwas gewinnen? Manchmal denke ich, Reeves, Sie sind verrückt.«
»Nein, Sie wissen, was ich meine. Jemanden, der es für Geld macht, nur für Geld. Das muß kein Profi sein. Wir bereiten alles vor. Es wäre wie … wie ein Anschlag, in aller Öffentlichkeit. Wir suchen jemanden, der so aussieht, daß man ihm so etwas nie und nimmer zutraut, wenn man ihn verhört.«
Madame Annette schob den Barwagen herein. Der Eiskübel schimmerte silbern, die Räder des Wagens quietschten leise. Seit Wochen hatte Tom sie schon ölen wollen. Er hätte das alberne Hin und Her mit Reeves fortsetzen können, weil Madame Annette, Gott segne sie, kein Englisch verstand. Aber das Thema ödete ihn an, und er freute sich über die Unterbrechung. Madame Annette, eine Frau in den Sechzigern, kam aus der Normandie, hatte ein angenehmes Gesicht, einen kräftigen Körper und war als Haushälterin ein wahres Juwel. Tom konnte sich Belle Ombre ohne sie nicht mehr vorstellen.
Héloïse kam aus dem Garten herein, und Reeves stand auf. Sie trug weit ausgestellte Latzhosen mit rosa- und dunkelroten Streifen. LEVI stand senkrecht auf jedem Streifen. Ihr langes, blondes Haar trug sie offen. Es schimmerte im Feuerschein. So rein, dachte Tom, verglichen mit dem, worüber sie gerade gesprochen hatten. Doch ihr Haar glänzte golden, und er mußte an Geld denken. Eigentlich brauchte er nicht noch mehr Geld, selbst wenn sie bald keine Derwatts mehr verkaufen konnten, weil es keine Bilder mehr gab. Tom bekam Prozente von den Verkäufen, war aber auch an Derwatt Limited beteiligt, einer Firma für Künstlerbedarf, und die würde weiterlaufen. Dann war da noch das bescheidene, langsam und stetig wachsende Einkommen aus den Greenleaf-Aktien, die er geerbt hatte – und zwar aufgrund eines Testaments, das er eigenhändig gefälscht hatte. Nicht zu vergessen der großzügige Zuschuß, den sein Schwiegervater Héloïse bewilligte. Bloß keine Gier. Tom war Mord zuwider, wenn er nicht unbedingt notwendig war.
»Haben Sie sich nett unterhalten?« fragte Héloïse auf englisch. Anmutig sank sie in das gelbe Sofa.
»Ja, danke«, sagte Reeves.
Sie sprachen auf französisch weiter, weil Héloïse im Englischen nicht so sattelfest war. Reeves konnte kaum Französisch, hielt sich aber ganz gut, zumal sie nur über Belanglosigkeiten redeten: über den Garten, den milden Winter, der schon vorbei schien, weil hier bereits die Osterglocken blühten, und das Anfang März. Tom schenkte Héloïse aus einem der Fläschchen vom Wagen Champagner ein.
»Und wie ist’s in Hambourg?« Héloïse versuchte es noch einmal auf englisch. Ihre Augen funkelten belustigt, als sich Reeves auf französisch mit einer ganz konventionellen Antwort abmühte.
Auch in Hamburg sei es nicht allzu kalt. Außerdem habe er ebenfalls einen Garten, fügte Reeves hinzu, denn seine petite maison liege an der Alster, also am Wasser, an einer Art Bucht, genauer gesagt. Viele Leute besäßen dort Häuser mit Gärten am Wasser und könnten sich also auch ein Segelboot halten, wenn sie das wollten.
Héloïse mochte Reeves Minot nicht und mißtraute ihm. Für sie war er einer der Leute, um die Tom besser einen Bogen machen sollte. Zufrieden dachte Tom, daß er heute abend ehrlich zu ihr sagen konnte, er habe jede Beteiligung an dem Plan abgelehnt, den Reeves vorgeschlagen hatte. Héloïse sorgte sich immer, was ihr Vater wohl sagen würde. Jacques Plisson war ein millionenschwerer Arzneimittelfabrikant, dazu Gaullist und die Verkörperung französischer Rechtschaffenheit. Und er hatte Tom nie gemocht. »Mein Vater sieht sich das nicht mehr lange an!« warnte sie Tom oft, aber ihr lag mehr an seiner Sicherheit als an dem Zuschuß, den ihr der Vater zahlte und, so sagte sie, nicht selten zu streichen drohte. Einmal in der Woche, gewöhnlich freitags, aß sie mit ihren Eltern zu Mittag, bei ihnen zu Hause in Chantilly. Sollte ihr Vater Héloïse je tatsächlich das Geld streichen, würden sie Belle Ombre kaum halten können. Das war klar.
Zum Abendessen gab es médaillons de bœuf, dazu kalte Artischocken mit Madame Annettes selbstkreierter Sauce als Vorspeise. Héloïse trug nun ein schlichtes, blaßblaues Kleid. Sie schien schon zu spüren, daß Reeves nicht bekommen hatte, was er wollte. Bevor sie zu Bett gingen, fragte Tom seinen Gast, ob er alles habe, was er brauche, und wann er Tee oder Kaffee gebracht haben wolle. Kaffee, um acht, antwortete Reeves. Er hatte das Gästezimmer oben links im Haus und damit das Bad, das sonst Héloïse benutzte. Madame Annette hatte aber ihre Zahnbürste schon in Toms Badezimmer gebracht, das von seinem Zimmer abging.
»Ich bin froh, daß er morgen abreist. Warum ist er so angespannt?« fragte Héloïse, die sich die Zähne putzte.
»Das ist er immer.« Tom drehte das Wasser ab, trat aus der Dusche und hüllte sich sofort in ein großes, gelbes Handtuch. »Vielleicht ist er deshalb so dünn.« Sie redeten englisch, denn mit Tom hatte Héloïse keine Hemmungen, seine Sprache zu sprechen.
»Wo hast du ihn kennengelernt?«
Er wußte es nicht mehr. Und wann? Vor fünf, sechs Jahren vielleicht. In Rom, oder? Reeves war ein Freund von irgendwem gewesen – nur von wem? Tom war zu müde, weiter nachzudenken, und es war auch nicht wichtig. Er hatte fünf, sechs solcher Bekannten und hätte wohl bei keinem sagen können, wo er ihm erstmals begegnet war.
»Was will er von dir?«
Tom legte seiner Frau den Arm um die Taille, so daß ihr weites Nachthemd eng an den Körper gepreßt wurde, und drückte ihr einen Kuß auf die kühle Wange. »Etwas Unmögliches. Ich habe nein gesagt, wie du gemerkt hast. Er ist enttäuscht.«
In dieser Nacht schrie eine einsame Eule irgendwo in dem Kiefernwäldchen hinter Belle Ombre. Tom lag im Bett, den linken Arm unter Héloïses Nacken, und dachte nach. Sie schlief ein, atmete langsam und sachte. Tom seufzte und grübelte weiter. Aber er dachte nicht logisch, nicht konstruktiv. Der zweite Kaffee hielt ihn hellwach. Eine Party in Fontainebleau fiel ihm ein, vor einem Monat, eine zwanglose Geburtstagsfeier für eine Madame – wie hieß sie noch gleich? Tom suchte eigentlich den Namen ihres Mannes, einen englischen Namen, vielleicht fiel er ihm gleich wieder ein. Der Mann, sein Gastgeber, war Anfang Dreißig, das Paar hatte einen kleinen Sohn. Sie wohnten in einer Nebenstraße von Fontainebleau, in einem schlichten, zweistöckigen Reihenhaus mit einem kleinen Garten dahinter. Der Mann war Bilderrahmer, deshalb hatte Pierre Gauthier, der Besitzer eines Ladens für Künstlerbedarf in der Rue Grande, wo Tom seine Farben und Pinsel kaufte, ihn auf die Party mitgeschleppt. »Ach, kommen Sie doch, Monsieur Riiepley!« hatte Gauthier gesagt. »Und bringen Sie Ihre Frau mit! Er will viele Leute um sich haben, er ist ein bißchen deprimiert … Außerdem macht er Rahmen, also könnten Sie bei ihm mal Bilder in Auftrag geben.«
Tom mußte blinzeln und nahm im Dunkeln den Kopf zurück, damit seine Wimpern nicht Héloïses Schulter streiften. Er erinnerte sich an einen großen, blonden Engländer, aber nur ungern und widerstrebend, weil dieser Mann in der Küche, in diesem düsteren Raum mit dem abgetretenen Linoleumfußboden und der rauchgeschwärzten Stuckimitatdecke aus dem neunzehnten Jahrhundert, ihm etwas Unangenehmes gesagt hatte. Der Engländer – Trewbridge? Tewksbury? – hatte fast abfällig zu ihm bemerkt: »Ach ja, von Ihnen hab ich schon gehört«, als Tom sich vorstellte: »Tom Ripley, ich wohne in Villeperce« und ihn gerade fragen wollte, wie lange er schon in Fontainebleau lebte, da ein Engländer mit einer französischen Frau doch vielleicht gern die Bekanntschaft eines Amerikaners mit einer französischen Frau machen würde, der nicht weit von ihm wohnte. Er hatte sich vorgewagt und war rüde abgewiesen worden. Trevanny, hieß der Mann nicht so? Blondes, glattes Haar, sah eher aus wie ein Holländer, doch das taten die Engländer ja oft und umgekehrt.
Jetzt aber fiel Tom ein, was Gauthier später an jenem Abend gesagt hatte: »Er will nicht unfreundlich sein, er ist nur deprimiert. Hat eine Blutkrankheit – Leukämie, glaube ich. Etwas Ernstes. Und sonst geht es ihm auch nicht besonders, wie Sie am Haus sehen können.« Gauthier hatte ein Glasauge. Die Farbe war merkwürdig: gelbgrün, offenbar ein Versuch, die Farbe des gesunden Auges nachzuahmen. Ein kläglich gescheiterter Versuch. Gauthiers Glasauge erinnerte an das Auge einer toten Katze. Man wollte nicht hinsehen, doch es hielt einen hypnotisch gefangen. Gauthiers düstere Worte in Verbindung mit dem Glasauge hatten Tom stark beeindruckt: Er hatte an den Tod denken müssen und das nicht vergessen.
»Ach ja, von Ihnen hab ich schon gehört.« Machte dieser Trevanny oder wie er auch hieß etwa ihn für den Tod von Bernard Tufts verantwortlich, und auch für den von Dickie Greenleaf damals? Oder war der Engländer bloß wegen seines Leidens verbittert und ließ es jeden spüren? Wie ein Mann mit einem nervösen Magen, der andauernd Bauchschmerzen hatte? Nun erinnerte Tom sich auch wieder an Trevannys Frau: nicht hübsch, aber apart, kastanienbraunes Haar, freundlich und offen. Sie hatte sich viel Mühe mit dieser Party gemacht, bei der alle gestanden und niemand auf den wenigen Stühlen in dem kleinen Wohnzimmer und in der Küche Platz genommen hatte.
Tom überlegte, ob ein Mann wie Trevanny wohl einen Auftrag übernehmen würde, wie er Reeves vorschwebte. Für den Engländer war ihm eine interessante Anbahnungsvariante eingefallen. Sie konnte bei jedem klappen, wenn man den Boden bereitete, was in diesem Fall jedoch schon geschehen war: Trevanny machte sich ernsthaft Sorgen um seine Gesundheit. Seine Idee war nur ein Scherz, ein übler Scherz, nicht gerade nett, aber der Mann war auch zu ihm nicht nett gewesen. Und es war nur für ein, zwei Tage, bis Trevanny mit seinem Arzt sprechen konnte.
Tom fand Vergnügen an seinen Gedankenspielen. Sachte löste er sich von Héloïse, damit er sie nicht weckte, falls er auf einmal lachen mußte. Angenommen, Trevanny willigte ein und führte Minots Plan tadellos aus, wie ein Soldat einen Befehl? War es einen Versuch wert? Ja, denn er hatte nichts zu verlieren, und Trevanny auch nicht. Der Mann konnte nur gewinnen. Reeves auch, wie er sagte, aber in welcher Hinsicht, das wußte nur er selber. Was Reeves Minot wollte, war Tom genauso unklar wie dessen Mikrofilmschmuggel, bei dem es vermutlich um internationale Spionage ging. Ob die Regierungen wußten, wie verrückt sich manche ihrer Spione aufführten? Spinner, halb Wahnsinnige, die mit Pistolen und Mikrofilmen von Bukarest nach Moskau und Washington hetzten – Männer, die mit der gleichen Begeisterung all ihre Kraft dem internationalen Krieg der Briefmarkensammler oder der Beschaffung geheimer Baupläne von Modelleisenbahnen widmen könnten.
2
Und so kam es, daß rund zehn Tage später, am 22. März, Jonathan Trevanny, der in der Rue Saint-Merry in Fontainebleau wohnte, einen merkwürdigen Brief von seinem guten Freund Alan McNear erhielt. Alan, der in Paris einen britischen Elektronikkonzern vertrat, hatte den Brief unmittelbar vor dem Abflug zu einem längeren geschäftlichen Aufenthalt in New York geschrieben – seltsamerweise nur einen Tag, nachdem er bei den Trevannys in Fontainebleau zu Besuch gewesen war. Jonathan hätte von Alan höchstens ein Dankeschön für die Abschiedsparty erwartet, die Simone und er für den Freund gegeben hatten, und Alan fand auch einige dankende Worte dafür, doch dann folgte ein Absatz, der Jonathan verstörte:
Jon, was ich über Dein altes Leiden gehört habe, hat mich zutiefst bestürzt. Ich hoffe immer noch, es war falscher Alarm. Man sagte mir, du wüßtest davon, würdest aber Deinen Freunden nichts sagen. Das ehrt Dich, aber wozu sind denn Freunde da? Denk bloß nicht, wir wollten Dir aus dem Weg gehen, weil wir vielleicht meinten, Du wärest uns zu trübsinnig. Deine Freunde (und dazu zähle ich mich) sind immer für Dich da. Aber ich kann nicht in Worte fassen, was ich wirklich sagen will. Das hole ich in ein paar Monaten nach, wenn wir uns wiedersehen – sobald ich einen Urlaub herausschlagen kann. Verzeih mir also diese dürftigen Zeilen.
Was meinte Alan damit? Hatte sein Hausarzt, Dr. Perrier, den Freunden etwas gesagt, das er ihm selber verschwieg? Etwas in der Art, daß er nicht mehr lange zu leben habe? Dr. Perrier war nicht auf der Party für Alan gewesen, doch womöglich hatte er mit jemand anderem darüber gesprochen.
Mit Simone vielleicht? Ob auch sie es vor ihm verschwieg?
Diese Möglichkeiten gingen Jonathan durch den Kopf, als er morgens um halb neun mit erdverschmierten Händen in seinem Garten stand. Trotz des Pullovers fror er. Am besten ging er heute noch zu Dr. Perrier. Simone zu fragen war sinnlos; sie könnte sich verstellen: »Aber Liebling, wie kommst du denn darauf?« Er würde kaum erkennen können, ob sie sich verstellte.
Und Dr. Perrier? Konnte er ihm vertrauen? Der Mann sprühte immerzu vor Optimismus, was gut und schön war, solange man nichts Schlimmes hatte; man fühlte sich gleich viel besser oder sogar schon geheilt. Aber Jonathan wußte, daß er etwas Schlimmes hatte: myeloische Leukämie, das bedeutete, einen Überschuß weißer Blutkörperchen im Knochenmark. In den letzten fünf Jahren hatte er mindestens vier Bluttransfusionen pro Jahr erhalten. Immer wenn er sich schwach fühlte, sollte er seinen Hausarzt aufsuchen oder ins Krankenhaus von Fontainebleau gehen und sich Blut übertragen lassen. Dr. Perrier hatte, genau wie sein Pariser Facharzt, gesagt, irgendwann werde sich sein Zustand rapide verschlechtern, dann würden Transfusionen nicht mehr helfen. Jonathan wußte das selber, er hatte genug über sein Leiden gelesen. Bislang war myeloische Leukämie unheilbar. Sie führte meist binnen sechs bis zwölf, manchmal auch binnen sechs bis acht Jahren zum Tode. Für Jonathan begann jetzt sein sechstes Jahr.
Er stellte die Forke in den Geräteschuppen zurück, einen kleinen Backsteinbau, der früher die Außentoilette gewesen war, und ging zur Hintertreppe. Dort blieb er stehen, den Fuß auf die erste Stufe gesetzt, sog tief die frische Morgenluft ein und dachte: »Wie viele Morgen wie diesen werde ich noch erleben?« Dann aber fiel ihm ein, daß er genau das auch schon im letzten Frühling gedacht hatte. Reiß dich zusammen, sagte er sich, schließlich weißt du seit sechs Jahren, daß du womöglich keine fünfunddreißig wirst. Festen Schrittes stieg Jonathan die acht eisernen Stufen hinauf, in Gedanken schon woanders: Es war 8:52 Uhr; spätestens kurz nach 9 mußte er in seinem Laden sein.
Simone brachte Georges gerade in den Kindergarten; das Haus war leer. Jonathan wusch sich die Hände über der Spüle. Er nahm die Gemüsebürste dazu, was Simone gar nicht gefallen hätte, säuberte sie aber anschließend wieder. Im Haus gab es nur noch ein weiteres Waschbecken, oben im Badezimmer. Und kein Telefon. Er würde Dr. Perrier gleich als erstes vom Laden aus anrufen.
Jonathan ging links die Rue de la Paroisse hinunter bis zur Kreuzung und dann weiter über die Rue des Sablons bis zu seinem Geschäft. Dort wählte er Dr. Perriers Nummer. Er wußte sie auswendig.
Die Schwester sagte, der Doktor habe heute keinen Termin mehr frei. Das hatte er erwartet.
»Es ist aber dringend. Lange dauert es nicht, eigentlich nur eine Frage, doch ich muß ihn unbedingt sprechen.«
»Fühlen Sie sich schwach, Monsieur Trevanny?«
»Ja«, sagte er sofort.
Er bekam einen Termin für zwölf Uhr. Die Uhrzeit hatte etwas Unheilschwangeres.
Jonathan war Bilderrahmer. Er schnitt Glas und Karton für Passepartouts zurecht, fertigte Rahmen an und wählte aus dem eigenen Vorrat fertige Rahmen für unentschlossene Kunden aus. Ganz selten einmal fand er beim Kauf alter Rahmen auf Auktionen oder bei Altwarenhändlern ein Bild, das ihn zusammen mit dem Rahmen interessierte; das konnte er dann reinigen, in sein Schaufenster stellen und verkaufen. Aber viel Geld war mit dem Geschäft nicht zu verdienen. Er kam gerade so über die Runden. Vor sieben Jahren hatte er mit seinem Partner, einem Engländer wie er, aber aus Manchester, einen Antiquitätenladen in Fontainebleau eröffnet. Sie hatten hauptsächlich alte Möbel aufpoliert und verkauft, doch das Geld hatte für zwei nicht gereicht und Roy war ausgestiegen, um irgendwo bei Paris als Automechaniker zu arbeiten. Kurz darauf hatte ein Pariser Arzt das gleiche zu Jonathan gesagt wie zuvor schon ein Doktor in London: »Sie neigen zu Blutarmut und sollten sich öfters untersuchen lassen. Vermeiden Sie lieber schwere körperliche Arbeit.« Also hatte Jonathan Schränken und Sofas den Rücken gekehrt und sich der Arbeit mit Bilderrahmen und Glas zugewandt. Vor ihrer Heirat hatte er zu Simone gesagt, er habe vielleicht nur noch sechs Jahre zu leben, denn als er sie kennenlernte, hatte er gerade von zwei Ärzten erfahren, daß seine wiederkehrenden Schwächeanfälle von myeloischer Leukämie herrührten.
Sollte er jetzt sterben, dachte Jonathan, als er ganz ruhig seinen Tag anging, könnte Simone ein zweites Mal heiraten. Sie half fünf Nachmittage die Woche von halb drei bis halb sieben in einem Schuhgeschäft auf der Avenue Franklin Roosevelt aus, das sie zu Fuß erreichen konnte; allerdings arbeitete sie dort erst seit letztem Jahr, seit Georges alt genug für den französischen Kindergarten war. Simone und er brauchten die zweihundert Franc pro Woche, die sie verdiente, doch Jonathan war nicht wohl bei dem Gedanken an Brezard, ihren Chef – ein Lüstling, der seinen Verkäuferinnen in den Hintern kniff und sicher im Hinterzimmer, das als Lager diente, auch weiter zu gehen versuchte. Simone war verheiratet, wie Brezard sehr wohl wußte; allzu weit konnte er also wohl nicht gehen, doch hielt das einen wie ihn nie davon ab, sein Glück zu versuchen. Simone flirtete nicht, ganz im Gegenteil: Sie wirkte merkwürdig schüchtern, was dafür sprach, daß sie sich nicht für attraktiv hielt. Jonathan liebte diesen Zug an ihr. Er fand sie geradezu umwerfend sexy, sie besaß eine magnetische sexuelle Anziehungskraft, die dem Mann auf der Straße jedoch nicht auffallen mochte, und es ärgerte ihn, daß ausgerechnet Brezard, dieser geile Bock, Simones ganz eigene Attraktivität bemerkt hatte und etwas davon für sich wollte. Nicht daß Simone viel von Brezard erzählte. Ein einziges Mal nur hatte sie erwähnt, daß er seinen weiblichen Angestellten (noch zweien außer ihr) zu nahe kam. Während Jonathan an diesem Morgen einer Kundin ein gerahmtes Aquarell zeigte, sah er für einen Moment Simone vor sich, wie sie sich nach einer Anstandsfrist dem widerwärtigen Brezard ergab, der schließlich Junggeselle war und finanziell besser gestellt als er. Unsinn. Simone konnte diesen Typ Mann nicht ausstehen.
»Oh, wie schön! Wunderbar!« Die junge Frau im hellroten Mantel hielt das Aquarell auf Armeslänge von sich.
Ein Lächeln stahl sich über Jonathans langes, ernstes Gesicht, als wäre seine eigene kleine Sonne hinter den Wolken hervorgekommen und leuchtete in ihm. Die Freude der Frau war so echt! Jonathan kannte sie gar nicht; sie holte nur ein Bild ab, das eine ältere Frau, vielleicht ihre Mutter, ihm gebracht hatte. Eigentlich hätte Jonathan zwanzig Franc mehr verlangen müssen, als ursprünglich genannt, weil der Rahmen ein anderer war als der von der Frau gewählte, den Jonathan nicht mehr auf Lager hatte; aber er erwähnte das gar nicht und nahm die vereinbarten achtzig Franc.
Danach fegte er den Holzfußboden und staubte die paar Bilder in seinem kleinen Schaufenster ab. Sein Laden war regelrecht schäbig, fand er an diesem Morgen: Nirgendwo frische Farben, Rahmen jeder Größe lehnten an den ungestrichenen Wänden, Musterleisten hingen unter der Decke. Da war der Tresen mit einem Auftragsbuch, ein Lineal, Bleistifte. Hinten im Laden stand ein langer Holztisch, an dem Jonathan mit seinen Schneidladen, Sägen und Glasschneidern arbeitete. Auf dem großen Tisch lagerte er auch die gut geschützten Kartonbögen für die Passepartouts, eine dicke Rolle braunes Packpapier, Bindfaden, Draht, Leimtöpfe und Kästchen mit Nägeln verschiedener Länge. An der Wand über dem Tisch hingen Messer und Hämmer in Haltern. Eigentlich mochte Jonathan die altertümliche Atmosphäre, das Fehlen jedes kommerziellen Schnickschnacks. Sein Laden sollte so aussehen wie die Werkstatt eines anständigen Handwerkers, und das war ihm, wie er fand, auch gelungen. Er verlangte niemals zu hohe Preise, hielt seine Termine ein und rief an oder schickte eine Karte, wenn er doch einmal nicht rechtzeitig fertig wurde. Die Kunden schätzten das, wie er bemerkt hatte.
Um fünf nach halb zwölf, als Jonathan zwei kleine Bilder gerahmt und mit den Namen der Kunden versehen hatte, wusch er sich über der Spüle Gesicht und Hände mit kaltem Wasser, kämmte sich und stand für einen Moment kerzengerade, während er sich auf das Schlimmste gefaßt machte. Dr. Perriers Praxis lag ganz in der Nähe in der Rue Grande. Jonathan drehte den OUVERT-Zeiger auf 14:30 Uhr, schloß die Ladentür ab und machte sich auf den Weg.
Bei Dr. Perrier mußte er im Vorzimmer warten, in dem ein verstaubter Lorbeerbaum vor sich hin kränkelte. Die Pflanze hatte noch nie geblüht; sie starb nicht, sie wuchs nicht und blieb, wie sie war. Jonathan fand, sie war wie er selbst. Immer wieder wanderte sein Blick zu ihr hinüber, obwohl er versuchte, an etwas anderes zu denken. Auf dem ovalen Tisch lagen alte, eselsohrige Ausgaben von Paris Match, doch die deprimierten Jonathan noch mehr als der Lorbeerbaum. Er mußte sich daran erinnern, daß Dr. Perrier auch noch im großen Krankenhaus von Fontainebleau arbeitete, sonst wäre es ihm absurd vorgekommen, sein Leben in die Hand eines Arztes mit einer so schäbigen kleinen Praxis zu legen und seiner Prognose zu vertrauen, ob er leben oder sterben würde.
Die Sprechstundenhilfe kam und winkte ihn herein.
»Nun, wie geht’s unserem interessantesten Patienten?« Dr. Perrier rieb sich die Hände, dann streckte er ihm die Rechte entgegen.
Jonathan schüttelte sie. »Danke, ganz gut. Aber was ist mit diesen Tests – ich meine die von vor zwei Monaten? Wenn ich es recht verstehe, sind die Werte nicht so günstig?«
Dr. Perrier sah Jonathan, der ihn nicht aus den Augen ließ, ausdruckslos an. Dann lächelte er und zeigte gelbliche Zähne unter einem ungepflegten Schnurrbart.
»Nicht so günstig? Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch gesehen.«
»Ja, aber … Ich bin kein Fachmann. Vielleicht –«
»Ich habe sie Ihnen doch schon erklärt. Was ist denn los? Fühlen Sie sich wieder erschöpft?«
»Nein, eigentlich nicht.« Jonathan spürte, daß der Arzt es eilig hatte, zum Mittagessen zu kommen, also fuhr er hastig fort: »Ehrlich gesagt, ein Freund von mir hat irgendwo gehört, mein … mein Zustand werde sich bald deutlich verschlechtern. Ich hätte vielleicht nicht mehr lange zu leben. Natürlich nahm ich an, diese Nachricht müßte von Ihnen stammen.«
Dr. Perrier schüttelte den Kopf, lachte, hüpfte wie ein Vogel herum und blieb vor einer Buchvitrine stehen, die dünnen Arme leicht auf die gläserne Deckplatte gelegt. »Mein Wertester, zunächst einmal hätte ich, wenn das wahr wäre, niemandem etwas gesagt. Das gebietet schon meine ärztliche Schweigepflicht. Zweitens ist es nicht wahr, soweit ich aus den letzten Ergebnissen ersehen kann. Wünschen Sie einen weiteren Test? Heute noch? Ich könnte vielleicht für den späten Nachmittag im Krankenhaus …?«
»Nicht nötig. Was ich wirklich wissen will: Stimmt das auch? Sie würden mir doch nichts verschweigen, oder?« Jonathan lachte. »Nur damit ich mich besser fühle?«
»Ach, Unsinn! Halten Sie mich für so einen Arzt?«
Ja, dachte Jonathan und sah Dr. Perrier in die Augen. In manchen Fällen mochte das ein Segen sein, doch Jonathan fand, daß er es verdiente, die Wahrheit zu hören, weil er ihr ins Gesicht sehen konnte. Er biß sich auf die Lippen. Nun könnte er zum Labor in Paris fahren und darauf bestehen, Moussu, den Facharzt, noch einmal zu sprechen. Außerdem würde er womöglich heute mittag etwas aus Simone herausbekommen.
Dr. Perrier klopfte ihm auf den Arm: »Entweder Ihr Freund irrt sich – ich verkneife mir die Frage, wie er heißt! –, oder er ist in meinen Augen kein sehr guter Freund. Na gut, Hauptsache, Sie sagen es mir, wenn die Müdigkeit wieder auftritt …«
Zwanzig Minuten später stieg Jonathan, einen Apfelkuchen und ein langes Baguette unter dem Arm, die Stufen zu seiner Haustür hinauf. Er schloß auf und ging durch den Flur in die Küche. Der Geruch nach Pommes frites ließ ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die gab es bei Simone stets zum Mittagessen, nie abends, und sie schnitt die Kartoffeln immer in lange, schmale Stifte, nicht in kurze, dicke Stücke, wie in England üblich. Warum hatte er gerade an englische Chips gedacht?
Simone stand am Herd, eine Schürze über dem Kleid, eine lange Gabel in der Hand. »Hallo, Jon. Du kommst spät.«
Er legte den Arm um sie und küßte sie auf die Wange. Dann hielt er den Pappkarton hoch und drehte sich zu Georges um, der seinen blonden Kopf über den Tisch beugte und aus einer leeren Cornflakes-Schachtel Teile für ein Mobile ausschnitt.
»Oh, ein Kuchen! Was für einer?« fragte Georges.
»Apfelkuchen.« Jonathan legte den Karton auf den Tisch.
Es gab ein kleines Steak für jeden, die köstlichen Pommes frites und grünen Salat.
»Brezard fängt jetzt mit der Inventur an«, sagte Simone. »Nächste Woche kommt die Sommerware, darum will er am Freitag und Samstag einen Schlußverkauf machen. Heute abend könnte es später werden.«
Sie hatte den Apfelkuchen auf dem Asbest-Teller aufgewärmt. Jonathan wartete ungeduldig darauf, daß Georges ins Wohnzimmer ging, wo er viel von seinem Spielzeug hatte, oder hinaus in den Garten. Als er endlich verschwunden war, sagte Jonathan:
»Heute habe ich einen seltsamen Brief von Alan bekommen.«
»Von Alan? Wieso seltsam?«
»Er hat ihn kurz vor seiner Abreise nach New York geschrieben. Offenbar hatte er gehört …« Sollte er ihr Alans Brief zeigen? Sie konnte Englisch ganz gut lesen. Jonathan entschied sich dagegen. »Irgendwer hat ihm erzählt, daß es mir schlechter geht, daß sich mein Zustand deutlich verschlimmern wird, etwas in der Art. Weißt du was davon?« Jonathan sah ihr in die Augen.
Simone schien ehrlich überrascht. »Aber nein, Jon. Woher auch, wenn nicht von dir?«
»Eben war ich bei Dr. Perrier. Daher auch die kleine Verspätung. Er sagte, er wüßte nicht, daß sich mein Zustand verändert hätte, aber du kennst ja Perrier!« Jonathan lächelte, beobachtete dabei aber ängstlich Simones Gesicht. »Hier ist der Brief.« Er zog ihn aus der Gesäßtasche und übersetzte den fraglichen Absatz.
»Mon dieu! Woher hat er das bloß?«
»Das ist die Frage. Ich werde ihm schreiben, was meinst du?« Wieder lächelte Jonathan, doch diesmal ungezwungener. Er war sicher, daß Simone nichts davon gewußt hatte.
Mit einer zweiten Tasse Kaffee ging Jonathan in das kleine, quadratische Wohnzimmer hinüber, wo Georges sich mittlerweile mit seinen Schnipseln auf dem Boden ausgebreitet hatte, und setzte sich an den Schreibtisch, an dem er sich immer wie ein Riese vorkam. Es war ein eher zierlicher französischer écritoire, ein Geschenk von Simones Familie. Jonathan achtete darauf, sich nicht zu schwer auf die Schreibplatte zu stützen. Er nahm ein Aerogramm, adressierte es an Alan McNear im Hotel New Yorker und begann den Brief heiter und unverfänglich, um dann im zweiten Absatz fortzufahren:
Ich weiß nicht genau, was Du in Deinem Brief mit dieser bestürzenden Neuigkeit (über mich) gemeint haben kannst. Mir geht es ganz gut, doch habe ich heute morgen mit meinem Hausarzt gesprochen, weil ich wissen wollte, ob er mir auch nichts verschweigt. Er sagt, er wüßte nicht, daß sich mein Zustand verschlechtert hätte. Also wüßte ich, lieber Alan, zu gern, woher Du das hast? Könntest Du mir bald einmal kurz zurückschreiben? Hier scheint ein Mißverständnis vorzuliegen. Ich würde es nur zu gern vergessen, aber Du verstehst hoffentlich, warum ich wissen will, woher Du es hast.
Auf dem Weg zum Laden warf er den Brief in einen gelben Postkasten. Alans Antwort würde wahrscheinlich eine Woche brauchen.
An diesem Nachmittag war Jonathans Hand so ruhig wie immer, als er das Rasiermesser an dem stählernen Lineal entlangzog. Er dachte an seinen Brief, der zum Flughafen von Orly unterwegs war und heute abend, vielleicht morgen früh, dort eintreffen würde. Er dachte an sein Alter – er war vierunddreißig – und daran, wie erbärmlich wenig er erreicht hätte, sollte er in wenigen Monaten sterben. Einen Sohn hatte er gezeugt, immerhin, doch brüsten konnte er sich damit wohl kaum. Simone wäre nicht ausreichend versorgt; wenn überhaupt, hätte er ihren Lebensstandard eher gesenkt. Ihr Vater war zwar nur Kohlenhändler, dennoch hatte sich ihre Familie über die Jahre die eine oder andere Annehmlichkeit anschaffen können, ein Auto zum Beispiel oder anständige Möbel. Im Juni oder Juli machten ihre Eltern Urlaub im Süden, wo sie ein Landhäuschen mieteten, und im letzten Jahr hatten sie einen Monat Miete übernommen, damit Jonathan und Simone mit Georges dort hinfahren konnten. Jonathan war nicht so erfolgreich wie sein Bruder Philip, der zwei Jahre älter war als er, aber körperlich schwächer wirkte und zeit seines Lebens ein langweiliger Streber gewesen war. Inzwischen hatte er es zum Professor für Anthropologie an der Universität Bristol gebracht – sicher kein brillanter Wissenschaftler, doch ein ordentlicher, grundsolider Mann mit einem ordentlichen Beruf, einer Frau und zwei Kindern. Jonathans inzwischen verwitwete Mutter lebte glücklich mit Bruder und Schwägerin in Oxfordshire, kümmerte sich um den großen Garten, erledigte die Einkäufe und kochte für die beiden. Jonathan hielt sich für den Versager der Familie, gesundheitlich wie auch beruflich. Mit achtzehn hatte er Schauspieler werden wollen und zwei Jahre lang die Schauspielschule besucht. Damals fand er, sein Gesicht eigne sich gut für die Bühne: Mit der großen Nase und dem breiten Mund war es nicht zu schön, aber anziehend genug für die romantischen Helden und dennoch so markant, daß er später auch Charakterrollen spielen könnte. Alles nur Träume. Gerade mal zwei winzige Nebenrollen hatte er in den drei Jahren bekommen, in denen er sich an den Theatern Londons und Manchesters herumtrieb, und dabei hatte er sich natürlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Jobs über Wasser halten müssen, einmal sogar als Tierarztgehilfe. »Sie brauchen viel Freiraum, doch Sie sind sich Ihrer selbst nicht sicher«, hatte ein Regisseur einmal zu ihm gesagt. Und dann, bei einer dieser Gelegenheitsarbeiten für einen Antiquitätenhändler, stellte Jonathan fest, daß ihm dieses Geschäft gefallen könnte. Er lernte von Andrew Mott, seinem Chef, was er nur konnte; dann folgte der große Umzug nach Frankreich mit Roy Johnson, seinem Kompagnon, der wie er für den Aufbau eines Antiquitätengeschäfts aus dem Altmöbelhandel viel Begeisterung, aber wenig Erfahrung mitbrachte. Jonathan wußte noch, wie er von Ruhm und Abenteuer in einem neuen Land geträumt hatte, von Freiheit und Erfolg in Frankreich. Und wie er sich statt des Erfolgs, statt erfahrener, lehrwilliger Mätressen, statt Freundschaften mit den Bohemiens oder den Angehörigen einer französischen Gesellschaftsschicht, die vielleicht nur in seiner Vorstellung existierte, weiterhin gerade so durchschlagen mußte, ohne daß es ihm eigentlich besserging als damals, als er sich als Schauspieler versucht und jeden Job angenommen hatte.
Der einzige Erfolg seines Lebens, dachte Jonathan, war die Ehe mit Simone. Er hatte von seiner Krankheit im selben Monat erfahren, als er Simone Foussadier kennenlernte. Damals begannen auch diese seltsamen Schwächeanfälle, die er in einer romantischen Anwandlung seiner Verliebtheit zuschrieb. Doch war es durch mehr Ruhe nicht besser geworden; einmal war er in Nemours auf der Straße ohnmächtig geworden. Also war er zu einem Arzt gegangen, zu Dr. Perrier in Fontainebleau. Der hatte eine Veränderung im Blutbild vermutet und ihn an einen Dr. Moussu in Paris überwiesen, einen Facharzt, der nach zweitägigen Untersuchungen bei Jonathan myeloische Leukämie festgestellt und erklärt hatte, ihm blieben noch sechs bis acht, mit Glück zwölf Jahre. Die damit einhergehende Vergrößerung der Milz war bei Jonathan bereits eingetreten, ohne daß er es bemerkt hätte. Insofern war der ungeschickt formulierte Heiratsantrag, den er Simone machte, zugleich eine Liebes- wie eine Todeserklärung. Den meisten jungen Frauen hätte das gereicht, um abzulehnen oder sich zumindest Bedenkzeit auszubitten. Simone aber hatte ja gesagt, sie liebe ihn auch. »Die Liebe zählt, nicht die Zeit«, hatte sie gesagt: nichts von der Berechnung, die Jonathan den Franzosen und Südländern generell zugeschrieben hatte. Simone meinte, mit ihrer Familie habe sie schon gesprochen. Und das zwei Wochen, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Auf einmal fühlte Jonathan sich in eine Welt versetzt, die sicherer war als jede bisher gekannte. Wie durch ein Wunder hatte die Liebe ihn errettet – Liebe im wirklichen, nicht nur romantischen Sinne des Wortes, Liebe, die außerhalb seiner Kontrolle lag. In gewisser Weise hatte sie ihn vom Tode erlöst, doch wußte er, was er damit eigentlich meinte: daß die Liebe dem Tod seinen Schrecken genommen hatte. Und da war er nun, der Tod, sechs Jahre später, so wie Dr. Moussu damals in Paris vorausgesagt hatte. Vielleicht. Jonathan wußte nicht mehr, was er glauben sollte.
Er würde Moussu in Paris noch einmal aufsuchen müssen. Vor drei Jahren hatte Jonathan unter dessen Aufsicht in einem Pariser Krankenhaus einen kompletten Blutaustausch vornehmen lassen. Das Verfahren hieß »Vincainestine«, und die Idee (oder die Hoffnung) ging dahin, daß das ausgetauschte Blut keinen Überschuß an Leukozyten und Granulozyten mehr aufweisen würde. Aber nach ungefähr acht Monaten war wiederum ein Überschuß an weißen Blutkörperchen festgestellt worden.
Bevor er jedoch einen Termin mit Dr. Moussu vereinbarte, wollte er Alan McNears Brief abwarten. Er war sicher, daß Alan sofort zurückschreiben würde. Auf Alan war Verlaß.
Bevor Jonathan seinen Laden verließ, warf er einen letzten verzweifelten Blick in den armseligen Raum. Allzu verstaubt war er nicht, nur die Wände müßten frisch gestrichen werden. Sollte er sich die Mühe machen, den Laden aufzupolieren, sollte er seine Kunden schröpfen wie so viele Bilderrahmer, indem er ihnen glänzendes Messing zu überhöhten Preisen andrehte? Jonathan wand sich innerlich. So etwas lag ihm nicht.
Das war am Mittwoch gewesen. Am Freitag hatte er sich mit einer hartnäckigen Schraube abgemüht, die seit rund hundertfünfzig Jahren in einem Eichenholzrahmen festsaß und keinerlei Anstalten machte, seiner Zange nachzugeben, als er auf einmal das Werkzeug fallen lassen und sich auf eine Holzkiste an der Wand setzen mußte. Im nächsten Moment stand er wieder auf und spritzte sich Wasser ins Gesicht, so tief über den Ausguß gebeugt, wie er nur konnte. Kurz darauf war der Schwächeanfall vorüber, und gegen Mittag dachte er schon nicht mehr daran. Diese Anfälle kamen alle zwei bis drei Monate. Jonathan war froh, wenn sie ihn nicht auf offener Straße erwischten.
Am Dienstag, sechs Tage nachdem er an Alan geschrieben hatte, bekam er einen Brief aus dem Hotel New Yorker.
Samstag, d. 25. März
Lieber Jon!
Wie ich mich freue, daß Du mit Deinem Hausarzt gesprochen hast und daß der neue Befund gut ist! Der Mann, der mir sagte, es gehe Dir schlechter, war ein kleiner Glatzkopf mit Schnurrbart und Glasauge, etwa Anfang Vierzig. Er schien sich ernsthaft Sorgen zu machen. Vielleicht solltest Du ihm nicht allzu böse sein, schließlich könnte er es seinerseits von jemand anderem gehört haben.
Die Stadt gefällt mir sehr gut – ich wünschte, Simone und Du könntet hier sein, zumal ich über ein Spesenkonto verfüge …
Der Mann, den Alan meinte, war Pierre Gauthier; er hatte ein Geschäft für Künstlerbedarf in der Rue Grande. Kein Freund von Jonathan, nur ein Bekannter. Er schickte ihm oft Kunden, die ihre Bilder gerahmt haben wollten. Gauthier war bei der Abschiedsparty für Alan im Haus gewesen, das wußte Jonathan genau, und mußte an dem Abend mit ihm gesprochen haben. Ausgeschlossen, daß Gauthier böswillig Gerüchte verbreitete. Daß er von seinem Leiden wußte, überraschte Jonathan ein bißchen, doch so etwas sprach sich eben herum. Am besten redete er mit Gauthier und fragte ihn, wo er die Geschichte gehört hatte.
Es war zehn vor neun. Jonathan hatte die Post abgewartet, genau wie gestern morgen. Am liebsten wäre er sofort zu Gauthier gelaufen, aber das hätte überängstlich gewirkt; besser, er ging ins Geschäft, um erst einmal zu sich zu kommen.
Jonathan hatte Kundschaft, konnte daher erst kurz vor halb elf weg. Er hängte das Schild mit dem Zifferblatt hinter die Glastür, den Zeiger auf elf Uhr gestellt.
Gauthier bediente gerade zwei Kundinnen, als Jonathan das Geschäft betrat. Er stöberte zwischen den Pinselgestellen herum und tat so, als suche er etwas, bis Gauthier frei war. Dann sagte er:
»Monsieur Gauthier! Wie geht es Ihnen?« Er streckte ihm die Hand entgegen.
Gauthier nahm Jonathans Rechte in beide Hände und lächelte. »Danke, gut. Und Ihnen, mein Freund?«
»Kann nicht klagen … Ecoutez, ich will Ihnen nicht die Zeit stehlen, aber ich würde Sie gern etwas fragen.«
»Ja, was denn?«
Jonathan bedeutete Gauthier, weiter von der Tür wegzutreten. Jeden Moment konnte jemand hereinkommen. Viel Platz zum Stehen gab es in dem kleinen Laden nicht. »Mir ist etwas zu Ohren gekommen. Ein Freund – Alan, Sie kennen ihn? Der Engländer. Auf der Party bei mir, vor einigen Wochen.«
»Ja klar. Ihr Freund, der Engländer. Alain.« Gauthier erinnerte sich. Er sah ihn aufmerksam an.
Jonathan gab sich Mühe, Gauthiers Glasauge mit keinem Blick zu streifen, sondern sich auf das andere Auge zu beschränken. »Nun, anscheinend haben Sie Alan erzählt, Sie hätten gehört, daß ich schwer krank wäre und vielleicht nicht mehr lange zu leben hätte.«
Gauthiers sanftes Gesicht verhärtete sich. »Stimmt, M’sieur, das habe ich gehört. Ich hoffe, es ist nicht wahr. An Alain erinnere ich mich, weil Sie ihn mir als Ihren besten Freund vorgestellt haben. Ich nahm also an, er wüßte davon. Wahrscheinlich hätte ich besser nichts sagen sollen. Tut mir leid, das war vielleicht taktlos von mir. Ich dachte, Sie wollten Haltung zeigen, wie die Engländer so sind.«
»Ist auch nicht weiter schlimm, Monsieur Gauthier, weil es nicht stimmt, soviel ich weiß. Ich habe gerade mit meinem Hausarzt gesprochen. Aber –«
»Ah, bon! Na gut, das ist etwas anderes! Freut mich, das zu hören, Monsieur Trevanny, ha ha!« Pierre Gauthier lachte schallend, als wäre ein Gespenst gebannt und Jonathan weilte wie er wieder unter den Lebenden.
»Aber ich wüßte doch gerne, woher Sie das haben. Wer hat Ihnen gesagt, ich wäre schwer krank?«
»Ach so!« Gauthier dachte nach, einen Finger an die Lippen gelegt. »Wer war’s doch gleich? Ein Mann. Ja, natürlich!« Es war ihm wieder eingefallen, doch er schwieg noch.
Jonathan wartete.
»Ich weiß noch, wie er sagte, er wäre sich nicht sicher. Er hätte es irgendwo gehört. Eine unheilbare Blutkrankheit.«
Heiß stieg die Angst in Jonathan auf, wie schon mehrmals zuvor in der letzten Woche. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Aber wer war das? Wie hat er davon erfahren? Hat er das nicht gesagt?«
Wieder zögerte Gauthier. »Da es nicht stimmt, sollten wir’s nicht besser vergessen?«
»Kannten Sie ihn gut?«
»Nein, nur flüchtig, da können Sie sicher sein.«
»Ein Kunde?«
»Ja. Ja, das ist er. Ein netter Herr, ein Gentleman. Und da er gesagt hat, er wäre nicht sicher … Wirklich, M’sieur, Sie sollten ihm nicht böse sein, obwohl ich verstehen kann, wie sehr Ihnen solch eine Bemerkung gegen den Strich gehen muß.«
»Bleibt die interessante Frage, wie dieser Gentleman erfahren haben will, ich wäre sehr krank«, setzte Jonathan lachend hinzu.
»Ja genau. Na, Hauptsache, es stimmt nicht, hab ich recht?«
Jonathan spürte Gauthiers französische Höflichkeit, seinen Widerwillen, einen Kunden zu verprellen, und, wie zu erwarten, seine Abneigung, über den Tod zu sprechen. »Sie haben recht. Das ist die Hauptsache.« Er schüttelte Gauthier die Hand (nun lächelten beide) und verabschiedete sich.
Später am Tag fragte Simone beim Mittagessen, ob er von Alan gehört habe. Ja, sagte Jonathan.
»Gauthier hat Alan davon erzählt.«
»Gauthier? Der mit dem Kunstladen?«
»Ja.« Jonathan zündete sich zum Kaffee eine Zigarette an. Georges war im Garten verschwunden. »Heute morgen bin ich bei Gauthier gewesen und hab ihn gefragt, woher er das hat. Von einem Kunden, hat er gesagt. Von einem Mann. – Ist doch komisch, oder? Gauthier wollte mir nicht sagen, wer es war, und ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Natürlich ist das ein Mißverständnis. Gauthier weiß das.«
»Aber schrecklich ist es trotzdem«, sagte Simone.
Jonathan lächelte: So schrecklich fand Simone das alles gar nicht, weil sie wußte, daß Dr. Perriers Befund nicht so schlimm gewesen war. »Wie heißt es so schön: Man soll aus einer Mücke keinen Elefanten machen.«
Eine Woche später lief Jonathan dem Arzt in der Rue Grande über den Weg. Dr. Perrier hatte es eilig, zur Société Générale zu kommen, denn die Sparkasse schloß um Punkt zwölf. Aber er blieb kurz stehen und fragte nach Jonathans Befinden.
»Danke, ganz gut«, sagte Jonathan, in Gedanken bei dem Saugstopfen für die Toilette, den er hundert Meter weiter in einem Laden besorgen wollte. Der Laden schloß gleichfalls um zwölf.
»Monsieur Trevanny …« Dr. Perrier blieb stehen, eine Hand auf dem großen Knauf der Sparkassentür. Er trat einen Schritt zurück, auf Jonathan zu. »Was unser Gespräch neulich betrifft: Wissen Sie, bei Ihrem Befund kann Ihnen kein Arzt völlige Sicherheit geben. Ich möchte nicht, daß Sie denken, ich hätte Ihnen auf Jahre beste Gesundheit garantiert, Unverwundbarkeit sozusagen. Sie wissen selber –«
»O nein, so hab ich das gar nicht verstanden!« fiel Jonathan ihm ins Wort.
»Dann wäre das ja geklärt.« Dr. Perrier lächelte und verschwand in der Bank.
Jonathan trottete weiter auf der Suche nach seinem Saugstopfen. Der Abfluß in der Küche war verstopft, nicht die Toilette, fiel ihm jetzt ein, und Simone hatte ihr Gerät schon vor Monaten einem Nachbarn geliehen und … Dann dachte er daran, was Dr. Perrier gesagt hatte: Wußte der Doktor etwa doch etwas? Hegte er nach dem letzten Test einen Verdacht, der noch zu vage war, um ihn zu erwähnen?
An der Tür zur Drogerie stand Jonathan vor einem dunkelhaarigen Mädchen, das gerade abschloß und die äußere Türklinke abnahm.
»Tut mir leid, Monsieur, es ist fünf nach zwölf«, sagte sie lächelnd.
3
In der letzten Märzwoche arbeitete Tom an einem lebensgroßen Porträt von Héloïse, das sie ausgestreckt auf dem gelben Satinsofa zeigte. Héloïse war nur selten bereit, Modell zu sitzen. Doch wenigstens das Sofa hielt still, und Tom hatte es zu seiner Zufriedenheit auf die Leinwand gebannt. Außerdem hatte er sieben oder acht Skizzen von Héloïse angefertigt, den Kopf auf die linke Hand gestützt, die Rechte auf einen großen Bildband gelegt. Die beiden besten behielt er, den Rest warf er weg.
Reeves Minot hatte in einem Brief angefragt, ob Tom schon etwas eingefallen sei, das ihm weiterhelfen könne – ein Name, meinte Reeves. Einige Tage zuvor hatte Tom mit Gauthier gesprochen, bei dem er gewöhnlich seine Farben kaufte. Tom hatte Reeves zurückgeschrieben: »Werde darüber nachdenken, doch falls Ihnen in der Zwischenzeit etwas einfällt, sollten Sie Ihre eigene Idee weiterverfolgen.« Das »werde darüber nachdenken« war nur eine Höflichkeitsfloskel, die nicht einmal stimmte, eine der vielen Phrasen zum Ölen des Räderwerks gesellschaftlichen Miteinanders, wie Emily Post gesagt hätte. Nicht daß Minots Geld Belle Ombres Räder ölte; seine Zahlungen an Tom für dessen gelegentliche Dienste als Mittelsmann und Hehler deckten kaum die Kosten für die chemische Reinigung. Aber es konnte nie schaden, Freundschaften zu pflegen. Der Mann hatte Tom einst einen gefälschten Paß besorgt und schnell nach Paris geschickt, als Tom zur Verteidigung von Derwatt Ltd. unter falschem Namen reisen mußte. Eines Tages könnte er Minot erneut brauchen.
Dagegen war die Sache mit Jonathan Trevanny für Tom nur ein Spiel. Mit Minots Glücksspielgeschäften hatte das für ihn nichts zu tun. Tom war Glücksspiel zuwider, er hielt nichts von Leuten, die davon lebten, und sei es nur zum Teil. Es roch nach Zuhälterei. Tom hatte das Spiel mit Trevanny begonnen, weil er neugierig war, weil Trevanny ihn einmal verhöhnt hatte – und weil er sehen wollte, ob sein ungezielter Pfeil das Ziel finden und Jonathan Trevanny, in seinen Augen ein selbstgerechter Spießer, für eine Weile verunsichern könnte. Danach durfte dann Reeves seinen Köder auswerfen, natürlich nicht ohne Trevanny einzubleuen, er müsse sowieso bald sterben. Tom glaubte nicht, daß der Mann anbeißen würde, aber auf jeden Fall hatte er eine ungemütliche Zeit vor sich. Leider konnte Tom nicht abschätzen, wann das Gerücht Jonathan Trevanny zu Ohren kommen würde. Gauthier tratschte ganz gerne, doch es war immerhin denkbar, daß er es zwei, drei Leuten erzählte, aber keiner von ihnen den Mut fand, das Thema Trevanny gegenüber anzusprechen.
Und so zählte Tom Wochen später noch immer die Tage – obwohl er wie immer genug zu tun hatte, mit seiner Malerei, dem Setzen der Frühjahrsknollen und seiner Lektüre deutscher und französischer Literatur (zur Zeit Schiller und Molière), dazu der Aufsicht über drei Arbeiter, die hinter dem Haus, rechts vom Rasen, ein Gewächshaus hochzogen – und stellte sich vor, was alles nach jenem Nachmittag mitten im März hätte geschehen können, als er zu Gauthier gesagt hatte, Trevanny bleibe nicht mehr viel Zeit auf dieser Welt. Daß Gauthier damit direkt zu Trevanny ging, war eher unwahrscheinlich, es sei denn, die beiden standen sich näher als vermutet. Eher würde Gauthier jemand anders davon erzählen. Dabei vertraute Tom auf die Tatsache, daß der möglicherweise unmittelbar bevorstehende Tod eines anderen Menschen jedermann faszinierte.
Etwa alle zwei Wochen fuhr er die zwanzig Kilometer nach Fontainebleau. Dort konnte er besser als in Moret einkaufen, Wildledermäntel in die Reinigung geben, Radiobatterien besorgen wie auch Delikatessen, die Madame Annette für die Küche brauchte. Ein Blick ins Telefonbuch hatte ihm verraten, daß Jonathan Trevanny zwar in seinem Laden Telefon hatte, offenbar aber nicht zu Hause in der Rue Saint-Merry. Er dachte daran zu versuchen, die Hausnummer herauszufinden, aber er würde das Haus wiedererkennen, wenn er es sähe. Gegen Ende März wurde Tom neugierig: Er wollte Trevanny wiedersehen, selbstverständlich nur von weitem, und so kam es, daß er eines Freitag morgens, nachdem er auf dem Markt von Fontainebleau zwei Blumenkübel aus Terracotta gekauft und sie hinten in seinem Renault Kombi verstaut hatte, durch die Rue des Sablons spazierte, wo Trevanny sein Geschäft hatte. Es war kurz vor zwölf.
Trevannys Laden könnte einen neuen Anstrich gebrauchen; er wirkte bedrückend, als wäre sein Besitzer ein alter Mann. Tom war dort nie Kunde gewesen, weil es in Moret, das Belle Ombre näher lag, einen guten Bilderrahmer gab. Das kleine Geschäft mit der Aufschrift Encadrements in verblichenen roten Buchstaben auf dem Holzschild über der Tür gehörte zu einer Ladenzeile mit einer Wäscherei, einem Schuhmacher und einem bescheidenen Reisebüro. Links war die Tür, rechts das quadratische Schaufenster mit diversen Rahmen sowie ein paar Bildern mit handgeschriebenen Preisschildern. Tom schlenderte über die Straße, warf einen Blick in den Laden und sah Trevannys hochgewachsene, nordische Gestalt hinter dem Ladentisch stehen, rund fünf Meter entfernt. Er zeigte einem Mann eine Rahmenleiste, redete auf ihn ein und schlug sich dabei mit dem Holz in die Hand. Dann blickte er auf und bemerkte Tom, sprach aber weiter zu dem Kunden, ohne eine Miene zu verziehen.
Tom schlenderte weiter. Trevanny hatte ihn sicher nicht erkannt. Er bog rechts ab in die Rue de France, die wichtigste Nebenstraße der Rue Grande, und ging weiter bis zur Kreuzung mit der Rue Saint-Merry. Dort wandte er sich nach rechts. Oder lag Trevannys Haus zur Linken? Nein, rechts.
Ja, da war es, kein Zweifel: ein schmales, graues, engbrüstiges Haus mit einem schlanken schwarzen Geländer über der Vordertreppe. Das winzige Zementgeviert beiderseits der Stufen wirkte öde ohne Blumentöpfe. Doch hinter dem Haus lag ein Garten, wie Tom sich erinnerte. Die Fenster waren blitzsauber, aber die Gardinen hingen schlaff herab. Ja, hier war er gewesen, auf Einladung Gauthiers, an jenem Abend im Februar. Links vom Haus führte ein schmaler Durchgang zum Garten. Eine grüne Plastiktonne stand vor dem eisernen Gartentor, das mit einem Vorhängeschloß gesichert war. Wahrscheinlich gelangten die Trevannys gewöhnlich von der Küche durch die Hintertür in den Garten. Im Geiste sah Tom die Tür wieder vor sich.
Auf dem Gehweg gegenüber ging er die Straße entlang, langsam, doch zielbewußt. Er wollte den Eindruck vermeiden, er lungere vor dem Haus herum, weil er nicht sicher sein konnte, daß nicht Trevannys Frau oder sonstwer gerade in diesem Augenblick aus dem Fenster schaute.
War noch etwas zu besorgen? … Deckweiß. Er hatte fast keins mehr. Und das würde ihn zu Gauthier führen, den Künstlerbedarfshändler. Tom ging schneller. Er war hochzufrieden mit sich, denn Deckweiß brauchte er wirklich, also würde er Gauthiers Laden mit einem echten Anliegen betreten und vielleicht zugleich seine Neugier befriedigen können.
Gauthier war alleine im Laden.
»Bonjour, Monsieur Gauthier«, sagte Tom.
»Bonjour, Monsieur Riiepley!« Gauthier lächelte. »Wie geht es Ihnen?«
»Danke, bestens, und Ihnen? – Ich bräuchte ein bißchen Deckweiß.«
»Deckweiß …« Aus einem Wandschrank zog Gauthier eine flache Schublade hervor. »Hier, bitte sehr. Sie nehmen gern das von Rembrandt, nicht wahr?«
Das stimmte. Deckweiß der Marke Derwatt und andere Farben jener Firma gab es auch; die Etikette der Tuben zeigten in Schwarz die kühne, schräg abwärts zackende Unterschrift Derwatts. Aber etwas in Tom sträubte sich dagegen, beim Malen zu Hause immerzu den Namen Derwatt zu lesen, wenn er nach einer Farbtube griff. Er bezahlte, Gauthier gab ihm das Wechselgeld und die kleine Tüte mit dem Deckweiß und sagte:
»Ach, Monsieur Riiepley, erinnern Sie sich an Monsieur Trevanny, den Bilderrahmer aus der Rue Saint-Merry?«
»Aber natürlich.« Tom hatte sich schon gefragt, wie er das Gespräch auf Trevanny bringen sollte.
»Nun, was Sie gehört haben – daß er bald sterben muß –, also, das stimmt gar nicht.« Gauthier lächelte.
»Ach nein? Na, wie schön! Das freut mich.«
»Ja. Monsieur Trevanny ist deshalb sogar zu seinem Hausarzt gegangen. Ich glaube, er war ein bißchen verstört. Wer wäre das nicht? Ha, ha. – Aber Monsieur Riipley, sagten Sie nicht, jemand hätte es Ihnen erzählt?«
»Ja. Ein Mann auf der Party damals im Februar. Madame Trevannys Geburtstagsparty. Sehen Sie, ich nahm an, es stimmte und jeder wüßte davon.«
Gauthier machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Haben Sie mit Monsieur Trevanny gesprochen?«
»Nein, das nicht. Aber mit seinem besten Freund, an einem anderen Abend im Haus der Trevannys. Diesen Monat war das. Offenbar hatte Monsieur Trevanny es ihm erzählt. Wie schnell sich so etwas herumspricht!«
»Mit seinem besten Freund?« fragte Tom unschuldig nach.
»Einem Engländer. Alain Soundso. Er wollte tags darauf nach Amerika. Aber … Monsieur Riipley, wissen Sie noch, wer Ihnen das erzählt hat?«





























