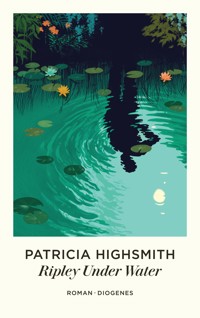
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ripley
- Sprache: Deutsch
Der Amerikaner Tom Ripley liebt tadellose Manieren, den richtigen Burgunder zum Hummer und allmorgendlich die schönste Blume aus dem liebevoll gehegten Garten seines Landsitzes südlich von Paris. Niemand käme auf die Idee, im Keller eines solchen Herrn nach Blutspuren zu suchen. Niemand außer Ripleys neuem Nachbarn, der davon träumt, Tom Ripleys Leben zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Patricia Highsmith
Ripley Under Water
Roman
Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis
Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay
Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta
Diogenes
Ripley Under Water
Den Toten und Sterbenden der Intifada und des kurdischen Volkes und jenen Menschen, die in allen Ländern der Welt gegen Unterdrückung kämpfen und nicht nur dagegen aufstehen, sondern auch dafür erschossen werden.
1
Tom stand in Georges’ und Maries bar-tabac mit einer fast vollen Espressotasse in der Hand. Er hatte schon gezahlt; die beiden Schachteln Marlboro für Héloïse beulten seine Jackettasche. Er beobachtete einen Mann vor einem Videospiel.
Auf dem Bildschirm raste ein Motorradfahrer, eine Figur wie aus dem Comic, geradeaus in den Hintergrund davon. Die Illusion der Geschwindigkeit entstand durch den Lattenzaun beiderseits der Straße, der nach vorne entschwand. Der Spieler bediente einen halbrunden Steuerknüppel und ließ den Fahrer ausscheren, um ein langsameres Auto zu überholen oder wie zu Pferd über einen Zaun zu springen, der plötzlich die Straße blockierte. Wenn Fahrer oder Spieler die Hürde zu spät nahmen, prallte das Motorrad lautlos dagegen, und ein schwarzgoldener Stern zeigte den Unfall an: Ende des Spiels, Ende des Fahrers. Tom hatte bei dem Spiel schon oft zugeschaut (es war beliebter als jeder andere Automat, den Georges und Marie je aufgestellt hatten), aber nie selber gespielt. Aus irgendeinem Grund wollte er das nicht.
»Non – non!« Marie hinter der Theke übertönte den üblichen Lärm; sie widersprach einem Gast, der sich wahrscheinlich politisch geäußert hatte. Ihr Mann und sie waren eingefleischte Linke. »Ecoutez, Mitterand …«
Tom mußte denken, daß der Zustrom nordafrikanischer Einwanderer den beiden trotzdem nicht gefiel.
»Eh, Marie! Deux pastis!« Das war der dicke Georges, eine schmuddelige Schürze über Hemd und Hose, der an den wenigen Tischen bediente, wo die Gäste sitzen konnten, um etwas zu trinken und Chips oder hartgekochte Eier zu essen.
Die Musikbox spielte einen alten Cha-Cha-Cha.
Ein lautloser, schwarzgoldener Stern! Die Umstehenden seufzten mitfühlend. Tot, aus, Ende – alles vorbei. Beharrlich flackerte die stumme Aufforderung über den Bildschirm: GELD EINWERFEN GELD EINWERFEN GELD EINWERFEN, und gehorsam fischte der Arbeiter in der Hose seiner Bluejeans nach Münzen, warf Geld nach, und das Spiel begann von neuem: Der Motorradfahrer raste los, heil und wie neu, gegen alles gewappnet, wich elegant einem Faß auf der Fahrbahn aus und übersprang mühelos die erste Barriere. Der Mann am Steuer war hoch konzentriert, versessen darauf, seinen Mann ins Ziel zu bringen.
Tom dachte an Héloïse, an ihre Reise nach Marokko. Tanger wollte sie sehen, Casablanca, vielleicht auch Marrakesch. Und er hatte gesagt, er werde mitkommen. Schließlich war das nicht eine ihrer Abenteuerkreuzfahrten, die vor dem Auslaufen diverse Impfungen in Krankenhäusern erforderten, und es gehörte sich, daß er als ihr Gatte sie bei manchen ihrer Spritztouren begleitete. Héloïse hatte zwei oder drei dieser spontanen Eingebungen pro Jahr, die sie aber nicht immer in die Tat umsetzte. Tom war gerade nicht in Urlaubsstimmung: Es war Anfang August, der heißeste Monat in Marokko – zu dieser Zeit des Jahres gefielen ihm seine Rosen und Dahlien besonders gut, und er schnitt fast täglich zwei, drei frische Blumen für das Wohnzimmer. Tom hing an seinem Garten, und er hatte auch nichts gegen Henri, der ihm gelegentlich bei größeren Arbeiten half – der war stark wie ein Riese, doch für gewisse Aufgaben nicht der richtige Mann.
Dann dachte er an dieses Paar, die »Seltsamen Zwei«, wie Tom sie inzwischen im stillen getauft hatte. Er wußte nicht, ob sie verheiratet waren, doch das war ja nicht wichtig. Er spürte, daß sie hier in der Gegend auf der Lauer lagen und ihn nicht aus den Augen ließen. Vielleicht waren sie harmlos, aber man konnte nie wissen. Tom waren die beiden erstmals vor rund vier Wochen aufgefallen, als Héloïse und er in Fontainebleau einkaufen gingen: ein Mann und eine Frau, Mitte Dreißig, dem Aussehen nach Amerikaner. Sie waren auf ihn zugekommen und hatten ihn mit diesem Blick gemustert, den er gut kannte – als wüßten sie, wer er sei, und kannten womöglich auch seinen Namen, Tom Ripley. Den gleichen Blick hatte er ein paarmal auf Flughäfen gespürt, wenn auch selten und zuletzt gar nicht mehr. Vermutlich passierte so etwas öfter, wenn eine Zeitung das Foto von jemandem brachte; aber seit Jahren war in den Blättern kein Bild von ihm mehr erschienen, da war Tom sicher. Nicht seit der Sache mit Murchison, und die lag rund fünf Jahre zurück: Der Blutfleck – Murchisons Blut – war im Keller nach wie vor zu sehen, und wenn er irgendwem auffiel, sagte Tom, es sei Rotwein.
Tatsächlich war es eine Mischung aus Wein und Blut, erinnerte sich Ripley, denn Murchison war von einer Weinflasche am Kopf getroffen worden – von einer Flasche Margaux, und er selber hatte zugeschlagen.
Tja, die Seltsamen Zwei … Zack, der Fahrer schlug auf und war weg. Tom wandte sich widerwillig ab und ging mit der leeren Tasse zur Theke zurück.
Der Mann von den beiden hatte dunkles, glattes Haar und trug eine Nickelbrille mit runden Gläsern; die Frau hatte hellbraunes Haar, ein schmales Gesicht und graue oder graubraune Augen. Es war der Mann gewesen, der Tom angestarrt und dazu vage, nichtssagend gelächelt hatte. Tom meinte, ihn schon einmal gesehen zu haben – ein Flughafen, Heathrow oder Roissy, und dieser Ich-kenne-dich-Blick: Nicht direkt feindselig, aber unangenehm.
Und dann hatte Tom die beiden einmal gesehen, als sie langsam in ihrem Wagen mittags die Hauptstraße von Villeperce entlangrollten und er mit einer flûte aus der Bäckerei kam (es mußte wohl Madame Annettes freier Tag gewesen sein, oder sie hatte mit dem Mittagessen zu tun gehabt). Und wieder war ihm aufgefallen, daß sie ihn musterten. Villeperce war ein kleines Nest mehrere Kilometer außerhalb von Fontainebleau – was hatten die Seltsamen Zwei ausgerechnet hier verloren?
Marie mit ihrem breiten, roten Lächeln und Georges mit seiner beginnenden Glatze standen beide hinter der Theke, als Tom ihnen Tasse und Untertasse hinüberschob. »Merci et bonne nuit, Marie – Georges!« Er lächelte.
»Bonsoir, M’sieur Ripley!« rief Georges und winkte mit der freien Hand, während er mit der anderen Calvados einschenkte.
»Merci, M’sieur – à bientôt!« warf Marie hinterher.
Tom war fast an der Tür, als der Mann mit der Nickelbrille eintrat. Er war offenbar allein.
»Mr. Ripley?« Wieder lag ein Lächeln auf seinen blaßrosa Lippen. »Guten Abend.«
»Bonsoir«, erwiderte Tom und ging weiter.
»Wir, das heißt, meine Frau und ich, würden Sie gern auf einen Drink einladen.«
»Danke, aber ich gehe gerade.«
»Ein andermal vielleicht. Wir haben ein Haus in Villeperce gemietet. Dort drüben.« Er wies vage in Richtung Norden, lächelte breiter und zeigte kleine, ebenmäßige Zähne. »Sieht aus, als würden wir Nachbarn.«
Tom stand zwei Leuten im Weg, die hineinwollten, und mußte in die Bar zurückweichen.
»Ich heiße Pritchard – David. Habe Kurse am INSEAD belegt, dem großen Managementinstitut in Fontainebleau. Sie kennen es sicher. Na jedenfalls, mein Haus hier ist weiß, zweistöckig, hat einen Garten. Und einen kleinen Teich. Deswegen haben wir uns in das Haus verliebt – die Spiegelungen an der Decke, vom Wasser.« Er lachte leise.
»Aha.« Tom gab sich Mühe, einigermaßen freundlich zu bleiben. Er stand nun draußen vor der Tür.
»Ich rufe Sie an. Meine Frau heißt Janice.«
Tom nickte knapp und lächelte gezwungen. »Ja, gut, tun Sie das. Guten Abend.«
»Gibt nicht so viele Amerikaner hier!« rief ihm David Pritchard unbeirrt nach.
Mr. Pritchard dürfte es schwer haben, seine Nummer herauszufinden, weil Héloïse und er darauf bestanden hatten, nicht eingetragen zu werden. Der eher bieder wirkende Mann, fast so groß wie Tom und ein bißchen schwerer, würde Ärger bringen, dachte Tom auf dem Weg nach Hause. Ein Polizist, der alte Akten ausgrub? Ein Privatdetektiv, der für – ja, wen eigentlich arbeitete? Feinde, die noch aktiv waren, fielen ihm nicht ein. »Falsch«, das war das Wort, das Tom bei David Pritchard in den Sinn kam: falsches Lächeln, falsche Bonhomie, und die Geschichte mit dem Studium am INSEAD war vielleicht auch falsch. Das INSEAD in Fontainebleau war möglicherweise nur eine Tarnung, doch eine so durchsichtige, daß er nicht ausschloß, Pritchard könne dort tatsächlich Kurse belegt haben. Vielleicht waren die beiden aber auch gar nicht Mann und Frau, sondern arbeiteten gemeinsam für die CIA. Doch weshalb sollten die USA hinter ihm her sein? Nicht wegen der Einkommenssteuer, die war in Ordnung. Murchison? Nein, der Fall war abgeschlossen. Zumindest hatte man die Ermittlungen eingestellt. Murchison und seine Leiche waren verschwunden. Dickie Greenleaf? Wohl kaum. Selbst Christopher Greenleaf, Dickies Cousin, schrieb Tom dann und wann eine freundliche Postkarte, so wie etwa letztes Jahr aus Alice Springs. Christopher war Bauingenieur geworden, hatte geheiratet und arbeitete in Rochester, New York, wenn Tom nicht irrte. Sogar mit Dickies Vater Herbert stand er sich gut; wenigstens schickten sie sich Weihnachtskarten.
Als der große Baum gegenüber von Belle Ombre in Sicht kam, dessen Äste ein Stück weit über die Straße ragten, stieg Toms Stimmung. Warum sich Sorgen machen? Er stieß den einen Torflügel gerade weit genug auf, um durchzuschlüpfen, schloß das Tor so sachte er konnte, ließ das Vorhängeschloß sanft klickend einrasten und schob den langen Bolzen vor.
Reeves Minot: Abrupt blieb Tom stehen, rutschte auf dem Kies der Einfahrt aus. Ein weiterer Hehlerjob für Minot zeichnete sich ab. Reeves hatte vor ein paar Tagen angerufen. Oft schwor sich Tom: nie wieder, und nahm dann doch noch einmal an. Weil er gern neue Leute kennenlernte? Tom lachte, kurz und fast lautlos, und ging weiter zur Haustür, mit seinen gewohnt leichten Schritten, die kaum auf dem Kies knirschten.
Im Wohnzimmer brannte Licht; die Haustür war nicht verschlossen, genau wie vor einer Dreiviertelstunde, als Tom gegangen war. Er trat ein, schloß hinter sich ab. Héloïse saß auf dem Sofa, in eine Zeitschrift vertieft – vermutlich einen Artikel über Nordafrika.
»’allô, chéri. Reeves hat angerufen.« Héloïse sah auf und warf ihr blondes Haar zurück. »Tomme, hast du …?«
»Ja. Fang!« Lächelnd warf er ihr die erste rotweiße Schachtel zu, dann die zweite. Die erste fing sie, die zweite prallte vorn gegen ihr blaues Hemd. »Irgendwas Dringendes bei Reeves? Pressant, prestissimo, penetrant?«
»Ach Tomme, hör schon auf!« Sie griff zu ihrem Feuerzeug. Insgeheim genoß sie seine Wortspiele, dachte Tom, würde das aber nie zugeben und sich nur selten ein Lächeln gestatten. »Er ruft zurück, doch vielleicht nicht mehr heute abend.«
»Irgendwer … Na, egal.« Tom brach ab: Minot ging niemals ins Detail, wenn er mit Héloïse sprach, und sie gab vor, die Aktivitäten der beiden seien ihr egal, sie finde sie sogar langweilig. Es war sicherer so – sie dachte wahrscheinlich, je weniger sie wisse, desto besser. Und wer wollte das bestreiten?
»Tomme, morgen gehen wir die Tickets kaufen, für Marokko. In Ordnung?« Sie hatte die bloßen Füße auf dem gelben Seidensofa unter sich gezogen wie ein behaglich hingekauertes Kätzchen und sah ihn ruhig aus ihren lavendelblauen Augen an.
»J-ja, gut.« Er hatte es versprochen, sagte er sich. »Zuerst fliegen wir nach Tanger.«
»Oui, chéri, und von dort geht’s dann weiter. Nach Casablanca natürlich.«
»Natürlich«, wiederholte Tom. »Gut, Liebes, morgen kaufen wir die Flugscheine. In Fontainebleau.« Sie buchten immer im selben Reisebüro, wo man sie kannte. Tom zögerte, sagte es dann aber doch: »Liebling, weißt du noch, das Paar, das wir neulich in Fontainebleau gesehen haben? Auf dem Bürgersteig? Sahen aus wie Amerikaner. Die beiden kamen uns entgegen, und später sagte ich, der Mann hätte uns angestarrt – dunkles Haar, Brille?«
»Ich glaube schon. Ja. Warum?«
Er sah ihr an, daß sie sich genau erinnerte. »Weil er mich vorhin im bar-tabac angesprochen hat.« Tom knöpfte sein Jackett auf und steckte die Hände in die Hosentaschen. Er stand noch. »Ich mag den Kerl nicht.«
»Seine Begleiterin sehe ich vor mir – helleres Haar. Beides Amerikaner, nicht?«
»Er mit Sicherheit. Na, jedenfalls haben sie hier in Villeperce ein Haus gemietet, du weißt schon, das mit –«
»Vraiment? In Villeperce?«
»Oui, ma chère! Das Haus mit dem Teich – er spiegelt sich an der Wohnzimmerdecke.« Beide hatten sie das Oval bestaunt, das wie Wasser auf der weißen Decke spielte.
»Ja, ich erinnere mich an das Haus. Zweistöckig, weiß, kein allzu schöner Kamin. Nicht weit von den Grais’, nicht? Jemand war doch mal bei uns, der überlegt hat, es zu kaufen.«
»Ja, stimmt.« Der amerikanische Bekannte eines Bekannten, der ein Landhaus nicht zu weit weg von Paris suchte, hatte Tom und Héloïse gebeten, ihn bei der Besichtigung einiger Häuser in der Umgebung zu begleiten. Gekauft hatte er nichts, jedenfalls nicht in oder um Villeperce. Mehr als ein Jahr war das her. »Nun, um zum Punkt zu kommen: Der Dunkelhaarige mit der Brille möchte mit mir, mit uns, auf gute Nachbarschaft machen, und ich will das nicht. Ha, nur weil wir seine Sprache sprechen! Scheint etwas mit INSEAD zu tun zu haben, der Hochschule bei Fontainebleau.« Tom fuhr fort: »Woher hat er überhaupt meinen Namen, und wieso ist er so versessen darauf, mich kennenzulernen?« Um nicht zu besorgt zu erscheinen, nahm er lässig ihr gegenüber auf dem Stuhl vor dem Couchtisch Platz. »David und Janice Pritchard heißen sie. Sollten sie tatsächlich hier anrufen, bleiben wir höflich, haben aber keine Zeit. In Ordnung, Liebes?«
»Natürlich, Tom.«
»Und falls sie so dreist sein sollten, an der Tür zu klingeln, lassen wir sie nicht herein. Keine Sorge, ich werde Madame Annette vorwarnen.«
Héloïse runzelte nachdenklich ihre sonst so glatte Stirn unter dem blonden Haar. »Was ist los mit ihnen?«
Die Frage war so arglos, daß Tom lächeln mußte. »Mein Gefühl sagt mir …« Er zögerte. Gewöhnlich sprach er mit ihr nicht über seine Ahnungen, aber in diesem Fall wäre es nur zu ihrem Schutz. »Die beiden scheinen mir nicht normal.« Tom senkte den Blick auf den Teppich. Was war schon normal? Darauf wüßte auch er keine Antwort. »Ich glaube, sie sind nicht verheiratet.«
»Na und, wenn schon?«
Tom lachte, griff nach der blauen Schachtel Gitanes auf dem Couchtisch und zündete sich mit ihrem Dunhill-Feuerzeug eine Zigarette an. »Ganz recht, mein Schatz. Aber warum beobachten sie mich? Hab ich dir nicht gesagt, daß ich meine, ich hätte ihn, womöglich auch beide, vor kurzem auf einem Flughafen gesehen? Und sie hätten mich angestarrt?«
»Nein, hast du nicht.« Sie klang sehr überzeugt.
»Nicht daß ich meine, es wäre wichtig … Aber ich schlage vor, bei eventuellen Annäherungsversuchen höflich auf Distanz zu gehen. Okay?«
»Ja, Tomme.«
Er lächelte. »Hat früher schon Leute gegeben, die wir nicht mochten. Kein großes Problem.« Tom stand auf, ging um den Couchtisch herum und zog Héloïse an der Hand hoch, die sie ihm entgegenstreckte. Er nahm sie in die Arme, schloß die Augen, genoß den Duft ihres Haars, ihrer Haut. »Ich liebe dich. Ich will nicht, daß dir etwas zustößt.«
Héloïse lachte. Sie lösten sich voneinander. »Belle Ombre scheint mir mehr als sicher.«
»Hier kommen sie jedenfalls nicht herein.«
2
Tags darauf fuhren Tom und Héloïse nach Fontainebleau, um die Tickets zu kaufen – Royal Air Maroc, wie sich herausstellte. Eigentlich hatten sie mit Air France fliegen wollen.
»Die beiden Linien sind eng vernetzt«, sagte die junge Frau im Reisebüro, ein neues Gesicht für Tom. »Hotel Minzah, ein Doppelzimmer, drei Übernachtungen?«
»Hotel Minzah, ja«, erwiderte Tom auf französisch. Bestimmt könnten sie einen Tag länger bleiben, wenn es ihnen gefiel. Das Minzah galt derzeit als Tangers beste Adresse. Héloïse war in einen Laden um die Ecke gegangen, sie wollte Shampoo kaufen. Tom ertappte sich dabei, daß er immer wieder zur Tür sah während der langen Minuten, die das Mädchen zum Ausstellen der Flugscheine brauchte, und daß er aus irgendeinem Grund an David Pritchard dachte. Dabei rechnete er nicht ernsthaft damit, daß der Mann hereinkommen werde. Hatten er und seine Frau nicht genug mit dem Einzug in ihr Landhaus zu tun?
»Kennen Sie Marokko, Monsieur Ripley?« fragte die junge Frau und sah lächelnd zu ihm auf, während sie ein Ticket in den großen Umschlag steckte.
Interessierte sie das wirklich, fragte sich Tom. Er lächelte höflich zurück. »Nein. Aber ich freue mich darauf.«
»Rückflug offen. Wenn Sie sich in das Land verlieben, können Sie also noch eine Weile bleiben.« Sie gab ihm den Umschlag mit dem zweiten Ticket.
Tom hatte schon einen Scheck ausgestellt. »Gut. Vielen Dank, Mademoiselle.«
»Bon voyage!«
»Merci.« Tom ging zur Tür. Bunte Plakate bedeckten die Wände: Tahiti, blaues Meer, ein kleines Segelboot und – ja, dort – das Bild, bei dem Tom zumindest im stillen stets lächeln mußte: Phuket, eine Insel vor Thailand, wie er wußte, denn er hatte es nachgeschlagen. Das Poster zeigte ebenfalls blaues Meer, gelben Strand, eine zum Meer hin geneigte Palme, gebeugt durch Jahre im Wind. Keine Menschenseele weit und breit. »Schlechten Tag gehabt? Schlechtes Jahr? Fuck it – Phuket!« Das wäre ein guter Werbespruch, dachte Tom. Würde jede Menge Urlauber anlocken.
Héloïse hatte gesagt, sie werde im Geschäft auf ihn warten, daher wandte sich Tom draußen nach links. Der Laden lag hinter der Kirche von Saint Pierre.
Und dort vor ihm – Tom biß sich auf die Zunge, um nicht laut zu fluchen – waren David Pritchard und seine – Mätresse? Sie kamen auf ihn zu. Tom sah sie zuerst, durch den anschwellenden Strom der Fußgänger (es war Mittag, Essenszeit), aber Sekunden später hatten die Seltsamen Zwei auch ihn bemerkt. Tom sah weg, stur nach vorn. Zu dumm, daß er den Umschlag mit den Flugscheinen noch in der Linken trug, so daß sie ihn sehen konnten. Würde er ihnen auffallen? Und: Würden sie die Straße vor Belle Ombre abfahren und den abzweigenden Waldweg erkunden, sobald sie sicher sein konnten, er werde für eine Weile nicht da sein? Oder machte er sich zu viele, ganz unsinnige Sorgen? Im Laufschritt nahm Tom die letzten Meter bis zu den goldgetönten Schaufenstern von Mon Luxe. Bevor er durch die offene Tür trat, blieb er stehen und blickte sich um, um zu sehen, ob ihm das Paar nachstarrte oder gar in das Reisebüro ging. Ihn würde nichts mehr überraschen, sagte er sich. Tom sah Pritchards breite Schultern in dem blauen Blazer knapp aus der Menge herausragen, sah seinen Hinterkopf. Offenbar gingen die beiden weiter geradeaus.
Tom trat in die parfümgeschwängerte Luft von Mon Luxe, wo Héloïse gerade mit einer Bekannten sprach. Ihr Name war ihm entfallen.
»’allô, Tomme! Françoise – tu te rappelles? Eine Freundin der Berthelins.«
Tom erinnerte sich nicht, tat aber so als ob. Es war nicht wichtig.
Héloïse hatte ihren Einkauf erledigt. Sie sagten Françoise au revoir; die junge Frau studiere in Paris und kenne auch die Grais’, erklärte Héloïse, als sie draußen waren. Antoine und Agnès Grais waren alte Freunde und Nachbarn, die im Norden von Villeperce wohnten.
»Du siehst besorgt aus, mon cher«, bemerkte Héloïse. »Hast du die Tickets? Alles in Ordnung?«
»Glaube schon. Das Hotel hat die Zimmer bestätigt.« Tom klopfte auf seine linke Jackettasche, aus der die Flugscheine hervorschauten. »Essen wir im Aigle Noir?«
»Ah – mais oui!« Sie klang erfreut. »Sicherlich.«
So hatten sie es geplant. Tom liebte ihren Akzent, wenn sie »sicherlich« sagte, weswegen er sie auch gar nicht mehr daran erinnerte, daß »sicher« richtiger wäre.
Sie aßen auf der sonnenbeschienenen Terrasse zu Mittag. Die Kellner und der Oberkellner kannten sie, wußten, daß Héloïse Blanc de Blanc mochte, Seezungenfilet, Sonnenschein und Salat, wahrscheinlich Endivien. Sie sprachen von angenehmen Dingen: dem Sommer, marokkanischen Lederhandtaschen, vielleicht ein Krug aus Bronze oder Kupfer. Warum nicht? Ein Kamelritt? Tom wurde schwindelig. Das hatte er schon einmal erlebt, oder war es im Zoo gewesen, auf einem Elefanten? Plötzlich meterhoch über dem Boden zu schwanken (auf dem er landen würde, falls er das Gleichgewicht verlöre) war nicht nach seinem Geschmack. Frauen liebten das. Aus Masochismus? Oder ob das alles zusammenhing und einen Sinn ergab: Kinder gebären, Schmerzen stoisch ertragen? Tom biß sich auf die Unterlippe.
»Du bist nerveux, Tomme.«
»Gar nicht«, widersprach er entrüstet.
Und gab sich bis zum Ende des Essens gelassen, wie auch während der Heimfahrt.
In etwa zwei Wochen sollten sie nach Tanger fliegen. Ein junger Mann namens Pascal, ein Freund von Henri, dem Aushilfsgärtner, würde sie zum Flughafen begleiten und den Wagen nach Villeperce zurückfahren. Pascal hatte das schon öfter getan.
Tom ging mit einem Spaten in den Garten, jätete aber auch mit der Hand. Er hatte Levis angezogen und die wasserdichten Lederstiefel, die er so gerne trug. Das Unkraut warf er in einen Plastiksack, für den Kompost. Kurz darauf war er gerade beim Auszupfen welker Blüten, als ihn Madame Annette von der Flügeltür der Terrasse rief.
»Monsieur Tomme? Téléphone, s’il vous plaît!«
»Merci.« Unterwegs ließ er die Backen der Heckenschere zuschnappen und legte die Schere auf die Terrasse. Er hob unten in der Diele ab. »Hallo?«
»Hallo, ich bin … Ist dort Tom?« Ein junger Mann, der Stimme nach.
»Ja.«
»Ich rufe aus Washington an.« Dann ein störendes Pfeifen, uuuii-uuuii, wie unter Wasser. »Ich bin …«
»Wer ist da?« Tom konnte nichts verstehen. »Bleiben Sie dran, ja? Ich gehe an den anderen Apparat.«
Madame Annette war mit dem Staubsauger in der Eßecke des Wohnzimmers zugange, weit genug weg für ein normales Telefongespräch. Doch nicht für dieses.
Tom hob oben auf seinem Zimmer ab.
»Hallo, da bin ich wieder.«
»Hier ist Dickie Greenleaf«, sagte der Mann mit der jungen Stimme. »Du kennst mich noch?« Leises Lachen.
Tom wollte spontan auflegen, zögerte kurz, sagte dann aber: »Natürlich. Und wo sind Sie?«
»In Washington, wie ich schon sagte.« Jetzt kippte die Stimme fast ins Falsett.
Übertrieben, seine Verstellung, dachte Tom. Oder war es eine Frau?
»Interessant. Eine Stadtbesichtigung?«
»Na ja, nach meinen Erfahrungen unter Wasser – du weißt schon – bin ich wohl nicht in der Verfassung, mir die Stadt anzusehen.« Ein aufgesetzt fröhliches Lachen. »Man hat –«
Ein Knistern und Knacken in der Leitung; die Verbindung wäre fast abgebrochen, dann ein Klick, doch die Stimme kam wieder: »… mich gefunden und wiederbelebt. Wie du siehst, ha, ha. Die alten Zeiten sind unvergessen, was, Tom?«
»O ja, allerdings«, erwiderte er.
»Jetzt sitze ich im Rollstuhl. Irreparabler –«
Wieder laute Geräusche in der Leitung, ein Klappern, als sei eine Schere oder etwas Größeres hinuntergefallen.
»Ist der Rollstuhl zusammengebrochen?« fragte Tom.
»Ha, ha!« Pause. »Nein, ich wollte sagen«, fuhr die jugendlich klingende Stimme ungerührt fort, »irreparabler Schaden am vegetativen Nervensystem.«
»Verstehe«, erwiderte Tom höflich. »Schön, mal wieder von Ihnen zu hören.«
»Ich weiß, wo du wohnst.« Bei dem letzten Wort ging die Stimme hoch.
»Davon gehe ich aus. Schließlich haben Sie angerufen«, sagte Tom. »Bleiben Sie gesund, das wünsche ich Ihnen wirklich. Und gute Besserung.«
»Solltest du auch! Wiederhören, Tom.« Der Anrufer legte schnell auf, vielleicht weil er sich das Lachen nicht länger verkneifen konnte.
Sieh mal an, dachte Tom. Sein Herz schlug schneller als sonst. Aus Wut? Überraschung? Nicht aus Angst, sagte er sich. Der Gedanke war ihm durch den Kopf geschossen, die Stimme könne David Pritchards Gefährtin gehören. Wer sonst kam in Frage? Ihm wollte niemand einfallen.
Was für ein übler, abscheulicher – ja, was? Streich? Geisteskrank, dachte Tom: das alte Klischee. Aber wer? Und warum? War das Gespräch wirklich aus Übersee gekommen, oder hatte das einer nur vorgetäuscht? Sicher war Tom nicht. Dickie Greenleaf – mit ihm hatte sein Ärger angefangen. Der erste Mensch, den er getötet hatte, und der einzige, bei dem er das bedauerte, das einzige Verbrechen, das ihm ehrlich leid tat. Dickie Greenleaf, ein für damalige Verhältnisse wohlhabender Amerikaner, der in Mongibello an der italienischen Westküste lebte, hatte ihm seine Gastfreundschaft erwiesen, ihn als Freund bei sich aufgenommen – und Tom hatte ihn respektiert und bewundert, vielleicht sogar zu sehr. Dann hatte Dickie sich von ihm abgewandt, was er nicht hinnehmen wollte, und ohne es genau geplant zu haben, hatte er Dickie eines Nachmittags, als sie allein in einem kleinen Boot saßen, mit dem Ruder erschlagen. Tot? Natürlich war Dickie tot, und das seit vielen Jahren schon! Tom hatte seine Leiche mit einem großen Stein beschwert und über Bord geworfen; sie war im Meer versunken, und Dickie war all diese Jahre nicht wieder aufgetaucht. Warum also jetzt?
Düster starrte Tom auf den Teppich, während er langsam in seinem Zimmer auf und ab schritt. Ihm wurde leicht übel; er atmete tief durch: Nein, Dickie Greenleaf war tot (das war sowieso nicht seine Stimme gewesen), und er selbst war in seine Haut, seine Kleidung geschlüpft, hatte eine Zeitlang Dickies Paß benutzt, aber auch damit bald aufgehört. Greenleafs formloses Testament, von Tom eigenhändig gefälscht, hatte einer Untersuchung standgehalten. Wer also hatte die Stirn, die Sache wieder aufzuwärmen? Wer wußte so viel, wem war sie so wichtig, daß er Toms damalige Verbindung zu Dickie Greenleaf ausgegraben hatte?
Gleich würde er sich übergeben müssen. Wenn ihm übel wurde, konnte er das Erbrechen nie lange unterdrücken. War nicht das erste Mal. Er hob die Toilettenbrille und beugte sich über die Schüssel. Glücklicherweise kam nur wenig Flüssigkeit, doch sein Magen schmerzte einen Moment. Er drückte die Spülung und putzte sich die Zähne über dem Waschbecken.
Zum Teufel mit den Hurensöhnen, wer sie auch waren, dachte Tom. Sein Gefühl sagte ihm, daß da eben zwei in der Leitung gewesen waren – nur einer hatte gesprochen, der andere zugehört, daher das Gekicher. Er ging nach unten. Im Wohnzimmer traf er Madame Annette, die eine Vase mit Dahlien trug – sie hatte wohl das Wasser gewechselt. Bevor sie die Vase auf das Sideboard zurückstellte, wischte sie ihren Boden mit einem Lappen ab. »Ich gehe für eine halbe Stunde weg, Madame«, sagte Tom auf französisch. »Falls jemand anruft.«
»Oui, Monsieur Tomme«, erwiderte sie und fuhr mit ihrer Hausarbeit fort. Madame Annette war schon seit Jahren bei Tom und Héloïse. Ihr Zimmer und Bad lagen von der Straße aus gesehen links, mit eigenem Radio und Fernseher. Auch die Küche war ihr Reich, das sie aus ihrer Unterkunft über einen kleinen Flur erreichte. Sie hatte die hellblauen Augen und schweren Lider der Menschen in der Normandie, ihrer Heimat. Tom und Héloïse hatten sie gern, weil Madame Annette sie auch gern hatte, wenigstens schien es so. Im Dorf wohnten zwei enge Freundinnen: Madame Geneviève und Madame Marie-Louise, Haushälterinnen wie sie, und an ihren freien Tagen trafen sich die drei reihum zu Fernsehabenden.
Tom holte die Heckenschere von der Terrasse und legte sie in eine Holzkiste, die für solche Zwecke in einer Ecke stand. Das war bequemer, als den weiten Weg zum Gewächshaus hinten rechts im Garten zu gehen. Er holte ein Baumwolljackett aus dem Schrank in der Diele und vergewisserte sich, daß er seine Brieftasche samt Führerschein dabeihatte. Die französische Polizei liebte stichprobenartige Verkehrskontrollen, für die sie ortsfremde Beamte nahm, die keine Gnade kannten. Wo war Héloïse? Womöglich suchte sie oben auf dem Zimmer ihre Reisegarderobe zusammen. Wie gut, daß sie nicht an den Apparat gegangen war, als die Widerlinge angerufen hatten. Das war sie bestimmt nicht, sonst wäre sie sofort verstört in sein Zimmer gelaufen und hätte Fragen gestellt. Doch sie lauschte nie, und seine Geschäfte interessierten sie nicht. Wenn Héloïse merkte, daß ein Anruf für Tom bestimmt war, legte sie gleich wieder auf, nicht hastig, doch quasi automatisch.
Héloïse kannte die Greenleaf-Geschichte, hatte bestimmt auch gehört, daß man Tom verdächtigte (oder verdächtigt hatte). Aber sie enthielt sich jeder Bemerkung und stellte keine Fragen. Gewiß hatten sie beide Toms fragwürdige Aktivitäten, seine häufigen Reisen aus Gründen, die er nicht nannte, herunterspielen müssen, damit Jacques Plissot, Héloïse’ Vater, Ruhe gab. Er war Arzneimittelfabrikant, und der Haushalt der Ripleys war zum Teil von der großzügigen Zuwendung abhängig, die Plissot seinem einzigen Kind gewährte. Héloïse’ Mutter Arlène war noch verschwiegener als ihre Tochter, was Toms Tätigkeiten betraf. Sie war eine schlanke, elegante Frau, die sich merklich mühte, den jungen Menschen gegenüber Toleranz zu zeigen; sie gab gern Héloïse und auch sonst jedermann Tips zur Möbelpflege und, ausgerechnet, zur sparsamen Haushaltsführung.
Diese Dinge gingen Tom durch den Kopf, während er im braunen Renault gemächlich zum Ortszentrum fuhr. Kurz vor fünf an einem Freitag: Antoine Grais müßte eigentlich zu Hause sein, dachte er, außer er hatte in Paris einen langen Tag eingelegt. Grais war Architekt; seine Frau und er hatten zwei Kinder knapp über zehn. Das Haus, das David Pritchard angeblich gemietet hatte, lag hinter dem der Grais’. Tom bog rechts in eine Seitenstraße von Villeperce ab; er konnte sich sagen, er besuche Agnès und Antoine, etwa um hallo zu sagen. Tom war durch die beruhigend vertraute Hauptstraße des Dorfes gefahren, mit der Post, dem Fleischer, dem Bäcker und dem bar-tabac – viel mehr hatte das Dorf auch nicht zu bieten.
Dort stand das Haus der Grais’, hinter ansehnlichen Kastanien gerade noch auszumachen. Es war rund wie ein Festungsturm und inzwischen malerisch von rosaroten Kletterrosen überwachsen. Zum Haus gehörte eine Garage, deren Tür geschlossen war, was bedeutete, daß Antoine noch nicht aus Paris zurück war und Agnès Besorgungen machte, womöglich mit den beiden Kindern.
Und da stand das weiße Haus – nicht das erste, sondern erst das übernächste, das Tom sah, durch ein paar Bäume links der Straße. Er schaltete herunter in den zweiten Gang. Die Schotterstraße, gerade breit genug für zwei entgegenkommende Autos, lag jetzt verlassen da. Hier im Norden von Villeperce gab es nur wenige Häuser und mehr Wiesen als Äcker.
Wenn die Pritchards vor einer Viertelstunde angerufen hatten, müßten sie zu Hause sein, dachte Tom. Wenigstens könnte er nachschauen, ob sie in Liegestühlen am Teich, der von der Straße einsehbar sein sollte, in der Sonne lagen: Grüner Rasen, der hätte gemäht werden müssen, reichte von der Straße bis zu dem weißen Haus; ein Plattenweg führte von der Einfahrt zu den wenigen Stufen einer Verandatreppe. Auf der Straßenseite der Veranda, zum Teich hin, sah er weitere Stufen. Wenn Tom sich recht erinnerte, lag der Großteil des Grundstücks hinter dem Haus.
Tom hörte Gelächter, von einer Frau, vielleicht auch noch von einem Mann. Ja, es kam aus der Nähe des Teiches, einem Rasenstreifen zwischen Tom und dem Haus, der von einer Hecke und ein paar Bäumen fast verdeckt wurde. Dann erspähte er den Teich, sah das Sonnenlicht auf dem Wasser funkeln und nahm flüchtig zwei Gestalten wahr, die dort auf dem Gras lagen. Aber sicher war er nicht. Ein Mann stand auf, groß, rote Shorts.
Tom fuhr wieder schneller. Ja, zehn zu eins, daß das David gewesen war.
Kannten die Pritchards seinen Wagen, den braunen Renault?
»Mr. Ripley?« Die Stimme klang leise, aber deutlich vernehmbar herüber.
Tom fuhr unvermindert schnell weiter, als hätte er nichts gehört.
Verdammt ärgerlich. Er nahm die nächste Abzweigung nach links, eine weitere Nebenstraße mit drei, vier Häusern auf der einen und Feldern auf der anderen Seite. Sie führte zurück ins Ortszentrum, Tom aber bog wieder links in eine Straße ab, die im rechten Winkel auf die Straße der Grais’ führte, und näherte sich erneut deren Turmhaus. Er fuhr genauso gemächlich wie zuvor.
Nun sah er den weißen Kombi der beiden in der Einfahrt stehen. Sonst kam er ungern vorbei, ohne vorher anzurufen, aber vielleicht konnte er heute, da er etwas von den neuen Nachbarn wußte, gegen die Etikette verstoßen. Agnès Grais schleppte zwei große Einkaufstüten ins Haus, als Tom vor dem Haus hielt.
»Hallo, Agnès. Kann ich helfen?«
»Das wäre nett. Hallo, Tomme!«
Er nahm die Tüten, während Agnès noch etwas aus dem Wagen hob.
Antoine trug gerade eine Kiste Mineralwasser in die Küche, wo die beiden Kinder eine große Flasche Coca-Cola aufgemacht hatten.
»Bonjour, Antoine«, sagte Tom. »Ich kam zufällig vorbei. Schönes Wetter, nicht?«
»Allerdings.« Antoines Französisch klang durch seinen Bariton für Tom manchmal wie Russisch. Der Mann trug jetzt Shorts, Socken, Tennisschuhe und ein T-Shirt, dessen Grün Tom gar nicht mochte. Antoine hatte dunkles, leicht gewelltes Haar und stets ein paar Kilo zuviel. »Was gibt’s Neues?«
»Nicht viel«, antwortete Tom und stellte die Tüten ab.
Sylvie, die Tochter des Hauses, begann routiniert mit dem Auspacken.
Tom lehnte ein Glas Coke oder Wein ab. Bald würde wohl Antoines Rasenmäher losknattern, der mit Benzin lief, nicht mit Strom. In seinem Pariser Büro wie auch hier in Villeperce war Antoine bienenfleißig. »Wie läuft es mit Ihren Mietern in Cannes diesen Sommer?« Sie standen noch immer in der großen Küche.
Die Grais’ besaßen ein Landhaus in oder bei Cannes, das Tom noch nie gesehen hatte. Im Juli und August, wenn sie am meisten dafür bekommen konnten, vermieteten sie es.
»Sie haben im voraus bezahlt – Miete plus die Kaution für die Telefonrechnung.« Antoine zuckte die Achseln. »Alles in Ordnung, würde ich sagen.«
»Sie haben neue Nachbarn, wußten Sie das?« fragte Tom, zum weißen Haus zeigend. »Amerikaner, glaube ich. Oder ist Ihnen das gar nicht neu? Keine Ahnung, seit wann die hier sind.«
»Non.« Antoine überlegte. »Nicht das Haus nebenan.«
»Nein, das dahinter, das große.«
»Das verkauft werden soll – ach so!«
»Oder vermietet. Ich glaube, sie haben es gemietet. Ein gewisser David Pritchard und seine Frau. Oder …«
»Amerikaner«, sagte Agnès nachdenklich. Sie hatte nur den letzen Satz mitbekommen. Und dann, während sie einen Salatkopf in das Fach unten im Kühlschrank steckte, fragte sie: »Haben Sie die schon kennengelernt?«
»Nein. Er …« Tom beschloß, noch weiter zu gehen: »Der Mann hat mich angesprochen, im bar-tabac. Vielleicht hat ihm jemand erzählt, daß ich Amerikaner bin. Ich dachte, Sie sollten das wissen.«
»Kinder?« Antoine runzelte die schwarzen Augenbrauen. Er hatte es gern ruhig.
»Nicht daß ich wüßte. Unwahrscheinlich.«
»Und sie sprechen Französisch?« fragte Agnès.
Tom lächelte. »Weiß ich nicht.« Falls nicht, dachte er, würden die Grais’ ihnen aus dem Weg gehen und auf sie herabschauen. Antoine Grais wollte Frankreich für die Franzosen, selbst wenn die Ausländer nur eine gewisse Zeit blieben und bloß zur Miete wohnten.
Sie wechselten das Thema: Antoines neue Kompostkiste, die er am Wochenende aufstellen wollte – ein Satz zum Selberbauen, er lag im Auto. Antoines Architekturbüro in Paris ging gut; er hatte einen jungen Mitarbeiter eingestellt, der im September anfangen würde. Selbstverständlich nahm Antoine im August keinen Urlaub, auch wenn er dann in Paris ein leeres Büro vorfand. Tom überlegte, ob er den beiden sagen sollte, daß er mit Héloïse nach Marokko reisen würde, ließ es aber sein. Nicht jetzt. Aber warum eigentlich? Hatte er unbewußt entschieden, doch nicht hinzufliegen? Na ja, jedenfalls blieb noch genug Zeit, die Grais’ anzurufen und ihnen mitzuteilen, wie unter guten Nachbarn eben, daß Héloïse und er für zwei, vielleicht drei Wochen nicht dasein würden.
Als Tom sich verabschiedete (nach wechselseitigen Einladungen auf einen Drink, einen Kaffee), war ihm, als habe er den beiden vor allem aus Selbstschutz von den Pritchards erzählt. War nicht der Telefonanruf des angeblichen Dickie Greenleaf eine Art Drohung gewesen? Auf jeden Fall.
Die Kinder, Sylvie und Edouard, kickten sich auf dem Rasen vor dem Haus einen schwarzweißen Fußball zu, als Tom davonfuhr. Der Junge winkte ihm hinterher.
3
Als er nach Belle Ombre zurückkehrte, stand Héloïse im Wohnzimmer. Sie wirkte unruhig.
»Chéri, ein Anruf«, sagte sie.
»Von wem?« fragte Tom, dem sofort mulmig wurde.
»Von einem Mann. Er sagte, er wäre Diikie Grainleaf – aus Washington.«
»Washington?« Ihre Verunsicherung machte ihm Sorgen. »Greenleaf – das ist absurd, Süße. Ein schlechter Scherz.«
Sie runzelte die Stirn: »Aber warum so eine – Schärz?« Sie sprach jetzt mit starkem Akzent. »Weißt du das?«
Tom richtete sich voll auf: der Beschützer seiner Frau und auch seines Hauses. »Nein. Ein dummer Witz eben, von wer weiß wem. Keine Ahnung, wer das sein soll. Was hat er gesagt?«
»Zuerst wollte er mit dir sprechen. Dann sagte er etwas wie, er würde in einem fauteuil roulant sitzen – einem Rollstuhl?«
»Ja, Liebes.«
»Wegen eines Unfalls, damals mit dir. Im Wasser …«
Tom schüttelte den Kopf. »Ein sadistischer Scherz, chérie. Irgendwer gibt vor, Dickie zu sein, dabei hat der Kerl Selbstmord begangen – schon vor Jahren. Irgendwo, vielleicht auch im Wasser. Seine Leiche wurde nie gefunden.«
»Ich weiß. Das hast du gesagt.«
»Nicht nur ich«, bemerkte Tom gelassen: »Jeder. Die Polizei. Seine Leiche wurde nie gefunden. Und er hat sein Testament gemacht. Nur ein paar Wochen vor seinem Verschwinden, wenn ich nicht irre.« Im Brustton der Überzeugung sagte er das, obwohl er das Testament selber verfaßt hatte. »Jedenfalls war ich nicht dabei. In Italien war das, ist Jahre her … daß er verschwunden ist.«
»Ich weiß, Tomme. Aber warum belästigt uns dieser Mensch jetzt?«
Tom steckte die Hände in die Hosentaschen. »Ein schlechter Witz. Manche Leute brauchen solchen Nervenkitzel – die Spannung, verstehst du? Leider kennt er unsere Telefonnummer. Wie klang seine Stimme?«
»Jung.« Héloïse schien ihre Worte sorgsam zu wählen: »Nicht sehr tief. Amerikanisch. Die Leitung, die Verbindung war nicht so gut.«
»Aus Amerika, wirklich?« Tom glaubte das nicht.
»Mais oui«, sagte sie sachlich.
Tom lächelte gezwungen. »Ich denke, wir vergessen die Sache lieber. Wenn es wieder vorkommt und ich hier bin, dann gib ihn einfach an mich weiter. Wenn ich nicht hier bin, mußt du gelassen klingen – als würdest du ihm kein Wort glauben. Und auflegen. Verstehst du?«
»Aber ja.« Als habe sie wirklich verstanden.
»Solche Leute wollen andere einfach durcheinanderbringen. Das ist ihre Art, sich zu amüsieren.«
Héloïse setzte sich in ihre Lieblingsecke des Sofas, nahe der Flügeltür. »Wo warst du vorhin?«
»Bin herumgefahren. Einmal durch den Ort.« Solche Touren unternahm Tom ungefähr zweimal die Woche in einem ihrer drei Autos – gewöhnlich nahm er den braunen Renault oder den roten Mercedes und erledigte unterwegs Dinge, die getan werden mußten, tankte etwa bei einem Supermarkt unweit von Moret oder prüfte den Reifendruck. »Mir fiel auf, daß Antoine schon zum Wochenende zurück war, also hab ich kurz angehalten und hallo gesagt. Sie luden gerade ihre Einkäufe aus. Hab ihnen von ihren neuen Nachbarn erzählt – den Pritchards.«
»Nachbarn?«
»Nicht weit, fünfhundert Meter oder so.« Tom lachte. »Agnès fragte, ob sie Französisch sprechen. Wenn nicht, sind sie bei Antoine ja ohnehin untendurch. Ich sagte, ich wüßte es nicht.«
»Und was meint Antoine zu unserer Reise nach l’Afrique du Nord?« Héloïse lächelte. »Ex-tra-va-gant?« Sie lachte. So, wie sie es betonte, klang das Wort nach sehr viel Geld.
»Ehrlich gesagt, ich hab’s ihnen nicht erzählt. Sollte Antoine die Kosten kommentieren, werd ich ihn daran erinnern, daß dort einiges ziemlich billig ist. Hotels zum Beispiel.« Tom ging zur Flügeltür. Er wollte über sein Grundstück spazieren, nach seinen Kräutern sehen, der prächtig stehenden Petersilie, dem robusten und schmackhaften Rucola. Vielleicht würde er etwas davon als Salat für den Abend schneiden.
»Tomme, willst du nichts unternehmen wegen dieses Anrufs?« Héloïse schmollte wie ein Kind, das eine Frage stellt und sich nicht abwimmeln läßt.
Tom störte das nicht, weil ihr Gehirn nicht kindlich war und der kindliche Eindruck wohl nur von dem langen, glatten blonden Haar stammte, das ihr jetzt halb vor der Stirn hing. »Vermutlich nichts. Die Polizei einschalten? Das wäre sinnlos.« Tom wußte, daß Héloïse sich darüber im klaren war, wie schwierig es wäre, die Polizei »belästigende« oder obszöne Anrufe (die sie noch nie bekommen hatten) zurückverfolgen zu lassen: Man mußte Formulare ausfüllen und einem Abhörgerät zustimmen, das natürlich auch alle anderen Anrufe überwachte. Tom hatte sich nie auf so etwas eingelassen und würde es auch niemals tun. »Sie rufen aus Amerika an. Irgendwann haben sie genug davon.«
Er sah zur halboffenen Flügeltür hinüber, ging dann aber daran vorbei in Madame Annettes Reich, in die Küche vorne links im Haus. Der Duft einer raffiniert komponierten Gemüsesuppe stieg ihm in die Nase.
Madame Annette, in blauweiß getupftem Kleid und dunkelblauer Schürze, rührte am Herd in einem Topf.
»Guten Abend, Madame.«
»Monsieur Tomme! Bonsoir.«
»Und was gibt’s heute abend als Hauptgericht?«
»Noisettes de veau – doch keine großen, denn es ist warm.«
»Stimmt. Riecht göttlich. Egal wie warm es ist, Appetit habe ich. Madame Annette, ich möchte klarstellen, daß Sie herzlich willkommen sind, Ihre Freundinnen einzuladen, wenn meine Frau und ich verreist sind. Hat Madame Héloïse das schon erwähnt?«
»Ah oui! Ihre Reise nach Marokko, natürlich. Alles so wie immer, Monsieur Tomme.«
»Aber … Nun gut. Sie müssen Madame Geneviève einladen und – die andere Freundin?«
»Marie-Louise.«
»Ja. Zum Fernsehabend oder auch zum Essen. Mit Wein aus dem Keller.«
»Ah, Monsieur. Zum Abendessen?!« Als sei das zuviel. »Mit Teetrinken wären wir mehr als zufrieden.«
»Dann also Tee und Kuchen. Sie werden für eine Weile die Herrin des Hauses sein. Es sei denn natürlich, sie würden gern für eine Woche zu Ihrer Schwester Marie-Odile nach Lyon fahren. Wir könnten Madame Clusot bitten, solange die Pflanzen im Haus zu gießen.« Madame Clusot, jünger als Madame Annette, reinigte einmal pro Woche Bäder und Böden – sie war »die Frau fürs Grobe«, wie Tom es nannte.
»Oh …« Madame Annette mußte offenbar erst überlegen, doch Tom spürte, daß sie Belle Ombre im August lieber nicht verlassen wollte: Oft fuhren die Herrschaften dann in Urlaub, und das Personal bekam frei, sofern es nicht mitreiste. »Ich glaube nicht, Monsieur Tomme, merci quand-même. Ich bleibe wohl lieber hier.«
»Wie Sie wollen.« Tom lächelte ihr zu und trat durch die Seitentür auf den Rasen neben dem Haus. Vor ihm verlief der Waldweg, kaum zu sehen durch die Birnen- und Apfelbäume und die niedrigen, wild wachsenden Büsche hindurch. Einst hatte er Murchison in einer Schubkarre über diesen Weg gerollt, um ihn – provisorisch – zu begraben. Und diesen Waldweg nahm gelegentlich auch ein Bauer mit seinem kleinen Traktor auf dem Weg nach Villeperce, oder er tauchte wie aus dem Nichts mit einer Fuhre Pferdemist oder Bündeln von Brennholz auf. Der Weg gehörte niemandem.
Tom ging weiter zu seinem gutgepflegten Kräuterbeet neben dem Gewächshaus, aus dem er sich eine lange Schere geholt hatte, und schnitt ein bißchen Rucola und ein Büschel Petersilie.
Vom Garten hinter dem Haus aus sah Belle Ombre genauso ansprechend aus wie von vorne: zwei abgerundete Ecken mit Erkerfenstern im Erdgeschoß und im ersten Stock (oder im zweiten, wie das in Amerika hieß). Sein rötlichbrauner Stein wirkte so undurchdringlich wie die Mauern einer Burg, obwohl dieser Eindruck durch die roten Blätter wilden Weins, die blühenden Büsche und ein paar große Topfpflanzen vor seinen Mauern gemildert wurde. Tom fiel ein, daß er vor ihrer Abreise mit dem Riesen Henri sprechen mußte. Henri hatte kein Telefon, aber Georges und Marie konnten ihm Bescheid sagen. Er lebte bei seiner Mutter; ihr Haus stand in einem Hinterhof an der Hauptstraße von Villeperce. Henri war weder ein heller Kopf noch ein schneller Arbeiter, dafür aber bärenstark.
Nun, groß genug war er ja auch, über eins neunzig. Tom stellte sich vor, wie Henri einen Angriff auf Belle Ombre abwehren würde. Lächerlich! Was für einen Angriff denn? Und von wem?
Was tat David Pritchard den ganzen Tag lang, fragte sich Tom, während er zu den drei Flügeltüren zurückging. Fuhr der Mann tatsächlich jeden Morgen nach Fontainebleau? Wann kehrte er zurück? Und womit vertrieb sich tagsüber die eher zarte, elfenhafte Janice oder Janis die Zeit? Mit Malen? Oder Schreiben?
Ob er bei ihnen vorbeischauen sollte (natürlich nur, falls er ihre Telefonnummer nicht herausbekäme), mit einer Handvoll Dahlien und Rosen, nur zum Zeichen guter Nachbarschaft? Die Idee verlor ihren Reiz sofort wieder. Die beiden waren bestimmt Langweiler. Und er stünde nur als Schnüffler da.
Nein, beschloß Tom, er würde hübsch hierbleiben, mehr über Marokko lesen, über Tanger und wo immer Héloïse sonst noch hinwollte, seine Kameras in Ordnung bringen und Belle Ombre auf mindestens zwei Wochen ohne Hausherren vorbereiten.
Also tat er genau das, kaufte in Fontainebleau dunkelblaue Bermudashorts und ein paar bügelfreie weiße Hemden mit langem Arm, denn kurzärmelige mochten weder er noch Héloïse. Manchmal fuhr sie zu ihren Eltern nach Chantilly zum Mittagessen, nahm dann aber den Mercedes und ging offenbar vorher und nachher noch einkaufen, denn sie kehrte stets mit mindestens sechs Plastiktüten zurück, auf denen die Namen der Geschäfte standen. Tom begleitete sie fast nie zu dem wöchentlichen Mittagessen bei den Plissots, weil ihn diese Lunches langweilten und weil er spürte, daß Jacques, ihr Vater, ihn dort nur duldete – der Mann wußte, daß Tom schmutzige Geschäfte machte. Nun, wer war schon sauber, dachte Tom oft. Betrog nicht auch Plissot bei seiner Einkommenssteuer? Héloïse hatte einmal fallenlassen (was ihr nichts ausmachte), ihr Vater habe ein Nummernkonto in Luxemburg. Das hatte Tom auch, und das Geld auf dem Konto stammte aus der Derwatt Inc., einer Firma für Künstlerbedarf, sowie nach wie vor aus Verkäufen und Wiederverkäufen von Derwatts Bildern und Zeichnungen in London. Geschäftlich lief da natürlich immer weniger, weil Bernard Tufts, der mindestens fünf Jahre lang die Derwatts gefälscht hatte, vor Jahren umgekommen war. Durch Selbstmord.
Wie dem auch sei: Wer war schon ganz sauber?
Ob Jacques Plissot ihm mißtraute, weil er nicht alles über ihn wußte? Eins mußte man dem Mann lassen – er drängte Héloïse anscheinend ebenso wenig wie ihre Mutter Arlène, ein Kind zu zeugen, damit die zwei einen Enkel bekamen. Tom hatte das heikle Thema natürlich mit Héloïse besprochen, unter vier Augen. Ihr lag nicht viel an Kindern. Sie war nicht unbedingt dagegen, aber sie sehnte sich auch nicht danach. Und inzwischen waren Jahre vergangen. Tom war es egal. Er hatte keine Eltern, die er mit der Verkündung des freudigen Ereignisses entzücken könnte – seine Eltern waren im Hafen von Boston, Massachusetts, ertrunken, als Tom noch ein kleiner Junge war; danach hatte ihn Tante Dottie adoptiert, die alte Pfennigfuchserin, auch sie aus Boston. Jedenfalls spürte Tom, daß Héloïse glücklich mit ihm war, mindestens zufrieden, denn sonst hätte sie sich schon lange beschwert – oder wäre gegangen. Héloïse war eigensinnig. Und Jacques, dem alten Glatzkopf, konnte nicht entgangen sein, daß seine Tochter glücklich war und daß die beiden in Villeperce sehr geachtet waren. Vielleicht einmal im Jahr kamen die beiden Plissots zum Abendessen. Arlène allein kam etwas häufiger, ihre Besuche waren wesentlich angenehmer.
Tom hatte seit Tagen nicht mehr an die Seltsamen Zwei gedacht, und wenn, dann nur flüchtig, als an einem Samstag mit der Post um halb zehn ein quadratischer Brief eintraf. Die Handschrift kannte er nicht; sie mißfiel ihm sofort: fette Großbuchstaben und ein Kreis über dem i, kein Punkt. Aufgeblasen und albern, fand Tom. Da er an Mme et M. Ripley gerichtet war, öffnete ihn Tom, und zwar als erstes. Héloïse nahm gerade oben ein Bad.
Lieber Mr. und Mrs. Ripley,
wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am Samstag (also morgen) auf einen Drink vorbeikommen könnten. Ginge es gegen sechs? Ich weiß, das kommt ein bißchen kurzfristig. Falls es Ihnen nicht paßt, können wir einen späteren Termin vorschlagen.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen!
Janice und David Pritchard
Umseitig eine Karte, wo Sie uns finden. Tel.: 424–6434
Tom drehte das Blatt um und warf einen Blick auf die einfache, handgezeichnete Karte mit Villeperce’ Hauptstraße und einer rechtwinklig abknickenden Seitenstraße, an der die Häuser der Pritchards und der Grais’ eingezeichnet waren, dazu das kleinere, leerstehende Haus dazwischen.
La-di-da, dachte Tom. Seine Finger drehten den Brief hin und her. Heute schon: Er war neugierig genug hinzugehen, soviel wurde ihm klar – je mehr man über seinen potentiellen Feind wußte, desto besser. Aber Héloïse wollte er nicht mitnehmen; er würde sich für sie etwas ausdenken müssen. Inzwischen sollte er wenigstens anrufen und zusagen, doch nicht um zwanzig vor zehn.
Er öffnete die übrige Post bis auf einen an Héloïse gerichteten Brief, von Noëlle Hassler, der Handschrift nach. Sie war eine gute Freundin seiner Frau und wohnte in Paris. Nichts Interessantes dabei: ein Kontoauszug von der Bank Manny Hanny in New York, wo Tom ein Girokonto unterhielt, Werbemüll von Fortune 500, die ihn aus unerfindlichen Gründen für reich genug hielt, eine Zeitschrift über Geldanlagen abonnieren zu wollen. Überlegungen, wo er investieren sollte, überließ Tom seinem Steuerberater Pierre Solway, der auch für Jacques Plissot arbeitete; durch ihn hatte Tom den Mann kennengelernt. Solway hatte manchmal gute Ideen. Arbeit dieser Art (wenn man es so nennen konnte) langweilte Tom, nicht aber Héloïse – der Umgang mit oder wenigstens das Interesse an Geld schien ihr angeboren zu sein, und sie fragte auch lieber erst noch ihren Vater, bevor Tom und sie irgendwo Geld anlegten.
Henri der Riese sollte heute vormittag um elf kommen, und obwohl er manchmal Donnerstag und Samstag verwechselte, kam er tatsächlich um zwei Minuten nach elf. Wie üblich trug er seinen ausgewaschenen Blaumann mit den altmodischen Hosenträgern und einen breitkrempigen Strohhut, auf den das Wort »zerfleddert« mehr als zutraf; außerdem einen rotbraunen Bart, den er augenscheinlich ab und zu mit einer Schere stutzte – nur um sich ja nicht rasieren zu müssen. Van Gogh hätte ihn zu gern Porträt sitzen lassen, mußte Tom oft denken. Seltsame Vorstellung, daß Henris Porträt in Pastelltönen von der Hand eines van Gogh heute für etwa dreißig Millionen Dollar angeboten und auch verkauft würde. Von denen van Gogh natürlich keinen Cent sähe.
Tom riß sich zusammen und erklärte Henri, was während ihrer zwei- oder dreiwöchigen Abwesenheit getan werden müsse. Der Kompost: Würde Henri ihn bitte wenden? Tom hatte eine Komposttonne aus Drahtgeflecht angeschafft, brusthoch und knapp einen Meter breit, mit einer Tür, die sich öffnen ließ, indem man einen Metallstift herauszog.
Und während Tom noch hinter Henri zum Gewächshaus ging und über das neue Rosenspritzmittel redete (hörte der Mann überhaupt zu?), ergriff Henri schon die Mistgabel, die gleich hinter der Gewächshaustür stand, und nahm den Kompost in Angriff. Er war so groß und stark, daß Tom keine Lust hatte, ihn davon abzuhalten. Henri konnte wirklich mit Kompost umgehen, weil er wußte, wozu der gut war.
»Oui, M’sieur«, murmelte er hin und wieder sanft.
»Und – na ja, die Rosen hab ich schon erwähnt. Kein Befall, im Moment. Und dann, nur damit’s schön aussieht, den Lorbeer – mit der Heckenschere.« Henri brauchte keine Leiter, anders als Tom, der nicht ganz ohne sie auskam, wenn er die Oberseite beschneiden wollte. Obendrauf ließ Tom den Lorbeer wachsen, wie er wollte, auch und gerade in die Höhe, weil eine oben flach getrimmte Hecke zu förmlich gewirkt hätte.
Neidisch beobachtete Tom, wie Henri die Drahttonne mit der linken Hand umkippte und mit der Forke in der Rechten besten schwarzen Kompost vom Boden kratzte. »Ah, wunderbar! Très bien!« Wenn Tom den Behälter vom Fleck bewegen wollte, stand das Ding wie angewurzelt.
»C’est vraiment bon«, bestätigte Henri.
Dann die Setzlinge im Gewächshaus und ein paar Geranien dort: Sie würden Wasser brauchen. Henri stapfte über die Holzlatten des Fußbodens und nickte, er habe verstanden. Er wußte, wo der Schlüssel zum Gewächshaus lag – unter einem runden Feldstein dahinter. Tom schloß nur ab, wenn Héloïse und er länger nicht zu Hause waren. Selbst Henris braune abgetragene Arbeitsschuhe schienen aus der Zeit van Goghs zu stammen: Die Sohle war mehrere Zentimeter dick, der Schaft ging bis über die Knöchel. Erbstücke?, fragte sich Tom. Der Mann war ein lebender Anachronismus.
»Wir werden mindestens zwei Wochen weg sein«, sagte Tom. »Aber Madame Annette bleibt die ganze Zeit hier.«
Noch ein paar Kleinigkeiten, dann fand Tom, er habe Henri ausreichend eingewiesen. Ein bißchen Geld konnte nicht schaden: Tom zückte die Brieftasche und gab ihm zwei Hundertfrancscheine.
»Für den Anfang, Henri. Und behalten Sie alles im Auge«, fügte er hinzu. Tom wollte ins Haus zurückkehren, doch Henri machte keine Anstalten zu gehen. So war er immer, drückte sich am Rand des Gartens herum, hob einen Zweig vom Boden auf, trat einen Stein weg, um schließlich wortlos davonzuschlurfen. »Au revoir, Henri!« Tom drehte sich um und ging zum Haus. Als er sich umsah, stand der Riese am Komposthaufen, vermutlich bereit für eine weitere Attacke mit der Forke.
Tom ging nach oben, wusch sich die Hände in seinem Bad und blätterte dann im Sessel zur Entspannung Reiseprospekte über Marokko durch: Die zehn, zwölf Fotos zeigten blaue Mosaike im Innern einer Moschee, fünf Kanonen am Rand einer Klippe, einen Markt mit aufgehängten, grellbunt gestreiften Decken, eine blonde Touristin in einem Nichts von Bikini, die ein rosa Handtuch auf gelbem Sand ausbreitete. Der Stadtplan von Tanger auf der Rückseite des Prospekts war stark vereinfacht und klar verständlich, hellblau und dunkelblau, der Strand gelb, der Hafen zwei Arme, die schützend in das Mittelmeer hinausragten, in die Straße von Gibraltar. Tom suchte nach der Rue de la Liberté, in der das Hotel El Minzah lag, und fand sie auch – anscheinend war der Grand Socco oder Große Markt von dort aus zu Fuß zu erreichen.
Das Telefon klingelte. Ein Apparat stand neben Toms Bett. »Ich gehe dran!« rief er die Treppe hinunter. Héloïse übte noch immer ihren Schubert am Cembalo. »Hallo?«
»Hi, Tom. Hier Reeves«, sagte Minot. Die Verbindung war gut.
»Sind Sie in Hamburg?«
»Natürlich. Ich glaube – nun, Héloïse hat Ihnen wahrscheinlich erzählt, daß ich schon einmal angerufen habe?«
»Ja, hat sie. Alles in Ordnung?«
»Sicher«, erwiderte Reeves gelassen. »Die Sache ist die: Ich würde Ihnen gern etwas per Post schicken. Ist nicht größer als eine Kassette. Ehrlich gesagt …«
Ist es eine Kassette, dachte Tom.
»Und hochgehen kann das Ding auch nicht«, fuhr Reeves fort. »Wenn Sie die Sendung rund fünf Tage lang zurückhalten und dann an eine Adresse schicken könnten, die ich mit in den Umschlag stecke …?«
Tom zögerte, leicht verärgert, wußte aber, daß er den Auftrag erledigen würde, weil auch Reeves ihm stets einen Gefallen tat, wenn er selber etwas brauchte – einen neuen Paß für irgendwen, ein Zimmer für eine Nacht in Minots großer Wohnung. Der Mann half umgehend und kostenlos. »Ich würde gern ja sagen, alter Freund, aber in ein paar Tagen fliegen Héloïse und ich nach Tanger. Von dort reisen wir weiter.«
»Tanger – wie schön! Wenn ich’s per Eilbrief schicke, reicht die Zeit. Kann sein, daß es morgen schon eintrifft. Kein Problem, ich schick’s heute noch los. Und Sie senden das Ding dann in vier, fünf Tagen weiter, wo Sie auch sein mögen.«
Wohl noch in Tanger, dachte Tom. »Okay, Reeves. Im Prinzip geht das klar.« Unbewußt hatte er leise gesprochen, als könnte sie jemand belauschen, dabei saß Héloïse noch unten am Cembalo. »Das wird Tanger sein. Trauen Sie der Post dort? Man hat mich gewarnt, sie wäre so langsam.«
Minot antwortete mit dem trockenen Lachen, das Tom so gut kannte. »Die Satanischen Verse sind da nicht drauf. Bitte, Tom!«
»Na gut. Was ist es dann?«
»Sag ich nicht. Noch nicht. Wiegt keine dreißig Gramm.«
Gleich danach legten sie auf. Tom fragte sich, ob der Empfänger die Sendung an einen weiteren Mittelsmann würde schicken müssen. Minot hatte schon immer die (vielleicht von ihm stammende) These vertreten, durch je mehr Hände ein Gegenstand gehe, desto sicherer sei er. Im Grunde war er ein Hehler, und er liebte seine Arbeit. Hehlerei – was für ein Wort! Eigentlich gab Minot nur den Hehler, was den Charme des Scheinbaren für ihn hatte, wie Versteckspiele für Kinder. Tom mußte zugeben, daß Minot bislang erfolgreich gewesen war. Er arbeitete allein; zumindest wohnte er allein in seinem Apartment in Harvestehude, hatte eine Bombe überlebt, die in der Wohnung hochgegangen war, und auch den Zwischenfall, was immer es gewesen war, dem er die zehn Zentimeter lange Narbe auf seiner rechten Wange verdankte.
Zurück zu den Prospekten. Als nächstes Casablanca; rund zehn Broschüren lagen auf dem Bett. Tom dachte an die Zustellung des Eilbriefs: Unterschreiben mußte er dafür sicher nicht, denn Reeves schickte höchst ungern etwas als Einschreiben, also könnte es jeder im Haus entgegennehmen.
Dann heute abend die Drinks bei den Pritchards, um sechs. Jetzt war es nach elf; er sollte anrufen, die Einladung annehmen. Doch was sollte er Héloïse sagen? Sie brauchte nicht zu wissen, daß er die Pritchards besuchte – erstens, weil er sie nicht mitnehmen wollte, und zweitens, um nicht alles noch zu verkomplizieren, indem er ihr erklärte (was er ebenfalls nicht wollte), daß er das Gefühl habe, sie beschützen und von diesen Spinnern fernhalten zu müssen.
Tom ging hinunter; er wollte einmal um den Rasen schlendern und, wenn möglich, einen Kaffee von Madame Annette ergattern, sollte sie in der Küche sein.
Héloïse stand vom Cembalo auf und streckte sich.
»Chéri, während du mit Henri sprachst, hat Noëlle angerufen. Sie würde heute abend gern zum Essen kommen und vielleicht über Nacht bleiben. Geht das?«
»Aber natürlich, meine Süße. Kein Problem.« Nicht das erste Mal, daß Noëlle Hassler anrief und sich selbst einlud. Sie war angenehm, er hatte nichts gegen sie. »Ich hoffe, du hast zugesagt.«
»Das habe ich. La pauvre …« Héloïse mußte loslachen. »Ein Mann – Noëlle hätte nie erwarten dürfen, daß er es ernst meint! Er war nicht nett zu ihr.«
Hatte sie verlassen, vermutete Tom. »Und nun ist sie am Boden?«
»Ach, nur ein bißchen, und das dauert nicht lang. Sie kommt mit dem Zug, deshalb hol ich sie ab. Vom Bahnhof in Fontainebleau.«
»Wann?«
»Gegen sieben. Ich muß nachschauen, in dem – horaire.«
Tom war erleichtert, zumindest ein bißchen. Er beschloß, ihr die Wahrheit zu sagen: »Heute morgen ist eine Einladung gekommen. Von den Pritchards, ob du’s glaubst oder nicht. Du weißt schon, das amerikanische Paar. Auf einen Drink, gegen sechs heute abend. Macht’s dir was aus, wenn ich allein hingehe? Nur um mehr über sie zu erfahren?«
»Nein.« Sie hörte sich an wie ein Teenager und sah auch so aus, nicht wie eine Frau Ende Zwanzig. »Warum auch? Und zum Essen bist du zurück?«
Tom lächelte. »Darauf kannst du dich verlassen.«
4
Tom beschloß dann doch noch, drei Dahlien zu schneiden und sie den Pritchards mitzubringen. Mittags hatte er angerufen und die Einladung angenommen. Janice Pritchard hatte erfreut geklungen. Tom hatte gesagt, er werde allein kommen, da seine Frau gegen sechs eine Freundin vom Zug abholen müsse.
Also fuhr Tom im braunen Renault kurz nach sechs langsam in die Einfahrt der Pritchards. Die Sonne war noch nicht untergegangen, es war noch warm. Er trug ein leichtes Jackett und Sommerhosen, ein Hemd, keinen Schlips.
»Ach, Mr. Ripley! Willkommen!« Janice Pritchard stand auf der Veranda.
»Guten Abend.« Tom lächelte. Er stieg die Stufen hinauf und überreichte ihr die roten Dahlien. »Frisch aus meinem Garten.«
»Oh, wie schön! Ich hole eine Vase. Kommen Sie herein. David!«
Tom betrat eine kleine Diele, die in ein weißes, quadratisches Wohnzimmer führte. Daran erinnerte er sich: Der beinah schon häßliche Kamin war unverändert, weiß gestrichenes Holz mit einer völlig mißglückten Borte in Dubonnet-Rot. Von Sofa und Lehnsessel abgesehen, fand Tom die ganze Einrichtung pseudorustikal. Dann kam David Pritchard herein und wischte sich die Hände an einem Geschirrtuch ab. Er war in Hemdsärmeln.
»Guten Abend, Mr. Ripley. Ich quäle mich noch mit den Kanapees.«





























