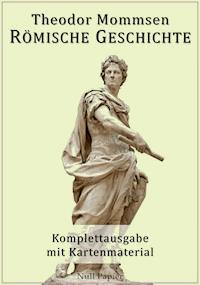
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Mit Kartenmaterial / 3610 Seiten Auch heu noch – mehr als hundert Jahre nach seiner Entstehung – gilt es als wichtiges Lehrbuch der historischen Wissenschaften. Es schildert die Geschichte Roms bis zum Ende der römischen Republik und der Herrschaft Caesars. Das Werk ist ein literarisches wie wissenschaftliches Meisterwerk, das noch immer höchste Autorität genießt. Die Gediegenheit der Kenntnisse, die Sicherheit des Urteils, Passion und suggestiver Stil des Autors haben bewirkt, dass diese Darstellung nichts von ihrem Glanz, ihrem künstlerischen und wissenschaftlichen Rang verloren hat. Die ›Römische Geschichte‹ ist und bleibt ein Höhepunkt unserer Geschichtsschreibung. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 4897
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Theodor Mommsen
Römische Geschichte
Komplettausgabe mit Kartenmaterial
Theodor Mommsen
Römische Geschichte
Komplettausgabe mit Kartenmaterial
Original: Berlin, 1925
Überarbeitung, Umschlaggestaltung: Null Papier Verlag
Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]
2. Auflage, ISBN 978-3-95418-637-2
Umfang: 3995 Normseiten bzw. 3610 Buchseiten
www.null-papier.de/321
Verlag
Der Null Papier Verlag wurde 2011 von Jürgen Schulze gegründet. Bis zum heutigen Tag ist er der einzige feste Mitarbeiter des Unternehmens, veröffentlichte über 200 Titel und verkaufte über 2 Millionen E-Books.
Informationen über Neuveröffentlichungen, Angebote und Geschenkaktionen erhalten Sie im regelmäßig erscheinenden Newsletter:
www.null-papier.de/newsletter
Erster Band – Bis zur Schlacht von Pydna
Widmung
Meinem Freunde
Moriz Haupt
in Berlin
Vorrede zu der zweiten Auflage
Die neue Auflage der ‘Römischen Geschichte’ weicht von der früheren beträchtlich ab. Am meisten gilt dies von den beiden ersten Büchern, welche die ersten fünf Jahrhunderte des römischen Staats umfassen. Wo die pragmatische Geschichte beginnt, bestimmt und ordnet sie durch sich selbst Inhalt und Form der Darstellung; für die frühere Epoche sind die Schwierigkeiten, welche die Grenzlosigkeit der Quellenforschung und die Zeit- und Zusammenhanglosigkeit des Materials dem Historiker bereiten, von der Art, daß er schwerlich andern und gewiß sich selber nicht genügt. Obwohl der Verfasser des vorliegenden Werkes mit diesen Schwierigkeiten der Forschung und der Darstellung ernstlich gerungen hat, ehe er dasselbe dem Publikum vorlegte, so blieb dennoch notwendig, hier noch viel zu tun und viel zu bessern. In diese Auflage ist eine Reihe neu angestellter Untersuchungen, zum Beispiel über die staatsrechtliche Stellung der Untertanen Roms, über die Entwicklung der dichtenden und bildenden Künste, ihren Ergebnissen nach aufgenommen worden. Überdies wurden eine Menge kleinerer Lücken ausgefüllt, die Darstellung durchgängig schärfer und reichlicher gefaßt, die ganze Anordnung klarer und übersichtlicher gestellt. Es sind ferner im dritten Buche die inneren Verhältnisse der römischen Gemeinde während der Karthagischen Kriege nicht, wie in der ersten Ausgabe, skizzenhaft, sondern mit der durch die Wichtigkeit wie die Schwierigkeit des Gegenstandes gebotenen Ausführlichkeit behandelt worden.
Der billig Urteilende und wohl am ersten der, welcher ähnliche Aufgaben zu lösen unternommen hat, wird es sich zu erklären und also zu entschuldigen wissen, daß es solcher Nachholungen bedurfte. Auf jeden Fall hat der Verfasser es dankbar anzuerkennen, daß das öffentliche Urteil nicht jene leicht ersichtlichen Lücken und Unfertigkeiten des Buches betont, sondern vielmehr wie den Beifall so auch den Widerspruch auf dasjenige gerichtet hat, darin es abgeschlossen und fertig war.
Im übrigen hat der Verfasser das Buch äußerlich bequemer einzurichten sich bemüht. Die Varronische Zählung nach Jahren der Stadt ist im Texte beibehalten; die Ziffern am Rande[Hier in Klammern im Text.] bezeichnen das entsprechende Jahr vor Christi Geburt. Bei den Jahresgleichungen ist durchgängig das Jahr 1 der Stadt dem Jahre 753 vor Christi Geburt und dem Olympiadenjahr 6, 4 gleichgesetzt worden; obgleich, wenn die verschiedenen Jahresanfänge des römischen Sonnenjahres mit dem 1. März, des griechischen mit dem 1. Juli berücksichtigt werden, nach genauer Rechnung das Jahr 2 der Stadt den letzten zehn Monaten des Jahres 753 und den zwei ersten des Jahres 752 v. Chr. sowie den vier letzten Monaten von Ol. 6, 3 und den acht ersten von Ol. 6, 4 entsprechen würde. Das römische und griechische Geld ist durchgängig in der Art reduziert worden, daß Pfundas und Sesterz, Denar und attische Drachme als gleich genommen und für alle Summen über 100 Denare der heutige Gold-, für alle Summen bis zu 100 Denaren der heutige Silberwert des entsprechenden Gewichtsquantums zugrunde gelegt wurde, wobei das römische Pfund (= 327,45 Gramm) Geld gleich 4000 Sesterzen nach dem Verhältnis des Goldes zum Silber 1:15,5 zu 304½ Talern preußisch, der Denar nach Silberwert zu 7 Groschen preußisch angesetzt wird. Die dem ersten Bande beigefügte Kiepertsche Karte wird die militärische Konsolidierung Italiens anschaulicher darstellen, als die Erzählung es vermag. Die Inhaltsangaben am Rande werden dem Leser die Übersicht erleichtern. Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis wird dem dritten Bande beigegeben werden[Karte und Register sind hier weggelassen.], da anderweitige Obliegenheiten es dem Verfasser unmöglich machen, das Werk so rasch, wie er es wünschte, zu fördern.
Breslau, im November 1856
Die Änderungen, welche der Verfasser in dem zweiten und dritten Bande dieses Werkes bei der abermaligen Herausgabe zu machen veranlaßt gewesen ist, sind zum größeren Teil hervorgegangen aus den neu aufgefundenen Fragmenten des Licinianus, welche er durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herausgebers, Herrn Karl Pertz, bereits vor ihrem Erscheinen in den Aushängebogen hat einsehen dürfen und die zu unserer lückenhaften Kunde der Epoche von der Schlacht bei Pydna bis auf den Aufstand des Lepidus manche nicht unwichtige Ergänzung, freilich auch manches neue Rätsel hinzugefügt haben.
Breslau, im Mai 1857
Vorrede zu der dritten bis neunten Auflage
Die dritte (vierte, fünfte, sechste, siebente, achte und neunte) Auflage wird man im ganzen von den vorhergehenden nicht beträchtlich abweichend finden. Kein billiger und sachkundiger Beurteiler wird den Verfasser eines Werkes, wie das vorliegende ist, verpflichtet erachten, für dessen neue Auflagen jede inzwischen erschienene Spezialuntersuchung auszunutzen, das heißt zu wiederholen. Was inzwischen aus fremden oder aus eigenen, seit dem Erscheinen der zweiten Auflage angestellten Forschungen sich dem Verfasser als versehen oder verfehlt ergeben hat, ist wie billig berichtet worden; zu einer Umarbeitung größerer Abschnitte hat sich keine Veranlassung dargeboten. Eine Ausführung über die Grundlagen der römischen Chronologie im vierzehnten Kapitel des dritten Buches ist späterhin in umfassender und dem Stoffe angemessener Weise in einer besonderen Schrift (‘Die römische Chronologie bis auf Caesar’. Zweite Auflage. Berlin 1859) vorgelegt und deshalb hier jetzt auf die kurze Darlegung der Ergebnisse von allgemein geschichtlicher Wichtigkeit eingeschränkt worden. Im übrigen ist die Einrichtung nicht verändert.
Berlin, am 1. Februar 1861; am 29. Dezember 1864; am 11. April 1868; am 4. August 1874; am 21. Juli 1881; am 15. August 1887; am 1. Oktober 1902.
Erstes Buch – Bis zur Abschaffung des römischen Königtums
Τά παλαίστερα σαφώς μέν ευρείν διά χρόνου πλήθος αδύνατα ήν. Εκ δέ τεκμηρίων ων επί μακρότατον σκοπούντί μοι πιστεύσαι ξυμβαίνει ου μεγάλα νομίζω γενέσθαι, ούτε κατά τούς πολέμους οίτε ες τά άλλα.
Die älteren Begebenheiten ließen sich wegen der Länge der Zeit nicht genau erforschen; aber aus Zeugnissen, die sich mir bei der Prüfung im großen Ganzen als verläßlich erwiesen, glaube ich, daß sie nicht erheblich waren, weder in bezug auf die Kriege noch sonst.
(Thukydides)
1. Kapitel – Einleitung
Rings um das mannigfaltig gegliederte Binnenmeer, das tief einschneidend in die Erdfeste den größten Busen des Ozeans bildet und, bald durch Inseln oder vorspringende Landfesten verengt, bald wieder sich in beträchtlicher Breite ausdehnend, die drei Teile der Alten Welt scheidet und verbindet, siedelten in alten Zeiten Völkerstämme sich an, welche, ethnographisch und sprachgeschichtlich betrachtet, verschiedenen Rassen angehörig, historisch ein Ganzes ausmachen. Dies historische Ganze ist es, was man nicht passend die Geschichte der alten Welt zu nennen pflegt, die Kulturgeschichte der Anwohner des Mittelmeers, die in ihren vier großen Entwicklungsstadien an uns vorüberfährt: die Geschichte des koptischen oder ägyptischen Stammes an dem südlichen Gestade, die der aramäischen oder syrischen Nation, die die Ostküste einnimmt und tief in das innere Asien hinein bis an den Euphrat und Tigris sich ausbreitet, und die Geschichte des Zwillingsvolkes der Hellenen und der Italiker, welche die europäischen Uferlandschaften des Mittelmeers zu ihrem Erbteil empfingen. Wohl knüpft jede dieser Geschichten an ihren Anfängen an andere Gesichts- und Geschichtskreise an; aber jede auch schlägt bald ihren eigenen abgesonderten Gang ein. Die stammfremden oder auch stammverwandten Nationen aber, die diesen großen Kreis umwohnen, die Berber und Neger Afrikas, die Araber, Perser und Inder Asiens, die Kelten und Deutschen Europas, haben mit jenen Anwohnern des Mittelmeers wohl auch vielfach sich berührt, aber eine eigentlich bestimmende Entwicklung doch weder ihnen gegeben noch von ihnen empfangen; und soweit überhaupt Kulturkreise sich abschließen lassen, kann derjenige als eine Einheit gelten, dessen Höhepunkt die Namen Theben, Karthago, Athen und Rom bezeichnen. Es haben jene vier Nationen, nachdem jede von ihnen auf eigener Bahn zu einer eigentümlichen und großartigen Zivilisation gelangt war, in mannigfaltigster Wechselbeziehung zueinander alle Elemente der Menschennatur scharf und reich durchgearbeitet und entwickelt, bis auch dieser Kreis erfüllt war, bis neue Völkerschaften, die bis dahin das Gebiet der Mittelmeerstaaten nur wie die Wellen den Strand umspült hatten, sich über beide Ufer ergossen und, indem sie die Südküste geschichtlich trennten von der nördlichen, den Schwerpunkt der Zivilisation verlegten vom Mittelmeer an den Atlantischen Ozean. So scheidet sich die alte Geschichte von der neuen nicht bloß zufällig und chronologisch; was wir die neue Geschichte nennen, ist in der Tat die Gestaltung eines neuen Kulturkreises, der in mehreren seiner Entwicklungsepochen wohl anschließt an die untergehende oder untergegangene Zivilisation der Mittelmeerstaaten wie diese an die älteste indogermanische, aber auch wie diese bestimmt ist, eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und Völkerleid im vollen Maße zu erproben: die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe des Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuß erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der schaffenden Kraft in der satten Befriedigung des erreichten Zieles. Aber auch dieses Ziel wird nur ein vorläufiges sein; das großartigste Zivilisationssystem hat seine Peripherie und kann sie erfüllen, nimmer aber das Geschlecht der Menschen, dem, so wie es am Ziele zu stehen scheint, die alte Aufgabe auf weiterem Felde und in höherem Sinne neu gestellt wird.
Unsere Aufgabe ist die Darstellung des letzten Akts jenes großen weltgeschichtlichen Schauspiels, die alte Geschichte der mittleren unter den drei Halbinseln, die vom nördlichen Kontinent aus sich in das Mittelmeer erstrecken. Sie wird gebildet durch die von den westlichen Alpen aus nach Süden sich verzweigenden Gebirge. Der Apennin streicht zunächst in südöstlicher Richtung zwischen dem breiteren westlichen und dem schmalen östlichen Busen des Mittelmeers, an welchen letzteren hinantretend er seine höchste, kaum indes zu der Linie des ewigen Schnees hinansteigende Erhebung in den Abruzzen erreicht. Von den Abruzzen aus setzt das Gebirge sich in südlicher Richtung fort, anfangs ungeteilt und von beträchtlicher Höhe; nach einer Einsattlung, die eine Hügellandschaft bildet, spaltet es sich in einen flacheren südöstlichen und einen steileren südlichen Höhenzug und schließt dort wie hier mit der Bildung zweier schmaler Halbinseln ab. Das nördlich zwischen Alpen und Apennin bis zu den Abruzzen hinab sich ausbreitende Flachland gehört geographisch und bis in sehr späte Zeit auch historisch nicht zu dem südlichen Berg- und Hügelland, demjenigen Italien, dessen Geschichte uns hier beschäftigt. Erst im siebenten Jahrhundert Roms wurde das Küstenland von Sinigaglia bis Rimini, erst im achten das Potal Italien einverleibt; die alte Nordgrenze Italiens sind also nicht die Alpen, sondern der Apennin. Dieser steigt von keiner Seite in steiler Kette empor, sondern breit durch das Land gelagert und vielfache, durch mäßige Pässe verbundene Täler und Hochebenen einschließend gewährt er selbst den Menschen eine wohl geeignete Ansiedelungsstätte, und mehr noch gilt dies von dem östlich, südlich und westlich an ihn sich anschließenden Vor- und Küstenland. Zwar an der östlichen Küste dehnt sich, gegen Norden von dem Bergstock der Abruzzen geschlossen und nur von dem steilen Rücken des Garganus inselartig unterbrochen, die apulische Ebene in einförmiger Fläche mit schwach entwickelter Küsten- und Strombildung aus. An der Südküste aber zwischen den beiden Halbinseln, mit denen der Apennin endigt, lehnt sich an das innere Hügelland eine ausgedehnte Niederung, die zwar an Häfen arm, aber wasserreich und fruchtbar ist. Die Westküste endlich, ein breites, von bedeutenden Strömen, namentlich dem Tiber, durchschnittenes, von den Fluten und den einst zahlreichen Vulkanen in mannigfaltigster Tal- und Hügel-, Hafen- und Inselbildung entwickeltes Gebiet, bildet in den Landschaften Etrurien, Latium und Kampanien den Kern des italischen Landes, bis südlich von Kampanien das Vorland allmählich verschwindet und die Gebirgskette fast unmittelbar von dem Tyrrhenischen Meere bespült wird. Überdies schließt, wie an Griechenland der Peloponnes, so an Italien die Insel Sizilien sich an, die schönste und größte des Mittelmeers, deren gebirgiges und zum Teil ödes Innere ringsum, vor allem im Osten und Süden, mit einem breiten Saume des herrlichsten, großenteils vulkanischen Küstenlandes umgürtet ist; und wie geographisch die sizilischen Gebirge die kaum durch den schmalen »Riß« (Ρήγιον) der Meerenge unterbrochene Fortsetzung des Apennins sind, so ist auch geschichtlich Sizilien in älterer Zeit ebenso entschieden ein Teil Italiens wie der Peloponnes von Griechenland, der Tummelplatz derselben Stämme und der gemeinsame Sitz der gleichen höheren Gesittung. Die italische Halbinsel teilt mit der griechischen die gemäßigte Temperatur und die gesunde Luft auf den mäßig hohen Bergen und im ganzen auch in den Tälern und Ebenen. In der Küstenentwicklung steht sie ihr nach; namentlich fehlt das Inselreiche Meer, das die Hellenen zur seefahrenden Nation gemacht hat. Dagegen ist Italien dem Nachbarn überlegen durch die reichen Flußebenen und die fruchtbaren und kräuterreichen Bergabhänge, wie der Ackerbau und die Viehzucht ihrer bedarf. Es ist wie Griechenland ein schönes Land, das die Tätigkeit des Menschen anstrengt und belohnt und dem unruhigen Streben die Bahnen in die Ferne, dem ruhigen die Wege zu friedlichem Gewinn daheim in gleicher Weise eröffnet. Aber wenn die griechische Halbinsel nach Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das epirotische und akarnanische Gestade für Hellas, so sind die apulischen und messapischen Küsten für Italien von untergeordneter Bedeutung; und wenn dort diejenigen Landschaften, auf denen die geschichtliche Entwicklung ruht, Attika und Makedonien, nach Osten schauen, so sehen Etrurien, Latium und Kampanien nach Westen. So stehen die beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten Halbinseln gleichsam voneinander abgewendet; obwohl das unbewaffnete Auge von Otranto aus die akrokeraunischen Berge erkennt, haben Italiker und Hellenen sich doch früher und enger auf jeder andern Straße berührt als auf der nächsten über das Adriatische Meer. Es war auch hier wie so oft in den Bodenverhältnissen der geschichtliche Beruf der Völker vorgezeichnet: die beiden großen Stämme, auf denen die Zivilisation der Alten Welt erwuchs, warfen ihre Schatten wie ihren Samen der eine nach Osten, der andere nach Westen.
Es ist die Geschichte Italiens, die hier erzählt werden soll, nicht die Geschichte der Stadt Rom. Wenn auch nach formalem Staatsrecht die Stadtgemeinde von Rom es war, die die Herrschaft erst über Italien, dann über die Welt gewann, so läßt sich doch dies im höheren geschichtlichen Sinne keineswegs behaupten und erscheint das, was man die Bezwingung Italiens durch die Römer zu nennen gewohnt ist, vielmehr als die Einigung zu einem Staate des gesamten Stammes der Italiker, von dem die Römer wohl der gewaltigste, aber doch nur ein Zweig sind.
Die italische Geschichte zerfällt in zwei Hauptabschnitte: in die innere Geschichte Italiens bis zu seiner Vereinigung unter der Führung des latinischen Stammes und in die Geschichte der italischen Weltherrschaft. Wir werden also darzustellen haben des italischen Volksstammes Ansiedelung auf der Halbinsel; die Gefährdung seiner nationalen und politischen Existenz und seine teilweise Unterjochung durch Völker anderer Herkunft und älterer Zivilisation, durch Griechen und Etrusker; die Auflehnung der Italiker gegen die Fremdlinge und deren Vernichtung oder Unterwerfung; endlich die Kämpfe der beiden italischen Hauptstämme, der Latiner und der Samniten, um die Hegemonie auf der Halbinsel und den Sieg der Latiner am Ende des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt oder des fünften der Stadt Rom. Es wird dies den Inhalt der beiden ersten Bücher bilden. Den zweiten Abschnitt eröffnen die Punischen Kriege; er umfaßt die reißend schnelle Ausdehnung des Römerreiches bis an und über Italiens natürliche Grenzen, den langen Status quo der römischen Kaiserzeit und das Zusammenstürzen des gewaltigen Reiches. Dies wird im dritten und den folgenden Büchern erzählt werden.
2. Kapitel – Die ältesten Einwanderungen in Italien
Keine Kunde, ja nicht einmal eine Sage erzählt von der ersten Einwanderung des Menschengeschlechts in Italien; vielmehr war im Altertum der Glaube allgemein, daß dort wie überall die erste Bevölkerung dem Boden selbst entsprossen sei. Indes die Entscheidung über den Ursprung der verschiedenen Rassen und deren genetische Beziehungen zu den verschiedenen Klimaten bleibt billig dem Naturforscher überlassen; geschichtlich ist es weder möglich noch wichtig festzustellen, ob die älteste bezeugte Bevölkerung eines Landes daselbst autochthon oder selbst schon eingewandert ist.
Wohl aber liegt es dem Geschichtsforscher ob, die sukzessive Völkerschichtung in dem einzelnen Lande darzulegen, um die Steigerung von der unvollkommenen zu der vollkommneren Kultur und die Unterdrückung der minder kulturfähigen oder auch nur minder entwickelten Stämme durch höher stehende Nationen soweit möglich rückwärts zu verfolgen. Italien indes ist auffallend arm an Denkmälern der primitiven Epoche und steht in dieser Beziehung in einem bemerkenswerten Gegensatz zu anderen Kulturgebieten. Den Ergebnissen der deutschen Altertumsforschung zufolge muß in England, Frankreich, Norddeutschland und Skandinavien, bevor indogermanische Stämme hier sich ansässig machten, ein Volk vielleicht tschudischer Rasse gewohnt oder vielmehr gestreift haben, das von Jagd und Fischfang lebte, seine Geräte aus Stein, Ton oder Knochen verfertigte und mit Tierzähnen und Bernstein sich schmückte, des Ackerbaues aber und des Gebrauchs der Metalle unkundig war. In ähnlicher Weise ging in Indien der indogermanischen eine minder kulturfähige dunkelfarbige Bevölkerung vorauf. In Italien aber begegnen weder Trümmer einer verdrängten Nation, wie im keltisch-germanischen Gebiet die Finnen und Lappen und die schwarzen Stämme in den indischen Gebirgen sind, noch ist daselbst bis jetzt die Verlassenschaft eines verschollenen Urvolkes nachgewiesen worden, wie sie die eigentümlich gearteten Gerippe, die Mahlzeit- und Grabstätten der sogenannten Steinepoche des deutschen Altertums zu offenbaren scheinen. Es ist bisher nichts zum Vorschein gekommen, was zu der Annahme berechtigt, daß in Italien die Existenz des Menschengeschlechts älter sei als die Bebauung des Ackers und das Schmelzen der Metalle; und wenn wirklich innerhalb der Grenzen Italiens das Menschengeschlecht einmal auf der primitiven Kulturstufe gestanden hat, die wir den Zustand der Wildheit zu nennen pflegen, so ist davon doch jede Spur schlechterdings ausgelöscht.
Die Elemente der ältesten Geschichte sind die Völkerindividuen, die Stämme. Unter denen, die uns späterhin in Italien begegnen, ist von einzelnen, wie von den Hellenen, die Einwanderung, von anderen, wie von den Brettiern und den Bewohnern der sabinischen Landschaft, die Denationalisierung geschichtlich bezeugt. Nach Ausscheidung beider Gattungen bleiben eine Anzahl Stämme übrig, deren Wanderungen nicht mehr mit dem Zeugnis der Geschichte, sondern höchstens auf aprioristischem Wege sich nachweisen lassen und deren Nationalität nicht nachweislich eine durchgreifende Umgestaltung von außen her erfahren hat; diese sind es, deren nationale Individualität die Forschung zunächst festzustellen hat. Wären wir dabei einzig angewiesen auf den wirren Wust der Völkernamen und der zerrütteten, angeblich geschichtlichen Überlieferung, welche aus wenigen brauchbaren Notizen zivilisierter Reisender und einer Masse meistens geringhaltiger Sagen, gewöhnlich ohne Sinn für Sage wie für Geschichte zusammengesetzt und konventionell fixiert ist, so müßte man die Aufgabe als eine hoffnungslose abweisen. Allein noch fließt auch für uns eine Quelle der Überlieferung, welche zwar auch nur Bruchstücke, aber doch authentische gewährt; es sind dies die einheimischen Sprachen der in Italien seit unvordenklicher Zeit ansässigen Stämme. Ihnen, die mit dem Volke selbst geworden sind, war der Stempel des Werdens zu tief eingeprägt, um durch die nachfolgende Kultur gänzlich verwischt zu werden. Ist von den italischen Sprachen auch nur eine vollständig bekannt, so sind doch von mehreren anderen hinreichende Überreste erhalten, um der Geschichtsforschung für die Stammverschiedenheit oder Stammverwandtschaft und deren Grade zwischen den einzelnen Sprachen und Völkern einen Anhalt zu gewähren.
So lehrt uns die Sprachforschung drei italische Urstämme unterscheiden, den iapygischen, den etruskischen und den italischen, wie wir ihn nennen wollen, von welchen der letztere in zwei Hauptzweige sich spaltet: das latinische Idiom und dasjenige, dem die Dialekte der Umbrer, Marser, Volsker und Samniten angehören.
Von dem iapygischen Stamm haben wir nur geringe Kunde. Im äußersten Südosten Italiens, auf der messapischen oder kalabrischen Halbinsel, sind Inschriften in einer eigentümlichen verschollenen Sprache[Ihren Klang mögen einige Grabschriften vergegenwärtigen, wie θeotoras artahiaihi berenarrihino und dazihonas platorrihi bollihi.] in ziemlicher Anzahl gefunden worden, unzweifelhaft Trümmer des Idioms der Iapyger, welche auch die Oberlieferung mit großer Bestimmtheit von den latinischen und samnitischen Stämmen unterscheidet; glaubwürdige Angaben und zahlreiche Spuren führen dahin, daß die gleiche Sprache und der gleiche Stamm ursprünglich auch in Apulien heimisch war. Was wir von diesem Volke jetzt wissen, genügt wohl, um dasselbe von den übrigen Italikern bestimmt zu unterscheiden, nicht aber, um positiv den Platz zu bestimmen, welcher dieser Sprache und diesem Volk in der Geschichte des Menschengeschlechts zukommt. Die Inschriften sind nicht enträtselt, und es ist kaum zu hoffen, daß dies dereinst gelingen wird. Daß der Dialekt den indogermanischen beizuzählen ist, scheinen die Genetivformen aihi und ihi entsprechend dem sanskritischen asya, dem griechischen οιο anzudeuten. Andere Kennzeichen, zum Beispiel der Gebrauch der aspirierten Konsonanten und das Vermeiden der Buchstaben m und t im Auslaut, zeigen diesen iapygischen in wesentlicher Verschiedenheit von den italischen und in einer gewissen Übereinstimmung mit den griechischen Dialekten. Die Annahme einer vorzugsweise engen Verwandtschaft der iapygischen Nation mit den Hellenen findet weitere Unterstützung in den auf den Inschriften mehrfach hervortretenden griechischen Götternamen und in der auffallenden, von der Sprödigkeit der übrigen italischen Nationen scharf abstechenden Leichtigkeit, mit der die Iapyger sich hellenisierten: Apulien, das noch in Timaeos’ Zeit (400 Roms, [350]) als ein barbarisches Land geschildert wird, ist im sechsten Jahrhundert der Stadt, ohne daß irgendeine unmittelbare Kolonisierung von Griechenland aus dort stattgefunden hätte, eine durchaus griechische Landschaft geworden, und selbst bei dem rohen Stamm der Messapier zeigen sich vielfache Ansätze zu einer analogen Entwicklung. Bei dieser allgemeinen Stamm- oder Wahlverwandtschaft der Iapyger mit den Hellenen, die aber doch keineswegs so weit reicht, daß man die Iapygersprache als einen rohen Dialekt des Hellenischen auffassen könnte, wird die Forschung vorläufig wenigstens stehen bleiben müssen, bis ein schärferes und besser gesichertes Ergebnis zu erreichen steht[Man hat, freilich auf überhaupt wenig und am wenigsten für eine Tatsache von solcher Bedeutung zulängliche sprachliche Vergleichungspunkte hin, eine Verwandtschaft zwischen der iapygischen Sprache und der heutigen albanesischen angenommen. Sollte diese Stammverwandtschaft sich bestätigen und sollten anderseits die Albanesen – ein ebenfalls indogermanischer und dem hellenischen und italischen gleichstehender Stamm – wirklich ein Rest jener hellenobarbarischen Nationalität sein, deren Spuren in ganz Griechenland und namentlich in den nördlichen Landschaften hervortreten, so würde diese vorhellenische Nationalität damit als auch voritalisch nachgewiesen sein; Einwanderung der Iapyger in Italien über das Adriatische Meer hin würde daraus zunächst noch nicht folgen.]. Die Lücke ist indes nicht sehr empfindlich; denn nur weichend und verschwindend zeigt sich uns dieser beim Beginn unserer Geschichte schon im Untergehen begriffene Volksstamm. Der wenig widerstandsfähige, leicht in andere Nationalitäten sich auflösende Charakter der iapygischen Nation paßt wohl zu der Annahme, welche durch ihre geographische Lage wahrscheinlich gemacht wird, daß dies die ältesten Einwanderer oder die historischen Autochthonen Italiens sind. Denn unzweifelhaft sind die ältesten Wanderungen der Völker alle zu Lande erfolgt; zumal die nach Italien gerichteten, dessen Küste zur See nur von kundigen Schiffern erreicht werden kann und deshalb noch in Homers Zeit den Hellenen völlig unbekannt war. Kamen aber die früheren Ansiedler über den Apennin, so kann, wie der Geolog aus der Schichtung der Gebirge ihre Entstehung erschließt, auch der Geschichtsforscher die Vermutung wagen, daß die am weitesten nach Süden geschobenen Stämme die ältesten Bewohner Italiens sein werden; und eben an dessen äußerstem südöstlichen Saume begegnen wir der iapygischen Nation.
Die Mitte der Halbinsel ist, soweit unsere zuverlässige Überlieferung zurückreicht, bewohnt von zwei Völkern oder vielmehr zwei Stämmen desselben Volkes, dessen Stellung in dem indogermanischen Volksstamm sich mit größerer Sicherheit bestimmen läßt, als dies bei der iapygischen Nation der Fall war. Wir dürfen dies Volk billig das italische heißen, da auf ihm die geschichtliche Bedeutung der Halbinsel beruht; es teilt sich in die beiden Stämme der Latiner einerseits, anderseits der Umbrer mit deren südlichen Ausläufern, den Marsern und Samniten und den schon in geschichtlicher Zeit von den Samniten ausgesandten Völkerschaften. Die sprachliche Analyse der diesen Stämmen angehörenden Idiome hat gezeigt, daß sie zusammen ein Glied sind in der indogermanischen Sprachenkette, und daß die Epoche, in der sie eine Einheit bildeten, eine verhältnismäßig späte ist. Im Lautsystem erscheint bei ihnen der eigentümliche Spirant f, worin sie übereinstimmen mit den Etruskern, aber sich scharf scheiden von allen hellenischen und hellenobarbarischen Stämmen, sowie vom Sanskrit selbst. Die Aspiraten dagegen, die von den Griechen durchaus und die härteren davon auch von den Etruskern festgehalten werden, sind den Italikern ursprünglich fremd und werden bei ihnen vertreten durch eines ihrer Elemente, sei es durch die Media, sei es durch den Hauch allein f oder h. Die feineren Hauchlaute s, w, j, die die Griechen soweit möglich beseitigen, sind in den italischen Sprachen wenig beschädigt erhalten, ja hie und da noch weiter entwickelt worden. Das Zurückziehen des Akzents und die dadurch hervorgerufene Zerstörung der Endungen haben die Italiker zwar mit einigen griechischen Stämmen und mit den Etruskern gemein, jedoch in stärkerem Grad als jene, in geringerem als diese angewandt; die unmäßige Zerrüttung der Endungen im Umbrischen ist sicher nicht in dem ursprünglichen Sprachgeist begründet, sondern spätere Verderbnis, welche sich in derselben Richtung wenngleich schwächer auch in Rom geltend gemacht hat. Kurze Vokale fallen in den italischen Sprachen deshalb im Auslaut regelmäßig, lange häufig ab; die schließenden Konsonanten sind dagegen im Lateinischen und mehr noch im Samnitischen mit Zähigkeit festgehalten worden, während das Umbrische auch diese fallen läßt. Damit hängt es zusammen, daß die Medialbildung in den italischen Sprachen nur geringe Spuren zurückgelassen hat und dafür ein eigentümliches, durch Anfügung von r gebildetes Passiv an die Stelle tritt; ferner daß der größte Teil der Tempora durch Zusammensetzungen mit den Wurzeln es und fu gebildet wird, während den Griechen neben dem Augment die reichere Ablautung den Gebrauch der Hilfszeitwörter großenteils erspart. Während die italischen Sprachen wie der äolische Dialekt auf den Dual verzichteten, haben sie den Ablativ, der den Griechen verlorenging, durchgängig, großenteils auch den Lokativ erhalten. Die strenge Logik der Italiker scheint Anstoß daran genommen zu haben, den Begriff der Mehrheit in den der Zweiheit und der Vielheit zu spalten, während man die in den Beugungen sich ausdrückenden Wortbeziehungen mit großer Schärfe festhielt. Eigentümlich italisch und selbst dem Sanskrit fremd ist die in den Gerundien und Supinen vollständiger als sonst irgendwo durchgeführte Substantivierung der Zeitwörter.
Diese aus einer reichen Fülle analoger Erscheinungen ausgewählten Beispiele genügen, um die Individualität des italischen Sprachstammes jedem anderen indogermanischen gegenüber darzutun und zeigen denselben zugleich sprachlich wie geographisch als nächsten Stammverwandten der Griechen; der Grieche und der Italiker sind Brüder, der Kelte, der Deutsche und der Slave ihnen Vettern. Die wesentliche Einheit aller italischen wie aller griechischen Dialekte und Stämme unter sich muß früh und klar den beiden großen Nationen selbst aufgegangen sein; denn wir finden in der römischen Sprache ein uraltes Wort rätselhaften Ursprungs, Graius oder Graicus, das jeden Hellenen bezeichnet, und ebenso bei den Griechen die analoge Benennung Οπικός, die von allen, den Griechen in älterer Zeit bekannten latinischen und samnitischen Stämmen, nicht aber von Iapygern oder Etruskern gebraucht wird.
Innerhalb des italischen Sprachstammes aber tritt das Lateinische wieder in einen bestimmten Gegensatz zu den umbrisch-samnitischen Dialekten. Allerdings sind von diesen nur zwei, der umbrische und der samnitische oder oskische Dialekt, einigermaßen, und auch diese nur in äußerst lückenhafter und schwankender Weise bekannt; von den übrigen Dialekten sind die einen, wie der volskische und der marsische, in zu geringen Trümmern auf uns gekommen, um sie in ihrer Individualität zu erfassen oder auch nur die Mundarten selbst mit Sicherheit und Genauigkeit zu klassifizieren, während andere, wie der sabinische, bis auf geringe, als dialektische Eigentümlichkeiten im provinzialen Latein erhaltene Spuren völlig untergegangen sind. Indes läßt die Kombination der sprachlichen und der historischen Tatsachen daran keinen Zweifel, daß diese sämtlichen Dialekte dem umbrisch-samnitischen Zweig des großen italischen Stammes angehört haben, und daß dieser, obwohl dem lateinischen Stamm weit näher als dem griechischen verwandt, doch auch wieder von ihm aufs bestimmteste sich unterscheidet. Im Fürwort und sonst häufig sagte der Samnite und der Umbrer p, wo der Römer q sprach – so pis für quis; ganz wie sich auch sonst nahverwandte Sprachen scheiden, zum Beispiel dem Keltischen in der Bretagne und Wales p, dem Gälischen und Irischen k eigen ist. In den Vokalen erscheinen die Diphthonge im Lateinischen und überhaupt den nördlichen Dialekten sehr zerstört, dagegen in den südlichen italischen Dialekten sie wenig gelitten haben; womit verwandt ist, daß in der Zusammensetzung der Römer den sonst so streng bewahrten Grundvokal abschwächt, was nicht geschieht in der verwandten Sprachengruppe. Der Genetiv der Wörter auf a ist in dieser wie bei den Griechen as, bei den Römern in der ausgebildeten Sprache ae; der der Wörter auf us im Samnitischen eis, im Umbrischen es, bei den Römern ei; der Lokativ tritt bei diesen im Sprachbewußtsein mehr und mehr zurück, während er in den andern italischen Dialekten in vollem Gebrauch blieb; der Dativ des Plural auf bus ist nur im Lateinischen vorhanden. Der umbrisch-samnitische Infinitiv auf um ist den Römern fremd, während das oskisch-umbrische, von der Wurzel es gebildete Futur nach griechischer Art (her-est wie λέγ-σω) bei den Römern fast, vielleicht ganz verschollen und ersetzt ist durch den Optativ des einfachen Zeitworts oder durch analoge Bildungen von fuo (ama-bo). In vielen dieser Fälle, zum Beispiel in den Kasusformen, sind die Unterschiede indes nur vorhanden für die beiderseits ausgebildeten Sprachen, während die Anfänge zusammenfallen. Wenn also die italische Sprache neben der griechischen selbständig steht, so verhält sich innerhalb jener die lateinische Mundart zu der umbrisch-samnitischen etwa wie die ionische zur dorischen, während sich die Verschiedenheiten des Oskischen und des Umbrischen und der verwandten Dialekte etwa vergleichen lassen mit denen des Dorismus in Sizilien und in Sparta.
Jede dieser Spracherscheinungen ist Ergebnis und Zeugnis eines historischen Ereignisses. Es läßt sich daraus mit vollkommener Sicherheit erschließen, daß aus dem gemeinschaftlichen Mutterschoß der Völker und der Sprachen ein Stamm ausschied, der die Ahnen der Griechen und der Italiker gemeinschaftlich in sich schloß; daß aus diesem alsdann die Italiker sich abzweigten und diese wieder in den westlichen und östlichen Stamm, der östliche noch später in Umbrer und Osker auseinander gingen.
Wo und wann diese Scheidungen stattfanden, kann freilich die Sprache nicht lehren, und kaum darf der verwegene Gedanke es versuchen, diesen Revolutionen ahnend zu folgen, von denen die frühesten unzweifelhaft lange vor derjenigen Einwanderung stattfanden, welche die Stammväter der Italiker über die Apenninen führte. Dagegen kann die Vergleichung der Sprachen, richtig und vorsichtig behandelt, von demjenigen Kulturgrade, auf dem das Volk sich befand, als jene Trennungen eintraten, ein annäherndes Bild und damit uns die Anfänge der Geschichte gewähren, welche nichts ist als die Entwicklung der Zivilisation. Denn es ist namentlich in der Bildungsepoche die Sprache das treue Bild und Organ der erreichten Kulturstufe; die großen technischen und sittlichen Revolutionen sind darin wie in einem Archiv aufbewahrt, aus dessen Akten die Zukunft nicht versäumen wird, für jene Zeiten zu schöpfen, aus welchen alle unmittelbare Überlieferung verstummt ist.
Während die jetzt getrennten indogermanischen Völker einen gleichsprachigen Stamm bildeten, erreichten sie einen gewissen Kulturgrad und einen diesem angemessenen Wortschatz, den als gemeinsame Ausstattung in konventionell festgestelltem Gebrauch alle Einzelvölker übernahmen, um auf der gegebenen Grundlage selbständig weiter zu bauen. Wir finden in diesem Wortschatz nicht bloß die einfachsten Bezeichnungen des Seins, der Tätigkeiten, der Wahrnehmungen wie sum, do, pater, das heißt den ursprünglichen Widerhall des Eindrucks, den die Außenwelt auf die Brust des Menschen macht, sondern auch eine Anzahl Kulturwörter nicht bloß ihren Wurzeln nach, sondern in einer gewohnheitsmäßig ausgeprägten Form, welche Gemeingut des indogermanischen Stammes und weder aus gleichmäßiger Entfaltung noch aus späterer Entlehnung erklärbar sind. So besitzen wir Zeugnisse für die Entwicklung des Hirtenlebens in jener fernen Epoche in den unabänderlich fixierten Namen der zahmen Tiere: sanskritisch gâus ist lateinisch bos, griechisch βούς; sanskritisch avis ist lateinisch ovis, griechisch όις; sanskritisch açvas, lateinisch equus, griechisch ίππος; sanskritisch hansas, lateinisch anser, griechisch χήν; sanskritisch âtis, griechisch νήσσα, lateinisch anas; ebenso sind pecus, sus, porcus, taurus, canis sanskritische Wörter. Also schon in dieser fernsten Epoche hatte der Stamm, auf dem von den Tagen Homers bis auf unsere Zeit die geistige Entwicklung der Menschheit beruht, den niedrigsten Kulturgrad der Zivilisation, die Jäger- und Fischerepoche, überschritten und war zu einer wenigstens relativen Stetigkeit der Wohnsitze gelangt. Dagegen fehlt es bis jetzt an sicheren Beweisen dafür, daß schon damals der Acker gebaut worden ist. Die Sprache spricht eher dagegen als dafür. Unter den lateinisch-griechischen Getreidenamen kehrt keiner wieder im Sanskrit mit einziger Ausnahme von ζέα, das sprachlich dem sanskritischen yavas entspricht, übrigens im Indischen die Gerste, im Griechischen den Spelt bezeichnet. Es muß nun freilich zugegeben werden, daß diese von der wesentlichen Übereinstimmung der Benennungen der Haustiere so scharf abstechende Verschiedenheit in den Namen der Kulturpflanzen eine ursprüngliche Gemeinschaft des Ackerbaues noch nicht unbedingt ausschließt; in primitiven Verhältnissen ist die Übersiedelung und Akklimatisierung der Pflanzen schwieriger als die der Tiere, und der Reisbau der Inder, der Weizen- und Speltbau der Griechen und Römer, der Roggen- und Haferbau der Germanen und Kelten könnten an sich wohl alle auf einen gemeinschaftlichen ursprünglichen Feldbau zurückgehen. Aber auf der andern Seite ist die den Griechen und Indern gemeinschaftliche Benennung einer Halmfrucht doch höchstens ein Beweis dafür, daß man vor der Scheidung der Stämme die in Mesopotamien wildwachsenden Gersten- und Speltkörner[Nordwestlich von Anah am rechten Euphratufer fanden sich zusammen Gerste, Weizen und Spelt im wilden Zustande (Alphonse de Candolle, Géographie botanique raisonnée. Paris 1855. Bd. 2, S. 934). Dasselbe, daß Gerste und Weizen in Mesopotamien wild wachsen, sagt schon der babylonische Geschichtschreiber Berosos (bei Georgios Synkellos p. 50 Bonn.).] sammelte und aß, nicht aber dafür, daß man schon Getreide baute. Wenn sich hier nach keiner Seite hin eine Entscheidung ergibt, so führt dagegen etwas weiter die Beobachtung, daß eine Anzahl der wichtigsten hier einschlagenden Kulturwörter im Sanskrit zwar auch, aber durchgängig in allgemeinerer Bedeutung vorkommen: agras ist bei den Indern überhaupt Flur, kûrnu ist das Zerriebene, aritram ist Ruder und Schiff, venas das Anmutige überhaupt, namentlich der anmutende Trank. Die Wörter also sind uralt; aber ihre bestimmte Beziehung auf die Ackerflur (ager), auf das zu mahlende Getreide (granum, Korn), auf das Werkzeug, das den Boden furcht wie das Schiff die Meeresfläche (aratrum), auf den Saft der Weintraube (vinum) war bei der ältesten Teilung der Stämme noch nicht entwickelt; es kann daher auch nicht wundernehmen, wenn die Beziehungen zum Teil sehr verschieden ausfielen und zum Beispiel von dem sanskritischen kûrnu sowohl das zum Zerreiben bestimmte Korn als auch die zerreibende Mühle, gotisch quairnus, litauisch girnôs ihre Namen empfingen. Wir dürfen darnach als wahrscheinlich annehmen, daß das indogermanische Urvolk den Ackerbau noch nicht kannte, und als gewiß, daß, wenn es ihn kannte, er doch noch in der Volkswirtschaft eine durchaus untergeordnete Rolle spielte; denn wäre er damals schon gewesen, was er später den Griechen und Römern war, so hätte er tiefer der Sprache sich eingeprägt, als es geschehen ist.
Dagegen zeugen für den Häuser- und Hüttenbau der Indogermanen sanskritisch dam(as), lateinisch domus, griechisch δόμος; sanskritisch vêças, lateinisch vicus, griechisch οίκος; sanskritisch dvaras, lateinisch fores, griechisch θύρα; ferner für den Bau von Ruderbooten die Namen des Nachens – sanskritisch nâus, griechisch ναύς, lateinisch navis – und des Ruders – sanskritisch aritram, griechisch ερετμός, lateinisch remus, tri-res-mis; für den Gebrauch der Wagen und die Bändigung der Tiere zum Ziehen und Fahren sanskritisch akshas (Achse und Karren), lateinisch axis, griechisch άξων, αμ-αξα; sanskritisch iugam, lateinisch iugum, griechisch ζυγόν. Auch die Benennungen des Kleides – sanskritisch vastra, lateinisch vestis, griechisch εςθής – und des Nähens und Spinnens – sanskritisch siv, lateinisch suo; sanskritisch nah, lateinisch neo, griechisch νήθω – sind in allen indogermanischen Sprachen die gleichen. Von der höheren Kunst des Webens läßt dies dagegen nicht in gleicher Weise sich sagen [Wenn das lateinische vieo, vimen, demselben Stamm angehört wie unser weben und die verwandten Wörter, so muß das Wort, noch als Griechen und Italiker sich trennten, die allgemeine Bedeutung flechten gehabt haben, und kann diese erst später, wahrscheinlich in verschiedenen Gebieten unabhängig voneinander, in die des Webens übergegangen sein. Auch der Leinbau, so alt er ist, reicht nicht bis in diese Zeit zurück, denn die Inder kennen die Flachspflanze wohl, bedienen sich ihrer aber bis heute nur zur Bereitung des Leinöls. Der Hanf ist den Italikern wohl noch später bekannt geworden als der Flachs; wenigstens sieht cannabis ganz aus wie ein spätes Lehnwort.]. Dagegen ist wieder die Kunde von der Benutzung des Feuers zur Speisenbereitung und des Salzes zur Würzung derselben uraltes Erbgut der indogermanischen Nationen und das gleiche gilt sogar von der Kenntnis der ältesten zum Werkzeug und zum Zierat von dem Menschen verwandten Metalle. Wenigstens vom Kupfer (aes) und Silber (argentum), vielleicht auch vom Gold kehren die Namen wieder im Sanskrit, und diese Namen sind doch schwerlich entstanden, bevor man gelernt hatte, die Erze zu scheiden und zu verwenden; wie denn auch sanskritisch asis, lateinisch ensis auf den uralten Gebrauch metallener Waffen hinleitet.
Nicht minder reichen in diese Zeiten die Fundamentalgedanken zurück, auf denen die Entwicklung aller indogermanischen Staaten am letzten Ende beruht: die Stellung von Mann und Weib zueinander, die Geschlechtsordnung, das Priestertum des Hausvaters und die Abwesenheit eines eigenen Priesterstandes sowie überhaupt einer jeden Kastensonderung, die Sklaverei als rechtliche Institution, die Rechtstage der Gemeinde bei Neumond und Vollmond. Dagegen die positive Ordnung des Gemeinwesens, die Entscheidung zwischen Königtum und Gemeindeherrlichkeit, zwischen erblicher Bevorzugung der Königs- und Adelsgeschlechter und unbedingter Rechtsgleichheit der Bürger gehört überall einer späteren Zeit an. Selbst die Elemente der Wissenschaft und der Religion zeigen Spuren ursprünglicher Gemeinschaft.
Die Zahlen sind dieselben bis hundert (sanskritisch çatam, ékaçatam, lateinisch centum, griechisch ε-κατόν, gotisch hund); der Mond heißt in allen Sprachen davon, daß man nach ihm die Zeit mißt (mensis). Wie der Begriff der Gottheit selbst (sanskritisch devas, lateinisch deus, griechisch θεός) gehören zum gemeinen Gut der Völker auch manche der ältesten Religionsvorstellungen und Naturbilder. Die Auffassung zum Beispiel des Himmels als des Vaters, der Erde als der Mutter der Wesen, die Festzüge der Götter, die in eigenen Wagen auf sorgsam gebahnten Gleisen von einem Orte zum andern ziehen, die schattenhafte Fortdauer der Seele nach dem Tode sind Grundgedanken der indischen wie der griechischen und römischen Götterlehre. Selbst einzelne der Götter vom Ganges stimmen mit den am Ilissos und am Tiber verehrten bis auf die Namen überein – so ist der Uranos der Griechen der Varunas, so der Zeus, Jovis pater, Diespiter der Djâus pitâ der Veden. Auf manche rätselhafte Gestalt der hellenischen Mythologie ist durch die neuesten Forschungen über die ältere indische Götterlehre ein ungeahntes Licht gefallen. Die altersgrauen geheimnisvollen Gestalten der Erinnyen sind nicht hellenisches Gedicht, sondern schon mit den ältesten Ansiedlern aus dem Osten eingewandert. Das göttliche Windspiel Saramâ, das dem Herrn des Himmels die goldene Herde der Sterne und Sonnenstrahlen behütet und ihm die Himmelskühe, die nährenden Regenwolken zum Melken zusammentreibt, das aber auch die frommen Toten treulich in die Welt der Seligen geleitet, ist den Griechen zu dem Sohn der Saramâ, dem Saramêyas oder Hermeias geworden, und die rätselhafte, ohne Zweifel auch mit der römischen Cacussage zusammenhängende hellenische Erzählung von dem Raub der Rinder des Helios erscheint nun als ein letzter unverstandener Nachklang jener alten sinnvollen Naturphantasie.
Wenn die Aufgabe, den Kulturgrad zu bestimmen, den die Indogermanen vor der Scheidung der Stämme erreichten, mehr der allgemeinen Geschichte der alten Welt angehört, so ist es dagegen speziell Aufgabe der italischen Geschichte, zu ermitteln, soweit es möglich ist, auf welchem Stande die graecoitalische Nation sich befand, als Hellenen und Italiker sich voneinander schieden. Es ist dies keine überflüssige Arbeit; wir gewinnen damit den Anfangspunkt der italischen Zivilisation, den Ausgangspunkt der nationalen Geschichte.
Alle Spuren deuten dahin, daß, während die Indogermanen wahrscheinlich ein Hirtenleben führten und nur etwa die wilde Halmfrucht kannten, die Graecoitaliker ein korn-, vielleicht sogar schon ein weinbauendes Volk waren. Dafür zeugt nicht gerade die Gemeinschaft des Ackerbaues selbst, die im ganzen noch keineswegs einen Schluß auf alle Völkergemeinschaft rechtfertigt. Ein geschichtlicher Zusammenhang des indogermanischen Ackerbaus mit dem der chinesischen, aramäischen und ägyptischen Stämme wird schwerlich in Abrede gestellt werden können; und doch sind diese Stämme den Indogermanen entweder stammfremd oder doch zu einer Zeit von ihnen getrennt worden, wo es sicher noch keinen Feldbau gab. Vielmehr haben die höher stehenden Stämme vor alters wie heutzutage die Kulturgeräte und Kulturpflanzen beständig getauscht; und wenn die Annalen von China den chinesischen Ackerbau auf die unter einem bestimmten König in einem bestimmten Jahr stattgefundene Einführung von fünf Getreidearten zurückführen, so zeichnet diese Erzählung im allgemeinen wenigstens die Verhältnisse der ältesten Kulturepoche ohne Zweifel richtig. Gemeinschaft des Ackerbaus wie Gemeinschaft des Alphabets, der Streitwagen, des Purpurs und andern Geräts und Schmuckes gestattet weit öfter einen Schluß auf alten Völkerverkehr als auf ursprüngliche Volkseinheit. Aber was die Griechen und Italiker anlangt, so darf bei den verhältnismäßig wohlbekannten Beziehungen dieser beiden Nationen zueinander die Annahme, daß der Ackerbau, wie Schrift und Münze, erst durch die Hellenen nach Italien gekommen sei, als völlig unzulässig bezeichnet werden. Anderseits zeugt für den engsten Zusammenhang des beiderseitigen Feldbaus die Gemeinschaftlichkeit aller ältesten hierher gehörigen Ausdrücke: agerαγρός, aro aratrumαρόω άροτρον, ligo neben λαχαίνω, hortusχόρτος, hordeumκριθή, miliumμελίνη, rapaραφανίς, malvaμαλάχη, vinumοίνος, und ebenso das Zusammentreffen des griechischen und italischen Ackerbaus in der Form des Pfluges, der auf altattischen und römischen Denkmälern ganz gleich gebildet vorkommt, in der Wahl der ältesten Kornarten: Hirse, Gerste, Spelt, in dem Gebrauch, die Ähren mit der Sichel zu schneiden und sie auf der glattgestampften Tenne durch das Vieh austreten zu lassen, endlich in der Bereitungsart des Getreides: pulsπόλτος, pinsoπτίσσω, molaμύλη, denn das Backen ist jüngeren Ursprungs, und wird auch deshalb im römischen Ritual statt des Brotes stets der Teig oder Brei gebraucht. Daß auch der Weinbau in Italien über die älteste griechische Einwanderung hinausgeht, dafür spricht die Benennung »Weinland« (Οινοτρία), die bis zu den ältesten griechischen Anländern hinaufzureichen scheint. Danach muß der Übergang vom Hirtenleben zum Ackerbau oder, genauer gesprochen, die Verbindung des Feldbaus mit der älteren Weidewirtschaft stattgefunden haben, nachdem die Inder aus dem Mutterschoß der Nationen ausgeschieden waren, aber bevor die Hellenen und die Italiker ihre alte Gemeinsamkeit aufhoben. Übrigens scheinen, als der Ackerbau aufkam, die Hellenen und Italiker nicht bloß unter sich, sondern auch noch mit anderen Gliedern der großen Familie zu einem Volksganzen verbunden gewesen zu sein; wenigstens ist es Tatsache, daß die wichtigsten jener Kulturwörter zwar den asiatischen Gliedern der indogermanischen Völkerfamilien fremd, aber den Römern und Griechen mit den keltischen sowohl als mit den deutschen, slawischen, lettischen Stämmen gemeinsam sind[So finden sich aro aratrum wieder in dem altdeutschen aran (pflügen, mundartlich eren), erida, im slawischen orati, oradlo, im litauischen arti, arimnas, im keltischen ar, aradar. So steht neben ligo unser Rechen, neben hortus unser Garten, neben mola unsere Mühle, slawisch mlyn, litauisch malunas, keltisch malirr.
Allen diesen Tatsachen gegenüber wird man es nicht zugeben können, daß es eine Zeit gegeben wo die Griechen in allen hellenischen Gauen nur von der Viehzucht gelebt haben. Wenn nicht Grund-, sondern Viehbesitz in Hellas wie in Italien der Ausgangs- und Mittelpunkt alles Privatvermögens ist, so beruht dies nicht darauf, daß der Ackerbau erst später aufkam, sondern daß er anfänglich nach dem System der Feldgemeinschaft betrieben ward. Überdies versteht es sich von selbst, daß eine reine Ackerbauwirtschaft vor Scheidung der Stämme noch nirgends bestanden haben kann, sondern, je nach der Lokalität mehr oder minder, die Viehzucht damit sich in ausgedehnterer Weise verband, als dies später der Fall war.]. Die Sonderung des gemeinsamen Erbgutes von dem wohlerworbenen Eigen einer jeden Nation in Sitte und Sprache ist noch lange nicht vollständig und in aller Mannigfaltigkeit der Gliederungen und Abstufungen durchgeführt; die Durchforschung der Sprachen in dieser Beziehung hat kaum begonnen, und auch die Geschichtschreibung entnimmt immer noch ihre Darstellung der Urzeit vorwiegend, statt dem reichen Schacht der Sprachen, vielmehr dem größtenteils tauben Gestein der Überlieferung. Für jetzt muß es darum hier genügen, auf die Unterschiede hinzuweisen zwischen der Kultur der indogermanischen Familie in ihrem ältesten Beisammensein und zwischen der Kultur derjenigen Epoche, wo die Graecoitaliker noch ungetrennt zusammenlebten; die Unterscheidung der den asiatischen Gliedern dieser Familie fremden, den europäischen aber gemeinsamen Kulturresultate von denjenigen, welche die einzelnen Gruppen dieser letzteren, wie die griechisch-italische, die deutsch-slawische, jede für sich erlangten, kann, wenn überhaupt, doch auf jeden Fall erst nach weiter vorgeschrittenen sprachlichen und sachlichen Untersuchungen gemacht werden. Sicher aber ist der Ackerbau für die graecoitalische, wie ja für alle anderen Nationen auch, der Keim und der Kern des Volks- und Privatlebens geworden und als solcher im Volksbewußtsein geblieben. Das Haus und der feste Herd, den der Ackerbauer sich gründet anstatt der leichten Hütte und der unsteten Feuerstelle des Hirten, werden im geistigen Gebiete dargestellt und idealisiert in der Göttin Vesta oder Εστία, fast der einzigen, die nicht indogermanisch und doch beiden Nationen von Haus aus gemein ist. Eine der ältesten italischen Stammsagen legt dem König Italus, oder, wie die Italiker gesprochen haben müssen, Vitalus oder Vitulus, die Überführung des Volkes vom Hirtenleben zum Ackerbau bei und knüpft sinnig die ursprüngliche italische Gesetzgebung daran; nur eine andere Wendung davon ist es, wenn die samnitische Stammsage zum Führer der Urkolonien den Ackerstier macht oder wenn die ältesten latinischen Volksnamen das Volk bezeichnen als Schnitter (Siculi, auch wohl Sicani) oder als Feldarbeiter (Opsci). Es gehört zum sagenwidrigen Charakter der sogenannten römischen Ursprungssage, daß darin ein städtegründendes Hirten- und Jägervolk auftritt: Sage und Glaube, Gesetze und Sitten knüpfen bei den Italikern wie bei den Hellenen durchgängig an den Ackerbau an [Nichts ist dafür bezeichnender als die enge Verknüpfung, in welche die älteste Kulturepoche den Ackerbau mit der Ehe wie mit der Stadtgründung setzte. So sind die bei der Ehe zunächst beteiligten Götter in Italien die Ceres und (oder?) Tellus (Plut. Rom. 22; Serv. Aen. 4, 166; A. Roßbach, Untersuchungen über die römische Ehe. Stuttgart 1853, S. 257, 301), in Griechenland die Demeter (Plut. coniug. praec. Vorrede), wie denn auch in alten griechischen Formeln die Gewinnung von Kindern selber »Ernte« heißt ( [Anm. 10] ); ja die älteste römische Eheform, die Confarreatio, entnimmt ihren Namen und ihr Ritual vom Kornbau. Die Verwendung des Pflugs bei der Stadtgründung ist bekannt.].
Wie der Ackerbau selbst beruhen auch die Bestimmungen der Flächenmaße und die Weise der Limitation bei beiden Völkern auf gleicher Grundlage; wie denn das Bauen des Bodens ohne eine wenn auch rohe Vermessung desselben nicht gedacht werden kann. Der oskische und umbrische Vorsus von 100 Fuß ins Gevierte entspricht genau dem griechischen Plethron. Auch das Prinzip der Limitation ist dasselbe. Der Feldmesser orientiert sich nach einer der Himmelsgegenden und zieht also zuerst zwei Linien von Norden nach Süden und von Osten nach Westen, in deren Schneidepunkt (templum, τέμενος von τέμνω) er steht, alsdann in gewissen festen Abständen den Hauptschneidelinien parallele Linien, wodurch eine Reihe rechtwinkeliger Grundstücke entsteht, deren Ecken die Grenzpfähle (termini, in sizilischen Inschriften τέρμονες, gewöhnlich όροι) bezeichnen. Diese Limitationsweise, die wohl auch etruskisch, aber schwerlich etruskischen Ursprungs ist, finden wir bei den Römern, Umbrern, Samniten, aber auch in sehr alten Urkunden der tarentinischen Herakleoten, die sie wahrscheinlich ebensowenig von den Italikern entlehnt haben als diese sie von den Tarentinern, sondern es ist altes Gemeingut. Eigentümlich römisch und charakteristisch ist erst die eigensinnige Ausbildung des quadratischen Prinzips, wonach man selbst, wo Fluß und Meer eine natürliche Grenze machten, diese nicht gelten ließ, sondern mit dem letzten vollen Quadrat das zum Eigen verteilte Land abschloß.
Aber nicht bloß im Ackerbau, sondern auch auf den übrigen Gebieten der ältesten menschlichen Tätigkeit ist die vorzugsweise enge Verwandtschaft der Griechen und Italiker unverkennbar. Das griechische Haus, wie Homer es schildert, ist wenig verschieden von demjenigen, das in Italien beständig festgehalten ward; das wesentliche Stück und ursprünglich der ganze innere Wohnraum des lateinischen Hauses ist das Atrium, das heißt das schwarze Gemach mit dem Hausaltar, dem Ehebett, dem Speisetisch und dem Herd, und nichts anderes ist auch das homerische Megaron mit Hausaltar und Herd und schwarzberußter Decke. Nicht dasselbe läßt sich von dem Schiffbau sagen. Der Rudernachen ist altes indogermanisches Gemeingut; der Fortschritt zu Segelschiffen aber gehört der graecoitalischen Periode schwerlich an, da es keine nicht allgemein indogermanische und doch von Haus aus den Griechen und Italikern gemeinsame Seeausdrücke gibt. Dagegen wird wieder die uralte italische Sitte der gemeinschaftlichen Mittagsmahlzeiten der Bauern, deren Ursprung der Mythus an die Einführung des Ackerbaues anknüpft, von Aristoteles mit den kretischen Syssitien verglichen; und auch darin trafen die ältesten Römer mit den Kretern und Lakonen zusammen, daß sie nicht, wie es später bei beiden Völkern üblich ward, auf der Bank liegend, sondern sitzend die Speisen genossen. Das Feuerzünden durch Reiben zweier verschiedenartiger Hölzer ist allen Völkern gemein; aber gewiß nicht zufällig treffen Griechen und Italiker zusammen in den Bezeichnungen der beiden Zündehölzer, des »Reibers« (τρύπανον, terebra) und der »Unterlage« (στόρευςεσχάρα, tabula, wohl von tendere, τέταμαι). Ebenso ist die Kleidung beider Völker wesentlich identisch, denn die Tunika entspricht völlig dem Chiton, und die Toga ist nichts als ein bauschigeres Himation; ja selbst in dem so veränderlichen Waffenwesen ist wenigstens das beiden Völkern gemein, daß die beiden Hauptangriffswaffen Wurfspeer und Bogen sind, was römischerseits in den ältesten Wehrmannsnamen (pilumni – arquites) deutlich sich ausspricht [Unter den beiderseits ältesten Waffennamen werden kaum sicher verwandte aufgezeigt werden können: lancea, obwohl ohne Zweifel mit λόγχη zusammenhängend, ist als römisches Wort jung und vielleicht von den Deutschen oder Spaniern entlehnt.] und der ältesten nicht eigentlich auf den Nahkampf berechneten Fechtweise angemessen ist. So geht bei den Griechen und Italikern in Sprache und Sitte zurück auf dieselben Elemente alles, was die materiellen Grundlagen der menschlichen Existenz betrifft; die ältesten Aufgaben, die die Erde an den Menschen stellt, sind einstmals von beiden Völkern, als sie noch eine Nation ausmachten, gemeinschaftlich gelöst worden.
Anders ist es in dem geistigen Gebiet. Die große Aufgabe des Menschen, mit sich selbst, mit seinesgleichen und mit dem Ganzen in bewußter Harmonie zu leben, läßt so viele Lösungen zu, als es Provinzen gibt in unsers Vaters Reich; und auf diesem Gebiet ist es, nicht auf dem materiellen, wo die Charaktere der Individuen und der Völker sich scheiden. In der graecoitalischen Periode müssen die Anregungen noch gefehlt haben, welche diesen innerlichen Gegensatz hervortreten machten; erst zwischen den Hellenen und den Italikern hat jene tiefe geistige Verschiedenheit sich offenbart, deren Nachwirkung noch bis auf den heutigen Tag sich fortsetzt. Familie und Staat, Religion und Kunst sind in Italien wie in Griechenland so eigentümlich, so durchaus national entwickelt worden, daß die gemeinschaftliche Grundlage, auf der auch hier beide Völker fußten, dort und hier überwuchert und unsern Augen fast ganz entzogen ist. Jenes hellenische Wesen, das dem Einzelnen das Ganze, der Gemeinde die Nation, dem Bürger die Gemeinde aufopferte, dessen Lebensideal das schöne und gute Sein und nur zu oft der süße Müßiggang war, dessen politische Entwicklung in der Vertiefung des ursprünglichen Partikularismus der einzelnen Gaue und später sogar in der innerlichen Auflösung der Gemeindegewalt bestand, dessen religiöse Anschauung erst die Götter zu Menschen machte und dann die Götter leugnete, das die Glieder entfesselte in dem Spiel der nackten Knaben und dem Gedanken in aller seiner Herrlichkeit und in aller seiner Furchtbarkeit freie Bahn gab; und jenes römische Wesen, das den Sohn in die Furcht des Vaters, die Bürger in die Furcht des Herrschers, sie alle in die Furcht der Götter bannte, das nichts forderte und nichts ehrte als die nützliche Tat und jeden Bürger zwang, jeden Augenblick des kurzen Lebens mit rastloser Arbeit auszufüllen, das die keusche Verhüllung des Körpers schon dem Buben zur Pflicht machte, in dem, wer anders sein wollte als die Genossen, ein schlechter Bürger hieß, in dem der Staat alles war und die Erweiterung des Staates der einzige nicht verpönte hohe Gedanke – wer vermag diese scharfen Gegensätze in Gedanken zurückzuführen auf die ursprüngliche Einheit, die sie beide umschloß und beide vorbereitete und erzeugte? Es wäre törichte Vermessenheit, diesen Schleier lüften zu wollen; nur mit wenigen Andeutungen soll es versucht werden, die Anfänge der italischen Nationalität und ihre Anknüpfung an eine ältere Periode zu bezeichnen, um den Ahnungen des einsichtigen Lesers nicht Worte zu leihen, aber die Richtung zu weisen.
Alles, was man das patriarchalische Element im Staate nennen kann, ruht in Griechenland wie in Italien auf denselben Fundamenten. Vor allen Dingen gehört hierher die sittliche und ehrbare Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens [Selbst im einzelnen zeigt sich diese Übereinstimmung, z. B. in der Bezeichnung der rechten Ehe als der »zur Gewinnung rechter Kinder abgeschlossenen« (γάμος επί παίδων γνησίων αρότω – matrimonium liberorum quaerendorum causa).], welche dem Manne die Monogamie gebietet und den Ehebruch der Frau schwer ahndet und welche in der hohen Stellung der Mutter innerhalb des häuslichen Kreises die Ebenbürtigkeit beider Geschlechter und die Heiligkeit der Ehe anerkennt. Dagegen ist die schroffe und gegen die Persönlichkeit rücksichtslose Entwicklung der eheherrlichen und mehr noch der väterlichen Gewalt den Griechen fremd und italisches Eigen; die sittliche Untertänigkeit hat erst in Italien sich zur rechtlichen Knechtschaft umgestaltet. In derselben Weise wurde die vollständige Rechtlosigkeit des Knechts, wie sie im Wesen der Sklaverei lag, von den Römern mit erbarmungsloser Strenge festgehalten und in allen ihren Konsequenzen entwickelt; wogegen bei den Griechen früh tatsächliche und rechtliche Milderungen stattfanden und zum Beispiel die Sklavenehe als ein gesetzliches Verhältnis anerkannt ward.
Auf dem Hause beruht das Geschlecht, das heißt die Gemeinschaft der Nachkommen desselben Stammvaters; und von dem Geschlecht ist bei den Griechen wie den Italikern das staatliche Dasein ausgegangen. Aber wenn in der schwächeren politischen Entwicklung Griechenlands der Geschlechtsverband als korporative Macht dem Staat gegenüber sich noch weit in die historische Zeit hinein behauptet hat, erscheint der italische Staat sofort insofern fertig, als ihm gegenüber die Geschlechter vollständig neutralisiert sind und er nicht die Gemeinschaft der Geschlechter, sondern die Gemeinschaft der Bürger darstellt. Daß dagegen umgekehrt das Individuum dem Geschlecht gegenüber in Griechenland weit früher und vollständiger zur innerlichen Freiheit und eigenartigen Entwicklung gediehen ist als in Rom, spiegelt sich mit großer Deutlichkeit in der bei beiden Völkern durchaus verschiedenartigen Entwicklung der ursprünglich doch gleichartigen Eigennamen. In den älteren griechischen tritt der Geschlechtsname sehr häufig adjektivisch zum Individualnamen hinzu, während umgekehrt noch die römischen Gelehrten es wußten, daß ihre Vorfahren ursprünglich nur einen, den späteren Vornamen führten. Aber während in Griechenland der adjektivische Geschlechtsname früh verschwindet, wird er bei den Italikern, und zwar nicht bloß bei den Römern, zum Hauptnamen, so daß der eigentliche Individualname, das Praenomen, sich ihm unterordnet. Ja es ist, als sollte die geringe und immer mehr zusammenschwindende Zahl und die Bedeutungslosigkeit der italischen, besonders der römischen Individualnamen, verglichen mit der üppigen und poetischen Fülle der griechischen, uns wie im Bilde zeigen, wie dort die Nivellierung, hier die freie Entwicklung der Persönlichkeit im Wesen der Nation lag.
Ein Zusammenleben in Familiengemeinden unter Stammhäuptern, wie man es für die graecoitalische Periode sich denken mag, mochte den späteren italischen wie hellenischen Politien ungleich genug sehen, mußte aber dennoch die Anfänge der beiderseitigen Rechtsbildung notwendig bereits enthalten. Die »Gesetze des Königs Italus«, die noch in Aristoteles’ Zeiten angewendet wurden, mögen diese beiden Nationen wesentlich gemeinsamen Institutionen bezeichnen. Frieden und Rechtsfolge innerhalb der Gemeinde, Kriegsstand und Kriegsrecht nach außen, ein Regiment des Stammhauptes, ein Rat der Alten, Versammlungen der waffenfähigen Freien, eine gewisse Verfassung müssen in denselben enthalten gewesen sein. Gericht (crimen, κρίνειν), Buße (poena, ποινή), Wiedervergeltung (talio, ταλάω τλήναι) sind graecoitalische Begriffe. Das strenge Schuldrecht, nach welchem der Schuldner für die Rückgabe des Empfangenen zunächst mit seinem Leibe haftet, ist den Italikern und zum Beispiel den tarentinischen Herakleoten gemeinsam. Die Grundgedanken der römischen Verfassung – Königtum, Senat und eine nur zur Bestätigung oder Verwerfung der von dem König und dem Senat an sie gebrachten Anträge befugte Volksversammlung – sind kaum irgendwo so scharf ausgesprochen wie in Aristoteles’ Bericht über die ältere Verfassung von Kreta. Die Keime zu größeren Staatenbünden in der staatlichen Verbrüderung oder gar der Verschmelzung mehrerer bisher selbständiger Stämme (Symmachie, Synoikismos) sind gleichfalls beiden Nationen gemein. Es ist auf diese Gemeinsamkeit der Grundlagen hellenischer und italischer Politie um so mehr Gewicht zu legen, als dieselbe sich nicht auch auf die übrigen indogermanischen Stämme mit erstreckt; wie denn zum Beispiel die deutsche Gemeindeordnung keineswegs wie die der Griechen und Italiker von dem Wahlkönigtum ausgeht. Wie verschieden aber die auf dieser gleichen Basis in Italien und in Griechenland aufgebauten Politien waren und wie vollständig der ganze Verlauf der politischen Entwicklung jeder der beiden Nationen als Sondergut angehört [Nur darf man natürlich nicht vergessen, daß ähnliche Voraussetzungen überall zu ähnlichen Institutionen führen. So ist nichts so sicher, als daß die römischen Plebejer erst innerhalb des römischen Gemeinwesens erwuchsen, und doch finden sie überall ihr Gegenbild, wo neben einer Bürger- eine Insassenschaft sich entwickelt hat. Daß auch der Zufall hier sein neckendes Spiel treibt, versteht sich von selbst.], wird die weitere Erzählung darzulegen haben.
Nicht anders ist es in der Religion. Wohl liegt in Italien wie in Hellas dem Volksglauben der gleiche Gemeinschatz symbolischer und allegorisierter Naturanschauungen zugrunde; auf diesem ruht die allgemeine Analogie zwischen der römischen und der griechischen Götter- und Geisterwelt, die in späteren Entwicklungsstadien so wichtig werden sollte. Auch in zahlreichen Einzelvorstellungen, in der schon erwähnten Gestalt des Zeus-Diovis und der Hestia-Vesta, in dem Begriff des heiligen Raumes (τέμενος, templum), in manchen Opfern und Zeremonien, stimmten die beiderseitigen Kulte nicht bloß zufällig überein. Aber dennoch gestalteten sie sich in Hellas wie in Italien so vollständig national und eigentümlich, daß selbst von dem alten Erbgut nur weniges in erkennbarer Weise und auch dieses meistenteils unverstanden oder mißverstanden bewahrt ward. Es konnte nicht anders sein; denn wie in den Völkern selbst die großen Gegensätze sich schieden, welche die graecoitalische Periode noch in ihrer Unmittelbarkeit zusammengehalten hatte, so schied sich auch in ihrer Religion Begriff und Bild, die bis dahin nur ein Ganzes in der Seele gewesen waren. Jene alten Bauern mochten, wenn die Wolken am Himmel hin gejagt wurden, sich das so ausdrücken, daß die Hündin der Götter die verscheuchten Kühe der Herde zusammentreibe; der Grieche vergaß es, daß die Kühe eigentlich die Wolken waren, und machte aus dem bloß für einzelne Zwecke gestatteten Sohn der Götterhündin den zu allen Diensten bereiten und geschickten Götterboten. Wenn der Donner in den Bergen rollte, sah er den Zeus auf dem Olymp die Keile schwingen; wenn der blaue Himmel wieder auflächelte, blickte er in das glänzende Auge der Tochter des Zeus, Athenaia; und so mächtig lebten ihm die Gestalten, die er sich geschaffen, daß er bald in ihnen nichts sah als vom Glanze der Naturkraft strahlende und getragene Menschen und sie frei nach den Gesetzen der Schönheit bildete und umbildete. Wohl anders, aber nicht schwächer offenbarte sich die innige Religiosität des italischen Stammes, der den Begriff festhielt und es nicht litt, daß die Form ihn verdunkelte. Wie der Grieche, wenn er opfert, die Augen zum Himmel aufschlägt, so verhüllt der Römer sein Haupt; denn jenes Gebet ist Anschauung und dieses Gedanke. In der ganzen Natur verehrt er das Geistige und Allgemeine; jedem Wesen, dem Menschen wie dem Baum, dem Staat wie der Vorratskammer, ist der mit ihm entstandene und mit ihm vergehende Geist zugegeben, das Nachbild des Physischen im geistigen Gebiet; dem Mann der männliche Genius, der Frau die weibliche Juno, der Grenze der Terminus, dem Wald der Silvanus, dem kreisenden Jahr der Vertumnus, und also weiter jedem nach seiner Art. Ja es wird in den Handlungen der einzelne Moment der Tätigkeit vergeistigt; so wird beispielsweise in der Fürbitte für den Landmann angerufen der Geist der Brache, des Ackerns, des Furchens, Säens, Zudeckens, Eggens und so fort bis zu dem des Einfahrens, Rufspeicherns und des Öffnens der Scheuer; und in ähnlicher Weise wird Ehe, Geburt und jedes andere physische Ereignis mit heiligem Leben ausgestattet. Je größere Kreise indes die Abstraktion beschreibt, desto höher steigt der Gott und die Ehrfurcht der Menschen; so sind Jupiter und Juno die Abstraktionen der Männlichkeit und der Weiblichkeit, Dea Dia oder Ceres die schaffende, Minerva die erinnernde Kraft, Dea bona oder, bei den Samniten, Dea cupra die gute Gottheit. Wie den Griechen alles konkret und körperlich erschien, so konnte der Römer nur abstrakte, vollkommen durchsichtige Formeln brauchen; und warf der Grieche den alten Sagenschatz der Urzeit deshalb zum größten Teil weg, weil in deren Gestalten der Begriff noch zu durchsichtig war, so konnte der Römer ihn noch weniger festhalten, weil ihm die heiligen Gedanken auch durch den leichtesten Schleier der Allegorie sich zu trüben schienen. Nicht einmal von den ältesten und allgemeinsten Mythen, zum Beispiel der den Indern, Griechen und selbst den Semiten geläufigen Erzählung von dem nach einer großen Flut übriggebliebenen gemeinsamen Stammvater des gegenwärtigen Menschengeschlechts, ist bei den Römern eine Spur bewahrt worden. Ihre Götter konnten nicht sich vermählen und Kinder zeugen wie die hellenischen; sie wandelten nicht ungesehen unter den Sterblichen und bedurften nicht des Nektars. Aber daß sie dennoch in ihrer Geistigkeit, die nur der platten Auffassung platt erscheint, die Gemüter mächtig und vielleicht mächtiger faßten als die nach dem Bilde des Menschen geschaffenen Götter von Hellas, davon würde, auch wenn die Geschichte schwiege, schon die römische, dem Worte wie dem Begriffe nach unhellenische Benennung des Glaubens, die »Religio«, das heißt die Bindung, zeugen. Wie Indien und Iran aus einem und demselben Erbschatz jenes die Formenfülle seiner heiligen Epen, dieses die Abstraktionen des Zendavesta entwickelte, so herrscht auch in der griechischen Mythologie die Person, in der römischen der Begriff, dort die Freiheit, hier die Notwendigkeit.





























