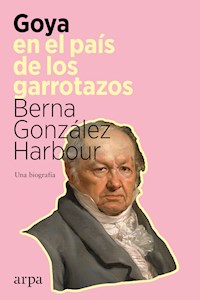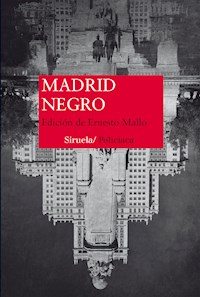Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Comisaria María Ruiz ermittelt in Madrid Der Sommer in Madrid ist rot: Von den Flaggen bis zu den Trikots, überall bekennt man Farbe für La Furia Roja, die spanische Nationalmannschaft. Auch Comisaria María Ruiz lässt sich von der Stimmung mitreißen. Doch ausgerechnet am Tag eines wichtigen Spiels wird eine Leiche gefunden und María wird zum Tatort gerufen. Die eigenwillige Comisaria hat bislang jeden ihrer Fälle gelöst und ist bekannt dafür, mit allen Regeln zu brechen. Das rätselhafte Tattoo des Toten führt sie zu einer katholischen Schule, hinter deren Türen sie düstere Geheimnisse wittert. Kaum haben die Ermittlungen begonnen, wird eine zweite Leiche gefunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. »Roter Sommer« (»Verano en Rojo«) wurde 2023 in Spanien prominent verfilmt. Der Roman »Roter Sommer« ist seit dem 27.6.2024 in Deutschland unter dem Filmtitel "Blutroter Sommer – Im Bann des Killers" als DVD und Stream erhältlich. »Das Thema kann aktueller nicht sein, der Spannungsbogen ist großartig aufgebaut. Berna González Harbour gehört für mich zu den interessantesten Stimmen der aktuellen spanischen Literatur« Walter Vennen | Buchhandlung Schmetz am Dom, Aachen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berna González Harbour • Roter Sommer
Berna González Harbour
RoterSommer
Comisaria Ruiz ermittelt in Madrid
Aus dem Spanischen von Kirsten Brandt
PENDRAGON
Der SUV bog von der Umgehungsstraße ab, umrundete den großen Kreisel mit der schwach beleuchteten Tankstelle und fuhr auf die ersten Ampeln der Stadt zu. Eine Temposchwelle zwang den Fahrer abzubremsen, bevor er wieder beschleunigte und über die nächste hinwegrumpelte, was seinen Beifahrer aus dem Schlaf riss. Bei der dritten Schwelle wurden sie von einem Ford Fiesta voller lärmender Jugendlicher überholt.
Noch mehr von diesen verdammten Idioten, dachte er, doch die Müdigkeit ließ ihn nur kurz einen abfälligen Blick hinüberwerfen. Er war schon zu lange unterwegs, aber bald würde er seinen Beifahrer absetzen. Danach konnte er nach Hause fahren, in seinem Zimmer die Kleidung und die staubigen Schuhe ausziehen, eiskaltes Wasser in die Badewanne lassen und darin dreißig, vierzig, fünfzig Sekunden lang untertauchen. So lange eben, wie er es aushielt, bis seine Nerven sich beruhigt hatten und er spürte, wie sauerstoffreiches Blut durch seine Adern strömte und sein Puls langsam wieder in Gang kam. Anschließend würde er unter den rauen Laken die Augen schließen und versuchen, ein wenig zu schlafen, bis der Wecker schließlich einen neuen Tag einläutete. Seit Juni herrschte glühende Hitze und die Klimaanlage des Wagens verstärkte noch das beklemmende Gefühl, sich in einem Ausnahmezustand zu befinden.
Wieder fuhr er langsam durch einen Kreisel und war fast am Ziel, als ihn Blaulicht aufschreckte. Mehrere Polizeiautos versperrten die Calle Arturo Soria, sodass er abbremsen musste und unter den strengen Blicken der Polizeibeamten, die ihm mit Leuchtstäben den Weg wiesen, auf die einzig freie Fahrspur auswich. Einer bedeutete ihm mit ausgestreckter Hand, anzuhalten, während der andere ihm die entsprechende Stelle am Straßenrand wies, wo er parken und ins Röhrchen pusten sollte. Wie immer bei Polizeikontrollen krampfte sich sein Magen zusammen, ein altbekanntes Gefühl, das ihn schon als Kind überkommen hatte, wenn er bei etwas Verbotenem ertappt worden war. Und nun war es wieder da, dieses kindliche Kribbeln, obwohl er inzwischen erwachsen war und es sich offensichtlich nur um eine gewöhnliche Verkehrskontrolle handelte. Als er ein paar Meter weiter den Ford Fiesta, jetzt ohne Musik, stehen sah und daneben den Fahrer, einen pickeligen Teenager mit gegeltem Haar, der gerade ins Röhrchen blies, beruhigte er sich. Wenn die Polizei diese Kinder angehalten hatte, konnte es nichts Ernstes sein. Aber dass sie ihn ebenfalls gestoppt hatten … Die Stimme seines Beifahrers ließ ihn zusammenzucken.
„Hast du alles?“
Er schüttelte den Kopf. Der Polizist bedeutete ihm, das Fenster zu öffnen und seine Hände begannen zu zittern.
„Nein, ich habe es noch nicht gefunden. Es tut mir leid“, entschuldigte er sich.
Der Beifahrer musterte ihn streng. Nachdem er aus dem Schlaf gerissen worden war, klang seine Stimme noch rauer als sonst. Der Polizist klopfte ungeduldig an die Scheibe.
„Beruhig dich und mach das Fenster auf “, befahl sein Begleiter. „Das ist im Augenblick das Beste. Aber du wirst das in Ordnung bringen müssen. Und jetzt mach schon!“
Ein Schwall glühender Luft drang ins Auto, als er endlich das Fenster herunterließ. Der Polizist war sehr jung, sein Kinn zierte ein unregelmäßiger Flaum, und über dem engen Gürtel konnte man den Bauchansatz erahnen.
„Ihre Papiere bitte.“
Seine hohe Stimme untergrub die Autorität, die ihm die Uniform und die im Dunkeln blinkenden Lichter verliehen. Der Fahrer schwieg.
„Guten Abend“, sagte stattdessen der Beifahrer. „Eine schwierige Nacht?“
Der Beamte beugte sich vor, um in den BMW X3 zu spähen, vermutlich in der Hoffnung, darin noch mehr zugekokste, besoffene Schnösel zu erwischen.
Doch mit dieser Vermutung lag er weit daneben. Der Fahrer war ein Mann Mitte vierzig in altmodischer Anzughose und klassischem Hemd, das bis auf den vorletzten Knopf zugeknöpft war, sodass gerade noch der ausgeprägte Adamsapfel hervorlugte, mit grau meliertem Bürstenschnitt und einer dickrandigen Brille. Und der Beifahrer? Ein korpulenter alter Priester. Er wirkte verschlafen, man sah ihm an, dass er gerade erst aufgewacht war. Auf seinem Schoß hielt er eine abgewetzte, vollgestopfte Aktentasche. Die dicke schwarze Soutane mit der Halsbinde war in dieser warmen Nacht völlig fehl am Platz, und der breite Ring, der sich eng um seinen rechten Ringfinger schloss, ließ seine kräftigen Hände geschwollen erscheinen.
Der Fahrer streckte dem Beamten die Papiere entgegen.
„Ja, in der Tat eine schwierige Nacht. Sie wissen ja, wie das ist nach einem solchen Fußballspiel, da sind alle betrunken“, erklärte der Polizist. „Aber machen Sie sich keine Sorgen, Ihnen sieht man an, dass Sie am Alkohol nicht mal geschnuppert haben.“
„Nicht seit der letzten Messe“, scherzte der Beifahrer scheinheilig. Der Fahrer lächelte gezwungen.
Das Spiel. Er wusste nicht einmal, wer gespielt hatte. Der Polizist nahm die Papiere und warf einen flüchtigen Blick auf den Führerschein. Der Mann auf dem Foto sah noch älter aus als das Original.
„Sie können weiterfahren“, sagte er. „Wir machen Stichproben, deshalb hat es zufällig Sie erwischt, aber Sie sind natürlich keine Verbrecher.“
Der Mann schluckte. Er spürte, wie sein Adamsapfel unter dem engen Hemdkragen auf und ab ging, als ihm der Speichel die Kehle hinabrann, und verabschiedete sich mit einem wenig überzeugenden Lächeln. Langsam fuhr er an und warf im Vorbeifahren unwillkürlich noch einen Blick auf die Jugendlichen in dem Ford Fiesta. Für sie war die Party definitiv vorbei. Das Gefühl, dass die Welt offenbar doch immer noch halbwegs in Ordnung war, beruhigte ihn ein wenig. Und nur ein paar Meter weiter lag schon ihr Ziel, die Calle Añastro Nummer eins.
Er stellte den Motor ab, stieg aus und öffnete die Beifahrertür. Auch der Priester quälte sich heraus. Seine kurzen Arme konnten die dicke Aktentasche kaum umfassen, die ein Silberkreuz an seine Brust drückte. Mit leicht verrutschter Soutane richtete er sich auf, sah den Fahrer an und sagte streng: „Erinnerst du dich an die Geschichte, wie Jesus einmal einen Besessenen geheilt hat? Sie findet sich im Matthäus-, Lukas- und Markusevangelium. Alles andere interessiert nicht.“
Ohne ein weiteres Wort des Abschieds wandte er sich ab und seine stämmige Gestalt verschwand im Gebäude, dem Sitz der Bischofskonferenz.
Endlich würde er sich ausruhen können. Aber die Nervosität saß ihm immer noch hartnäckig in der Magengrube. Und wieder einmal würde selbst ein eiskaltes Bad zu nächtlicher Stunde nicht ausreichen, um ihn zu beruhigen.
1
María saß am Frühstückstisch und blätterte genüsslich in der Zeitung. Nach einer Joggingrunde auf dem Pasillo Verde, zehn Bahnen im Schwimmbad und einer ausgiebigen Dusche fühlte sie sich entspannt. Dazu kamen der Ausblick auf einen arbeitsfreien Samstag und das, was sie stattdessen erwartete: Um drei würde sich die Familie in ihrem Haus in Alcobendas treffen. Sie würde ihre Mutter, ihre Geschwister, Nichten und Neffen sehen, Paella essen und literweise Kaffee trinken, während alle darauf warteten, dass um neun das Spiel gegen Paraguay begann. Sie liebte diese dämliche Weltmeisterschaft. Man musste kein großer Fußballfan sein, um die freudige Erwartung und den ansteckenden Enthusiasmus zu teilen, die Kriminelle und Polizeibeamte in seltener Einigkeit verbanden. Die gelöste Stimmung tat allen gut. Spanien hält im Viertelfinale den Atem an. Das Land verlässt sich auf euch. Ganz Spanien ist ein Fußballverein, lauteten die Schlagzeilen vor ihr auf dem Tisch. Selbst die Zeitungen waren freundlich gestimmt und mit einem Mal herrschte eine versöhnliche Atmosphäre. Wer wollte zu Zeiten der Finanzkrise schon auf eine Gelegenheit zu guter Laune verzichten?
Sie leerte die winzige Kaffeetasse und war gerade dabei, ihr feuchtes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden, als das Handy neben der Zeitung vibrierte. Vielleicht ihre Mutter, der in letzter Minute eingefallen war, dass noch eine Zutat fehlte oder jemand, der die Großmutter in Chamberí abholen musste – aber María, bitte nicht mit dem Motorrad! Doch dafür war es zu früh. Die Anzeige auf dem Display bestätigte ihre schlimmsten Befürchtungen: 8800. Die Zentrale.
„Comisaria Ruíz?“
„Am Apparat.“
„Ich stelle Sie zu Esteban durch.“
Mist, dachte sie, nicht ausgerechnet heute.
„Chefin, weißt du noch, dass wir uns einen guten Fall gewünscht haben, damit wir uns den Sommer über nicht langweilen?“
„Na ja, also gewünscht … das klingt ein bisschen heftig. Wen hast du denn umgebracht?“
„Es ist ein Junge.“
„Wie bitte?“
„Wir haben einen toten Jugendlichen gefunden.“
„Und weiter?“
„Vermutlich minderjährig.“
„Und weiter?“
„Ertrunken.“
„Und weiter?“
María hatte es nie geschafft, Esteban das abzugewöhnen, was sie seinen „Fortsetzungsroman“ nannte: Wenn ihre Nummer zwei etwas wusste, ließ er sich die Informationen mühsam aus der Nase ziehen. „Im Sommer ertrinken viele Leute.“
„Aber nicht so wie der hier“, rückte er schließlich mit der Sprache heraus. „Den hier haben wir gefunden …“
„Nun spuck’s schon aus.“
”… in einem See …“
„Raus mit der Sprache!“
”… der nur achtzig Zentimeter tief ist.“
Der Reinigungstrupp im Park Juan Carlos I war frühmorgens lustlos dabei, im Dickicht und auf den Parkwegen rund um den See für Ordnung zu sorgen, als sie die Leiche fanden. Die erste Samstagsschicht war dafür verantwortlich, den Müll wegzuräumen, die Grünflächen zu bewässern und alles herzurichten, bevor die Familien mit ihren Drachen, Fahrrädern, Bällen, tragbaren Kühlschränken und Picknickdecken anrückten. Winston Enrique war in seiner orangefarbenen Uniform mit dem Wägelchen unterwegs. Mit Kopfhörern im Ohr las er ab und zu ein Papierchen auf, sorgfältig darauf bedacht, bloß nicht so schnell zu arbeiten, dass am Ende nichts zu tun blieb, aber auch nicht so langsam, dass er den anstrengendsten Teil der Arbeit in der prallen Sonne erledigen müsste. Bei Sonnenaufgang war es noch kühl und das Licht hier in Madrid erinnerte ihn an die hellen Morgenstunden in Ecuador. Von Zeit zu Zeit überraschte ihn ein einsamer Jogger und manchmal kräuselte eine sanfte Brise die Wasseroberfläche. Eigentlich ist der Job gar nicht so schlecht, dachte er, schließlich hast du zum Saubermachen Handschuhe und diese lange Zange, sodass du dich nicht bücken musst. Also hob er, wie man ihn angewiesen hatte, zerknüllte Zeitungen und Kugeln aus Alufolie, ein paar leere Dosen oder Brotstücke auf, die im See trieben und ans Ufer klatschten.
„Können wir das Brot, das die Leute ins Wasser werfen, nicht einfach den Fischen überlassen?“
„Auf gar keinen Fall. Das wird alles eingesammelt, sonst haben wir bald keine Karpfen mehr im See, sondern Wale“, hatte Parkdirektor Manuel Perales gesagt.
Und so nahm er jetzt das Netz von seinem Wägelchen und machte sich daran, die dicken Brotbrocken aus dem Wasser zu fischen, die Eltern regelmäßig den gierig schnappenden Mäulern zuwarfen, um ihren Kindern eine Freude zu machen.
„Da schwimmt eine ganze Bäckerei“, dachte er laut, während er im Kopf den Preis dieses Nahrungsmittels überschlug, das weder er noch seine Mitbewohner jemals vergeudet hätten.
Dieses Mal war es wirklich extrem. Am Seeufer trieben Dutzende von Brotkrumen, unbeachtet von den Karpfen.
„Anscheinend sind die Fische schon so verwöhnt, dass sie es verschmähen“, redete er weiter mit sich selbst.
Er war so in seine Gedanken versunken, dass er erst nach einer Weile merkte, dass etwas anders war als sonst: Die hungrigen Fische drängten sich heute nicht um das Brot, das in einer Brühe oder einer Tomatensuppe besser aufgehoben gewesen wäre, sondern um irgendetwas am Grund des Sees. Neugierig sah Winston Enrique zu der Stelle hinüber, wo das Wasser geräuschvoll brodelte wie ein Zaubertrank. Was er dort sah, ließ ihn erschauern.
„Virgen del Cisne, steh mir bei!“
Ein ganzer Schwarm Karpfen drängte sich um eine reglose, unförmige Masse, die ein paar Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser trieb. Der Putzmann streckte das Netz so weit aus, wie er konnte, um die Tiere zu verscheuchen. Aus dem See ragte ein menschliches Bein, als versuche es, sich langsam und mühselig an die Oberfläche und ins Leben zurückzustrampeln.
Schon drängten sich wieder die Fische darum.
Er musste Hilfe holen.
Als Comisaria Ruiz und ihr Kollege Esteban Vázquez im Park Juan Carlos I ankamen, war dort schon die Hölle los. Die Parkwächter hatten absurderweise angenommen, ein Körper, der wahrscheinlich schon seit Stunden im Wasser trieb, könnte noch leben. Ihr Versuch, ihn herauszuziehen, hatte den Tatort, der ihnen bei genauerer Betrachtung einiges hätte erzählen können, verstummen lassen. Fünf Rettungswagen standen nutzlos um den Teich herum, während der Parkdirektor, in knappem Freizeithemd und Mexx-Hose, sich offensichtlich zu einer Erklärung veranlasst sah, warum er unrasiert war und nach Whisky und Zigaretten roch.
„Entschuldigen Sie bitte, ich wurde von einer Feier weggerufen.“
María streifte sich die Handschuhe über und beugte sich über den Toten, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Sie war in Jeans, einem engen weißen T-Shirt und flachen Sandalen aus dem Haus gegangen, aber sie wusste, dass sie auch in der unauffälligsten Kleidung immer die Blicke der Männer auf sich zog. Es überraschte sie, eine weibliche Comisaria vor sich zu sehen, und eine äußerst attraktive noch dazu. Verächtlich ignorierte sie den Blick des Parkdirektors, der vom unterbrochenen Rausch noch vernebelt war.
Die Parkwächter hatten den leblosen Körper auf das feuchte Gras gebettet und eine alte, ausgeblichene, karierte Tischdecke über ihn gebreitet, die irgendjemand im Park vergessen hatte. Die Decke war zu klein, und deshalb quer über der Leiche drapiert worden, um sie möglichst vollständig zu verdecken. Dennoch lugten unter den straff gezogenen Ecken an einem Ende große Füße in Sneakersocken und am anderen das kurze Haar, die Stirn, Schläfen und Wangen eines jungen, hochgewachsenen Mannes hervor. María sah auf die Uhr. Neun Uhr dreiundzwanzig an einem Samstagmorgen. Ihre Erfahrung mit Leichen schützte sie nicht vor dem Anflug von Traurigkeit, den der Anblick eines reglosen Körpers auslöste, der durch eigenen oder fremden Willen gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde. Vor allem wenn es sich, wie in diesem Fall, um ein junges Leben handelte. Sie wechselte einen raschen Blick mit Esteban und für einen kurzen Moment teilten beide unausgesprochen die gleiche Müdigkeit, die auf der Schwelle zwischen Alltagsleben und dem unvermeidlichen Abgrund eines schrecklichen neuen Falles wartete. Niemand wusste, wie lange er sie in Atem halten, wie viel Kraft er sie kosten und wie er ausgehen würde. Ein flüchtiger Moment der Trägheit, die Sekunden später von der Aufmerksamkeit für den Fall und schließlich von völliger Besessenheit verdrängt wurde. Trotzdem warf María in Gedanken einen letzten bedauernden Blick auf den gescheiterten Plan vom Besuch bei ihrer Mutter mit Paella und Fußball. Symbole einer Normalität, der sie, wie so oft in letzter Zeit, eine Absage erteilen musste.
Als sie die Decke vom Gesicht des Toten zog, folgte das in diesen Fällen übliche Phänomen. Alle Umstehenden traten näher, schlossen den Kreis und hoben gleichzeitig die Hände, um Nase und Mund zu bedecken. Die Leiche musste schon ein paar Stunden tot sein. Es war tatsächlich ein junger Mann. Er hatte kurz geschorenes Haar, sein Gesicht war aufgedunsen, die Haut vom Wasser ausgebleicht. Wieder wichen die Umstehenden gleichzeitig instinktiv einen Schritt zurück, wandten entsetzt die Gesichter ab und sahen einander erschrocken an. Inzwischen hatte María die Decke vollständig weggezogen, und so bot sich den Zuschauern, die den Atem anhielten, der Anblick einer unförmigen Masse aus zerfetzten Muskeln, Sehnen und Nerven. Die Fische hatten Teile der Wangen, der Lippen und des Halses weggefressen. Die vom Nike-Trägershirt unbedeckten Arme und Schultern wiesen zahlreiche Bisswunden auf, während Brustkorb und Bauch weitgehend verschont geblieben waren. Auch die Hüften und Oberschenkel waren dank der kurzen Jeans unversehrt.
Die Karpfen hatten ein wahres Festmahl gehabt.
Es war noch nicht zehn, als Teresa die Augen öffnete, sich reckte und auf dem Nachttisch nach ihrem Handy tastete. Verschlafen wie sie war, misslang der erste Versuch, es mit Stern- und Pfeiltaste zu entsperren, und das Handy rutschte ihr aus der Hand und fiel in die Ritze zwischen Bett und Nachttisch. Mist. Sie setzte sich hin, stand wieder auf, rieb sich die Augen und beschloss, direkt ins Kinderzimmer zu gehen und nachzusehen, ob er da war. Sein Bett war unberührt, genauso ordentlich, wie sie es am Morgen zuvor gemacht hatte, das Laken glatt gestrichen, die Decke ausgebreitet und umgeschlagen, das Kopfkissen zwischen Decke und Wand millimetergenau ausgerichtet. Es war nicht zu übersehen, dass Samuel nicht zu Hause geschlafen hatte. Nur eine kleine Delle in der Decke, die ans Bett gelehnte E-Gitarre und ein paar herumliegende Zeitschriften verrieten, dass er nachmittags hier gesessen hatte, bevor er feiern gegangen war. Natürlich ohne zu lernen. Zwar war bis September noch viel Zeit, aber trotzdem …
Teresa riss das Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen, obwohl in dem Zimmer seit gestern niemand mehr gewesen war, der die Luft hätte verbrauchen können. Sie kehrte schlecht gelaunt ins Schlafzimmer zurück, räumte den Sessel voller Wäsche und das Bügelbrett zur Seite, um an den Nachttisch zu kommen. Sie schob ihn vom Bett weg, fischte endlich das Handy aus dieser verdammten Ritze heraus und rückte alles wieder an seinen Platz. Sie hatte schon lange vor, in eine größere Wohnung zu ziehen, schließlich konnte sie es sich leisten. Aber der bloße Gedanke an die Suche, an den Verkauf, vor allem aber an die Reaktion Samuels, der mitten in der rebellischsten Phase der Pubertät steckte und jede noch so kleine Entscheidung seiner Mutter infrage stellte, raubte ihr jede Energie. Also begnügte sie sich mit dieser Vierzigquadratmeterwohnung, wo alles nur funktionierte, solange jedes Puzzleteil an seinem Platz war.
Diesmal klappte es: Stern, Pfeil, und das Telefon war entsperrt. „Sie haben zwei Nachrichten.“ Sie sah nach der letzten, die üblicherweise die entscheidende Information enthielt, doch sie bestand nur aus einer sinnlosen Zeichenfolge: xrrmxxp1. Der Junge musste hoffnungslos betrunken gewesen sein. Sie öffnete die erste Nachricht: swird spt Mma mch dr kn Srgn. Kss.
Und das war’s. Nur zwei Vokale in einer Reihe dicht gedrängter Konsonanten, das war Nachricht genug für die eigene Mutter. swird spt Mma, mch dr kn Srgn. Kss. „Es wird spät, Mama, mach dir keine Sorgen. Kuss.“ Riet er ihr, sich keine Sorgen zu machen, oder war das eher ein Befehl? Oder die Anweisung, sich mit der unvermeidlichen Tatsache abzufinden? Sie spürte, wie Ärger sie durchflutete, zündete sich eine Zigarette an und ging zum Herd, um Kaffeewasser aufzusetzen. Während sie darauf wartete, dass es blubberte und der rettende Duft die Wohnung erfüllte, betrachtete sie sich im Garderobenspiegel. Ihr erst kürzlich geschnittenes und blondiertes Haar war verfilzt und sie würde Mühe haben, es so gelegt zu bekommen, wie die Friseurin. Am Bauch eroberten Rettungsringe das Terrain zurück, das sie ihnen mithilfe von Fitnessstudio und Fettabsaugung abgetrotzt hatte, aber im Großen und Ganzen sah sie nicht schlecht aus. Es hatte schon schlimmere Zeiten gegeben, in denen sie Größe 44, in den Jahren nach ihrer Scheidung sogar 46, gehabt hatte. Zeiten, in denen sie nichts anderes getan hatte, als sich mit Essen vollzustopfen, in der Wohnung herumzuhängen und Samuel zu bemuttern. Jetzt hatte sie die Nase voll; so sehr sie ihn auch liebte und sich um ihn sorgte, im Grunde genommen wollte sie nur noch, dass er endlich erwachsen und unabhängig wurde und studieren ging.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte er damit gedroht, zu seinem Vater zu ziehen, wenn sie ”ihm weiterhin ständig auf der Pelle hing und seine Privatsphäre verletzte“, wie der Junge es ausgedrückt hatte, als sie Haschisch in seinem Rucksack gefunden hatte. Damals hatte sie weinend klein beigegeben und ihn angefleht, zu bleiben, und die Streitereien hatten stets denselben absurden Ausgang genommen. Er, der mit fünfzehn in flagranti mit Drogen erwischt worden war, verzieh ihr schließlich großzügig und blieb bei ihr. Sie, die ihn auf frischer Tat ertappt hatte, bat ihn um Verzeihung dafür, dass sie in seinen Sachen gewühlt hatte, und war glücklich, dass er bei ihr blieb. Würde das heute wieder passieren, dachte sie, dann würde sie ganz andere Saiten aufziehen.
Während der erste Kaffee sie ein wenig für das holprige Erwachen entschädigte, sah Teresa wieder auf ihr Handy. Die erste Nachricht hatte er um ein Uhr zehn heute früh geschrieben, am Samstag, den 3. Juli. Und die Aneinanderreihung sinnloser Zeichen, die dadurch zustande gekommen sein musste, dass er versehentlich auf die Tasten des nicht gesperrten Handys gedrückt hatte, stammte von ein Uhr dreiundfünfzig. Jetzt erst bemerkte sie, dass zwischen der ersten und der letzten Nachricht acht verpasste Anrufe lagen. Wer weiß, wo der Dummkopf sein Handy hingelegt hatte. Man könnte meinen, er wäre darauf herumgetanzt.
Das Wichtigste war, den See leerzupumpen. Zur Beschleunigung nutzten sie die Pumpanlage der Polizei. Um die Karpfen, die von der ganzen Aufregung um sie herum ungerührt waren und sich wieder dem Brot zugewandt hatten, würde sich der beflissene Direktor Perales kümmern.
„Wir wollten ihn sowieso in den nächsten Tagen völlig entleeren. Wir beschleunigen das Ganze einfach und fangen gleich morgen damit an.“
„Wir haben schon angefangen“, berichtigte ihn María Ruiz und deutete auf den Weg, der zum See führte. „Die Kollegen von der Spezialeinheit sind bereits da. Und die Spurensicherung ist unterwegs.“
Eine vorläufige Untersuchung der Leiche brachte mehr Fragen als Antworten. Nachdem der erste Schreck überwunden und die unmittelbare Umgebung abgeriegelt war und sich die übrigen Beamten, die Parkangestellten und die Schaulustigen zerstreut hatten, konnten sich María und Esteban auf die Details konzentrieren. In den Taschen des Toten fanden sich weder Brieftasche noch Papiere. Man hatte ihnen schon kurz mitgeteilt, dass er mit dem Oberkörper am Grund des Sees festgehangen hatte und nur das linke Bein frei an der Oberfläche getrieben war. Das rechte hatte sich mühelos lösen lassen. Die beiden Parkwächter, die den Körper geborgen hatten, berichteten klatschnass, aber voller Stolz von ihrer Heldentat und beschrieben, wie viel Mühe es sie gekostet hatte, ihn von einer Art Fessel zu befreien, mit der er am Grund des Sees befestigt gewesen war. María und Esteban tauschten einen raschen Blick. Beide dachten dasselbe. Diese Idioten hatten vermutlich den Tatort ruiniert, aber man konnte schließlich zwei Zivilisten nicht für ihren Eifer tadeln. Wahrscheinlich hatten sie nur eine Gelegenheit gesehen, einmal zu glänzen bei ihrer zwanzigstündigen Schicht als unterbezahlte Parkwächter in schäbiger Uniform. Während ihres Berichts, den sie mit immer neuen Details ausschmückten, sahen sie Esteban und María unablässig an, vor allem aber Esteban, auf der Suche nach der Anerkennung durch einen männlichen Polizeibeamten. Beide hatten mit aller Kraft an der Leiche zerren müssen, um sie freizubekommen. Volltrottel.
Aber letztendlich musste das, was den Körper am Grund des Sees festgehalten hatte, ja immer noch da sein. Und auch wenn die Fische noch so gefräßig waren, war es äußerst unwahrscheinlich, dass sie die Beweismittel verschlungen hatten.
2
Er öffnete die Augen, Sekunden bevor der Wecker klingelte, wie er das jeden Samstag um sechs Uhr morgens tat. Das war seine wöchentliche Routine: Montags bis freitags stand er um fünf auf, samstags um sechs, und am Sonntag, dem Tag des Herrn, um sieben. Und ganz gleich, ob er die ganze Nacht hindurch wach gelegen hatte oder, so wie heute, erst im Morgengrauen eingeschlafen war, seine innere Uhr weckte ihn stets wenige Sekunden vor dem Schrillen des Weckers, der ihm jetzt schon zwanzig Jahre treue Dienste leistete. Und wie jeden Morgen musste er an seinen Vater denken, der ihm eines Jahres zu Weihnachten die kurze Notiz geschickt hatte: „Mein Geschenk an dich ist Pünktlichkeit. Frohe Weihnachten.“
Im kleinen Waschbecken seines Schlafzimmers wusch er sich Gesicht und Hände und betrachtete einen Augenblick lang sein Bild in dem fünfzehn mal zwanzig Zentimeter großen Spiegel, den man ihm zugestanden hatte. Er hatte tiefe Ringe unter den Augen und war blasser als gewöhnlich, aber er wirkte entschlossen, erfüllt von einer Energie, die ihn bislang noch nicht verlassen hatte. Während er sich musterte, atmete er tief durch. Du hast es geschafft, sagte er sich und zog leicht verwundert die Brauen hoch. Aber es gibt noch einiges zu erledigen.
Er setzte sich an den Schreibtisch unter dem schlichten Kruzifix, um die Bibelstelle für diesen Morgen zu lesen. Es fehlte nicht mehr viel, dann würde er zum zehnten Mal die Bibel durchgelesen haben, seit er diese Methode der jährlichen Lektüre mit drei täglichen Lesungen angefangen hatte. Vor dem Frühstück ein kurzer Text aus dem Alten Testament, vor dem Mittagessen eine Stelle aus dem Neuen Testament und vor dem Abendessen ein Psalm oder ein Abschnitt aus den Briefen. Weder notierte er Gedanken noch markierte er Verse, wie er es zu besseren Zeiten getan hatte. Er hakte lediglich das entsprechende Kästchen ab, um den Überblick zu behalten, und wandte sich der dringlichsten Aufgabe zu. Eigentlich sollte er sich auf seine Doktorarbeit konzentrieren, die nach vier Jahren Arbeit kurz vor dem Abschluss stand, doch auch die hatte zu warten. Er musste sofort verreisen. Es würde eine kurze Reise werden, es galt nur, die Verbindung rauszusuchen. Eine einfache Fahrt. Er schaltete den Computer ein und checkte seine Mails.
Zwei Spamnachrichten mit Viagrawerbung. Papierkorb.
Eine wenig ansprechende Einladung from Moscow with love: „Irina möchte dich kennenlernen, ich dich werden lieben und umsorgen.“ Papierkorb.
Zwei Newsletter der Bischofskonferenz. Papierkorb.
Und eine Überraschung.
Betreff: „Ihre Stellenbewerbung.“ Absender: „Colegio Nuestra Señora de los Penitentes, Uruguay.“ Sein Herz schlug schneller, als er die ersten Zeilen las: „Geliebter Bruder. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren Antrag positiv beschieden haben. Ihr Oberer wird Sie über alle Einzelheiten zu Ihrem Arbeitsbeginn im neuen Schuljahr informieren.“
Er las die Nachricht noch einmal. Es stand tatsächlich da: Er hatte eine Stelle in Uruguay. Jetzt raste sein Herz und seine Hände zitterten. War es wirklich möglich, dass jetzt alles ins Lot kam? Atemlos und angespannt studierte er den Fahrplan, dann sah er auf die Uhr: Die Zeit war knapp. Er machte sich fertig, verließ das Zimmer und blieb stehen. Eines hatte er vergessen. Die Schlüssel. Er ging zurück, holte sie aus der untersten Schreibtischschublade, und rannte die Treppe hinunter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, wie ein Blitz an der erstaunten Rezeptionistin vorbei ins Freie.
Wenn er rechtzeitig am Bahnhof sein wollte, musste er sich beeilen. Und vor allem musste er sich beruhigen, um das zu Ende zu bringen, was er begonnen hatte.
Anschließend würde er sich in aller Ruhe mit Uruguay beschäftigen können.
María rief ihre Mutter an, um ihr zu sagen, dass sie nicht kommen würde – ”aber Kind, sogar deine Großmutter ist da, und dein Bruder hat extra seinen Urlaub verschoben, nur um dabei zu sein“ – und musste feststellen, dass der Fall bereits sein erstes Opfer verlangte. Ja, es war der erste Geburtstag ihrer Mutter seit dem Tod ihres Vaters, und die ganze Familie hatte sich verabredet, um ihr Gesellschaft zu leisten. Doch für Selbstmitleid blieb keine Zeit, denn Vicente und Juan, die wegen ihres ähnlichen Auftretens vom Rest des Teams Hernández und Fernández genannt wurden, nach den Zwillings-Detektiven eines beliebten Comics, warteten schon auf sie. Sie kehrte zu dem abgesperrten Tatort zurück, um sie zu begrüßen. Beide würden mit der Autopsie beginnen, sobald der Untersuchungsrichter die Genehmigung zum Abtransport der Leiche erteilte, und ihnen würde nicht die kleinste Auffälligkeit an dem Toten entgehen.
Trotz seines kläglichen Zustands sah man, dass der Junge gut aufgewachsen, gesund und vermutlich auch einst hübsch gewesen war. Am Hals waren neben den Bissspuren der Fische ein paar hellrote Flecken zu erkennen. Der Junge hatte nichts bei sich, anhand dessen man ihn hätte identifizieren können. Keinen Anhänger, nichts in seinen Hosentaschen, nur ein kleines Lederarmband mit ein paar Knoten an einem Handgelenk und eine protzige Uhr am anderen. Das T-Shirt und die Nike-Hose verrieten, dass er aus einigermaßen wohlhabenden Verhältnissen stammte. Oder auch nicht, schließlich konnte sich jeder Junkie aus Orcasitas inzwischen Nikeprodukte leisten.
„Die Armbanduhr ist Schrott“, sagte Vicente alias Hernández.
„Könnt ihr schon irgendwas über ihn sagen?“, fragte María.
„Er ist … er war kräftig, sportlich, wohlgenährt. Keinerlei Hinweis auf Drogenmissbrauch, obwohl wir das noch näher untersuchen müssen“, fügte Juan alias Fernández hinzu.
„Und die Flecken am Hals? Worauf könnten die hinweisen? Sind das Würgemale?“
„Auch das wissen wir noch nicht“, sagte Juan.
„Könnte es Selbstmord oder ein Unfall gewesen sein?“, fragte Esteban.
„Spinnst du?“, riefen beide wie aus einem Munde.
„Natürlich wäre es durchaus möglich, dass eine Nixe ihn auf den Grund des Sees gelockt und dort gefesselt hat“, scherzte Juan.
„Wann werden wir Genaueres wissen?“, fragte María.
„In zwei Wochen haben wir sämtliche Ergebnisse“, erklärte Vicente, und María musste an sich halten, um ihre Ungeduld zu zügeln.
„Zwei … Wochen?“, brachte sie schließlich hervor.
„Einschließlich des toxikologischen Gutachtens“, sprang Juan seinem Kollegen gegen die unübersehbare Wut der Comisaria bei.
„Und ohne dieses Gutachten … könnten wir dann heute mit ersten Ergebnissen rechnen?“
María wog jedes Wort sorgfältig ab. Vicente und Juan waren die Pfadfinder unter den Forensikern, allzeit bereit, überall zur Stelle. Kein Feiertag, kein Urlaub, weder Weihnachten noch Ostern konnten sie von der Arbeit abhalten. Im Prinzip stand immer einer von ihnen zur Verfügung, aber letztendlich tauchten sie doch zu zweit auf. Trotz ihrer ständigen Bereitschaft überkam sie manchmal ein Anfall von Förmlichkeit und Bedächtigkeit, der einem den letzten Nerv rauben konnte. Es war, als gehörte die Leiche ihnen, wenn sie sie erst einmal in die Finger bekamen, als wäre nach ihrer seelenruhigen Untersuchung alles getan. Sie gingen die Sache sehr entspannt an, und deshalb musste man sie immer ein bisschen drängen. Aber nicht allzu sehr, sonst redeten sie sich auf Dienstwege und offizielle Fristen heraus, und man kam gar nicht an Vorabinformationen heran.
„Denkt dran: Morgen kann es …“
”… zu spät sein“, fielen ihr die beiden ins Wort. Sie kannten sie gut.
„Und es ist durchaus möglich, dass dieses Arschloch …“
”… wieder zuschlägt“, beendeten sie den Satz mit einem leichten Grinsen. María bedachte sie mit einem ernsten Blick. Natürlich waren sie als Forensiker einzig und allein dem Untersuchungsrichter Rechenschaft schuldig und ihr zu nichts verpflichtet, aber sie arbeiteten schon seit Jahren gut und gerne zusammen. Deshalb lenkte Vicente ein.
„Wir rufen dich heute Nachmittag an, Comisaria.“
„Ich danke euch, Doctores.“
Anfangs hatte sich María mit dem Korpsgeist unter den Polizisten schwergetan, mit den ständigen Beleidigungen, Witzen und den Schimpfwörtern, die offenbar nötig waren, um diese Supermachos zur Arbeit zu bewegen. Es brachte mehr zu sagen: „Hast du diese Arschlöcher aus Hortaleza angerufen, du Idiot, oder hast du dir das Koks reingezogen, das wir gestern beschlagnahmt haben, und bist jetzt high?“, als zu fragen „Hast du eigentlich schon mit unserem Informanten gesprochen?“ Sie schienen sich wohler zu fühlen, wenn man sie fragte: „Wirst du diesen Typen jetzt verdammt noch mal verhören oder willst du ihn bei Mondlicht im Kerzenschein ficken?“, als: „Wann wirst du ihn verhören?“
Aber mit ein wenig Gewohnheit hatte sie ein Gespür für den im Raum herrschenden Testosteronspiegel entwickelt und kam nun gut damit klar. War ihr Gegenüber ein kultivierter Mensch, konnte sie sich zum Erstaunen einiger Kollegen ganz normal mit ihm unterhalten. Aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Bei den klassischen Typen, sprich Raucher, Trinker, Zyniker und Frauenheld (oder Maulheld), griff sie auf Wortschatz B zurück: Arschloch, Scheißkerl und Konsorten. Und der ganze Trupp, Polizisten wie Ermittler, schien sich damit wohler zu fühlen. Es war wie mit den Kerlen aus dem Fitnessstudio, die stolz ihre Brustmuskeln und Waschbrettbäuche zur Schau stellen, obwohl sie heimlich Anabolika nehmen. Genauso waren ihre Obszönitäten: künstlich aufgeblasen.
Und deshalb würde sie jetzt alle rücksichtslos antreiben, nachdem sie ihrer Mutter zum zigsten Mal hatte sagen müssen, dass aus den Plänen für das Familientreffen nichts wurde. Besser, alle hier legten einen Zahn zu, damit ihr Opfer sich lohnte.
Die Karriere von María Ruiz – seit zwölf Jahren Polizistin, vor einem Jahr zur Comisaria ernannt – war alles andere als typisch verlaufen. Anders als ihre Kollegen hatte sie sich nicht von unten hochgearbeitet, sondern ihre Stelle nach drei Jahren als Polizeipsychologin angetreten. Sie war keineswegs nur für die Opfer zuständig gewesen, für die misshandelten Frauen und die Angehörigen von Ermordeten. Den größten Teil ihrer Erfahrungen, die intensivsten und brutalsten, hatte sie gemacht, indem sie ihre Kollegen beriet. Polizisten mit Alkoholproblemen, traumatisierte Beamte, die im Baskenland tätig gewesen waren, Kollegen, die zu lange mit Dealern, V-Männern oder Mafiosi zu tun gehabt hatten, um noch zu wissen, was richtig und was falsch war.
Dank ihrer ungewöhnlichen Laufbahn waren einige Kollegen ihr mit Argwohn begegnet, stets in Sorge, María könnte ihre alten Abgründe durchleuchten oder neue ausfindig machen. Aber inzwischen, zwölf Jahre nach ihrem Seitenwechsel, hatte sie ein gutes Verhältnis zu den meisten Kollegen, die ihr für die früher geleistete Hilfe dankbar waren. Sie wussten, dass ihre Geheimnisse gut aufgehoben waren und María nicht nur unter den Kollegen, sondern auch den Vorgesetzten gegenüber eisern schwieg. Schließlich hatte sie auch ihren eigenen persönlichen Keller voller Leichen – Themen, von denen alle wussten, dass man sie besser ruhen ließ.
Und hier und jetzt im Park wusste María, dass sie die Arbeit an diesem Fall dringend vorantreiben musste. Ein ungeklärter Mord an einem Jugendlichen in Madrid, und dann auch noch mitten im Juli, wenn die Hälfte der Belegschaft im Sommerurlaub war, wäre ein gefundenes Fressen für die Presse, die begierig auf eine Sensationsgeschichte lauerte, mit der man die unbeschäftigten Leser am Pool oder Strand unterhalten konnte. Was gab es Besseres als eine mysteriöse, blutige Fortsetzungsgeschichte, um die Leute im Sommerloch bei der Stange zu halten? Und wenn noch Sex dabei ist, umso besser, wie ihr alter Freund Luna gesagt hätte.
María hatte immer viel Spaß mit dem Journalisten, der für die Kriminalberichterstattung bei El Diario zuständig war. Wenn beide im Sommer Bereitschaftsdienst hatten, trafen sie sich oft, um einander von ihren momentanen Fällen zu erzählen.
„Hast du nicht was schön Saftiges für uns?“, fragte Luna regelmäßig.
„Ihr solltet doch vollauf mit dem Hochwasser in China beschäftigt sein. Ich habe gehört, dass es dort mehrere Tausend Tote gibt“, erwiderte sie.
„Ja, aber das sind keine Spanier.“
Früher oder später würde sie mit ihm reden müssen, vor Luna konnte man einen solchen Fall nicht lange geheim halten. Aber vorher wollte sie sichergehen, dass jeder Stein umgedreht wurde. Dabei war bisher nicht einmal der Untersuchungsrichter aufgetaucht.
„Esteban, ruf im Sekretariat der Staatsanwaltschaft an und sag, dass die Schmeißfliegen schneller hier waren als der Untersuchungsrichter. Und dann in der Polizeizentrale. Frag nach, ob jemand als vermisst gemeldet wurde.“
Sie sah sich um und beschloss, mit dem Parkdirektor anzufangen. Sie trat auf die Gruppe zu.
„Ich habe Ihrem Kollegen schon alles gesagt, was ich weiß, Señorita.“ Perales zeigte auf Martín.
Der junge Beamte, der seine Chefin uneingeschränkt bewunderte, grinste verstohlen und tat so, als machte er sich Notizen.
„Nun, dann erzählen Sie jetzt einfach alles noch mal mir, wenn es Ihnen nichts ausmacht“, fauchte María.
„Das ist Comisaria Ruiz, Señor Perales. Sie ist hier die Chefin“, erklärte Martín feixend und zeigte mit dem Daumen auf sie.
Die Kollegen, die die Szene beobachteten, senkten die Köpfe, um ihr Lachen zu verbergen. Sie kannten das schon, und es gelang María nicht immer, sich zu beherrschen. Viele Typen behandelten sie genau wie der Parkdirektor. Mit der Herablassung, die Männer in einer gewissen Machtposition Frauen gegenüber an den Tag legen. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass eine attraktive Mittdreißigerin wie sie, mit langen Beinen, einem beachtlichen Dekolleté, einer prächtigen schwarzen Mähne und durchtrainiertem Körper, die Ermittlungen leitete und dem ganzen Trupp uniformierter Beamter vorstand. Perales schwieg einen Moment lang betreten, bevor er sagte: „Natürlich, Señora Comisaria, mit Vergnügen.“ Sein Tonfall war mehr als beflissen, und obwohl er nach der durchfeierten Nacht verkatert wirkte, hatte er sich wieder völlig im Griff. Ihm war bewusst, dass sein Posten von den offiziellen Stellen abhing. In seinem Fall vom Bürgermeister, aber Comisario war Comisario. Oder Comisaria. Und er hatte einen verdammt schlechten ersten Eindruck gemacht. „Sagen Sie mir, womit ich Ihnen helfen kann.“
„Erzählen Sie mir etwas über die Öffnungszeiten, die Aktivitäten und die Sicherheitsvorkehrungen des Parks.“
„Der Park schließt im Sommer um ein Uhr nachts und öffnet am Wochenende um sieben Uhr morgens. Montags bis donnerstags dagegen …“
„Kommen Sie zur Sache, Perales. Es ist Samstagmorgen um zehn und wir haben hier einen Toten. Erzählen Sie mir etwas, das uns weiterhilft. Was hier in den letzten vierundzwanzig Stunden passiert ist. Wer diesen Park bewacht und wer ihn besucht.“
„Die Wachleute gehen nachts auf dem Gelände Streife, aber sie haben nichts Ungewöhnliches bemerkt.“
„Haben Sie sie schon danach gefragt?“
„Wenn etwas vorgefallen wäre, hätten sie es mir berichtet.“
„Den Mord haben sie auch nicht bemerkt, oder? Reden Sie keinen Schwachsinn.“
Nachdem María diese sinnlose Unterhaltung einmal in vernünftige Bahnen gelenkt hatte, bekam sie die Informationen, die sie brauchte. Der Park hatte um eins geschlossen und um sieben wieder geöffnet; zwischendurch waren sechs Wachmänner jeweils zu zweit auf Streife gewesen und hatten sich zwischendurch in einem etwa fünfhundert Meter vom Tatort entfernten Wachhäuschen aufgehalten. Die einzigen Kameras am Haupteingang sahen zwar so aus, als würden sie funktionieren, waren aber schon seit einiger Zeit ausgeschaltet. Nachmittags war im Park nicht viel los gewesen, aber wie an Freitagen im Sommer üblich, hatte er sich am frühen Abend gegen sieben oder acht allmählich mit Familien, Gruppen von Freunden, Joggern und Radfahrern gefüllt. Am Ende waren schätzungsweise an die zweitausend Menschen da gewesen. Am See hatten sich wie immer drei, vier Angler versammelt, denn das Angeln war das ganze Jahr über erlaubt, solange man die Fische wieder ins Wasser zurückwarf. Es waren immer dieselben, und dann waren da noch viele Kinder, die Fische mit Brot fütterten. Eigentlich gab es im Sommer auch öfter Konzerte oder Feuerwerk, aber dieses Jahr hatten aufgrund der Finanzkrise keine Veranstaltungen stattgefunden. Eine halbe Stunde vor Schließung des Parks machten die Wachmänner üblicherweise einen Rundgang, um die Letzten zum Aufbruch zu bewegen. Wegen der Größe des Geländes konnte es allerdings passieren, dass ein Betrunkener, ein Pärchen oder ein später Besucher vergessen wurde. Die Putzkolonne machte sich um sechs an die Arbeit. Kurz gesagt: Nichts, mit dem man etwas hätte anfangen können.
Blieb nur, die zu befragen, die immer da waren: die Wachleute, die Putzkolonne und die Angler.
„Findet heraus, wer sie sind, und bestellt sie so schnell wie möglich aufs Revier“, befahl María. Ihre Leute machten sich eilig Notizen, aber Esteban unterbrach sie: „Der Fahrer des Untersuchungsrichters steht am Haupteingang und fragt, wie er hierherkommt.“
Wunderbar. Wenigstens die Forensiker konnten sich an die Arbeit machen.
Alka-Seltzer. Das war das einzige Wort, das in Lunas Hirn stärker hämmerte als der Schmerz, der ihm noch den Schädel sprengen würde, wenn er nicht bald eine Sprudeltablette auftrieb. Alka-Seltzer. Er öffnete die Augen, ohne sich zu rühren. Letztendlich waren es die unbarmherzigen Sonnenstrahlen, die ihm von allen Seiten in die Augen stachen, an denen er erkannte, dass er auf der Terrasse seines Wohnzimmers sein musste. Wo sonst knallte die Sonne so erbarmungslos? Abends war diese Terrasse ein echtes Schmuckstück, mit dem er manchmal noch die eine oder andere Frau beeindrucken konnte, aber an Sommervormittagen verwandelte sie sich in ein tödliches Solarium, und jetzt mussten sich seine Augen erst allmählich an das grelle Licht gewöhnen, bevor er sie wiedererkannte. Mühsam richtete er sich auf und sah sich um. Er saß auf dem Boden. „Wie bin ich bloß hierhergekommen?“ Die stinkende Lache aus Erbrochenem auf dem Boden schien mit einem anklagenden Finger auf ihn zu weisen. Luna schloss die Augen wieder. In welchem Zustand bist du denn nach Hause gekommen, Alter? Seit Ewigkeiten hatte er sich nicht mehr so volllaufen lassen. Seit Jahrhunderten. Seit Jahrzehnten. Seit Jahren. Oder Monaten. Okay, vergiss es.
Alka-Seltzer. Wenn er doch nur eine Alka-Seltzer hätte. Luna tastete sein Haar, den Bart, den Oberkörper ab, aber da war nichts. Er stand auf und schaffte es, sein Wohnzimmer zu durchqueren und in sein fensterloses Bad zu wanken, wo er vor der Hausapotheke zu Boden plumpste. Was war bloß geschehen? Was hatte er getrunken, was hatte er getan? Wieder und wieder mit trübem Blick auf die abgelaufenen Medikamente zu starren, war sinnlos, also schleppte er die Hausapotheke in den um einiges helleren Flur und kippte sie aus. Döschen mit Aspirin, Paracetamol, Schlaftabletten, Fläschchen mit alten Antibiotika und Hustensaft rollten durch die Gegend. Wo waren verdammt noch mal die Alka-Seltzer? Da waren sie ja. Eine alte Schachtel mit nur noch einer Tablette darin, aber das machte nichts. Luna schloss seine Hand um sie, als handelte es sich um ein wertvolles Medaillon, das er aus einem Brand gerettet hatte. In der Küche versenkte er sie in einem randvoll gefüllten Glas und sah zu, wie sie sprudelte.
Wodka. Es konnte nur Wodka gewesen sein. Es gab keine andere Substanz, die ihn so schnell vom Zustand der Glückseligkeit in den der Bewusstlosigkeit versetzte. Ein wahrer Höllentrip. Wobei er dieser Substanz eigentlich für alle Zeiten abgeschworen hatte, mit einem jener heiligen Eide, die man nur bei ganz besonderen Anlässen bricht.
Daran erinnerte er sich genau. Warum also hatte er getrunken? Warum hatte er die Kontrolle verloren? Welchen besonderen Anlass hatte es gegeben? Warum war er mit seinen alten Kollegen losgezogen und war heute erledigt, völlig fertig? Und warum war seine Wohnung vollgekotzt und auf den Kopf gestellt, so wie sein ganzes Leben?
Er wusste, warum.
Teresa beschloss, dass es an der Zeit war, seine Exzellenz anzurufen – vorausgesetzt natürlich, er hatte sein Handy eingeschaltet – um zu erfahren, wo er steckte und wann er sich wohl freundlicherweise dazu bequemen würde, nach Hause zu seiner Mutter und seinen Lernmaterialien zurückzukehren. Kurzzeitig überlegte sie, eine Paella zu machen wie in den ersten glücklichen Jahren ihrer Mutterschaft. Das Bedürfnis überkam sie aus alter Gewohnheit sonntags regelmäßig, aber heute verursachte es ihr einen leisen Stich in der Seele. Sollte sie kochen oder nicht? Und wenn ja, für einen, für zwei oder für alle seine Kumpels? Schon mehr als einmal hatte Samuel sonntags fünf oder sechs lärmende Teenager angeschleppt, und sie hatte gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Mit der Notration Schinken, die sie immer im Kühlschrank hatte, hatte sie eine Tortilla gezaubert und die letzten Dosen Limo geopfert, nur um dann, nachdem die Jungs aufgegessen, zum Abschluss laut gerülpst hatten und abgezogen waren wie eine Horde Plünderer, wieder allein zurückzubleiben.
„Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.“
Sollte sie für eine ganze Horde kochen oder lieber Belén anrufen, ihre Freundin in Getafe, die einen Pool besaß und sie schon hundert Mal eingeladen hatte? Sie würde etwas zu essen machen, ein oder zwei panierte Schnitzel, aber nur, um sie mit nach Getafe zu nehmen. Schließlich war es das, was „Mma mch dr kn Srgn“ letztendlich bedeutete. Sie würde jetzt endlich genau das tun. Sicherheitshalber versuchte sie noch einmal, anzurufen. Dieselbe Nachricht.
„Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.“
Also rief sie, ohne es sich noch einmal anders zu überlegen, ihre Freundin an.
Am späten Vormittag war María unterwegs zu ihrem Büro im Kommissariat. Sie musste allein sein, um in Ruhe nachdenken zu können. Auf der Büroetage angelangt, kramte sie ein paar Münzen aus der Hosentasche und hielt vor dem Kaffeeautomaten an. Alles wie immer. Sie warf fünfundvierzig Cent ein, die Maschine spie die Fünf-Cent-Münze zwei oder drei Mal wieder aus, doch María blieb hartnäckig, bis das Gerät die Münze schließlich schluckte. Sie drückte auf den Knopf ”ohne Zucker“ und wählte wie immer einen Milchkaffee. Während sie zerstreut mit dem Stäbchen den Kaffee umrührte, ging sie in ihr Büro und schloss die Tür.
Nachdenken. Nachdenken. In einem Madrider Park, die Leiche eines jungen Mannes, vielleicht eines Minderjährigen, offenbar ermordet. Die zuständige Spezialeinheit hatte mit der Trockenlegung des Sees begonnen. Das Drainagesystem des Parks war mit einer Reihe von Schiebern ausgestattet, die es ermöglichten, den gesamten See mithilfe der eigenen Pumpen und denen der Polizei innerhalb von zehn bis fünfzehn Stunden trockenzulegen. Das hatte man ihr bestätigt. Ab acht Uhr würde es die ersten Neuigkeiten geben (vielleicht mitten in ein Tor von Villa hinein, dem erfolgversprechendsten Spieler der heutigen Partie?, fragte sie sich selbstquälerisch). Ansonsten blieb ihr nichts weiter zu tun.
Sie benötigte mehr Daten. Zeugen. Ihre Kollegen waren schon dabei, Listen der anwesenden Parkwächter und Reinigungskräfte zusammenzustellen, um so bald wie möglich mit der Befragung anzufangen. Und über den Anglerverein ließ sich vielleicht herausfinden, wer am Vortag dort gewesen war, denn alle Hobbyangler brauchten eine Genehmigung. Morgen, spätestens Montag, würden sie sie befragen können.
Die Autopsie. Hernández und Fernández standen bestimmt schon mit Maske und Skalpell bewaffnet im Institut für Rechtsmedizin, die grelle Lampe auf den Tisch in der Mitte gerichtet. Von ihnen konnte sie ab fünf mit den ersten Neuigkeiten rechnen.
Was noch? Nachdenken, während sie den Kaffee umrührte und nach dem ersten Schluck das Gesicht verzog. Wie bist du bloß auf die Idee gekommen, bei der Hitze dieses Gesöff zu trinken?, fragte sie sich. Im Bürotrakt des Kommissariats war am Wochenende die Klimaanlage ausgeschaltet, und die Sonnenhitze hing im ganzen Gebäude. Ihr Handy klingelte. Es war Esteban.
„Neuigkeiten?“
„Bist du bereit?“
„Nun pack schon aus, verdammt.“ Normalerweise redete sie nicht so mit Esteban, aber manchmal verlor sie die Geduld.
„Seit Freitag sind drei Vermisstenmeldungen eingegangen.“
„Und zwar?“
„Ein fünfzehnjähriges Mädchen aus einem Dorf in der Provinz Orense.“
„Komm zur Sache, Esteban.“
„Ein Mann, der am Donnerstag sein Haus in Las Rozas verlassen hat und seitdem nicht mehr gesehen wurde.“
„Wie alt?“
„Dreiundsiebzig.“
„Und der dritte ist ein Alzheimerpatient?“
„Nein.“ Esteban kostete den Moment aus, er konnte es sich erlauben. „Ein Siebzehnjähriger aus Santander. Sportlich, gut aussehend. Am Donnerstag hat er sich zu Hause verabschiedet, um mit Freunden feiern zu gehen, aber von denen hat ihn keiner gesehen. Keine Freundin, keine Auffälligkeiten, heißt es. Und er ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ich habe ein Foto von ihm gesehen. Er könnte es sein.“
María zielte mit dem leeren Becher auf den Papierkorb in der Ecke und traf. „Bingo.“
Nach einem Augenblick der Stille fragte Esteban erstaunt: „Glaubst du, der Fall ist damit gelöst?“
„Nein, nein, das war nur eine dumme Bemerkung von mir.“
Zum ersten Mal an diesem Morgen lächelte María, voller Freude über den perfekten Bogen des Bechers, bevor er in ihrem persönlichen Basketballkorb landete, den sie bis heute immer verfehlt hatte. Schon vor einer ganzen Weile hatte sie die imaginäre Schwelle zwischen ihrem Leben als Zivilistin und dem als einer ermittelnden Polizistin überschritten, und von jetzt an würde sie jeden einzelnen Korb treffen. „Wir sehen uns später, Esteban. Ich muss vorher noch einen Anruf erledigen.“
Sie legte auf. Es gab immer gute Gründe für ein Gespräch mit ihrem alten Freund und Lehrmeister Carlos, aber diesmal war der Grund besonders dringlich. Sie rief ihn an.
Es stimmte: Alejandro Sánchez Gandarillas – Álex – war ein sportlicher, gut aussehender Siebzehnjähriger und ohne feste Freundin. Insofern entsprach die Beschreibung in der Vermisstenanzeige der Realität. Allerdings wäre es falsch gewesen, daraus zu schließen, dass er keine Beziehung hatte.
„Na ja, du musst verstehen, seine Familie hat uns nicht erzählt, dass … Das gehört nicht zu den Dingen, die man in eine Vermisstenanzeige aufnimmt. Aber es gibt da etwas Wichtiges, was ich dir erzählen muss“, hatte Carlos María berichtet.
Carlos Fuentes war ein alter Comisario, dem es nach jahrelangen erfolglosen Anträgen endlich gelungen war, sich nach Santander versetzen zu lassen. Ein Herzinfarkt hatte dabei eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt. „Auf ein geruhsames Leben! Jetzt kannst du eine ruhige Kugel schieben!“, hatten seine Kollegen bei der Abschiedsfeier gescherzt. Adieu Madrid mit seinen Obdachlosen, der ständigen Furcht vor Terroristen, den Auseinandersetzungen mit der Drogenmafia, den Migranten, den Prostitutionsringen. Das alles gab es in Kantabrien auch, aber in geringerem Maße und vor allem ohne politischen Druck auf die Polizeiarbeit. Nur in Madrid gab es Minister, die sich genötigt sahen, Erfolge zu präsentieren. Nur in Madrid gab es einen Polizeidirektor, der bessere Statistiken sehen wollte. Nur in Madrid gab es Zeitungen, die jeden Fehler aufdeckten. Deshalb hatte ein Comisario in Kantabrien zwar auch genug zu tun, aber bedeutend weniger Gründe, sich aufzuregen. Und so hatte Carlos sich sehr über Marías Anruf gefreut. Vor Jahren hatte er die junge Kollegin in den Beruf eingeführt, auch wenn er anfangs nicht die geringste Lust dazu gehabt hatte. Doch schon bald hatte sie sich als wissbegierige Schülerin mit einer ungewöhnlich schnellen Auffassungsgabe profiliert.
Er erinnerte sich noch genau an ihre erste Begegnung. Sie hatten um Verstärkung für ihre Einheit gebeten, sein Chef hatte gesagt ”wird erledigt“, und jemand hatte zaghaft an seine Bürotür geklopft. Eine Frau hatte davorgestanden, die durchaus hätte attraktiv sein können, wenn sie nur gewollt hätte (wie er dachte), aber wortkarg und unentschlossen wirkte.
„Warum willst du nicht mehr als Psychologin arbeiten?“, hatte er gefragt, während er in der Akte blätterte, die sie ihm vorgelegt hatte.
„Weil man da zu viel am Schreibtisch sitzt“, hatte sie zu seiner Überraschung geantwortet. Sie war klein und zierlich und sah ein wenig eingeschüchtert aus, aber ihre Antwort kam unerschrocken und wie aus der Pistole geschossen.
„Und du glaubst, dass du die Verbrecher mit der Waffe in der Hand besser analysieren kannst?“
Sie schwieg, schien nicht zu wissen, was sie sagen sollte, hielt aber seinem Blick stand.
„Oder willst du lieber die Kollegen analysieren?“
Sie sagte immer noch nichts, sah ihn nur unablässig an. Sie war doch hübsch, entschied er, auch wenn sie sich dessen anscheinend nicht bewusst war. Sie erweckte den Eindruck, als wäre sie zu wütend oder zu sehr auf das Wesentliche konzentriert, um sich mit Unwesentlichem aufzuhalten. Schade, sagte seine Machoseele. Aus der könnte etwas werden, sagte der pflichtbewusste Polizist in ihm. Man merkte, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen war.
„Warum bist du Polizistin geworden?“
„Genau deshalb. Um was zu tun.“
Und das war es gewesen. Keine weiteren Erklärungen. Sie musste damals siebenundzwanzig oder achtundzwanzig gewesen sein. Es hatte lange gedauert, bis sie ihm ihre wahren Gründe verriet, viel länger, als sie gebraucht hatte, um alles von ihm zu lernen.
Und wie das Leben so spielte, war er heute derjenige gewesen, der ihr gegenüber Rechenschaft ablegte und ihr alles erzählte, was er über das mögliche Verschwinden von Alejandro Sánchez Gandarillas wusste, einem schlechten Schüler mit höchst problematischen Verbindungen.
Einhundertundzwei. Genau einhundertundzwei Entlassungen. Sie konnten es nennen, wie sie wollten: Vorruhestand, Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse, Anpassung an die neuen Zeiten, aber es waren und blieben einhundertundzwei gottverdammte Entlassungen. Sein Name hatte nicht auf der ersten Liste gestanden, der mit den fünfzig Journalisten, die definitiv gehen mussten. Aber auf der zweiten, der mit den Freiwilligen, wobei diese „Freiwilligen“ in ihren Entscheidungen in etwa so frei waren wie Zwangsarbeiter. Und genauso fühlte sich Luna heute, nachdem die chemische Wirkung der Alka-Seltzer die Wodkaströme in seinen Adern weitgehend neutralisiert hatte: wie ein Zwangsarbeiter.
„Luna, wir wollen nicht auf dich verzichten“, hatte der Personalchef gesagt. „Deshalb würden wir dir gerne einen Sondervertrag vorschlagen.“
Sondervertrag nannten sie es. Im Klartext: freier Mitarbeiter ohne festes Gehalt, bezahlt nach Text. Und das nach vierzig Jahren Treue, vierzig Jahren, in denen er immer wieder Angebote der Konkurrenz abgelehnt hatte, nur damit er jetzt seine Recherchen von zu Hause aus und ohne jede Garantie auf Veröffentlichung betreiben sollte wie ein Anfänger. Und seine Kollegen? Saßen fast alle auf der Straße oder zu Hause. El Diario wurde zu einer Zeitung ohne altgediente Journalisten, ohne Redaktion, ohne Seele.
„Ihr müsst das verstehen, Luna. Wir sind am Ende.“
Und genau deshalb, weil sie es nicht verstehen konnten, waren sie alle gemeinsam einen trinken gegangen, hatten ein Glas nach dem anderen aufgesaugt wie ein trockener Schwamm.
Bevor María in den Park zurückkehrte, musste sie noch etwas anderes erledigen. Sie fuhr den Rechner hoch, um die Nachrichten zu überfliegen und sicherzugehen, dass noch nichts durchgesickert war. Mit der Fernbedienung schaltete sie den kleinen Fernseher in ihrem Büro ein. Ein einziges Thema beherrschte alle Sender: der Traum, zum ersten Mal die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Schaltungen nach Südafrika, Reportagen aus den Spielerunterkünften, Geschichten darüber, wie die Erfolge der La Roja die alten Vorbehalte gegen die spanische Flagge beerdigt hatten. Sie flatterte nun selbst im baskischen Baracaldo und im katalanischen El Vendrell, wo man mit spanischem Nationalstolz sonst nicht viel anfangen konnte. Und natürlich war da die Sache mit dem Kraken Paul. Es war María ein Rätsel, wieso namhafte Ozeanografen und Biologen auf die Geschichte hereinfielen und allen Ernstes behaupteten, dieser Kopffüßer besitze die Fähigkeit, den Champion vorherzusagen. Dabei ignorierten sie das Wahrscheinlichste, dass nämlich eine der mit Flaggen versehenen Muscheln ihm leckerer erschien als die andere. Nun ja, irgendwelchen Unsinn musste man ja erzählen, um die vielen Stunden Sendezeit zu füllen. Erst als sie zu Telemadrid zappte, bekam sie etwas anderes zu sehen. Es war die Reise des Papstes nach Malta, wo er sich mit Opfern von pädophilen Priestern ablichten ließ. Prima, dann sind wenigstens alle beschäftigt, dachte sie.
Nachdem sie das Internet durchstöbert hatte und zu einem ähnlich beruhigenden Ergebnis gekommen war, klickte sie bei ein paar der überregionalen Tageszeitungen die Rubrik „Madrid“ an. Überraschung. Bei einer Suche nach den entsprechenden Schlüsselwörtern bezogen sich die ersten acht Ergebnisse auf ein Verbrechen. Eine oder mehrere Vergewaltigungen im Jahr 2002. Das konnte interessant sein. Aber nichts über den heutigen Fall. Nachdem sie so die Medienfront geklärt hatte, begab sie sich zurück an den Tatort.