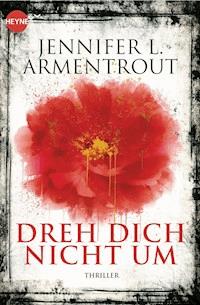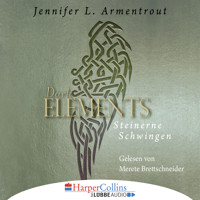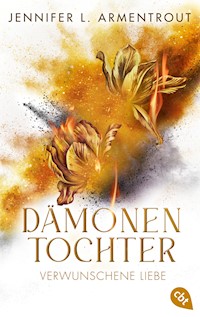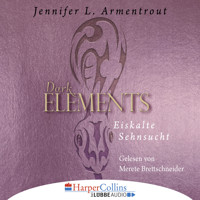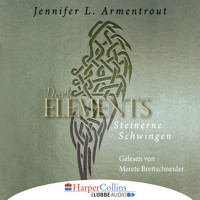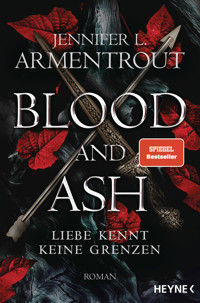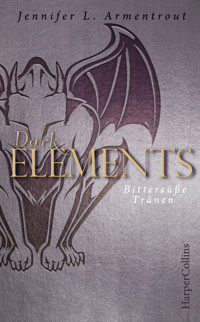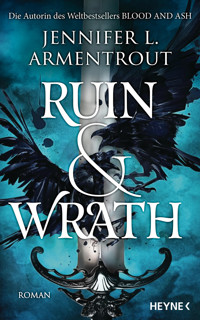
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ruin and Wrath-Reihe
- Sprache: Deutsch
Einst wurde die Welt von den Göttern vernichtet. Nur neun Städte wurden verschont. Durch gewaltige Urwälder, in denen die gefährlichsten Kreaturen ihr Unwesen treiben, voneinander getrennt, werden die Städte von Königen regiert, die sich an den Gefühlen der Sterblichen nähren. Dies ist die Welt der schönen Calista, deren magische Gabe der Vorsehung sie zum Spielball der Mächtigen macht. Als eines Tages ein fremder Lord in die Stadt kommt, ist Calista sofort klar, dass er ihr zum Verhängnis werden wird – in mehr als nur einer Weise …
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Die schöne Calista hat ein Geheimnis: Sobald sie eine Person berührt, kennt sie all ihre Gedanken, Gefühle und Geheimnisse – und in einer Welt, in der Wissen Macht bedeutet, wird sie so zu einer der begehrtesten Personen der ganzen Stadt. Um ein möglichst unauffälliges Leben führen zu können, versteckt sie sich als Kurtisane am Hof des Barons von Archwood.
Eines Tages rettet Lis einem fremden Lord namens Thorne das Leben. Ihre Gabe warnt sie, dass dieser Hochgeborene ihr Untergang sein wird, aber weil der Baron Genaueres über den Fremden erfahren will, lässt sich Lis auf eine leidenschaftliche Affäre mit ihm ein. Doch trotz ihrer Gabe gelingt es Lis nicht, Thorne zu durchschauen. Wer ist er wirklich? Und wo kommt er her?
Als in der Stadt eine Rebellion ausbricht, eine unaussprechliche Gefahr vor den Toren Archwoods auftaucht und ihr eigenes Begehren sie zu verzehren droht, begreift Calista, dass ihre magische Gabe dieses Mal wohl nicht ausreichen wird, um ihr Leben zu retten. Oder ihr Herz ...
Die Autorin
Jennifer L. Armentrout ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA. Immer wieder stürmt sie mit ihren Romanen – fantastische, realistische und romantische Geschichten für Erwachsene und Jugendliche – die Bestsellerlisten. Ihre Zeit verbringt sie mit Schreiben, Sport und Zombie-Filmen. In Deutschland hat sie sich mit ihrer Obsidian-Reihe und der Wicked- Saga eine riesige Fangemeinde erobert. Mit ihrer Blood and Ash-Reihe ist sie regelmäßig auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Hunden in West Virginia.
JENNIFER L.
ARMENTROUT
RUIN
&
WRATH
ROMAN
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Sonja Rebernik-Heidegger
Titel der amerikanischen Originalausgabe
FALLOFRUINANDWRATH
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2023 by Jennifer L. Armentrout
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Karte: Virginia Allyn
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München, unter Verwendung des Originalentwurfs von Hang Le
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31607-5V002
www.heyne.de
Für meine Leser*innen
Prolog
Eine unheimliche Stille senkte sich über den Schlafsaal des Findelhauses, und selbst das sanfte Schnarchen und die keuchenden Atemzüge der auf den Pritschen dösenden Kinder verstummten. Meine schmerzenden Finger umklammerten die kratzige, fadenscheinige Decke. Im Kloster der Barmherzigkeit waren die Betten wärmer gewesen, und ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt, auf dem Boden zu schlafen, über den die ganze Nacht Mäuse und Ratten huschten.
Heute Nacht allerdings waren keine dünnen, flinken Schwänze zu sehen, und ich hörte auch kein Getrappel auf dem Steinboden. Das war zwar erst mal gut, aber es kam mir trotzdem nicht richtig vor. Weder der Boden, auf dem ich schlief, noch die Luft, die ich atmete.
Ich war mit einer Gänsehaut am ganzen Körper und einem schlechten Gefühl im Bauch aufgewacht. Die Priorin hatte mir beigebracht, meinem Instinkt, meiner Intuition – dem Zweiten Gesicht – zu vertrauen. Die Götter hatten mir diese Gabe zum Geschenk gemacht, weil ich aus den Sternen geboren war.
Ich hatte zwar nie verstanden, was das bedeutete, aber jetzt gerade sagte mir mein Instinkt, dass etwas ganz und gar nicht stimmte.
Mein Blick glitt über die feuchten, von Gaslampen erhellten Steinwände und suchte nach dem Grund, warum sich mein Bauch anfühlte, als hätte ich verdorbenes Fleisch gegessen. Das Licht an der Tür flackerte und erlosch. Die Lampe am Fenster folgte, und so ging es in der ganzen Kammer weiter, bis auch die letzte Lampe ausgegangen war.
Ich hatte allerdings niemanden gesehen, der sie ausgemacht hätte. So etwas wagte hier keiner, denn er hätte damit sofort den Zorn des Findelherrn auf sich gezogen.
Mein Blick huschte zum Kamin. Die Kohlen, die es kaum schafften, die Kammer zu wärmen, brannten noch, aber das Feuer … es machte kein Geräusch. Da waren kein Knistern und auch kein Zischen.
Die feinen Haare in meinem Nacken richteten sich auf, als mich ein Schaudern durchfuhr und über meinen Rücken nach unten wanderte.
Die Decke neben mir bewegte sich, und ein Schopf verstrubbelter brauner Locken schaute hervor. Grady sah mich verschlafen blinzelnd an. »Was’n los, Lis?«, murmelte er, und seine Stimme brach irgendwo in der Mitte. Das passierte in letzter Zeit öfter – seit er zu wachsen begonnen hatte wie das Unkraut hinter dem Findelhaus.
»Lis?« Grady richtete sich ein Stück weit auf und zog die Decke zum Kinn hoch, als langsam auch die Flammen im Kamin erstarben.
»Hatte der Herr es schon wieder auf dich abgesehen?«
Ich schüttelte eilig den Kopf. Ich hatte den Findelherrn nicht gesehen, nur die Blutergüsse auf meinen Armen zeugten von den Nächten, in denen ich seinen bösartigen, kneifenden Fingern nicht entkommen war.
Grady rieb sich stirnrunzelnd den Schlaf aus den Augen. »Hast du schlecht geträumt?«
»Nein«, flüsterte ich. »Mit der Luft stimmt etwas nicht.«
»Mit der Luft …?«
»Geister vielleicht?«
Er schnaubte. »Es gibt keine Geister.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil ich …« Grady verstummte, als auch die letzten Flammen im Kamin erloschen. Nun wurde der Raum nur noch von dem schwachen Mondlicht erhellt, das durchs Fenster fiel. Langsam drehte er den Kopf und sah sich um, als ihm klar wurde, dass keine einzige Lampe mehr brannte. Sein Blick huschte zu mir, die Augen waren geweitet. »Sie sind da.«
Mein ganzer Körper zuckte, als eisiges Entsetzen von mir Besitz ergriff. Sie sind da konnte nur eines bedeuten.
Die Hochgeborenen.
Sie waren die Nachkommen der Götter und sahen aus wie wir – na ja, zumindest zum Großteil –, aber sie waren nicht wie wir. Die Herrscher über das Königreich Caelum waren alles andere als sterblich.
Und sie hatten keinen Grund, hier zu sein.
Es standen keine Feierlichkeiten bevor, zu denen sich die Hochgeborenen offen unter uns Niedriggeborene mischten, und wir befanden uns hier im ärmsten Viertel der Stadt. Hier gab es nichts Schönes und nichts Wertvolles, weder Dinge noch Leute. Hier gab es keine Freude, an der sie sich nähren hätten können.
»Warum sind sie gekommen?«, flüsterte ich.
Gradys Hand schloss sich um meinen Arm, und ich spürte seine kalten Finger durch den Stoff meines Pullovers. »Ich habe keine Ahnung, Lis.«
»Werden sie uns etwas tun?«
»Dazu gibt es keinen Grund. Wir haben nichts falsch gemacht.« Er zog mich mit sich, sodass wir nebeneinander auf seinem flachen Kissen lagen. »Mach einfach die Augen zu und tu, als würdest du schlafen. Dann lassen sie uns in Ruhe.«
Ich folgte Gradys Anweisung, wie ich es schon seit dem Tag tat, an dem er endlich aufgehört hatte, mich zu verscheuchen, doch ich konnte nicht schweigen. Die Angst stieg unaufhaltsam in mir hoch und mit ihr die schlimmsten Befürchtungen. »Was, wenn sie … meinetwegen hier sind?«
Er legte die Wange auf meinen Scheitel. »Warum sollten sie?«
Meine Lippen zitterten. »Weil ich … nicht wie du bin.«
»Darüber musst du dir keine Gedanken machen«, versicherte er mir so leise, dass niemand sonst ihn hören konnte. »Das wird sie nicht interessieren.«
Aber wie konnte er sich da so sicher sein? Andere Leute interessierten sich doch auch dafür. Ich machte sie nervös, weil ich mich nicht zurückhalten konnte und laut aussprach, was ich gesehen hatte. Einzelheiten zu einem Ereignis, das noch gar nicht passiert war, oder einer Entscheidung, die noch getroffen werden musste. Grady war daran gewöhnt. Von anderen konnte man das nicht behaupten. Sie beäugten mich, als würde etwas mit mir nicht stimmen, und der Findelherr starrte mich manchmal an, als wäre ich eine Hexe. Als hätte er Angst vor mir. Nicht genug, um mich nicht mehr zu drangsalieren, aber genug, um nicht damit aufzuhören.
»Vielleicht spüren die Hochgeborenen, dass etwas an mir anders ist«, flüsterte ich mit rauer Stimme. »Und vielleicht gefällt ihnen das nicht. Oder sie denken, ich bin …«
»Sie werden nichts spüren, versprochen.« Grady zog die Decke über uns, als könnte sie uns vor allem Unheil bewahren.
Dabei würde eine Decke rein gar nichts gegen die Hochgeborenen ausrichten. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten. Mit wem auch immer sie wollten. Und wenn sie wütend wurden, brachten sie ganze Städte zum Einsturz.
»Ruhig«, ermahnte Grady mich eindringlich. »Nicht weinen. Mach einfach die Augen zu, dann wird alles gut.«
Die Tür in die Kammer öffnete sich knarrend. Grady drückte meinen Arm, und die Wände ächzten, als könnten sie den Umfang dessen, was gerade ins Zimmer geschlüpft war, nicht in sich aufnehmen. Ein Zittern durchfuhr mich. Mir war so übel wie damals, als die Priorin zum letzten Mal meine Hand genommen hatte. Sie hatte es davor oft und ohne Scheu davor getan, was ich womöglich sehen oder erfahren würde, aber an diesem Tag war es anders gewesen. Ich hatte den Tod gesehen, der auf sie wartete.
Ich atmete flach, trotzdem nahm ich den Duft wahr, der den Geruch nach abgestandenem Bier und zu vielen Körpern auf zu engem Raum verdrängte. Er roch nach Minze, beinahe wie … die Bonbons, die die Priorin immer in den Taschen ihres Habits dabeigehabt hatte. Nicht bewegen. Ganz ruhig, betete ich mir selbst vor. Nicht bewegen. Ganz ruhig.
»Wie viele sind es?«, fragte ein Mann mit leiser Stimme.
»Das ändert sich N-Nacht für N-Nacht, Lord Samriel«, antwortete der Findelherr mit zitternder Stimme. Ich hatte ihn noch nie so verängstigt gehört – normalerweise ängstigte er uns –, aber andererseits befand sich ein hochgeborener Lord in seinem Findelhaus. Lords gehörten zu den mächtigsten Hochgeborenen. So etwas ängstigte selbst den fiesesten Tyrannen. »Normalerweise s-sind es etwa dreißig, aber ich wüsste nicht, dass einer hier hat, wonach Ihr sucht.«
»Das werden wir selbst beurteilen«, erwiderte Lord Samriel. »Überprüft sie.«
Die Schritte der Rae, die den Hochgeborenen als berittene Diener zur Seite standen, hallten wie das Echo meines Herzschlags durch meinen Körper. Die Temperatur in der Kammer sank, und eine dünne Eisschicht schien sich über uns zu legen.
Die Rae waren einst niedriggeborene Krieger gewesen, doch sie waren im Kampf gegen die hochgeborenen Prinzen und Prinzessinnen gefallen, und nun waren sie nur noch leere Hüllen aus Fleisch und Knochen, deren Seelen von den Prinzen, den Prinzessinnen und König Euros gefangen gehalten wurden. Bedeutete ihre Anwesenheit etwa, dass jemand aus der königlichen Familie hier war? Ich erschauderte.
»Öffne deine Augen«, befahl Lord Samriel irgendjemandem im Schlafsaal.
Warum wollten sie unsere Augen sehen?
»Wer sind diese Kinder?«, fragte eine andere Stimme. Der Mann sprach leise, aber große Macht sickerte aus jedem seiner Worte.
»Waisen. Verstoßene, mein Lord«, krächzte der Herr. »Einige kommen aus dem Kloster der Barmherzigkeit. A-andere standen einfach vor der Tür. Ich habe keine Ahnung, woher sie kommen und wohin es sie am Ende verschlägt, wenn sie erst einmal verschwunden sind. Aber ich schwöre, dass kein Seraph hier ist.«
Sie … sie dachten, ein Seraph wäre hier?
Deshalb wollten sie also unsere Augen sehen! Sie suchten nach dem Zeichen – dem Leuchten in den Augen, von dem ich gehört hatte. Aber so etwas gab es hier nicht.
Zitternd lauschte ich dem überraschten Aufkeuchen und leisen Gewimmer der anderen und presste die Augen zusammen, während ich mir mit aller Kraft wünschte, dass sie uns in Ruhe lassen würden. Dass sie einfach verschwanden …
Die Luft über uns geriet in Bewegung, und der Duft nach Minze wurde stärker. Grady erstarrte.
»Augen auf«, befahl Lord Samriel von oben herab.
Ich lag regungslos da, während Grady sich halb aufrichtete und mich mit seinem Körper und der Decke abschirmte. Die Hand um meinen Arm zitterte, und das beunruhigte mich noch mehr, denn Grady … er trat den älteren Jungen furchtlos gegenüber und lachte bloß, wenn die Ordnungswächter ihn durch die Straßen jagten. Er hatte noch nie Angst gehabt.
Bis jetzt.
»Nichts«, verkündete Lord Samriel schwer seufzend. »Und das waren alle?«
Der Herr räusperte sich. »Ja, soweit ich das unter diesen Umständen sagen kann … nein, Moment.« Ich hörte seine schweren, humpelnden Schritte. »Der da hat immer ein kleineres Gör bei sich. Ein Mädchen und seltsam obendrein.« Er trat mit dem Fuß gegen meine unter der Decke versteckten Beine, und ich schluckte einen leisen Schrei hinunter. »Da.«
»Er redet wirres Zeug«, widersprach Grady. »Ich bin allein.«
»Pass auf, was du sagst, Junge!«, warnte der Herr.
Ich biss mir auf die Lippe, bis ich Blut schmeckte.
»Pass du mal lieber auf«, zischte Grady, und eine anders geartete Angst stieg in mir hoch. Der Herr hatte es nicht gern, wenn Grady zurückmaulte. Wenn wir das hier überstanden, würde er ihn bestrafen, und zwar ordentlich. Wie letztes Mal.
In diesem Moment wurde die Decke zurückgezogen, und mein Blut gefror zu Eis. Grady versuchte weiter, mich mit dem Körper abzuschirmen, aber es war zwecklos. Sie hatten mich gesehen.
»Da steckt tatsächlich noch jemand unter der Decke. Ein Mädchen.« Der namenlose Lord hielt inne. »Glaube ich zumindest.«
»Tritt zurück«, befahl Lord Samriel Grady.
»Das ist niemand«, presste dieser hervor, und ich spürte seinen zitternden Körper neben meinem.
»Jeder ist irgendjemand«, erwiderte der namenlose Lord.
Grady bewegte sich nicht. Es folgte ein tiefes, ungeduldiges Seufzen, dann war Grady … verschwunden.
Panik überkam mich, und ich fuhr hoch. Die Kammer wurde plötzlich in viel zu helles Licht getaucht. Ich schrie auf, als ich sah, dass einer der Rae Grady um die Mitte gepackt hatte. Dünne, graue Schatten waberten wie Tentakel aus seinem Mantel und umfingen Gradys Beine.
»Lass mich los!«, kreischte Grady und trat in alle Richtungen. »Wir haben doch nichts getan. Lass mich los!«
»Still«, zischte Lord Samriel und trat zwischen Grady und mich. Seine Haare waren lang und so hell, dass sie beinahe weiß wirkten. Er legte eine Hand auf Gradys Schulter.
Grady verstummte.
Seine warme braune Haut nahm eine graue Färbung an, die geweiteten Augen blickten ins Leere. Er sagte nichts und bewegte sich auch nicht.
»Grady«, hauchte ich und zitterte so sehr, dass meine Zähne klapperten.
Er antwortete nicht. Dabei antwortete er sonst immer. Aber es war, als wäre er gar nicht da. Als wäre da bloß eine Hülle, die aussah wie Grady.
Finger schlossen sich um mein Kinn, und eine Art elektrischer Schlag durchfuhr mich. Die Haare auf meinen Armen richteten sich auf, und meine Haut prickelte.
»Ist schon gut«, sagte der namenlose Lord, und seine Stimme klang sanft, beinahe liebevoll, als er meinen Kopf in seine Richtung drehte. »Ihm passiert nichts.«
»Das werden wir noch sehen«, erwiderte Lord Samriel.
Ich wollte zurückweichen, doch es gelang mir nicht. Der namenlose Lord ließ es nicht zu.
Ich starrte durch mein verfilztes, dunkles Haar zu ihm hoch. Er … er wirkte jünger, als ich gedacht hätte, als wäre er erst in der dritten Dekade seines Lebens. Sein Haar war goldbraun und reichte bis zu seinen von einem schwarzen Mantel umhüllten Schultern. Seine Wangen hatten die Farbe des Sandes in der Bucht der Fluchenden, sein Gesicht war eine interessante Mischung aus Ecken und Kanten, und seine Augen …
Sie waren leicht schräg gestellt, aber es war ihre Farbe, die mich gefangen nahm. Ich hatte noch nie so farbenfrohe Augen gesehen, die in Blau, Grün und Braun leuchteten.
Je länger ich ihn anstarrte, desto mehr erinnerte er mich an die verblassten Gestalten auf der gewölbten Decke des Klosters der Barmherzigkeit. Wie hatte die Priorin sie genannt? Engel. Die Hochgeborenen waren in ihren Augen die Beschützer der Sterblichen und der ganzen Welt. Aber das, was heute ins Findelheim gekommen war, hatte nichts mit Beschützern zu tun.
Es waren eher Jäger.
Abgesehen von dem einen mit den seltsamen Augen.
»Was ist mit ihr?«, fragte Lord Samriel in die Stille hinein.
Der junge hochgeborene Lord, der noch immer mein Kinn umfasst hielt, starrte mich schweigend an, und mit einem Mal wurde mir klar, dass ich aufgehört hatte zu zittern. Mein Herz klopfte ruhig.
Ich hatte keine Angst vor ihm.
Genauso wie damals, als ich Grady kennengelernt hatte. Aber das war gewesen, weil ich gespürt hatte, wie Grady wirklich war. Meine Intuition hatte mir gesagt, dass ich kaum einen besseren Freund finden würde. Ich starrte wortlos in die Augen des Lords und wusste, dass mir nichts geschehen würde. Auch nicht, als sich seine Pupillen weiteten und so hell leuchteten wie die Sterne. Bis ich nichts mehr sah außer ihnen. Mein Herz begann erneut zu pochen. Ich öffnete meine Sinne. Ich sah nichts in seinen Augen und auch nicht dahinter.
Aber ich fühlte etwas.
Eine Warnung.
Eine Abrechnung.
Ein Versprechen dessen, was kommen würde.
Der Lord wich zurück, seine Pupillen fanden zu ihrer normalen Größe zurück, und die weißen Flecken verschwanden.
»Nein«, sagte er, und sein Blick fiel auf meine Arme, die aus dem zu großen Pullover herausragten. »Sie ist sauber.«
Er ließ mein Kinn los.
Ich krabbelte rückwärts über die Decke und fort von ihm, dann drehte ich mich zu Grady herum. Er hing noch immer regungslos und mit leerem Blick in der Luft. »B-bitte«, hauchte ich.
»Lass ihn los«, befahl der namenlose Lord.
Lord Samriel seufzte, und im nächsten Moment kehrte das Leben in Gradys Körper zurück. Die Blässe verschwand, während ich auf ihn zu robbte und ihn in die Arme schloss. Ich hielt seinen zitternden Körper fest umschlungen, doch mein Blick wanderte zurück zu dem hochgeborenen Lord mit den Sternen in den Augen.
Er hockte noch immer vor der Decke und starrte mich an. Sein Blick ruhte auf meinen Armen, während Lord Samriel an ihm vorbei und zur Tür schritt. Meine Finger gruben sich in die Rückseite von Gradys dünnem Pullover.
»Deine Arme«, fragte er leise, und ich war mir nicht einmal sicher, ob sich seine Lippen bewegten. »Wie ist das passiert?«
Ich hatte keine Ahnung, warum er fragte und warum es ihn überhaupt kümmerte, aber ich wusste, dass ich auf keinen Fall sagen durfte, wer Schuld daran hatte. Ich blickte lediglich einen Moment lang in Richtung des Findelherrn und nickte unauffällig.
Der Lord beäugte mich noch einen Augenblick, dann legte er die Finger an die Lippen, die sich zu einem kaum merklichen Lächeln verzogen hatten, und erhob sich zu einer schier unmöglichen Größe.
Erneut senkte sich Dunkelheit über die Kammer, und die undurchdringliche Stille kehrte wieder, doch dieses Mal hatte ich keine Angst.
Ein spitzer, kurzer Schrei durchschnitt das Schwarz um mich und endete in einem feuchten Knirschen. Als etwas Schweres auf dem Boden landete, zuckte ich zusammen.
Dann war es erneut still, und im nächsten Moment wich die Schwere aus dem Zimmer, und die Luft selbst schien erleichtert aufzuatmen. Die Lampen an der Wand erwachten flackernd zum Leben. Das Feuer im Kamin sprühte zischend Funken.
Vor der Tür lag der Herr mit seltsam verdrehtem Körper in einer Pfütze aus Blut.
Jemand schrie. Pritschen knarrten, als immer mehr Leute sich erhoben, doch ich rührte mich nicht. Ich starrte zur Tür und war mir sicher, dass ich den hochgeborenen Lord irgendwann wiedersehen würde.
1
»Hast du einen Moment Zeit, Lis?«
Ich sah von den Kamillenblüten auf, die ich für Baron Huntingtons Tee zu Pulver mahlte, und mein Blick fiel auf Naomi, die in der Tür in meine Gemächer stand. Die brünette junge Frau hatte sich bereits für den Abend zurechtgemacht. Ihr hauchdünnes Kleid wäre vollkommen transparent gewesen, hätten nicht mehrere strategisch verteilte Streifen im tiefsten Himmelblau die verfänglichsten Stellen verdeckt.
Der Baron von Archwood führte im Vergleich zu den meisten Sterblichen ein einigermaßen unorthodoxes Leben, aber andererseits war Claude nicht nur ein Sterblicher. Er gehörte zu den Caelestianern und war somit ein Sterblicher, der einer selten vorkommenden Verbindung zwischen einem Niedriggeborenen und einem Hochgeborenen entsprang. Caelestianer wurden auf dieselbe Weise geboren wie wir Sterblichen, und sie alterten auch. Claude war mittlerweile sechsundzwanzig und hatte keinerlei Bedürfnis zu heiraten. Er bevorzugte es, seine Zuneigung großzügig zu verteilen. Er sammelte – wie die Hochgeborenen – alles, was schön und einzigartig war. Es wäre unklug gewesen, sich mit einer seiner Mätressen zu messen, aber gleich doppelt, sich mit Naomi zu vergleichen.
Die Frau mit den glänzenden Haaren und den zarten Gesichtszügen war schlichtweg atemberaubend schön.
Ich hingegen sah aus wie jemand, der Teile aus den Gesichtern anderer genommen und sie in sein eigenes Gesicht verpflanzt hatte. Mein kleiner Mund passte nicht zu den von Natur aus gespitzten Lippen, meine zu runden und zu großen Augen nahmen zu viel Platz ein und ließen mich wesentlich unschuldiger wirken, als ich tatsächlich war. Das war mir zwar während des Lebens auf der Straße mehr als einmal zugutegekommen, aber mittlerweile erinnerte ich mich selbst eher an diese gruseligen Puppen, die man in den Schaufenstern sieht. Außer, dass meine Haut nicht porzellanweiß war, sondern golden.
Der Baron hatte einmal gemeint, ich sei »interessant« anzusehen – auf sonderbare Weise »atemberaubend« –, aber selbst, wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich immer noch sein wichtigster Schatz gewesen, den er immer in seiner Nähe behalten wollte, und das hatte nichts mit meiner Attraktivität zu tun.
Meine Schultern verkrampften sich, dann nickte ich zögerlich. Ich biss mir auf die Unterlippe und sah zu, wie Naomi die Tür schloss und durch den Wohnbereich meiner Gemächer schritt. Meiner privaten Gemächer.
Bei den Göttern, ich war zweiundzwanzig und lebte mittlerweile seit sechs Jahren hier. Lange genug, um mich nicht mehr von der Erkenntnis aus der Bahn werfen zu lassen, dass ich meine eigenen, mit Elektrizität und Warmwasser ausgestatteten vier Wände hatte, was in unserem Königreich bei Weitem nicht selbstverständlich war. Ich hatte mein eigenes Bett – ein richtiges Bett, keinen Stapel dünner Decken oder eine von Flöhen heimgesuchte, mit Stroh gefüllte Matratze –, aber ich konnte es nach wie vor nicht begreifen.
Ich konzentrierte mich auf Naomi. Sie verhielt sich seltsam, verschränkte immer wieder die Hände und löste sie im nächsten Moment wieder. Sie war nervös, und so kannte ich sie gar nicht.
»Was gibt es denn?«, fragte ich, auch wenn ich glaubte, es zu wissen. Ich war mir sogar hundertprozentig sicher, dass ich wusste, was sie wollte und warum sie so nervös war.
»Ich … ich wollte mit dir über meine Schwester sprechen«, begann sie zögerlich, dabei zögerte Naomi sonst nie, egal, in welcher Situation. Es gab wenige, die so mutig und verwegen waren wie sie. »Laurelin geht es nicht gut.«
Meine Brust zog sich zusammen, und ich senkte den Blick auf die Schale mit dem gelblich-braunen Pulver in meinem Schoß. Genau das hatte ich befürchtet.
Naomis Schwester hatte einen reichen Grundbesitzer und damit weit über ihrem Stand geheiratet. Es war eine Hochzeit aus Liebe gewesen, was selten genug vorkam, und normalerweise hätte ich das Gesicht verzogen, aber in diesem Fall stimmte es tatsächlich. Laurelin war eine Seltenheit in einer Welt, in der Bequemlichkeit, Gelegenheit und Sicherheit die Hauptgründe für eine Hochzeit waren.
Aber welche Vorteile brachte die Liebe? Sie hatte Laurelins Mann jedenfalls nicht davon abgehalten, sich einen Sohn zu wünschen, obwohl die letzte Geburt Laurelin beinahe das Leben gekostet hätte. Also versuchten sie es weiter, und das Risiko war ihnen egal.
Inzwischen hatte er seinen Sohn, und Laurelin litt unter einem Fieber, das so viele Frauen nach der Geburt befiel.
»Ich wollte wissen, ob sie …« Naomi holte tief Luft und straffte die Schultern. »Ob sie sich wieder erholen wird?«
»Ich schätze, du bist nicht wegen meiner fachlichen Meinung hier«, erwiderte ich und drückte den Mörser in die aufgehäuften Kamillenblüten. Der fruchtige Tabakgeruch wurde stärker. »Oder?«
»Nicht, wenn du nebenbei nicht auch noch Ärztin oder Hebamme bist«, erklärte sie trocken. »Ich würde gern wissen, was die Zukunft für sie bereithält.«
Ich ließ langsam die Luft entweichen. »Du solltest mich so etwas nicht fragen.«
»Ich weiß.« Naomi sank neben mir auf die Knie, ihr Rock bauschte sich um ihre Mitte. »Und mir ist klar, dass der Baron es nicht leiden kann, wenn dich jemand darum bittet, aber ich schwöre dir, dass er es nicht erfahren wird.«
Mein Zögern hatte wenig mit Claude zu tun, auch wenn der es tatsächlich nicht mochte, wenn ich meine hellseherische Gabe – meine gesteigerte Sinneswahrnehmung – für jemand anderen außer für ihn einsetzte. Er hatte Angst, man könnte mich als Hexe hinstellen, die sich verbotener Knochenmagie bediente. Wobei mir klar war, dass er in Wahrheit keine Angst vor den Magistraten von Archwood hatte, die allesamt auf seiner Gehaltsliste standen und sich auch niemals gegen einen Hochgeborenen oder dessen Nachkommen gewandt hätten. Er fürchtete vielmehr, dass jemand mit mehr Geld oder Macht kommen und mich mitnehmen könnte.
Aber sein Befehl, meine Gabe zu verstecken, und meine Angst, als Hexe verurteilt zu werden, hatten mich noch nie davon abgehalten, sie anzuwenden. Es war einfach so, dass ich den Mund nicht halten konnte, wenn ich etwas sah oder spürte. Ich hatte in solchen Fällen schlichtweg den Drang, es auszusprechen. So war es auch an all den Orten gewesen, an denen Grady und ich gelebt hatten, bevor wir nach Archwood gekommen waren, das sich im Mittleren Territorium befand. Man hatte mich unzählige Male als Hexe angeprangert, und wir waren gezwungen gewesen, mitten in der Nacht das Weite zu suchen, um dem Galgen zu entkommen. Meine Unfähigkeit, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, hatte auch dazu geführt, dass ich Claude kennengelernt hatte.
Die Leute auf Gut Archwood – und darüber hinaus – kannten mich als Frau, die Dinge wusste. Nicht alles, aber genug.
Der Grund, warum ich nicht wollte, dass Naomi mir eine derartige Frage stellte, lag einzig und allein an Naomi selbst.
Als ich mit sechzehn auf Gut Archwood gekommen war, hatte Naomi bereits seit dreizehn Monaten hier gelebt. Sie war im selben Alter wie Claude und nur einige Jahre älter als ich, klug und weltgewandter, als ich jemals sein würde, und ich war davon ausgegangen, dass sie mich nicht weiter beachten würde.
Doch das war nicht der Fall gewesen.
Naomi war zu meiner … nun, sie war zu meiner ersten Freundin geworden. Mal abgesehen von Grady.
Ich hätte alles für sie getan.
Aber ich fürchtete, ihr das Herz zu brechen, und ich hatte genauso große Angst um unsere Freundschaft wie um das Leben, das ich mir in Archwood aufgebaut hatte. In den meisten Fällen wollten die Leute nämlich keine Antwort auf die Frage, die sie mir stellten, und die Wahrheit zerstörte oft wesentlich mehr als jede Lüge.
»Bitte«, flüsterte Naomi. »Ich habe dich noch nie darum gebeten, und ich …« Sie schluckte schwer. »Ich hasse es. Aber ich mache mir Sorgen, Lis. Ich habe Angst, dass sie diese Welt bald verlassen wird.«
In ihren dunklen Augen glänzten Tränen, und das ertrug ich nicht. »Bist du dir sicher?«
»Natürlich.«
»Das sagst du jetzt, aber was, wenn die Antwort genau das ist, was du befürchtest? Denn wenn es so ist, werde ich nicht lügen. Und deine Angst würde sich in unendliche Trauer verwandeln«, erinnerte ich sie.
»Ich weiß. Glaub mir, das weiß ich«, schwor sie, und ihre üppigen braunen Locken fielen ihr über die Schultern, als sie sich in meine Richtung beugte. »Deshalb habe ich nicht sofort gefragt, als ich von dem Fieber erfahren habe.«
Ich biss mir auf die Lippe und umfasste den Mörser fester.
»Ich werde es dir nicht übel nehmen«, erklärte sie sanft. »Wie auch immer die Antwort lautet, ich werde sie dir nicht zur Last legen.«
»Versprochen?«
»Natürlich.«
»Gut.« Ich konnte nur hoffen, dass sie die Wahrheit sagte. Naomi gehörte nicht zu den Leuten, die ihre Gedanken und Absichten projizierten und die dadurch viel zu einfach zu lesen waren.
Mit ein wenig Anstrengung konnte ich allerdings auch in Naomis Gedanken dringen und herausfinden, ob sie die Wahrheit sagte. Ich musste dazu nur meine Sinne öffnen und erlauben, dass sich die Verbindung aufbaute.
Aber ich tat es nicht, wenn es sich vermeiden ließ. Es war ein zu großer Eingriff. Was mich in der Vergangenheit allerdings nicht davon abgehalten hatte, es trotzdem bei einigen zu tun, wenn ich mir einen Nutzen davon versprochen hatte.
Ich schob den Gedanken beiseite, nahm einen tiefen Atemzug, der nach Kamille schmeckte, und stellte die Schale auf dem Tisch ab. »Gib mir deine Hand.«
Naomi streckte die Hand aus, ohne zu zögern, aber ich war zurückhaltender. Ich konnte andere Niedriggeborene nicht berühren, ohne ihre Absichten – und manchmal auch ihre Zukunft – direkt vor mir zu sehen. Es ging nur, wenn ich meine Sinne betäubte, etwa mit Alkohol oder anderen Substanzen. Aber diese Mittel betäubten auch alles andere, und ihre Wirkung hielt meist nicht sehr lange an, weshalb es im Grunde sinnlos war.
Ich schloss meine Hand um Naomis und hätte mir gern zumindest eine Sekunde lang erlaubt, das Gefühl zu genießen. Den meisten war nicht klar, dass es ein riesiger Unterschied war, ob man berührt wurde oder jemanden berührte.
Doch hier ging es nicht um mich. Ich durfte mir diese Sekunde nicht nehmen, denn je länger ich Naomis Hand hielt, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende Dinge über sie sah, die sie mir nicht zeigen wollte. Und ich würde mich weder mit Summen noch mit anderen Gedanken davon ablenken können.
Ich ließ meinen Geist verstummen, öffnete meine Sinne und schloss die Augen. Eine Sekunde verging, und dann noch eine, bis plötzlich ein Kribbeln von meinen Schulterblättern nach oben über meinen Schädel wanderte. Ich sah Naomis verschwommenes Gesicht vor meinem geistigen Auge, aber ich ließ es nicht näher herankommen.
»Wiederhole deine Frage«, befahl ich, denn es würde mir helfen, mich auf das zu konzentrieren, was sie wissen wollte, und nichts von dem zu beachten, was sonst Gestalt annahm oder in Worte gefasst wurde.
»Wird sich Laurelin von ihrem Fieber erholen?«, fragte Naomi so leise, dass ich sie kaum verstand.
In meinem Kopf herrschte Schweigen, doch dann hörte ich eine Stimme, ähnlich meiner eigenen: Sie wird sich erholen.
Ein erleichtertes Schaudern durchfuhr mich, doch im nächsten Augenblick wurde mir eisig kalt. Die Stimme hatte noch mehr zu sagen.
Ich ließ Naomis Hand los und öffnete die Augen.
Naomi war erstarrt, ihre Hand schwebte zwischen uns in der Luft. »Was hast du gesehen?«
»Laurelin wird sich von dem Fieber erholen.«
Sie schluckte. »Wirklich?«
»Ja.« Ich lächelte, aber es fühlte sich falsch an.
»Den Göttern sei Dank«, hauchte sie und legte sich die Finger auf die Lippen. »Ich danke dir.«
Mein Lächeln glich einer Grimasse, und ich wandte mich ab, räusperte mich und griff nach der Schale mit den Kamillen. Ich spürte das kühle Porzellan kaum.
»Hat Claude wieder Schlafprobleme?«, fragte Naomi nach ein paar Augenblicken mit Blick auf die Kräuter und klang dabei sehr viel heiterer.
Ich war ihr dankbar, dass sie das Thema wechselte, und nickte. »Er will für die bevorstehenden Feierlichkeiten ausgeruht sein.«
Naomi hob die Augenbrauen. »Bis dahin sind es doch noch mehrere Wochen.«
Ich warf ihr einen Blick zu. »Er will wirklich sehr gut ausgeruht sein.«
Naomi schnaubte. »Er muss ziemlich aufgeregt sein.« Sie lehnte sich zurück und spielte mit dem Saphir, der an einer dünnen Silberkette um ihren Hals hing. Sie trug diese Kette fast jeden Tag. »Was ist mit dir? Bist du auch aufgeregt?«
Ich zuckte mit den Schultern, auch wenn sich mein Magen drehte. »Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.«
»Aber es werden deine ersten Feierlichkeiten, oder?«
»Ja.« Ich durfte das erste Mal teilnehmen, nachdem man entweder zweiundzwanzig oder verheiratet sein musste, was meines Erachtens wenig Sinn ergab, aber die Regeln wurden von den Hochgeborenen und König Euros gemacht und nicht von mir.
»Es wird eine ziemliche Show«, erklärte sie langsam.
Ich kicherte, denn ich kannte die Geschichten, die sich um diese Zusammenkünfte rankten.
Naomi lehnte sich erneut näher heran und senkte die Stimme. »Wirst du auch am Festakt teilnehmen?«
»Am Festakt.« Ich lachte. »Das klingt aber ziemlich lahm.«
Sie grinste. »Wie würdest du es denn sonst nennen?«
»Orgie?«
Sie legte den Kopf in den Nacken und lachte laut auf, und es war ein herrliches, ansteckendes Geräusch. Naomi hatte das schönste Lachen von allen, und es zauberte mir ebenfalls ein Grinsen auf die Lippen. »Aber nicht doch!«, meinte sie.
»Wirklich nicht?«, erwiderte ich trocken.
Naomi setzte einen unschuldigen Blick auf, was beeindruckend war, nachdem sie kaum etwas Unschuldiges an sich hatte. »Im Laufe der Feierlichkeiten haben die Hochgeborenen die Möglichkeit, den Niedriggeborenen zu beweisen, dass sie diesen weiterhin mit vollster Hingabe dienen, indem sie ihr Essen und Trinken im Überfluss mit ihnen teilen.« Sie rezitierte den Glaubensgrundsatz genauso gut wie die Priorinnen und faltete ihre Hände züchtig im Schoß. »Manchmal wird ein wenig mehr getrunken, und in Kombination mit der Anwesenheit der Hochgeborenen kann es zu gewissen Aktivitäten kommen. Mehr nicht.«
»Ach ja, genau. Sie beweisen damit ihre Hingabe zu den Niedriggeborenen«, kommentierte ich trocken. Naomi sprach von dem höchsten Kreis der Hochgeborenen, den Deminyen.
Deminyen stiegen dem Glauben nach aus der Erde empor und hatten dabei bereits die Gestalt, die sie für den Rest ihres alterslosen Lebens behalten würden. Sie konnten die Elemente und selbst den Geist anderer Lebewesen beeinflussen. Einige waren als Lords und Ladys bekannt, doch die einflussreichsten aller Deminyen waren die Prinzen und Prinzessinnen, die gemeinsam mit dem König über die sechs Territorien des Königreiches Caelum herrschten, und ihre Macht war schreckenerregend. Sie konnten jede mögliche Gestalt annehmen, ruhige Bäche mit einem einzigen Wink in reißende Flüsse verwandeln und selbst die Seelen der Niedriggeborenen in Besitz nehmen, aus deren Hüllen die Furcht einflößenden Rae entstanden.
Über die Prinzen und Prinzessinnen war kaum etwas bekannt. Abgesehen von Prinz Rainer von Primvera kannten wir nicht einmal ihre Namen. Der Einzige, über den uns manchmal Gerüchte zu Ohren kamen, war der Prinz von Vytrus, der das Obere Territorium regierte und von den meisten gefürchtet wurde, nachdem er die ausführende Hand war, wann immer sich König Euros’ Zorn gegen eines der Territorien richtete.
Jedenfalls hätte mich Naomis Erklärung beinahe laut auflachen lassen. Die Hochgeborenen hielten zwar ihre schützenden Hände über uns, aber ich war mir nicht ganz sicher, auf welche Weise sie uns »dienten«. Sie glichen Grundherren, die sich rarmachten und nur auftauchten, wenn die Pacht fällig war, dennoch kontrollierten sie jeden Aspekt im Leben von uns Niedriggeborenen. Angefangen dabei, wer ein Recht auf Bildung hatte, bis hin zu dem Recht, Land zu besitzen oder Geschäfte zu machen.
Aus diesem Grund waren die Feierlichkeiten meiner Meinung nach eher dazu da, den Hochgeborenen das zu geben, was sie wollten. Indem wir uns dem Genuss hingaben und sowohl das üppige Festessen als auch einander genossen, nährten wir sie. Wir verliehen ihnen neue Stärke. Und Macht. Unsere Freude und unser Vergnügen waren ihre Nahrung. Sie gaben ihnen Lebenskraft. Es ging bei den Feierlichkeiten also viel mehr um die Hochgeborenen als um uns.
Es hätte unzählige Möglichkeiten gegeben, uns Niedriggeborenen zu beweisen, dass sie sich um uns kümmerten – angefangen dabei, auch unter dem Jahr dafür zu sorgen, dass alle genug zu essen hatten. Viel zu viele verhungerten, schufteten sich in den Minen zu Tode oder riskierten ihr Leben auf der Jagd, um ihre Familien durchzufüttern. Und während die Aristos – die Hochgeborenen und die reichen Niedriggeborenen – immer reicher wurden, wurden die Armen immer ärmer. So war es immer schon gewesen, und so würde es immer sein, ganz egal, wie oft die Niedriggeborenen zur Rebellion aufriefen.
Anstatt uns zu helfen, veranstalteten die Hochgeborenen lieber einmal im Jahr besagte Feierlichkeiten, bei denen das meiste Essen verdarb, weil sich alle Gäste besagten Aktivitäten hingaben.
Was ich natürlich nicht laut aussprach.
Ich war zwar verwegen, aber ich war keine Närrin.
»Weißt du, manche sind gar nicht so schlimm«, meinte Naomi nach einem Augenblick des Schweigens. »Die Hochgeborenen, meine ich. Ich habe bereits einige Lords und Ladys kennengelernt, die sich zugunsten in Not geratener Niedriggeborener eingesetzt haben, und die Hochgeborenen von Primvera sind freundlich und sogar fürsorglich. Ich glaube, die meisten von ihnen sind gut.«
Ich musste sofort an meinen Hochgeborenen denken – an den namenlosen Lord, der mein Kinn umfasst und mich gefragt hatte, woher die Blutergüsse auf meinen Armen stammten. Keine Ahnung, warum ich ihn als meinen Hochgeborenen bezeichnete. Denn das war er natürlich nicht. Leute seiner Art schliefen sich durch die Betten der Niedriggeborenen, wie es ihnen beliebte, und einige hatten sogar Männer oder Frauen zumindest eine Zeit lang an sich gebunden, doch es war noch nie vorgekommen, dass sich ein Hochgeborener für immer an einen Niedriggeborenen band. Allerdings hatte ich den Namen des Lords nun mal nie erfahren, und so war es seit jener Nacht zu einer dummen Angewohnheit geworden, ihn so zu nennen.
Ich bezweifelte, dass dem Lord damals klar war, dass er Gradys Leben gerettet hatte. Der Findelherr hätte ihn für seine Widerrede hart bestraft, und viel zu viele hatten diese Art von Bestrafung nicht überlebt.
Mein Magen drehte sich um, wie jedes Mal, wenn ich an meinen Hochgeborenen dachte, denn ich wusste, dass ich ihn wiedersehen würde.
Bis jetzt war es noch nicht dazu gekommen, doch jedes Mal, wenn ich daran dachte, packte mich eine Mischung aus Angst und Aufregung, die ich nicht ansatzweise deuten konnte.
Auf jeden Fall hatte Naomi recht, und viele der Hochgeborenen nahmen ihre Rolle als Beschützer durchaus ernst. Archwood florierte zum Teil auch dank der Hochgeborenen, die am Hof von Primvera – der sich in den Wäldern außerhalb des Gutes befand – lebten, und mein Hochgeborener hatte damals den Findelherrn bestraft. Wobei er allerdings brutal vorgegangen war, was vielleicht kein gutes Beispiel für die Freundlichkeit und Fürsorglichkeit der Hochgeborenen war.
»Glaubst du, dass auch Deminyen zu den Feierlichkeiten kommen werden?«, fragte ich.
»Ja, normalerweise lassen sich immer ein paar blicken.« Naomi runzelte die Stirn. »Hoffentlich kommen sie auch dieses Jahr.«
Ich spielte gedankenverloren mit dem Stößel und sah sie an.
Sie grinste listig und drehte die silberne Kette um ihre Finger. »Den Staub der Nacht brauchst du jedenfalls nicht, wenn du an einen Hochgeborenen gerätst«, erklärte sie und meinte damit ein Pulver, das aus den Samen der Trompetenblume gewonnen wurde und den Geist in der richtigen Dosierung genug benebelte, um nach dem Nachlassen der Wirkung kaum noch eine Erinnerung an die Zeit dazwischen zu haben. »Ihre Gesellschaft ist höchst angenehm.«
Ich hob die Augenbraue.
»Was ist denn?«, rief sie und stieß ein weiteres lautes, kehliges Lachen aus. »Wusstest du, dass die Orgasmen der Hochgeborenen manchmal mehrere Stunden dauern können? Und ich spreche tatsächlich von Stunden.«
»Ja, davon habe ich gehört.« Ich war mir nicht sicher, ob es stimmte, aber stundenlange Orgasmen … das klang heftig. Möglicherweise sogar ein wenig schmerzhaft.
Ihr Blick huschte zu mir. »Kannst du einen Hochgeborenen berühren, ohne … etwas zu spüren?«
»Ich bin mir nicht sicher.« Ich dachte an Claude und meinen hochgeborenen Lord. »Ich kann einen Caelestianer zumindest eine Zeit lang berühren, bevor es anfängt, aber ich habe noch nie einen Hochgeborenen berührt, und wenn ich eine Frage stelle, die mit ihnen zu tun hat, bekomme ich keine Antwort. Deshalb kann ich es nicht mit Sicherheit sagen.«
»Na, dann wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert.« Sie zwinkerte mir zu.
Lachend schüttelte ich den Kopf.
Sie grinste. »Ich muss los. Allyson ist in letzter Zeit ziemlich durch den Wind«, sagte sie und meinte damit einen der Neuzugänge auf dem Gut. »Ich muss dafür sorgen, dass sie sich zusammennimmt.«
»Na dann, viel Glück.«
Naomi erhob sich lachend und machte sich auf den Weg zur Tür, doch dann hielt sie noch einmal inne. »Ich danke dir, Lis.«
»Wofür denn?« Ich runzelte die Stirn.
»Für deine Antwort.«
Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte, und so sah ich ihr lediglich schweigend hinterher. Ich wollte ihren Dank nicht.
Als sie fort war, sackte ich in mir zusammen und richtete den Blick hinauf zu dem sich langsam drehenden Ventilator an der Decke. Ich hatte Naomi nicht belogen. Ihre Schwester würde das Fieber überstehen. Aber ich hatte noch mehr gehört. Die flüsternde Stimme hatte mir verraten, dass der Tod trotzdem hinter Laurelin her war. Ich hatte mir nicht erlaubt, so lange zuzuhören, bis ich wusste, wann und wie es passieren würde, aber ich hatte das Gefühl, dass sie das Ende der Feierlichkeiten nicht mehr erleben würde, und meine Gefühle täuschten sich selten.
2
»Hättest du gern einen anderen Wein, Mäuschen?«
Meine Finger verkrampften und gruben sich in die Haut, die zwischen den zahlreichen, mit Edelsteinen besetzten Schnüren um meine Hüfte hervorblitzte. Normalerweise machte mir der Kosename nichts aus, aber Claudes Vetter Hymel stand nahe genug, um uns zu hören, was für den Kommandanten der Wache natürlich nichts Außergewöhnliches war. Ich spürte sein höhnisches Grinsen, auch wenn er mir den Rücken zugewandt hatte. Er war einfach ein Arschloch.
Ich trug eine Krone aus frischen Chrysanthemen, von der dünne, mit Diamanten versehene Ketten nach unten fielen und sanft gegen meine Wangen schlugen, als ich den Blick von der Menge der Gäste unter uns abwandte und ihn auf den Mann neben mir richtete.
Der Stuhl, auf dem der dunkelhaarige Baron von Archwood Platz genommen hatte, konnte gut und gern als Thron bezeichnet werden. Ein ziemlich kitschiger Thron, wenn man mich fragte. Groß genug, um auch zwei Personen Platz zu bieten, und von Rubinen aus den Versunkenen Höhlen besetzt, kostete er mehr, als die Minenarbeiter in ihrem gesamten Leben verdienten.
Was dem Baron nicht ansatzweise bewusst war.
Claude Huntington war nicht unbedingt ein böser Mann, das hätte ich auch ohne meinen Instinkt gewusst. Ich hatte schon zu viele böse Zeitgenossen aus allen gesellschaftlichen Schichten kennengelernt, um mich täuschen zu lassen. Allerdings neigte er zur Leichtsinnigkeit und gab sich den schönen Dingen des Lebens ein wenig zu gern hin. Er kannte keine Gnade, wenn ihn jemand wütend machte, und war es gewöhnt, immer alles zu bekommen, wonach ihm verlangte. Als Caelestianer war er erwartungsgemäß egozentrisch, und es bereitete ihm selten etwas wirkliche Sorgen.
Wobei sich Letzteres in den letzten Monaten geändert hatte. Seine Kassen waren nicht mehr so prall gefüllt wie einst, woran die kitschigen Stühle und das Golddekor, auf das Claude bestand, sicher nicht ganz unschuldig waren. Genauso wenig wie die beinahe täglichen Feiern und Zusammenkünfte, die er offenbar zum Überleben brauchte. Wobei dieser Vorwurf zugegebenermaßen nicht ganz fair war. Natürlich genoss Claude den Großteil dieser Festivitäten, aber es wurde auch von ihm – und allen anderen Baronen – erwartet. Auf diesen Treffen gab es Genuss und Vergnügen im Überfluss, sei es beim Essen, beim Trinken, bei angeregten Gesprächen oder bei dem, was meist später noch passierte.
»Nein«, erwiderte ich lächelnd. »Trotzdem danke für das wohlwollende Angebot.«
Der helle Schein des Kronleuchters ließ die Haut auf seinen Wangenknochen und der Nase golden schimmern – allerdings nicht, weil er künstlich nachgeholfen hatte, sondern weil die Haut der Caelestianer von Natur aus sanft leuchtete.
Seine herrlich blauen Augen, die mich an Meerglas erinnerten, musterten mich. Claude war der Inbegriff der Anmut. Er hatte perfekt manikürte, glatte Hände, akkurat frisierte, glänzende Haare, war groß und schlank, konnte alles tragen, was gerade unter den Aristos in Mode war, und wenn er lächelte, brachte er so manchen aus dem Gleichgewicht.
Eine Zeit lang war es auch mir so ergangen. Wobei es ein zusätzlicher Vorteil war, dass Claude als Caelestianer sehr schwer zu erspüren war. Meine Fähigkeiten erwachten in seiner Gegenwart nicht sofort zum Leben. Ich konnte ihn berühren – wenn auch nur eine gewisse Zeit lang.
»Aber du hast kaum etwas getrunken«, bemerkte er.
Gelächter und angeregte Gespräche hüllten uns ein, während ich den Blick auf meinen Kelch senkte. Die Farbe des Weins glich dem Lavendel, der im Park von Archwood blühte, und schmeckte nach gesüßten Beeren. Er war köstlich, und das Trinken von Alkohol war gern gesehen und wurde sogar erwartet. Es bereitete den Anwesenden Vergnügen, doch in meinem Fall dämpfte es auch meine Fähigkeiten. Und die waren immerhin der Hauptgrund, warum ich die Lieblingsmätresse des Barons war.
Es war nicht meine atemberaubende, ungewöhnliche Schönheit und auch nicht mein Charakter. Der Baron versorgte mich und Grady mit einem Dach über dem Kopf, genug zum Essen und auch mit sonstigen Annehmlichkeiten, weil ich Fähigkeiten hatte, die ihm von Nutzen waren, und ich befürchtete, dass Grady und ich wieder auf der Straße landen würden, wenn ich diesen Zweck nicht mehr erfüllte.
Ein Leben auf der Straße bedeutete ein Leben am Abgrund, und das war kein echtes Leben.
»Es ist alles gut«, versicherte ich ihm und nahm einen winzigen Schluck, ehe ich meine Aufmerksamkeit wieder auf die Gäste richtete, die sich unter dem Podium tummelten. Die mit Gold verzierte Große Halle war voller Aristos, darunter wohlhabende Fuhrunternehmer, Kaufmänner, Bankiers und Grundbesitzer. Niemand trug eine Maske. Es war nicht diese Art von Party. Zumindest noch nicht. Ich sah mich nach Naomi um, die ich mittlerweile aus den Augen verloren hatte.
»Mäuschen?«, fragte Claude leise.
Ich drehte mich erneut zu ihm um. Er beugte sich zu mir und streckte die Hand aus. Die Leibwächter hinter uns hielten ihren Blick auf die Menge gerichtet – alle außer Grady. Ich erhaschte einen Blick auf ihn und sah, wie er die Zähne aufeinanderbiss. Grady war nicht unbedingt glücklich mit dem Baron und diesem Arrangement. Ich konzentrierte mich wieder auf Claude.
Er lächelte mir zu.
Ich stützte mich auf dem Samtkissen ab, auf dem ich saß, beugte mich näher und legte das Kinn auf seine Handfläche. Seine Finger waren kalt wie immer. Genauso wie seine Lippen, als er den Kopf senkte und mich küsste. Ich spürte lediglich ein leichtes Kribbeln im Bauch. Früher war es mehr gewesen. Damals, als ich noch dachte, seine Zuneigung gelte mir persönlich.
Was wiederum der Grund war, warum Grady nichts von diesem Arrangement hielt.
Hätte Claude mich mit Aufmerksamkeit überschüttet, weil er mich wollte, hätte es Grady nicht das Geringste ausgemacht. Er war einfach der Meinung, ich würde mehr verdienen. Etwas Besseres. Und es war nicht so, dass ich nicht auch dieser Meinung war, aber mehr und besser war nur in den seltensten Fällen machbar. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, genügend zu essen und waren in Sicherheit – das alles war wesentlich wichtiger.
Claude hob den Mund von meinem. »Ich mache mir Sorgen um dich.«
»Warum?«
Sein Daumen glitt über meine Unterlippe, wobei er darauf achtete, die rote Farbe nicht zu verwischen. »Du bist so still.«
Natürlich war ich das, immerhin saß ich auf dem Podium, und abgesehen von Claude und Hymel war niemand in der Nähe, mit dem ich mich hätte unterhalten können. Wobei Claude ständig neue Gesprächspartner fand und ich mir lieber die Zunge herausgeschnitten hätte, als mit Hymel zu reden. Ehrlich. Ich hätte mir eher die Zunge herausgeschnitten und sie nach ihm geworfen. »Ich bin bloß müde.«
»Warum das?«, fragte Claude, und es schwang genau das richtige Maß an Sorge mit.
»Ich habe nicht gut geschlafen.« Ein Albtraum aus der Vergangenheit war aus den Tiefen der Erinnerung emporgekrochen und hatte mich geweckt. Grady und ich hatten wieder auf der Straße gelebt, und er hatte diesen schrecklichen Husten eingefangen, den ich all die Jahre später immer noch hören konnte. Ich träumte oft davon, aber letzte Nacht war es viel zu real gewesen.
Weshalb ich den Großteil des Tages im Blumengarten verbracht hatte, den ich für mich selbst angelegt hatte. Ich hatte kaum Zeit gehabt, etwas zu essen und mich für den Abend in der Großen Halle bereitzumachen, aber in meinem kleinen Garten dachte ich nicht an die Vergangenheit, die Albträume und die Angst, dass alles hier jeden Moment vorbei sein konnte.
Claude hob eine Augenbraue. »Ist das wirklich alles?«
Ich nickte.
Seine Hand glitt in meine Haare, und er rückte eine der mit Diamanten besetzten Ketten zurecht. »Ich hatte schon die Befürchtung, du könntest eifersüchtig sein.«
Ich sah ihn verwirrt an.
»Ich weiß, dass ich den anderen in letzter Zeit sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe.« Sein Blick schweifte über die Menge und blieb vermutlich an der blonden Allyson hängen. »Ich hatte befürchtet, du könntest deshalb das Gefühl haben, ich würde dich nicht genügend würdigen.«
Ich hob die Augenbraue. »Wirklich?«
Er runzelte die Stirn. »Ja.«
Ich sah ihn an, und es dauerte einen Augenblick, bis mir klar wurde, dass er es ernst meinte. Ein Lachen stieg in mir hoch, doch ich schluckte es hinunter. Ich konnte mich nicht einmal mehr erinnern, wann Claude mehr für mich übrig gehabt hatte als einen schnellen Kuss oder einen Klaps auf den Hintern, und das war vollkommen in Ordnung.
Meistens zumindest.
Auch wenn ich mich kaum mehr zu ihm hingezogen fühlte, genoss ich es, berührt – und begehrt – zu werden. Ich genoss es, jemanden zu berühren, auch wenn es nur für wenige Minuten war. Claude verbat seinen Mätressen zwar nicht den Kontakt mit anderen, aber in meinem Fall war es etwas komplizierter. Ich war eher eine Beraterin … eine Spionin, der er zwischendurch seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
»Mir wurde gesagt, dass du auch in keiner anderen Kammer zu Gast warst«, fügte er hinzu.
Wut stieg in mir hoch. Es gefiel mir nicht, dass er mich im Auge behalten ließ, und außerdem war diese Bemerkung unnötig. Claude wusste genau, wie schwierig es für mich war, mit anderen intim zu sein, und wie unwohl ich mich mit Partnern fühlte, die keine Ahnung hatten, welches Risiko bestand, wenn ich sie berührte, ohne vorher meine Sinne vorher mit Unmengen an Alkohol betäubt zu haben.
Am nächsten Morgen aufzuwachen und nicht zu wissen, ob man Sex gehabt hatte und ob es angenehm gewesen war, war genauso beunruhigend, wie Dinge zu sehen oder zu hören, die nicht für mich bestimmt waren. Oder sogar noch beunruhigender.
Aber Claude vergaß eben gern Dinge, die ihn nicht unmittelbar betrafen.
»Ich will nicht, dass du dich einsam fühlst«, sagte er und meinte es auch so.
Weshalb ich ihm ein Lächeln schenkte. »Das tue ich nicht.«
Claude erwiderte das Lächeln bereitwillig und wandte sich schließlich einem neuen Gesprächspartner zu. Ich hatte ihm gegeben, was er wollte. Die Bestätigung, dass ich zufrieden war. Er hatte danach gefragt, weil es ihm wichtig war, aber auch, weil er Angst hatte, dass ich gehen würde, wenn es irgendwann nicht mehr so sein würde.
Er hatte keine Ahnung, dass ich gelogen hatte. Denn ich war …
Ich unterbrach mich selbst, als hätte es etwas daran geändert, wie ich mich fühlte.
Ich griff nach meinem Kelch und trank die Hälfte des Weines mit einem großen Schluck, während ich den Blick auf die goldenen Adern im Marmorboden gerichtet hielt. Mein Geist schwieg einen Moment lang, aber es war genug. Unzählige Stimmen stiegen empor und verbanden sich zu einem Summen. Ich schloss die Augen, holte tief Luft und hielt sie so lange an, bis ich alle unsichtbaren Verbindungen getrennt hatte, die mein Geist von selbst aufgebaut hatte.
Nach einigen Sekunden ließ ich langsam die Luft entweichen und öffnete die Augen. Mein Blick wanderte über die Menge. Die Gesichter waren verschwommen, mein Geist gehörte wieder mir allein.
Hymel lehnte sich an das Podium und blickte zu mir hoch. Die von einem sorgfältig gestutzten Bart umgebenen Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Grinsen. »Kann ich etwas für dich tun, Mäuschen?«
Ich erwiderte Hymels Blick mit ausdruckslosem Gesicht. Ich konnte ihn nicht ausstehen, und Claude tolerierte ihn nur, weil er zur Familie gehörte und sich um die weniger angenehmen Aufgaben kümmerte, die dazugehörten, wenn man eine Stadt regierte. So genoss es Hymel zum Beispiel sehr, die Pacht einzutreiben. Vor allem, wenn jemand damit in Verzug war. Er war gegenüber den Wächtern unnötig grob und verhöhnte mich, wann immer es ging.
Er wollte, dass ich mich gegen ihn auflehnte, wie ich es bei anderen tat, die mich zur Weißglut brachten. Ich hatte durchaus eine große Klappe. Zumindest meistens. Wenn ich wirklich wütend oder nervös war und wenn ich Angst hatte, war es meine einzige Waffe.
Wobei man es eigentlich nicht als Waffe bezeichnen konnte. Es war eher ein selbstzerstörerisches Verhalten, denn es brachte mich jedes Mal in Schwierigkeiten.
Naomi hatte mir einmal erzählt, dass Hymel ein solches Ekel war, weil er es im Bett nicht zum Abschluss bringen konnte. Ich hatte keine Ahnung, ob das stimmte, aber ich fand es paradox, dass Wesen wie die Caelestianer derartige Schwierigkeiten haben konnten. Andererseits waren sie den Sterblichen doch sehr ähnlich, auch wenn sie von den Hochgeborenen abstammten. Sie wurden zwar seltener krank und waren körperlich robuster, ohne sich nähren zu müssen, wie etwa die Deminyen, aber sie waren nicht immun gegen Krankheiten.
Jedenfalls bezweifelte ich, dass dieses Problem die treibende Kraft hinter Hymels Gemeinheiten war – zumindest nicht das Hauptproblem. Eines wusste ich allerdings mit Sicherheit: Hymel trug eine besonders ausgeprägte Grausamkeit in sich, und sie auszuleben, erregte ihn.
Er grinste. »Du bist wie sein Lieblingshündchen, und das weißt du auch, oder?« Er sprach so leise, dass nur ich ihn hören konnte, und Claudes Aufmerksamkeit galt ohnehin wieder seinen Gästen. »Immerhin darfst du brav vor seinen Füßen sitzen.«
Natürlich wusste ich das.
Aber ich war lieber das Lieblingshündchen des Barons als ein halb verhungerter Straßenköter.
Was Hymel natürlich nicht verstand. Leute wie er, die sich noch nie darüber Gedanken machen mussten, wann sie sich das nächste Mal satt essen würden oder ob die Ratten, die nachts über ihre Haare huschten, irgendwelche Krankheiten in sich trugen, hatten keine Ahnung, wozu andere bereit waren, bloß um genug zu essen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Und genau deshalb hatte seine Meinung – und die Meinung anderer, die genauso waren wie er – keine Bedeutung für mich.
Also lächelte ich bloß, hob den Kelch an meine Lippen und nahm einen weiteren, sehr viel kleineren Schluck.
Hymels Augen wurden schmal, doch dann wandte er sich ab und versteifte sich im nächsten Moment. Ich folgte seinem Blick. Ein groß gewachsener, herausgeputzter Mann trat aus der Menge.
Ellis Ramsey, ein reicher Fuhrunternehmer aus der Nachbarstadt Newmarsh.
Er trat vor den Baron und verbeugte sich tief. »Einen schönen Abend, Baron Huntington.«
Claude nickte zur Begrüßung und deutete auf einen der leeren Stühle. »Wein?«
»Danke, aber das ist nicht nötig. Ich will Eure Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen.« Ramsey lächelte verkniffen, wodurch sein säuerliches Gesicht noch herber wirkte. »Ich habe Neuigkeiten.«
»Tatsächlich?«, murmelte Claude, und sein Blick huschte zu mir.
Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, aber es entging mir nicht.
»Es gab eine Entwicklung im Westlichen Territorium.«
»Und die wäre?«
Ramsey lehnte sich näher an den Baron heran. »Es sind Gerüchte im Umlauf, dass der Hof sich gegen den König stellt.«
Ich senkte meinen Kelch und öffnete meine Sinne. In einem derart vollen Raum musste ich darauf achtgeben, nicht mitgerissen zu werden. Ich konzentrierte mich auf Ramsey und knüpfte ein imaginäres Band zwischen uns. Gedanken waren oft schwer zu deuten – manchmal hörte ich nur eine Abfolge an Worten, die entweder dem entsprachen, was derjenige gerade sagte, oder in eine völlig andere Richtung gingen. Auf jeden Fall brauchte ich immer einen Moment, um mich zu orientieren und eine Grenze zwischen dem zu ziehen, was laut ausgesprochen wurde, und dem, was nur im Kopf meiner Zielperson stattfand.
»Gerüchte interessieren mich wenig«, meinte Claude gerade.
»Dieses vermutlich schon.« Ramsey senkte die Stimme, und ich hörte: Dich interessiert doch gar nichts, was nicht die Beine für dich breitmacht und schön feucht ist. Ich verdrehte die Augen. »Zwei Gesandte des Königs wurden nach Visalien geschickt.« Besagte Gesandte waren Niedriggeborene, die als Bindeglieder zwischen dem König und den fünf Höfen fungierten und Nachrichten überbrachten. »Aber es gab offenbar ein Problem, denn sie kamen zwar zu Seiner Majestät zurück, aber …« Der Fuhrunternehmer legte eine dramatische Pause ein. »In mehreren Stücken.«
Ich hätte beinahe laut nach Luft geschnappt. Das war gar nicht gut.
»Nun, das klingt tatsächlich besorgniserregend.« Claude nahm einen großen Schluck Wein.
»Das war aber noch nicht alles.«
Claude umfasste seinen Kelch fester. »Ich kann es kaum erwarten, auch den Rest zu hören.«
»Die Prinzessin von Visalien hat eine beträchtliche Menge Männer entlang der Grenze zwischen dem Westlichen Territorium und dem Mittleren Territorium versammelt«, berichtete Ramsey, und seine Gedanken entsprachen dem, was er sagte. »Auch das sind nur Gerüchte, die meiner Meinung nach allerdings der Wahrheit entsprechen.«
»Eine beträchtliche Menge?« Claude ließ den Blick über die Gäste schweifen. »Ihr meint ein ganzes Bataillon?«
»Das und die Eisernen Ritter.« Ramsey verlagerte sein Gewicht und legte sich eine fleischige Hand aufs Knie.
Überrascht sah ich auf und stellte meinen Kelch auf dem Tablett ab. Die Eisernen Ritter waren eine Gruppe aus rebellischen Niedriggeborenen, die eher Räubern und Banditen glichen als tatsächlichen Rittern. Sie hatten letztes Jahr für einige Unruhen in den Grenzstädten des Mittleren und des Unteren Territoriums gesorgt, und soweit ich gehört hatte, wollten sie den hochgeborenen König durch einen niedriggeborenen ersetzen. Ich interessierte mich zwar nur für Politik, wenn mir nichts anderes übrig blieb, aber selbst ich wusste, dass sie im ganzen Königreich Caelum immer mehr Anhänger fanden. Die Leute glaubten, dass Vayne Beylen – der Kommandant der Eisernen Ritter – das Königreich in eine bessere Zukunft führen konnte, aber wie sollte das möglich sein, wenn er sich mit den Hochgeborenen aus den Westlichen Territorium verbündete?
Claude fuhr sich mit dem Daumen übers Kinn. »Sind sie bereits ins Mittlere Territorium vorgedrungen?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Und was ist mit Beylen?«, wollte Claude wissen. »Wurde er gesehen?«
»Auch darauf habe ich keine Antwort«, erwiderte Ramsey und dachte: Wenn sich der Mistkerl irgendwo sehen lässt, ist er tot. Der Gedanke beunruhigte mich, denn es klang beinahe so, als wäre Beylens Tod nicht wünschenswert. Auch wenn die Eisernen Ritter immer mehr Anhänger unter den Niedriggeborenen fanden, waren die Wohlhabenden nicht sehr begeistert, denn ein Erfolg hätte den Status quo in Gefahr gebracht. »Archwood liegt zum Glück nicht so dicht an der Grenze, und wir würden zumindest vorgewarnt, sollten sich die Eisernen Ritter auf den Weg hierher machen. Auf jeden Fall müssen wir uns auf eine länger dauernde Rebellion einstellen, wenn sie es erst einmal an den Grenzstädten vorbeigeschafft haben.«
»Nein, keine Rebellion«, murmelte Claude. »Das wäre eine Kriegserklärung.«
Meine Brust war wie zugeschnürt, als ich die Verbindung zu dem Fuhrunternehmer trennte. Ich warf einen Blick auf Grady und ließ ihn anschließend über die Menge schweifen. In den vierhundert Jahren seit dem Ende des Großen Krieges, der das Königreich beinahe vollständig zerstört hatte, hatte es keine Kriege mehr gegeben.
»Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird«, erklärte Ramsey.
»Ich auch nicht.« Claude nickte gemächlich. »Danke für Euren Bericht.« Er lehnte sich zurück. »Ich würde das alles aber für mich behalten, bis wir mehr wissen. Sonst geraten die Leute womöglich in Panik.«
»In Ordnung.«
Der Baron beobachtete schweigend, wie sich Ramsey erhob, das Podium verließ und in der Menge verschwand. Als er nicht mehr zu sehen war, wandte sich Claude an mich. »Was siehst du?«
Genau das war mein Teil der Abmachung. Manchmal reichte es, in die Zukunft von Claudes Gesprächspartner zu sehen oder dessen Gedanken zu lesen, um zu erfahren, ob dieser etwas im Schilde führte oder in gutem Glauben nach Archwood gekommen war.
Manchmal war ein aktiverer Zugang nötig, um herauszubekommen, was ich wissen wollte.
Dieses Mal allerdings nicht.
Er hatte seine Frage gerade zu Ende gestellt, als sich eine Kälte in mir ausbreitete und sich zwischen meinen Schulterblättern festsetzte. Mein Magen zog sich zusammen, und ich schob die Hand unter meine schweren dunklen Haare, um einen Finger auf die Stelle hinter meinem linken Ohr zu legen, die sich so anfühlte, als hätten kalte Lippen einen Kuss darauf gedrückt. Die Stimme in meinen Gedanken erhob sich warnend.
Er kommt.
3
Die dumpfen Kopfschmerzen, die mich immer überkamen, wenn zu viele Leute anwesend waren, verschwanden erst, nachdem ich in meine Gemächer zurückgekehrt war. Ich war müde, aber meine Gedanken rasten, und an Schlaf war nicht zu denken.
Ich trat in die Badekammer, wusch mir eilig die Farbe aus dem Gesicht und flocht meine Haare. Nachdem ich in mein Nachtkleid geschlüpft war, warf ich mir einen dünnen Morgenmantel mit angeschnittenen Ärmeln über, schloss den Gürtel um die Mitte und schob die Füße in ein Paar Stiefel mit dünner Sohle. Dann trat ich durch die Terrassentür hinaus in die feuchte Abendluft, überquerte die schmale Terrasse und machte mich auf den Weg über den Rasen hinter dem Gutshaus. Offenbar hatte es vor Kurzem geregnet, aber die Wolken hatten sich mittlerweile verzogen. Der Vollmond warf ein silbernes Licht auf den mit Steinen ausgelegten, aber von Gras bewachsenen Pfad, und ich gab mir keine Mühe, mich vor den Wächtern zu verstecken, die entlang der Gutsmauer patrouillierten. Der Baron wusste von meinen nächtlichen Ausflügen und hatte kein Problem damit.