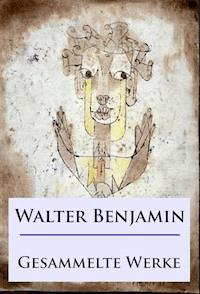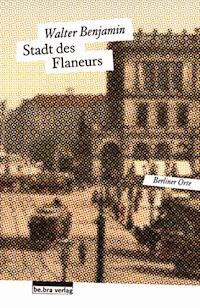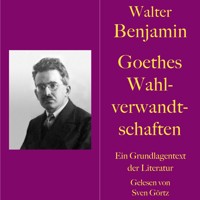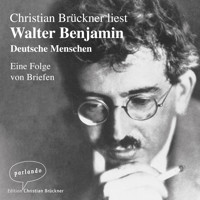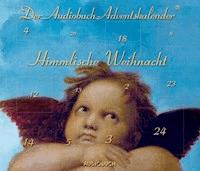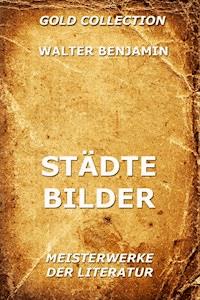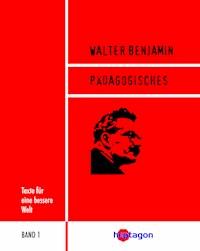Rundfunkgeschichten für Kinder: Benjamins Kasperle tobt durch die Welt des Radios E-Book
Walter Benjamin
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Rundfunkgeschichten für Kinder: Benjamins Kasperle tobt durch die Welt des Radios" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Walter Benjamin (1892-1940) war ein deutscher Philosoph, Literaturkritiker und Übersetzer der Werke von Balzac, Baudelaire und Marcel Proust. Aus dem Buch: "Zum ersten Mal habt ihr bei Hänsel und Gretel von Hexen gehört. Und was habt ihr euch dabei gedacht? Eine böse, gefährliche Waldfrau, die allein vor sich hinlebt und der man besser nicht in die Arme läuft. Sicher habt ihr euch nicht den Kopf zerbrochen, wie die Hexe zu dem Teufel oder dem lieben Gott steht, woher sie kommt, was sie tut und was sie nicht tut. Und genauso wie ihr haben die Menschen von den Hexen jahrhundertelang gedacht. Wie kleine Kinder Märchen glauben, so haben sie meist an die Hexen geglaubt." Inhalt: Berliner Dialekt Straßenhandel und Markt in Alt- und Neuberlin Berliner Puppentheater Das dämonische Berlin Ein Berliner Straßenjunge Berliner Spielzeugwanderung I Berliner Spielzeugwanderung II Borsig Die Mietskaserne Theodor Hosemann Besuch im Messingwerk Fontanes "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" Hexenprozesse Räuberbanden im alten Deutschland Die Zigeuner Die Bastille, das alte französische Staatsgefängnis Caspar Hauser Dr. Faust Cagliostro Briefmarkenschwindel Die Bootleggers Neapel Untergang von Herculanum und Pompeji Erdbeben von Lissabon Theaterbrand von Kanton Die Eisenbahnkatastrophe vom Firth of Tay Die Mississippi-Überschwemmung 1927 Wahre Geschichten von Hunden
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rundfunkgeschichten für Kinder: Benjamins Kasperle tobt durch die Welt des Radios
28 spannende Geschichten und Anekdoten für Kinder und Erwachsene
Inhaltsverzeichnis
Berliner Dialekt
[1929]
Also ich will heute mit euch über die Berliner Schnauze sprechen; die sogenannte große Schnauze ist doch das erste, was allen einfällt, wenn man vom Berliner redet. Der Berliner, sagen die Leute in Deutschland, na ja, das ist eben der Mann, bei dem alles zu Hause anders und besser und schlauer gemacht wird wie bei uns. Wenn man’s ihm nämlich glaubt. Deswegen haben sie auch den Berliner nicht gern, wenigstens tun sie so. In Wirklichkeit ist es doch sehr schön, wenn man eine Hauptstadt hat, auf die man ein bißchen schimpfen kann.
Aber stimmt das nun überhaupt mit der Berliner Schnauze? Es stimmt und stimmt auch nicht. Jeder von euch kennt natürlich eine Menge Geschichten, wo diese Schnauze so weit aufgerissen wird, daß das Brandenburger Tor darin Platz hätte. Und nachher erzähle ich euch noch ein paar, die ihr vielleicht sogar nicht kennt. Aber wenn man’s sich dann näher überlegt, stimmt doch auch manches mit der großen Schnauze wieder nicht. Zum Beispiel, ganz einfach: andere Stämme und Landschaften machen viel Wesens von ihrer besonderen Sprache; Dialekt, so nennt man doch die Sprache, die in den einzelnen Städten oder Gegenden gesprochen wird. Also sie machen viel Wesens davon und sind stolz darauf und lieben ihre Dichter, die wie Reuter Mecklenburger Platt, wie Hebel Alemannisch, wie Gotthelf Schweizerdeutsch geschrieben haben. Und damit haben sie auch recht. Die Berliner sind aber, grade was ihr Berlinern angeht, immer sehr bescheiden gewesen. Sie haben sich eigentlich mehr wegen ihrer Sprache geschämt, wenigstens vor den feinen Leuten und vor den Fremden. Unter sich haben sie natürlich desto mehr Spaß dran gehabt. Sie haben sich auch über das Berlinern lustig gemacht, genauso wie über alles andere. Davon gibt es viele hübsche Geschichten, zum Beispiel: sitzt da ein Mann mit seiner Frau bei Tisch und sagt: »Wat, heute jibts schon wieder Bohnen, ick eßte sie doch erst jestern.« Da verbessert ihn aber seine Frau und sagt: »Man sacht nich, ick eßte, man sacht ick aß«, und da antwortet ihr der Mann: »Det mußt du vielleicht von dir sagen, ick brauch det von mir nich zu sagen.« Oder die bekannte Geschichte von dem Vater, der mit dem Sohn auf der Landpartie ist: »Wie heeßt der Schmetterling, Vater«, da sagt der Vater: »Heeßen heeßt et nich, heißen heeßt et.«
Und man mußte den Berlinern erst Mut machen, zu ihrer Sprache sich auch nach außen zu bekennen. Früher hatten sie das eigentlich nicht nötig. Vor hundert Jahren gab es schon Schriftsteller, die haben Berliner Typen aufgestellt, die dann in ganz Deutschland berühmt wurden. Die bekanntesten davon sind: der Schusterjunge, das Marktweib, der Budiker, der Straßenhändler, vor allem der berühmte Eckensteher Nante. Und dann habt ihr vielleicht einmal, wenn ihr alte Jahrgänge von einem Witzblatt in der Hand gehabt habt, die beiden berühmten Berliner gesehen, von denen der eine ganz dick ist und klein und der andere ganz lang und schmal; die redeten über Politik, und mal hießen sie Kielmeier und Strobelweber und Plümecke und Bohnhammel, mal Meck und Scherbel und zum Schluß einfach Müller und Schulze; und sie haben die schönsten berlinischen Sachen zusammengequatscht. Jede Woche stand etwas Neues davon in der Zeitung. Dann kam aber 1870 und die Reichsgründung, und die Berliner wollten auf einmal sehr hoch hinaus und sehr vornehm werden. Da mußten ihnen erst ein paar große Männer, vor denen sie ja immer Respekt haben, die Courage zu ihrem eigenen Dialekt wiedergeben. Zwei von denen sind komischerweise Maler und keine Dichter. Und es gibt eine Menge wunderschöne Geschichten von ihnen. Der eine, den kennen die meisten von euch aber nicht, ist der berühmte alte Max Liebermann, der noch lebt und wegen seiner schrecklichen Schnauze gefürchtet ist. Dem hat es nun aber einmal ein anderer Maler, Bondi heißt er, vor ein paar Jahren mächtig gegeben. Da saßen die beiden im Café einander gegenüber und unterhielten sich nett, und auf einmal sagt Liebermann zu dem Bondi: »Wissense Bondi, Sie sind ja ’n janz netter Kerl, wenn Se bloß nich so eklije Hände hätten.« Der Bondi sieht den Professor Liebermann an und sagt: »Herr Professor, da habense ja recht, aber sehnse, die Hände, die kann ick denn eben in meine Tasche stecken, aber wie machen Sie det mit Ihrn Kopp?« Und der andere große Berliner, von dem kennen viele von euch den Namen, der ist vor kurzem gestorben und heißt Heinrich Zille. Wenn der eine besonders schöne Geschichte hörte oder beobachtete, dann ließ er sie nicht einfach so dummweg drucken, sondern zeichnete ein famoses Bild dazu. Und diese Geschichten mit den Bildern hat man jetzt nach seinem Tode gesammelt, ihr könnt sie euch schenken lassen, und viele werdet ihr auch schon kennen. Oder kennt ihr etwa die nicht: ein Vater sitzt mit seinen drei Jungs bei Tisch. Es gibt Nudelsuppe. Da sagt der eine: »Oskar, seh mal, wie Vater die Nudeln um die Schnauze bammeln!« Da sagt der Älteste, der heißt Albert: »Justav, wie kannste denn zu Vater seine Fresse Schnauze sagen!« »Na«, sagt Gustav, »wennt sich der Ochse jefallen läßt!« Nun wird es aber dem Vater zu bunt, er springt auf und sucht nach dem Rohrstock. Und die drei Jungens, Gustav, Albert und Oskar, kriechen unter die Bettstelle. Der Vater versucht, sie herauszukriegen, aber das glückt ihm nicht, und schließlich sagt er zu dem Jüngsten: »Du komm man vor, Oskar, du hast ja nischt jesagt, dir tu ick ja nischt.« Da hört man die Stimme von Oskar unterm Bett: »Dir Aas kenn ick!« Nachher erzähl ich euch noch ein paar Geschichten von frechen Jöhren.
Aber ihr müßt nicht etwa denken, das Berlinische wäre eine Witzesammlung. Es ist eben eine ganz richtige und wundervolle Sprache. Man hat sogar eine richtige Grammatik dieser Sprache geschrieben. Hans Meyer, Direktor der alten Berliner Schule vom Grauen Kloster, hat sie verfaßt, und sie heißt »Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten«. Man kann auf Berlinisch so fein, so witzig, so zart, so klug sprechen wie nur in irgendeiner Sprache sonst. Nur muß man natürlich wissen, wo und wann. Das Berlinische ist eine Sprache, die aus der Arbeit kommt. Sie entsteht nicht bei dem Schriftsteller und bei dem Gelehrten sondern in der Mannschaftsstube und am Skattisch, auf dem Omnibus und im Leihhaus, im Sportpalast und in der Fabrik. Das Berlinisch ist eine Sprache von Leuten, die keine Zeit haben, die sich oft mit einer ganz kurzen Andeutung, einem Blick, einem halben Wort verständigen müssen. Das können nicht Leute, die sich gelegentlich dann und wann in Gesellschaft treffen, sondern nur welche, die sich regelmäßig, tagtäglich, unter ganz bestimmten unveränderten Bedingungen sehen. Unter solchen Leuten entstehen immer besondere Sprachen, und ihr selber habt in der Klasse das beste Beispiel dafür. Es gibt ja eine besondere Schülersprache. So gibt es auch besondere Ausdrücke unter den Arbeitern, unter den Sportsleuten, unter den Soldaten, unter den Dieben usw. usw. Und alle diese Sprachen steuern zum Berlinischen etwas bei, weil eben in Berlin all diese Menschen in den verschiedensten Berufen und Verhältnissen in großen Massen und in einem ungeheuren Tempo zusammenleben. Das Berlinische ist heute einer der schönsten und genauesten Ausdrücke von diesem rasenden Lebenstempo. – Natürlich ist es das nicht immer gewesen. Jetzt lese ich euch eine Berliner Geschichte aus einer Zeit vor, wo Berlin noch nicht die Vier-Millionen-Stadt war, sondern eine Stadt von ein paar hunderttausend Einwohnern.
»Bürstenbinder(trägt seine Bürsten und Besen, ist aber so betrunken, daß er seine Handelsartikel vergessen hat): Neunoogen! Neunoogen! Immer ran, wer Jeld hat!
Erster Schusterjunge: Hör’n Se, Herr Schrubber, wer von die Neunoogen en Paar ißt, der bekehrt sich. ( Er verläßt den Betrunkenen und schreit, indem er auf der Straße hin und her rennt:) Herrjees, nanu is et noch hübscher! Keen Mensch darf nich mehr aus’t Fenster roochen!
Mehrere Leute: Wat meenst du’n damit? Ist des wahr? Darf man nich mehr aus’t Fenster roochen? Det wär’ denn doch zu arch?
Erster Schusterjunge ( fortrennend): Nee! Man muß aus de Pfeife rochen!– Etsch, etsch!
Eckensteher Brisich(vor dem Museum): Det Haus freut mir, det Haus macht mir Spaß.
Eckensteher Lange: Wie so macht dir det Haus Spaß? –
Brisich(ein wenig turkelnd): Wie so es mir Spaß macht? Na, wegen die Adlersch da oben druf!
Lange: Na, wie so machen dir denn die Adlersch Spaß? –
Brisich: Weil des königliche Adlersch sind und doch Ecke stehen müssen! Denk’ dir, wenn ick son’n königlicher Adler wäre un da oben uf’t Museum Ecke stehen müßte als Verzierung! Det wüßt’ ick woll: wenn mir durschterte, verziert’ ick ’ne Weile nich, sondern zöge meine Pulle raus, jenösse Eenen, und schrie runter uf de Leute: ›Nehmen Se det jefälligst des Museum nich übel! Ein königlicher Adler erholt sich!‹«
Alle Sprachen ändern sich schnell, aber die Sprache einer Großstadt ändert sich noch viel schneller als die Sprache in ländlichen Gegenden. Nun hört euch einmal im Vergleich zu dieser kleinen Geschichte die Sprache eines Ausrufers von heute an. Der Mann, der sie aufgeschrieben hat, heißt Döblin und hat euch an einem der letzten Sonnabende von Berlin erzählt. Natürlich wird er sie nicht genau so gehört haben, wie er sie aufgeschrieben hat. Er hat sich eben oft auf den Alexanderplatz hingestellt und den Leuten zugehört, die ihr Zeug da verkaufen, und dann hat er das Beste zusammengeschrieben.
»Warum aber im Westen der feine Mann Schleifen trägt und der Prolet trägt keine? Herrschaften, treten Sie nur näher, Frollein, Sie auch, mit dem Herrn Gemahl, Jugendlichen ist der Eintritt erlaubt, für Jugendliche kostet es hier nicht mehr. Warum trägt der Prolet keine Schleifen? Weil er sie nicht binden kann. Da muß er sich einen Schlipshalter zu kaufen, und wenn er ihn gekauft hat, ist er schlecht und er kann den Schlips nicht mit binden. Das ist Betrug, das verbittert das Volk, das stößt Deutschland noch tiefer ins Elend, als es schon drin sitzt. Warum zum Beispiel hat man diese großen Schlipshalter nicht getragen? Weil man sich keine Müllschippen um den Hals binden will. Das will weder Mann noch Frau, das will nicht mal der Säugling, wenn der antworten könnte. Man soll darüber nicht lachen, Herrschaften, lachen Sie nicht, wir wissen nicht, was in dem lieben kleinen Kindergehirn vorgeht. Ach Gottchen, das liebe Köpfchen, son kleines Köpfchen und die Härchen, nicht, ist schön, aber Alimente zahlen, da gibts nichts zu lachen, das treibt in Not. Kaufen Sie sich solchen Schlips bei Tietz oder Wertheim, oder, wenn Sie bei Juden nicht kaufen wollen, woanders. Ich bin ein arischer Mann. Die großen Warenhäuser haben keinen Grund, sich von mir Reklame machen zu lassen, die können auch ohne mir bestehen. Kaufen Sie sich solchen Schlips, wie ich hier habe, und dann denken Sie daran, wie Sie ihn morgens binden sollen. Herrschaften, wer hat heutzutage Zeit, sich morgens einen Schlips zu binden, und gönnt sich nicht lieber die Minute mehr Schlaf. Wir brauchen alle viel Schlaf, weil wir viel arbeiten müssen und wenig verdienen. Ein solcher Schlipshalter erleichtert Ihnen den Schlaf. Er macht den Apotheken Konkurrenz, denn wer solchen Schlipshalter kauft, wie ich hier habe, braucht kein Schlafgift und keinen Schlummerpunsch und nichts. Er schläft ungewiegt wie das Kind an der Mutterbrust, weil er weiß: es gibt morgens kein Gedränge; was er braucht, liegt auf der Kommode fix und fertig und braucht bloß in den Kragen geschoben zu werden. Sie geben Ihr Geld für viel Dreck aus. Da haben Sie voriges Jahr die Ganofim gesehn im Krokodil, vorne gab es heiße Bockwurst, hinten hat Jolly gelegen im Glaskasten und hat sich den Sauerkohl um den Mund wachsen lassen. Das hat jeder von Ihnen gesehn, – treten Sie nur dichter zusammen, damit daß ich meine Stimme schonen kann, ich hab meine Stimme nicht versichert, mir fehlt noch die erste Anzahlung – wie Jolly im Glaskasten lag, das haben Sie gesehn. Wie sie ihm aber Schokolade zugesteckt haben, das haben Sie nicht gesehn. Hier kaufen Sie ehrliche Ware, es ist nicht Zelluloid, es ist Gummi gewalzt, ein Stück zwanzich Pfennig, drei Stück fuffzich.«
Hieran könnt ihr auch gleich sehen, wie nützlich die Berliner Schnauze sein kann, und wie jemand mit ihr Geld verdient, wenn er für seinen Krawattenbinder soviel Betrieb machen kann, als ob er ein ganzes Warenhaus leitet.
So eine Sprache erneuert sich jeden Augenblick. Alle Ereignisse, große und kleine, lassen ihren Abdruck darin zurück. Krieg und Inflation ebensogut wie ein Zeppelinbesuch oder der Einzug von Amanullah oder der eiserne Justav. Es gibt sogar richtige berlinische Sprachmoden. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an das berühmte »Bei mir«. Zum Beispiel: wenn einer angequatscht wird von einem, mit dem er nicht reden will, sagte er: »Bei mir Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche«. Das heißt eben: Türme. Und »türme« heißt ja auf Deutsch bekanntlich: »Mach, daß du fortkommst!« Oder ein kleiner Junge, dem man eine Bestellung aufgibt; und man fragt ihn: »Wirst du’s auch ordentlich besorgen?« Da sagt er: »Bei mir Schiefertafel«. (Auf mir könn’ Sie rechnen.)
An vielen von diesen Geschichten werdet ihr schon gemerkt haben, die große Schnauze ist nicht das einzig Merkwürdige an den Berlinern. Man kann zum Beispiel sehr unverschämt und dennoch sehr ungeschickt sein. Der Berliner, jedenfalls der beßre, verbindet aber seine Unverschämtheit immer mit sehr viel Schlagfertigkeit und Geist und Witz. Er läßt sich, wie man sagt, »nich for dumm verkaufen«. Da gibt es zum Beispiel diese schöne Geschichte von dem Herrn, der große Eile hat, sitzt in der Pferdedroschke, es geht ihm zu langsam: »Mein Gott, Kutscher, können Sie denn wirklich nicht schneller vorwärts kommen?« »Det schon, aber ick kann doch det Ferd nich jut alleene lassen.« Aber der richtige Berliner Witz geht gar nicht nur auf Kosten anderer Leute, sondern ebensogern auf Kosten des Witzbolds selbst. Das macht ihn so liebenswürdig und frei: Er macht auch vor dem eignen Dialekt nicht halt, es gibt viele hübsche Geschichten, welche das zeigen, z. B. kommt da ein Mann schon ein bißchen besoffen in die Kneipe und fragt: »Kricht man hier Rum?« »Ne«, sagt der Budiker, »hier setzt man sich.«
Also nun die versprochenen Geschichten von Kindern. Drei Jungen kommen in eine Drogerie. Einer verlangt »forn Jroschen Lakritze«. Der Verkäufer schleppt eine lange Leiter heran, steigt auf die oberste Stufe, füllt die Tüte und klettert wieder herunter. Als der Kleine bezahlt hat, sagt der zweite: »Ick mechte ooch forn Jroschen Lakritze!« Nun wird der Verkäufer schon ärgerlich und fragt schon, bevor er von neuem die Leiter raufklettert, den dritten: »Willste ooch forn Jroschen Lakritze?« »Nee«, sagt der. Nun klettert der Verkäufer wieder rauf, kommt wieder mit der vollen Tüte runter. Und nun wendet er sich zum dritten: »Und wat willst du, Kleener?« Da sagt der: »Ick möchte forn Sechser Lakritze.« – Oder: der Herr, der einen Jungen auf der Straße trifft: »Was, du rauchst schon, na warte, das sag ich deinem Lehrer.« »Wat denn, du oller Dussel, ick jeh ja noch jar nich zur Schule.« – Oder: da ist ein Junge in der Quinta, der kann es sich nicht abgewöhnen, »Du« zum Lehrer zu sagen. Der Lehrer heißt Ackermann. Er hört sich das eine Weile mit an, schließlich wird er wütend und sagt: »Du schreibst mir zu morgen hundertmal in dein Heft: ›Ich soll zu meinem Lehrer nicht Du sagen.‹« Am andern Tag kommt der Junge, gibt dem Lehrer das Heft ab, wirklich, hundertmal hat er aufgeschrieben: »Ich soll zu meinem Lehrer nicht Du sagen«, fast das halbe Heft voll. Der Lehrer zählt nach, es stimmt. »Wat«, sagt der Kleine, der neben ihm steht, »wat, Ackermann, da staunste!«
Ein andermal, wenn ihr wollt, kommt noch mehr Berlinisch. Aber ihr habt gar nicht nötig, darauf zu warten. Wer von euch die Augen und Ohren aufmacht, wenn er durch Berlin geht, kann viel mehr schöne Geschichten zusammenbringen, als er heute im Radio gehört hat.
Straßenhandel und Markt in Alt- und in Neuberlin
[1929/30]
Kennt ihr das Märchen vom Goldnen Topf, erinnert ihr euch an das seltsame Äpfelweib, dem der Student Anselmus da am Anfang begegnet? Oder kennt ihr Hauffs Märchen »Zwerg Nase«, das mit einem Markt beginnt, auf dem die Hexe mit spinnedürren Fingern die Waren betastet, um das Beste für sich nach Hause zu nehmen? Ist es euch nicht selbst schon, wenn ihr mit der Mutter den Markt betratet, spannend und festlich vorgekommen? Denn noch im einfachsten Wochenmarkt steckt etwas vom Zauber der orientalischen Märkte, der Bazare von Samarkand. Oder habt ihr den neuen Film gesehn, wo einer den Markt am Wittenbergplatz aufgenommen hat, und es ist spannender geworden als mancher Detektivfilm? Eins aber geht in den Film natürlich nicht hinein, und auch Bücher handeln davon nur selten: das Marktgespräch nämlich, das eigentliche Verhandeln und Handeln, all dies Hin und Her um Ware und Geld, das auf seine Weise ebenso saftvoll und üppig ist wie das Bild, das der Markt für die Augen bietet. Ganz besonders gilt das für den Berliner Markt. Vor mehreren Monaten sprach ich euch hier vom Dialekt von Berlin. Der Markt und der Straßenhandel überhaupt ist nun eine der Stellen, an denen sich das Berlinische am besten erlauschen, in seiner Entwicklung, Bewegung erfassen läßt. Vom alten und neuen Berliner Straßenhandel will ich euch heute erzählen.
Die Marktweiber waren schon im alten Berlin etwas ganz Besonderes. Sie hatten eben, als einzige unter allen Händlerinnen, Erlaubnis, ihre Ware auf dem Wochenmarkt auszubieten, und werden meist Bauernfrauen gewesen sein, die Erzeugnisse aus der eigenen Wirtschaft feilboten. Ganz anders die sogenannten Hökerfrauen. Sie durften keine besseren Waren führen und mußten obendrein als Entgelt für ihre Handelserlaubnis im Monat vier Pfund Wolle fürs Lagerhaus spinnen. Da ihnen auch das Einkaufen außerordentlich beschränkt war – sie durften nicht von den Bauern aufkaufen, sondern nur an Markttagen zu später Stunde die Reste an sich bringen – so machten die Hökerinnen elende Geschäfte und schlugen sich mit ihrer Familie notdürftig durch. Das war schon im 18. Jahrhundert so. Und wollte damals eine Frau aus niederem Stand zum Familienunterhalt beitragen, wie so viele Soldatenweiber, so blieb ihr manchmal gar nichts weiter übrig, als Hökerin zu werden. Für eine regelrechte Marktfrau gab es denn auch keine größere Beleidigung, als wenn man sie »Hökerin« nannte. Glassbrenner hat in einer von seinen besten Szenen so eine Marktfrau und ihre weltberühmte Berliner Schnauze geschildert und was ihr alles einfällt, um einem Kunden, der sie grad eben »Hökerin« geschimpft hat, heimzuleuchten. »Hökerin?« wiederholt sie, steht auf und stemmt den Arm in die Seite: »Hörn Se mal, Sie olle Bulldogge, nu blaffen Se mal nen Ogenblick vor ne andre Tiere oder ick tret Ihnen uffn Fuß, det Se acht Tage lang winseln sollen.« – Der Herr sagt: »Nein, das ist doch merkwürdig, was diese Hökerinnen schimpfen können.« – Hökerin: »Schimpfen? – Son dämlicher Lulatsch wie er is, dem kann man ja gar nich schimpfen, der is ja schon allens doppelt und dreifach jewesen, wat man Niederträchtjes von ihm sagen kann. Son Schatten von Mannsperson will Leute zum besten haben. Er ausjehungerter Federfuchser, er will die Leute hier schikanieren? Die Leute will er hier schikanieren? Soll er sich doch lieber an nen Jaljen hängen, damit kein anständijer Mensch mehr an ihm ein Verbrechen bejeht. Soll er sich doch lieber zusammenknautschen und zum Lumpenmann jehn und sich forn viertel Pfund Lumpen verkoofen. Nehm er sich doch Kiessand und scheuer sich reene, damit nuscht mehr von ihm übrig bleibt. Häng er sich an nen Mond, damit die Lüderjahns früh zu Hause jehn! Und nehm er sich ja in acht, det er die Kurrendejungens nicht zu nah kommt, sonst singen die: Jott bewahre mir in Jnaden.« – Es war ein richtiger Sport geworden, die Marktweiber zum Schimpfen zu reizen. Man sieht ja hier, daß es sich lohnte. Richtig von Herzen und mit Ausdauer schimpfen können, ist eben ein großes Talent. Das kann nicht jeder, der es gern möchte. Dazu gehört nicht nur viel Grobheit und eine gesunde Lunge, sondern ein großer Wortschatz und nicht zuletzt Geist. Daß man den Budenbesitzerinnen und Marktweibern von Berlin den gern zuspricht, davon zeugt manche hübsche Geschichte. Zum Beispiel diese, in der erzählt wird, wie eine Obstverkäuferin auf dem Totenbett liegt, und das Sterben wird ihr sehr schwer. Ihr Mann steht daneben, weiß nicht recht, was er sagen soll, und versucht, sie zu trösten: »Gräme dir nich darüber, det du sterben mußt; det find sich allens, det wird allens schon jehn! Seh mal, eenmal müssen wir ja alle in unserm Leben sterben!« – »Schafskopp«, lispelt die arme Frau, »det is es ja eben! Wenn man zehnmal oder zwölfmal sterben müßte, denn würd ick mir aus det eine Mal jar nischt machen.« Das große Berliner Schlagwort »Bange machen gilt nicht« ist auch für diesen Typus der Wahlspruch gewesen. Besonders läßt sich der Berliner bekanntlich von Bildung nicht imponieren. Oder wenn er es tut, dann läßt er sich’s doch nicht merken. Wir haben ein schönes Berliner Bild aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Damals gab es ja noch kaum Witzblätter. Dafür waren in den Buch- und Papierhandlungen einzelne Bilder mit Unterschriften zu kaufen, die oft von großen Künstlern, von Hosemann, Franz Krüger, Dörbeck und andern gemacht waren, häufig in Tuschfarben. Also von einem dieser Bilder spreche ich hier. Da sieht man in der Nähe des Brandenburger Tores eine dicke Obstfrau vor ihren Körben sitzen, und neben ihr stehen ein besserer Herr nebst Begleitung, Fremde, wie man ihnen ansieht, die sich in Berlin nicht auskennen. »Liebste Frau«, sagt der Herr und zeigt auf die Victoria auf dem Brandenburger Tor, »können Sie mir nicht sagen, was das da oben auf dem Tor für eine Puppe ist?« – Antwort: »Ja nu, wat wird det sind. Alte römische Geschichte, Kurfürsten von Brandenburj, siebenjährijer Kriej, det is et!« – »Ach so«, sagt der Herr, »na ich danke auch sehr.«
Ich möchte nicht behaupten, daß dieser Berliner Typ heute ausgestorben ist. Nur sind die Klassenunterschiede schärfer geworden, das Volk bleibt mehr unter sich, es ist heute nicht mehr so leicht, als Kunde im Rummel der Markttage diesen Leuten näher zu kommen. Darum ist auch für so klassisch schöne Schimpfereien, wie Glassbrenner sie uns überliefert hat, keine Zeit mehr. Die heutigen Marktfrauen sind mehr Geschäftsfrauen geworden, und die Fleischer, die auf den Markt kommen, haben ihre Vorratskammern in den großen Kühlhallen, wo sie vor Beginn des Marktes aufladen und nach dem Markt wieder abladen. Dafür haben wir ein andres Schauspiel, das es als Augenweide gewiß mit dem Ohrenschmaus des alten Berliner Wochenmarktes aufnehmen kann: die Markthallen. Für mich war es, wie ich klein war, ein großes Fest, in die Markthalle am Magdeburger Platz mitgenommen zu werden, wo es im Winter so warm und an heißen Tagen so kühl war. Alles ist da anders wie auf Wochenmärkten im Freien. Zunächst die riesigen Haufen von Ware der gleichen Art, die hier in den Ständen scharf aneinandergrenzen. Vor allem aber der Geruch, der sich im geschlossenen Raum aus Fischen, Käse, Blumen, rohem Fleisch und Früchten ganz anders als unter freiem Himmel mischt, und der in seinem Unentschiedenen und Schummrigen so gut zu dem Licht paßt, das durch die trüben, in Blei gefaßten Scheiben hereindringt. Nicht zu vergessen den Steinboden, der immer in Abwässern oder Spülicht gebadet daliegt, und über den man wie über schlüpfrigen, kalten Meerboden hinspaziert. Weil ich, seitdem ich klein war, kaum je in einer Markthalle wieder gewesen bin, darum hat ein Besuch in ihnen für mich den ganzen Reiz von früher behalten. Und wenn ich mir ein besonderes Fest machen will, dann gehe ich nachmittags zwischen vier und fünf manchmal in der Markthalle an der Lindenstraße spazieren. Vielleicht begegne ich da mal einem von euch. Aber wir werden uns nicht erkennen. Das ist die Schattenseite vom Rundfunk.
Manche Art Handel ist nun freilich ganz und gar aus den Straßen Berlins verschwunden. So die Sandwagen, die bis ungefähr 1900 vor jedem Hause und auf jedem Hof ihr: »Sand, weeßen Sand!« ausriefen. Sie kamen aus den Rehbergen im Norden, vom Kreuzberg aus dem Süden und aus allen andern Richtungen mit dem weißen Sand, den die Hausfrauen einst zum Bestreuen der weißgescheuerten Dielen brauchten. Oder die Bücklingswagen. Oder die Kolporteure, Hunderte von ärmlichen Existenzen, die mit Schundromanen mit bunten Bildern oder am häufigsten vielleicht mit Noten und Liedertexten gehandelt haben. Vor der Entwicklung des Reklamewesens war ja der Buchhandel, wenn er seine Erzeugnisse bis ins Volk herunter vertreiben wollte, auf Kolporteure angewiesen. Man möchte sich gern den vollkommnen Bücherreisenden dieser Zeit und dieser Volksschichten vorstellen, den Mann, der es verstand, Geister- und Rittergeschichten in die Dienstbotenkammern der Städte und die Bauernstuben der Dörfer zu bringen. Er mußte selber ein wenig in die Geschichten hineinpassen, die er absetzte. Nicht als Held natürlich, nicht als junger, verstoßner Prinz oder fahrender Ritter, wohl aber als der zweideutige Greis, der Warner oder Verführer, der in so vielen dieser Geschichten auftritt. Die Blätter, die er damals für wenige Pfennige verkaufte, und besonders die sogenannten Neuruppiner Bilderbogen von Gustav Kühn sind heute sehr selten und gesuchte Kostbarkeiten geworden.
Kolporteure also gibt es wenigstens in Berlin heute so gut wie gar nicht mehr. Dafür gibt es aber die Bücherwagen. Der Bücherverkäufer von der Berliner Straße ist der einzige Buchhändler, den man heute noch bei der Lektüre seiner eigenen Bücher antreffen kann. Oft sitzt so ein Mann auf der schmalen Steinrampe eines Gartens oder auf einem Feldstühlchen, das er mitgebracht hat, und läßt sich durch die Leute, die seinen Wagen beschnuppern, nicht stören. Denn er weiß, daß unter zehnen vielleicht noch nicht einer ist, der da ernstliche Absichten hat. Überhaupt, wäre er auf die angewiesen, die mit ernsthaften Absichten kommen, dann wäre es hoffnungslos. Aber der Trick der Bücherwagen ist eben: hier kaufen Leute Bücher, die eigentlich morgens, als sie von Hause fortgingen, nicht im Traum dran gedacht haben. Gelegenheitsleser, Gelegenheitsliebhaber. Nur in der Inflation war es anders. Wer da noch einen Pfennig für Bücher ausgeben konnte, der fand auf den Bücherwagen Kostbarkeiten zum hundertsten oder tausendsten Teil ihres Werts. Denn zu der Geldentwertung kam die Ahnungslosigkeit dieser meist nicht sehr beschlagenen Verkäufer hinzu, und die Sammler haben davon Gebrauch gemacht.
Der Mann am Bücherwagen ist schweigsam. Aber er ist eine Ausnahme; denn im allgemeinen ist der Berliner Straßenhandel die hohe Schule der Berliner Schnauze, die eigentliche Berliner Rednerakademie. Ich werde euch jetzt zum Schluß so eine echte Berliner Meisterschaftsrede halten, wie man sie allerdings nicht grade täglich auf der Straße zu hören bekommt. Das werdet ihr selbst schon bemerkt haben, daß so ein Redner, um in Schwung zu kommen, sich gewissermaßen selbst aufzieht, daß er, schon ehe noch irgendwer achtgibt oder zuhört, vor seinem »Universellen Fleckenreiniger«, seinem Selbstbinder, seinem Kristallpalastkitt sich aufstellt und mit Todesverachtung in die leere Luft hinein eine Ansprache hält, sie womöglich mit Gebärden begleitet, bis eben irgend jemand anbeißt. Anbeißt, das heißt hier aber nicht: kauft. Der Kauf ist im Straßenhandel nur das letzte Glied einer Kette. Das erste ist jedenfalls die Begeisterung des Redners, das zweite aber, daß Zuhörer und Zuschauer sich einfinden müssen, je mehr desto besser. Der Straßenhändler steht in der Mitte. Er hat seine Rede auswendig gelernt, wiederholt sie immer von neuem. Das wissen seine Hörer so gut wie er. Und für sie ist eben das Interessante, wie er sich trotzdem mit Abschweifungen, Variationen etc. aus der Affäre zieht, oder wie er dann wieder manche wichtigen Stellen jedesmal in genau der gleichen Betonung und mit der Präzision eines Grammophons herausbringt. Ist dann endlich einer der Umstehenden mürbe und kauft etwas, so muß er vortreten und steht mit dem Verkäufer im Mittelpunkt eines Kreises, wie zwei Schauspieler in der Mitte einer Arena stehen. Und diese Attraktion, etwas aufzuführen, eine Rolle zu spielen, gesehn zu werden, ist ein Hauptanreiz zum Kaufen.
Hier also unser Mann mit dem Wäscheschoner: »Meine Herrschaften! Glauben Sie nicht, daß ich Ihnen hier etwas aufschwatzen will, was noch nicht erprobt ist. Sämtliche Kapazitäten des Fachs haben diesen Wäscheschoner untersucht und begutachtet. Wenn Sie sie sehen wollen – wenn Se näher treten wollen! Dieser Wäscheschoner ist das denkbar Praktischste, was Sie sich auf diesem Gebiet leisten können. So einfach – und elegant! Zugleich aber auch sparsam! In dieser Zeit, wo wir alle, wie wir da stehn, das Geld zweimal herumdrehn, eh’ wir’s ausgeben, und wo doch jeder sauber aussehen muß, der Karriere machen will – in dieser Zeit ist dieser Wäscheschoner der Rettungsengel für die ganze Welt. – Ja meine Herrschaften – Se lachen. Eines Tages werden Se einsehn, det ick nich zuviel jesacht habe.« Inzwischen hat sich schon ein dichter Kreis von 20 bis 30 Personen um den Händler angesammelt. Nun nimmt er seinen Wäscheschoner und erläutert ihn: »Sehn Sie, meine Herrschaften, Sie nehmen den weichen Stehumlegekragen, schlagen ihn auf, legen den steifen Wäscheschoner hinein – schlagen ihn zu – binden den Kragen um – und wie sitzt er nun? Straff und elegant! – Straff und elegant! Und auch die Krawatte sitzt nun besser. Und wenn sonst der Kragen schon nach wenigen Stunden unsauber aussah – jetzt können Sie ihn acht Tage tragen. Und immer ist er noch straff und elegant! Wer einen solchen Wäscheschoner trägt, wird stets alle Mitbewerber aus dem Felde schlagen, wenn er sich um eine Stelle bewirbt. Denn wie wird der Chef von ihm sagen: Ja, der Mann ist straff und elegant!« –
Wenn man so einer Rede zuhört, braucht man dem alten Berlin nicht nachzutrauern. Es steckt noch im neuen und ist so unverwüstlich wie unserm Redner sein Wäscheschoner.
Berliner Puppentheater
[1929]
Wenn ihr Berliner Kinder einmal ins Puppentheater gehen wollt, habt ihr es gar nicht leicht. In München gibt es zum Beispiel den berühmten Papa Schmidt, der in einem eigenen Theater, das die Stadt München für ihn gebaut hat, mindestens zweimal die Woche spielt. In Paris gibt es auch ein ständiges Kasperltheater, sogar mehrere, die stehen im Luxembourg, das ist dasselbe wie hier der Tiergarten. In Rom gibt es das berühmte »Teatro dei piccoli«, d. h. »Das Theater der Kleinen«: nicht etwa für die Kleinen, sondern von den Kleinen, nämlich den Puppen, und schon ebensosehr für die Großen. Es ist überhaupt dem Puppentheater so gegangen. Lange war es eine Sache für Kinder und für die einfachen Leute, dann ist es allmählich heruntergekommen, niemand hat sich mehr drum gekümmert, und als es wieder entdeckt wurde, war es auf einmal etwas sehr Vornehmes, nur für Erwachsene und sogar nur für die feinen Leute. Nur der Kasperle hat immer zu den Kindern gehalten. Im Sommer kann man sogar in Berlin noch einen ganz schönen Kasperle sehen. Im Lunapark, am Ende der großen Eingangsallee, spielt er den ganzen Nachmittag, nur etwas zu kurz und zu oft dasselbe.
Vor hundert Jahren war es gerade umgekehrt. Da kam der Kasperl im Winter. Und zwar genau um diese Zeit, kurz vor Weihnachten. Und mit ihm eine Menge von andern Puppen, meist unter seinem Oberbefehl. Denn das ist ja das Merkwürdige am Kasperl, daß er nicht nur in den Stücken vorkommt, die man für ihn geschrieben hat, sondern immer frech die Nase in allerhand große, richtige Theaterstücke für die Erwachsenen steckte. Er wußte eben, er kann es riskieren. In den schrecklichsten Trauerspielen passierte ihm nichts. Und wenn der Teufel den Faust holt, muß er den Kasperl doch leben lassen, der es gar nicht besser getrieben hat als sein Herr. Er ist eben ein kurioser Kerl. Oder, wie er selbst sagt: »Ich bin immer ’n kurioser Mensch gewesen. Schon als Junge sparte ich mir immer mein Taschengeld. Und wenn ich etwas zusammen hatte, wissense, wat ick denn damit machte, ich ließ mir ’n Zahn ausziehen.« Also, wenn Weihnachten herankam, erschienen dann an den Straßenecken Anschlagzettel, rote oder grüne, blaue oder gelbe, auf denen zum Beispiel zu lesen stand:
»Der geschundene Raubritter oder Liebe und Menschenfraß oder Gebratenes Menschenherz und Menschenhaut. Danach großes Metamorphosenkunstballett, worin mehrere, ganz nach dem Leben tanzende Figuren und Verwandlungen durch ihre niedlichen, kunstgerechten Bewegungen das Auge des Zuschauers angenehm überraschen werden. Zum Schluß wird der Wunderhund Pussel sich sehr auszeichnen. Um keine Störung zu befürchten, so werden ungesittete Knaben nicht hereingelassen; so ist der Eintrittspreis gestellt: 2 Silbergroschen, 6 Pfennig, für Kinder wie erwachsene Personen.«
Solche Aufführungen waren immer mit den sogenannten »Humoristischen Weihnachtsausstellungen« verbunden, die alljährlich in ein paar berühmten Konditoreien stattfanden. Auf diesen Ausstellungen war eigentlich nichts ausgestellt als ein paar große, farbige Figuren aus Zucker. Da hieß es zum Beispiel:
»Bei dem Konditor Zimmermann in der Königstraße sind feine Zuckerbilder von allen Sorten, nebst dem Brandenburger Tor aus Tragant ausgestellt.« Die Hauptsache aber war dann natürlich das Puppentheater. Dabei ging es im Zuschauerraum nicht immer sehr zimperlich und manierlich zu. Besonders, als später die Vorstellungen in den Konditoreien abgelöst wurden von Julius Lindes mechanischem Marionettentheater oder Nattkes großem Badebassin-Theatersalon, Palisadenstraße 76, wo angezeigt stand: »Unterhaltung durch Laune und anständigen Witz sind von allbekannter Güte«. Die anständige Unterhaltung hinderte aber nicht, daß, wie wir hören, oben im Rang Jungens von 10 bis 14 Jahren mit großen Pfeifen oder Zigarren dasaßen und aus hohen Gläsern Bier tranken.
Der berühmte Berliner Schriftsteller Glassbrenner, der solche Aufführungen beschrieben hat, hat dabei auch die Musik nicht vergessen: das Quartett, von welchem er sagt, daß fünf Mann dazu gehören, von denen einer immer nur mit Kümmel oder Branntwein begleitet.
Wollen wir einmal hören, was da gespielt wurde. Zum Beispiel: »Die Reise um die Erde in 80 Tagen«, »Der Mord im Weinkeller«, »Käthchen von Heilbronn«, »Der Lumpenball oder der verhängnisvolle Affe mit Feuerwerk«, »Der Freischütz«.
Wenn man jemanden fragen würde, woher er glaubt, daß das Puppentheater kam, würde er wahrscheinlich sagen: »Weil es eben viel billiger ist als ein richtiges Theater«. Das ist schon richtig. Aber das ist nur eine kleine, angenehme Nebenerscheinung an diesen Puppen, daß sie nichts essen und kein Gehalt verlangen. In den allerältesten Zeiten war das Puppentheater nicht nur eine spaßige, sondern manchmal auch eine heilige Sache, weil die Puppen Götter vorstellten. (Bei manchen Völkern auf den Südseeinseln ist es noch heute so. Sie machen Puppen aus Stroh bis zur Höhe von 30 Metern. Dann stecken sie einen Mann hinein, der sie bewegt und ein paar Schritt mit ihnen tanzt. Wenn der Mann dann erschöpft unter dem Gewicht zusammenbricht und die Puppe hinfällt, stürzen sich die Wilden darauf, zerreißen sie und bringen die Fetzen als schützende Zaubermittel nach Hause.) Wie aber das Puppentheater später in Deutschland aufkam, ist noch viel merkwürdiger. Das war nach dem dreißigjährigen Kriege. Die Söldnerhaufen zogen im Lande herum, hatten keine Beschäftigung und keinen Sold mehr und machten die Straßen unsicher. So unsicher, daß den Schauspielern, die von Berufs wegen viel unterwegs sein mußten und doch meist nur auf dem Theater fechten und schießen können, die Sache verleidet wurde. Da kam man auf den Gedanken, sie durch Marionetten zu ersetzen, und bei dieser Gelegenheit merkte man bald, was für ein wunderbares Theaterinstrument diese Puppen waren. Vor allem widersprechen sie nie. Sie haben zwar einen eigenen Kopf, noch dazu einen, der im Verhältnis zum Körper viel größer und schwerer ist als beim Schauspieler; und auch im Ausdruck ist er eigensinniger und starrer. Aber das ist nun das Sonderbare, und ihr werdet es ja im Puppentheater beobachtet haben. So ein hölzernes, scharfes Gesicht scheint doch im Mienenspiel alle kleinen und feinen Zuckungen dieses Körperchens zu begleiten, wenn ein richtiger Puppenspieler dahintersteht. Ein richtiger Puppenspieler ist ein Despot, gegen den der Zar nur ein kleiner Gendarm ist. Stellt euch vor, er dichtet seine Stücke allein, malt die Dekorationen selber, schnitzt sich die Puppen so, wie er sie haben will, spricht fünf bis sechs, ja manchmal noch viel mehr Rollen mit seiner eigenen Stimme. Und nirgends trifft er auf Schikanen, Hemmungen, Hindernisse. Auf der anderen Seite aber muß er dann auch mit seinen Puppen mitgehen, die für ihn etwas Lebendiges werden. Alle großen Puppenspieler versichern, das Geheimnis der Sache sei eigentlich, der Puppe ihren eigenen Willen zu lassen, ihr nachzugeben. Der große Dichter Heinrich von Kleist (das sage ich für die paar Erwachsenen, die hier sich zwischen den Kindern versteckt haben und denken, ich sehe sie nicht) hat in seinem Aufsatz über das Marionettentheater sogar bewiesen, daß der Puppenspieler sich ganz und gar wie ein Tänzer verhalten muß, wenn er die Figuren richtig bewegen will. Dann kommt dieser schönste Anblick zustande, wie die Kleinen gleichsam mit ihren Zehenspitzen den Boden kitzeln, weil sie ja, wie die Engel, von oben herunter kommen und nicht, wie richtige Schauspieler, an die Schwerkraft gebunden sind. Aber ihre Überlegenheit hat ihnen auch schon viel Haß und Verfolgungen eingetragen. Erstens durch die Kirche und durch die Obrigkeit, weil die Puppen sich so leicht, ohne boshaft zu werden, über alles mokieren können. Sie brauchen ja die größten Männer nur nachzumachen, dann sieht es so aus: »Was der Mann kann, das kann ja jede Puppe.« So haben sie zum Beispiel im alten Österreich die Tyrannen lächerlich gemacht. Dann aber sind sie bisweilen auch eine gefährliche Konkurrenz für die richtigen Theater gewesen. In Paris zum Beispiel haben die Schauspieler nicht geruht, bis sie sie aus der inneren Stadt in die äußersten Gegenden des Weichbildes verjagt hatten.
Daß die großen Puppenspieler große Originale gewesen sind, ist bekannt. Erstens leben sie nur für ihre Puppen, alles andere ist ihnen egal. Darum werden sie sehr alt. Der Papa Schmidt aus München ist 91 Jahre geworden. Und der berühmte Puppenspieler Winter, der die Kölner Puppenspiele eingeführt hat, in denen der Kaspar »Hänneschen« heißt, sogar 92. Zweitens: die Puppenspieler sind eine Art von Geheimverband. Bei ihnen erbt sich’s vom Vater auf den Sohn. Einer lernt’s vom andern auswendig. Und nachher trägt er die ganze Geschichte im Kopfe mit sich herum. Jeder von ihnen hat einen Schwur ablegen müssen, daß er niemals eine Zeile niederschreiben will, damit es nicht in unrechte Hände kommt, die ihnen das Brot wegnehmen. So ist es jedenfalls früher gewesen. Heute werden viele Puppenspiele gedruckt, aber die besten sind doch sicher die ungedruckten, die Kinder und Puppenspieler sich selbst machen. Natürlich mit Ausnahme der wundervollen Kasperlekomödien vom Grafen Pocci, die noch überall gespielt werden. Da war so ein ganz großer Puppenspieler, der hieß Schwiegerling. Ich habe selbst noch im Jahre 1918 das Schwiegerlingsche Marionettentheater in Bern gesehen, dann nie wieder etwas davon gehört oder gelesen. Es war schöner als alles, was man sich vorstellen kann. Schwiegerling hat die sogenannten Verwandlungspuppen oder Metamorphosen erfunden. Sein Marionettentheater war eigentlich mehr eine Zauberbude. Er gab nur ein Theaterstück jeden Abend. Vorher aber produzierten sich seine Kunstpuppen. An zwei Nummern kann ich mich noch erinnern. Kasperl kommt tanzend mit einer schönen Dame herein. Plötzlich, wie die Musik gerade am süßesten spielt, klappt die Dame ein, verwandelt sich in einen Luftballon, der Kasperl, weil er ihn aus Liebe festhält, in den Himmel entführt. Eine Minute bleibt die Bühne ganz leer, dann kommt Kasperl mit einem furchtbaren Krach heruntergefallen. Die andere Nummer war traurig. Auf einem Leierkasten spielt ein Mädchen, das aussieht, als wäre es eine verwunschene Prinzessin, eine traurige Melodie. Auf einmal klappt der Leierkasten ein. Zwölf zuckerwinzige Tauben fliegen heraus. Die Prinzessin aber versinkt mit hochgehobenen Armen stumm in der Erde. Und eben, wie ich dies erzähle, kommt mir noch eine andere Erinnerung von damals. Ein langer Clown steht auf der Bühne, verbeugt sich, beginnt zu tanzen. Während des Tanzens schüttelt er einen kleinen Zwergenclown aus dem Ärmel, der genauso rot-gelb geblümt gekleidet ist wie er; und so bei jedem zwölften Walzertakt einen neuen. Bis schließlich zwölf ganz gleiche Zwergen- oder Babyclowns um ihn im Kreise herumtanzen. Ich weiß schon, daß das unglaublich klingt, aber wahr ist es. Auf einer anderen Puppenbühne wieder war die Hauptattraktion ein Soldat, der rauchte und den Rauch von sich blies. Ein Hamburger Konkurrent von Schwiegerling ließ die »Öffentliche Enthauptung des Fräulein Dorothea« spielen; und setzte nach der Enthauptung Beifall ein, so bekam die Puppe ihren Kopf zurück und wurde nochmals geköpft. Dieser selbe Hamburger Puppenspieler gab seinem Kasperle immer eine Taube bei, so wie mit dem Wiener Wurstl ehemals ein Karnickel und mit dem französischen Guignol, so heißt dort das Kasperle, eine Katze auf das Theater kam.
Nun aber zurück nach Berlin. Ein andermal werde ich euch mehr von Puppen erzählen, inzwischen könnt ihr euch den »Pole Poppenspäler« von Storm holen, wo so ein großes Puppenspieleroriginal beschrieben ist. Wir hören noch von einer anderen, nämlich stummen Puppenvorstellung, die in Berlin um Weihnachten aufgemacht wurde. Sie ist eigentlich ein berlinisches und weltliches Gegenstück zu den süddeutschen frommen Krippen und hieß »Theatrum mundi«, Welttheater. Man sah in verschiedenen, auf der Bühne parallel laufenden, durch Versatzstücke voneinander getrennten Reihen Vorgänge des täglichen Lebens in beständiger Bewegung auf unsichtbaren Rollen an sich vorüberziehen. Wild vom Jäger und Hunden verfolgt; Wagen, Reiter und Fußgänger; weidendes Vieh; Schiffe mit Dampf oder Segel; ein Eisenbahnzug; Jungen, die sich balgten – alles kam in bestimmten Abständen wieder. Es war eine Art mechanischer Vorläufer des jetzigen Kinos.