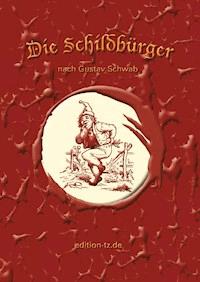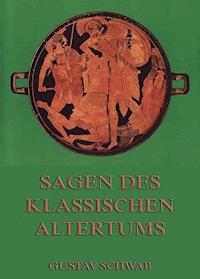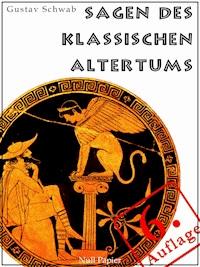
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Märchen bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Mit 96 Zeichnungen und ausführlichem, interaktiven Inhaltsverzeichnis. Überarbeitete Fassung mit neuem Einführungsaufsatz. Man stelle sich eine Welt vor ohne die Abenteuer des Herkules, ohne den Kampf um Troja, ohne die Irrfahrten des Odysseus, ohne die Tragödie um Ödipus - unvorstellbar. Die Sagen des klassischen Altertums vereinen die größten Geschichten unserer europäischen Kultur und sind Grundlage und Ausgangspunkt unzähliger Variationen und Zitate geworden. Wer sie nicht kennt, weiß nichts. Über 1200 Seiten vereinen die gewaltigsten Abenteuer, die die Menschheitsgeschichte kennt. Sie zeugen von Göttergeburten und Schlachten, von Liebesepen und Tragödien. Sie sind das einzige deutschsprachige Standardwerk zur griechischen Mythologie. Diese Ausgabe beinhaltet die komplette dreibändige Version von Gustav Schwab, ergänzt durch mehrere kürzere Sagen, die Gotthold Klee 1881 als Herausgeber der 14. Auflage hinzufügte. Band 1: Sagen, die vor dem Trojanischen Krieg stattgefunden haben. Hierzu zählen die Prometheussage, die Argonautensage und der Mythos um den Vatermörder Ödipus, der unwissentlich seine eigene Mutter heiratet. Band 2: Sage um Troja (Ilias) bis zum Niedergang der Stadt und den Sieg der Griechen. Band 3: Rückkehr aus Troja widerfährt. Hierzu gehört vor allem die bewegte Rückreise des Odysseus, die sogenannte Odyssee. Auch die sagenhafte Gründung Roms fällt in diesen Zeitrahmen und wird von Schwab beschrieben. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1642
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gustav Schwab
Sagen des klassischen Altertums
Illustrierte Fassung
Gustav Schwab
Sagen des klassischen Altertums
Illustrierte Fassung
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: John FlaxmannFußnoten: Jürgen Schulze 7. Auflage, ISBN 978-3-954180-26-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur vierten digitalen Ausgabe
Gustav Schwab und die Sagen des klassischen Altertums
Erster Teil – Die kleineren Sagen
Erstes Buch
Prometheus
Die Menschenalter
Deukalion und Pyrrha
Io
Phaëton
Europa
Kadmos
Pentheus
Perseus
Ion
Dädalos und Ikaros
Zweites Buch – Die Argonautensage
Iason und Pelias
Anlaß und Beginn des Argonautenzuges
Die Argonauten zu Lemnos
Die Argonauten im Lande der Dolionen
Herakles zurückgelassen
Pollux und der Bebrykenkönig
Phineus und die Harpyien
Die Symplegaden
Weitere Abenteuer
Iason im Palaste des Aietes
Medea und Aietes
Der Rat des Argos
Medea verspricht den Argonauten Hilfe
Iason und Medea
Iason erfüllt des Aietes Begehr
Medea raubt das goldene Vlies
Die Argonauten, verfolgt, entkommen mit Medea
Weitere Heimfahrt der Argonauten
Neue Verfolgung der Kolcher
Letzte Abenteuer der Helden
Iasons Ende
Drittes Buch
Meleager und die Eberjagd
Tantalos
Pelops
Niobe
Salmoneus
Viertes Buch – Aus der Heraklessage
Herakles der Neugeborne
Die Erziehung des Herakles
Herakles am Scheidewege
Des Herakles erste Taten
Herakles im Gigantenkampfe
Herakles und Eurystheus
Die drei ersten Arbeiten des Herakles
Die vierte Arbeit des Herakles bis zur sechsten
Die siebente, achte und neunte Arbeit des Herakles
Die drei letzten Arbeiten des Herakles
Herakles und Eurytos
Herakles bei Admetos
Herakles im Dienste der Omphale
Die späteren Heldentaten des Herakles
Herakles und Deïanira
Herakles und Nessos
Herakles, Iole und Deïanira. Sein Ende
Fünftes Buch
Bellerophontes
Theseus
Die Sage von Ödipus
Sechstes Buch
Die Sieben gegen Theben
Die Sage von den Herakliden
Zweiter Teil – Die Sagen Trojas
Erstes Buch
Trojas Erbauung
Priamos, Hekabe und Paris
Der Raub der Helena
Die Griechen
Botschaft der Griechen an Priamos
Agamemnon und Iphigenia
Abfahrt der Griechen. Aussetzung des Philoktetes
Die Griechen in Mysien. Telephos
Paris zurückgekehrt
Die Griechen vor Troja
Zweites Buch
Ausbruch des Kampfes. Protesilaos. Kyknos
Palamedes und sein Tod
Taten des Achill und Ajax
Polydoros
Chryses, Apollo und der Zorn des Achill
Versuchung des Volkes durch Agamemnon
Paris und Menelaos
Drittes Buch
Pandaros
Die Schlacht. Diomedes
Glaukos und Diomedes
Hektor in Troja
Hektor und Ajax im Zweikampf
Waffenstillstand
Sieg der Trojaner
Botschaft der Griechen an Achill
Dolon und Rhesos
Zweite Niederlage der Griechen
Kampf um die Mauer
Kampf um die Schiffe
Die Griechen von Poseidon gestärkt
Hektor von Apollo gekräftigt
Tod des Patroklos
Jammer Achills
Viertes Buch
Achill neu bewaffnet
Achill und Agamemnon versöhnt
Schlacht der Götter und Menschen
Kampf des Achill mit dem Stromgotte Skamander
Schlacht der Götter
Achill und Hektor vor den Toren
Der Tod Hektors
Leichenfeier des Patroklos
Priamos bei Achill
Hektors Leichnam in Troja
Penthesilea
Memnon
Der Tod des Achill
Leichenspiele zu Ehren Achills
Fünftes Buch
Der Tod des großen Ajax
Machaon und Podaleirios
Neoptolemos
Philoktet auf Lemnos
Der Tod des Paris
Sturm auf Troja
Das hölzerne Pferd
Die Zerstörung Trojas
Menelaos und Helena. Polyxena
Abfahrt von Troja. Ajax des Lokrers Tod
Dritter Teil
Erstes Buch – Die letzten Tantaliden
Agamemnons Geschlecht und Haus
Agamemnons Ende
Agamemnon gerächt
Orestes und die Eumeniden
Iphigenia bei den Tauriern
Zweites Buch – Odysseus – Erster Teil
Telemach und die Freier
Telemach bei Nestor
Telemach zu Sparta
Verschwörung der Freier
Odysseus scheidet von Kalypso und scheitert im Sturm
Nausikaa
Odysseus bei den Phäaken
Odysseus erzählt den Phäaken seine Irrfahrten (Kikonen. Lotophagen. Zyklopen. Polyphem)
Odysseus erzählt weiter (Der Schlauch des Äolos. Die Lästrygonen. Kirke)
Odysseus erzählt weiter (Das Schattenreich)
Odysseus erzählt weiter (Die Sirenen. Skylla und Charybdis. Thrinakia und die Herden des Sonnengottes. Schiffbruch. Odysseus bei Kalypso)
Odysseus verabschiedet sich von den Phäaken
Drittes Buch – Odysseus – Zweiter Teil
Odysseus kommt nach Ithaka
Odysseus bei dem Sauhirten
Telemach verläßt Sparta
Gespräche beim Sauhirten
Telemach kommt heim
Odysseus gibt sich dem Sohne zu erkennen
Vorgänge in der Stadt und im Palast
Telemach, Odysseus und Eumaios kommen in die Stadt
Odysseus als Bettler im Saal
Odysseus und der Bettler Iros
Penelope vor den Freiern
Odysseus abermals verhöhnt
Odysseus mit Telemach und Penelope allein
Die Nacht und der Morgen im Palaste
Der Festschmaus
Der Wettkampf mit dem Bogen
Odysseus entdeckt sich den guten Hirten
Die Rache
Bestrafung der Mägde
Odysseus und Penelope
Odysseus und Laërtes
Aufruhr in der Stadt durch Athene gestillt
Der Sieg des Odysseus
Viertes Buch – Äneas – Erster Teil
Äneas verläßt die trojanische Küste
Den Flüchtlingen wird Italien versprochen
Sturm und Irrfahrten. Die Harpyien
Äneas an der Küste Italiens. Sizilien und der Zyklopenstrand. Tod des Anchises
Äneas nach Karthago verschlagen
Venus von Jupiter mit Rom getröstet. Sie erscheint ihrem Sohne
Äneas in Karthago
Dido und Äneas
Didos Liebe betört den Äneas
Äneas verläßt auf Jupiters Befehl Karthago
Fünftes Buch – Äneas – Zweiter Teil
Der Tod des Palinurus. Landung in Italien. Latinus. Lavinia
Lavinia dem Äneas zugesagt
Juno facht Krieg an. Amata. Turnus. Die Jagd der Trojaner
Ausbruch des Krieges. Äneas sucht bei Euander Hilfe
Der Schild des Äneas
Turnus beim Lager der Trojaner
Nisus und Euryalus
Sturm des Turnus abgeschlagen
Äneas kommt ins Lager zurück
Äneas und Turnus kämpfen. Turnus tötet den Pallas
Turnus von Juno gerettet. Lausus und Mezentius von Äneas erschlagen
Sechstes Buch – Äneas – Dritter Teil
Waffenstillstand
Volksversammlung der Latiner
Neue Schlacht. Kamilla fällt
Unterhandlung. Versuchter Zweikampf. Friedensbruch. Äneas meuchlerisch verwundet
Äneas geheilt. Neue Schlacht. Sturm auf die Stadt
Turnus stellt sich zum Zweikampf und erliegt. Ende
Anhang
Nachtrag nach Gotthold Klee
Aktäon
Prokne und Philomela
Prokris und Kephalos
Äakos
Philemon und Baucis
Arachne
Midas
Hyakinthos
Atalante
Zethos und Amphion
Die Dioskuren
Melampus
Orpheus und Eurydike
Keyx und Halkyone
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Märchen bei Null Papier
Andersens Märchen
Die Märchen des Wilhelm Hauff
Weihnachten
Grimms Märchen
Tausendundeine Nacht - 4 Bände - Erwachsene Märchen aus 1001 Nacht
Grimms Sagen
Bunte Märchen
Sagen des klassischen Altertums
Grimms Märchen – Illustriertes Märchenbuch
Alice hinter den Spiegeln
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort zur vierten digitalen Ausgabe
Diese Ausgabe beinhaltet die komplette dreibändige Version von Gustav Schwab, ergänzt durch mehrere kürzere Sagen, die Gotthold Klee 1881 als Herausgeber der 14. Auflage hinzufügte.
Des Weiteren finden Sie hier auch die in vielen »entschärften« Ausgaben weggelassene Geschichte um Oedipus.
Die für diese Ausgabe erweiterten und überarbeiteten Zeichnungen stammen von John Flaxman.
Die vierte Ausgabe besitzt ein Stichwortverzeichnis (Index) zum schnelleren Auffinden einzelner Geschichten.
Fragen, Kritik oder Anregungen? Schreiben Sie an: redaktion@null-papier.de
Jürgen Schulze Neuss, Mai 2016
Gustav Schwab und die Sagen des klassischen Altertums
Dem Lehrer und Pfarrer Gustav Schwab ist es zu verdanken, dass die Sagen des klassischen Altertums in Deutschland, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf breite Rezeption stoßen. Seine Nacherzählungen der griechischen Mythen schrieb er in zeitgemäßer Sprache, die insbesondere Kindern und Jugendlichen Zugang zu diesem Kulturgut gewährten, das ihnen anderenfalls womöglich verwehrt geblieben wäre.
Ein schwäbischer Mentor
Im Stuttgart des Jahres 1792 geboren, als Sohn des Geheimen Hofrats Schwab, wächst Gustav in einem Elternhaus auf, das ihm die Werte evangelisch-humanistischer Bildung von Beginn an vermittelt. Nachdem der junge Mann das Gymnasium absolviert hat, studiert er Philologie und Philosophie, bevor er sich im Fach Theologie einschreibt.
Bereits im Alter von 25 Jahren wird Gustav Schwab als Professor für alte Sprachen an ein Stuttgarter Gymnasium berufen, acht Jahre später beginnt seine Mitarbeit für ein literarisches Magazin bei F. A. Brockhaus, dem er 20 Jahre lang treu bleiben wird. Als er schließlich 1828 bei Johann Friedrich Cotta als Verlagsredakteur eintritt, wird Schwab zum Förderer junger Literaten. Mit untrüglichem Gespür unterstützt er Autoren, deren Werke heute untrennbar mit der deutschen Romantik verbunden sind, beispielsweise Wilhelm Hauff und Eduard Mörike.
Dass Schwab 1837 das Pfarramt in Gomaringen – und später ein Stadtpfarramt – antritt, ist für den leidenschaftlichen Pädagogen kein Widerspruch; Lehren und Predigen sind so weit voneinander nicht entfernt. In Gomaringen verfasst er, innerhalb von zwei Jahren, »Die schönsten Sagen des klassischen Altertums«, indem er Originaltexte sammelt, übersetzt und redigiert. Er will zwar eine möglichst originalgetreue Übersetzung anfertigen, wie es zuvor Johann Heinrich Voß für die homerischen Epen getan hat, aber er bearbeitet die ausgewählten Mythen unter eindeutig pädagogischen Gesichtspunkten, indem er sie in Prosa überträgt und insbesondere erotische sowie grausame Schilderungen zensiert.
Als Autor veröffentlicht er zunächst Gedichte, bevor seine »Wanderungen durch Schwaben« erscheinen. Wie sehr ihm identitätsstiftende Erzählungen und Sagen am Herzen liegen, belegen weitere Publikationen, die sich hauptsächlich Nacherzählungen deutscher Volksliteratur widmen. Schwab ist eine feste Größe im Literaturbetrieb des südwestlichen Deutschlands, sowohl als Schriftsteller als auch durch sein Mäzenatentum, als er 1850 wegen eines ärztlichen Kunstfehlers stirbt. Gustav Schwabs letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Hoppenlaufriedhof in Stuttgart.
Die liebsten Sagen des Herrn Schwab
Das Sammlungswerk erscheint ursprünglich dreibändig, jeder Band ist in mehrere Bücher gegliedert. Der Autor bezieht Inhalte aus diversen griechischen und römischen Quellen ein, vor allem aus den Epen Homers, der »Theogonie« Hesiods, den Dramen des Aischylos, Ovids »Metamorphosen« und Vergils »Aeneis«. Nachdem Schwab im ersten Band die bedeutsamsten Städte, Helden sowie deren Geschlechter schildert, widmet er den zweiten Band ausschließlich Troja, in Anlehnung an die homerische »Ilias«. Der dritte Band umfasst, im ersten Buch, den Untergang des Geschlechtes der Tantaliden sowie im zweiten und dritten Buch eine erneute Entlehnung bei Homer, nämlich die Fahrten und die Heimkehr des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. In den verbleibenden drei Büchern geht es, in Anlehnung an Vergils »Aeneis«, schließlich um den mythischen Urvater Roms und um die Anfänge des römischen Imperiums.
Inhaltliche Parallelen zur biblischen Überlieferung, wie in »Deukalion und Pyrrha« dürften dem Pfarrer gefallen haben. Daneben sind ihm sowohl erzieherische Botschaften – wie in »Phaeton« (Selbstüberschätzung), »Ikaros« (Leichtsinn) oder »Salmoneus« (Überheblichkeit) – als auch Gründungsmythen wichtig, wie in »Kadmos« (Theben) und »Äneas« (Rom).
Der Verfasser ordnet die Sagen grob chronologisch, wobei er mit Ereignissen beginnt, die bereits der Herrschaft olympischer Götter zugeordnet sind. Lediglich der Titanensohn Prometheus findet als Auftakt positive Berücksichtigung, weshalb er in gewisser Weise ein Fremdkörper in der Sammlung bleibt. Solche inhaltlichen, dem strukturellen Aufbau geschuldeten, Brüche gibt es mehrfach: Wenn beispielsweise der Argonautensage die Geschichte des Argonauten Meleagros folgt, um willkürlich Tantalos sowie seinen Kindern Pelops und Niobe Platz zu machen, danach beziehungslos Salmoneus angefügt wird, um anschließend über den Argonauten Herakles zu berichten, erschließen sich die Zusammenhänge nicht ohne Weiteres. Während Tantalos und die Ursache des Fluchs der Tantaliden im ersten Band erklärt werden, taucht das Geschlecht erst im dritten Band wieder auf, als »Die letzten Tantaliden«. Die Komplexität und Tiefe der griechischen Mythen ist durch diese Gliederung schwer zu durchdringen – die Sammlung ist demnach kein in sich geschlossenes Werk. Was dem Verfasser hingegen sehr gut gelingt, nicht zuletzt durch seine poetische Sprache, ist die Vermittlung des den Mythen innewohnenden Zaubers und ihrer identitätsstiftenden Macht.
Der Jugend zur sittlichen Erbauung
Gustav Schwab sieht sich als wohlwollenden Lehrer und Pfarrer, mit Zuneigung zum Menschen und ganz besonders zur Jugend. Über die deutschen Volkssagen stellt er fest, dass sie voller Poesie und Sittlichkeit seien und somit dem Verfall der Moral entgegenwirken. Ähnlich denkt er über die kraftvollen Epen Homers, die freilich nicht das verkörpern, was ein evangelischer Pfarrer unter »sittlich« versteht. Gleichwohl will er die Geschichten nicht neu verfassen, sondern sie für die Jugend aufarbeiten, die sich an Heldensagen zwar erbauen kann, durch Hexameter aber, so Schwabs Annahme, womöglich überfordert ist. Zudem vertritt er die Ansicht, dass die Mythen einen beiläufig allgemeinbildenden Effekt besitzen, hinsichtlich Historie und Geografie beispielsweise. Der Autor will seine christliche Haltung nicht in den Vordergrund stellen, dennoch macht er im Vorwort der Originalausgabe darauf aufmerksam, dass das lesende Kind von den Eltern auf die Überlegenheit der eigenen Religion hingewiesen werden solle. Seine Aufgabe sieht Schwab in einer möglichst wortgetreuen Übersetzung und im Streichen erotischer sowie als zu gewalttätig empfundener Passagen. Einige Mythen entfallen deshalb vollständig, andere – wie den Ödipus-Mythos – »entschärft« er lediglich, weil er die Grundaussage als wertvoll erachtet. Seine Absicht ist, jungen Lesern die Wiege des europäischen Denkens und der abendländischen Literatur nahezubringen.
Wie gut ihm dies gelingt, bezeugt die Tatsache, dass seither Generationen junger Leser die griechischen Mythen zumindest auszugsweise kennen, bevor sie in der Schule die Voß’sche Übersetzung der »Ilias« lesen. Erwachsene, die keine höhere Bildung genossen haben, können ebenfalls auf Schwabs eingängige Übersetzung zurückgreifen, weshalb sie – beziehungsweise ihre modernere Fassung des Kinderbuchautors Josef Guggenmos – hierzulande bestimmend für die volkstümliche Rezeption klassisch-altertümlicher Mythen ist. Sowohl deutschsprachige Nacherzählungen als auch erweiterte Bearbeitungen der griechischen Sagen und der »Aeneis« fußen auf Schwabs Werk sowie auf den Übersetzungen anderer Altphilologen. Die zahlreichen einzelnen Quellen erstmals in Beziehung zueinander gesetzt zu haben, ist – trotz der Lückenhaftigkeit der Sammlung – das nicht zu überschätzende Verdienst Gustav Schwabs.
Erster Teil – Die kleineren Sagen
Erstes Buch
Prometheus
Himmel und Erde waren geschaffen: das Meer wogte in seinen Ufern, und die Fische spielten darin; in den Lüften sangen beflügelt die Vögel; der Erdboden wimmelte von Tieren. Aber noch fehlte es an dem Geschöpfe, dessen Leib so beschaffen war, daß der Geist in ihm Wohnung machen und von ihm aus die Erdenwelt beherrschen konnte. Da betrat Prometheus die Erde, ein Sprößling des alten Göttergeschlechtes, das Zeus entthront hatte, ein Sohn des erdgebornen Uranossohnes Iapetos, kluger Erfindung voll. Dieser wußte wohl, daß im Erdboden der Same des Himmels schlummre; darum nahm er vom Tone, befeuchtete denselben mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und formte daraus ein Gebilde nach dem Ebenbilde der Götter, der Herren der Welt. Diesen seinen Erdenkloß zu beleben, entlehnte er allenthalben von den Tierseelen gute und böse Eigenschaften und schloß sie in die Brust des Menschen ein. Unter den Himmlischen hatte er eine Freundin, Athene, die Göttin der Weisheit. Diese bewunderte die Schöpfung des Titanensohnes und blies dem halbbeseelten Bilde den Geist, den göttlichen Atem ein.
So entstanden die ersten Menschen und füllten bald vervielfältigt die Erde. Lange aber wußten diese nicht, wie sie sich ihrer edlen Glieder und des empfangenen Götterfunkens bedienen sollten. Sehend sahen sie umsonst, hörten hörend nicht; wie Traumgestalten liefen sie umher und wußten sich der Schöpfung nicht zu bedienen. Unbekannt war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu behauen, aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus dem gefällten Holze des Waldes zu zimmern und mit allem diesem sich Häuser zu erbauen. Unter der Erde, in sonnenlosen Höhlen, wimmelte es von ihnen, wie von beweglichen Ameisen; nicht den Winter, nicht den blütenvollen Frühling, nicht den früchtereichen Sommer kannten sie an sicheren Zeichen; planlos war alles, was sie verrichteten. Da nahm sich Prometheus seiner Geschöpfe an; er lehrte sie den Auf- und Niedergang der Gestirne beobachten, erfand ihnen die Kunst zu zählen, die Buchstabenschrift; lehrte sie Tiere ans Joch spannen und zu Genossen ihrer Arbeit brauchen, gewöhnte die Rosse an Zügel und Wagen; erfand Nachen und Segel für die Schiffahrt. Auch fürs übrige Leben sorgte er den Menschen. Früher, wenn einer krank wurde, wußte er kein Mittel, nicht was von Speise und Trank ihm zuträglich sei, kannte kein Salböl zur Linderung seiner Schäden; sondern aus Mangel an Arzneien starben sie elendiglich dahin. Darum zeigte ihnen Prometheus die Mischung milder Heilmittel, allerlei Krankheiten damit zu vertreiben. Dann lehrte er sie die Wahrsagerkunst, deutete ihnen Vorzeichen und Träume, Vogelflug und Opferschau. Ferner führte er ihren Blick unter die Erde und ließ sie hier das Erz, das Eisen, das Silber und das Gold entdecken; kurz, in alle Bequemlichkeiten und Künste des Lebens leitete er sie ein.
Im Himmel herrschte mit seinen Kindern seit kurzem Zeus, der seinen Vater Kronos entthront und das alte Göttergeschlecht, von welchem auch Prometheus abstammte gestürzt hatte.
Jetzt wurden die neuen Götter aufmerksam auf das eben entstandene Menschenvolk. Sie verlangten Verehrung von ihm für den Schutz, welchen sie demselben angedeihen zu lassen bereitwillig waren. Zu Mekone in Griechenland ward ein Tag gehalten zwischen Sterblichen und Unsterblichen, und Rechte und Pflichten der Menschen bestimmt. Bei dieser Versammlung erschien Prometheus als Anwalt seiner Menschen, dafür zu sorgen, daß die Götter für die übernommenen Schutzämter den Sterblichen nicht allzu lästige Gebühren auferlegen möchten. Da verführte den Titanensohn seine Klugheit, die Götter zu betrügen. Er schlachtete im Namen seiner Geschöpfe einen großen Stier, davon sollten die Himmlischen wählen, was sie für sich davon verlangten. Er hatte aber nach Zerstückelung des Opfertieres zwei Haufen gemacht; auf die eine Seite legte er das Fleisch, das Eingeweide und den Speck, in die Haut des Stieres zusammengefaßt, und den Magen oben darauf, auf die andere die kahlen Knochen, künstlich in das Unschlitt des Schlachtopfers eingehüllt. Und dieser Haufen war der größere. Zeus, der Göttervater, der allwissende, durchschaute seinen Betrug und sprach: »Sohn des Iapetos, erlauchter König, guter Freund, wie ungleich hast du die Teile geteilt!« Prometheus glaubte jetzt erst recht, daß er ihn betrogen, lächelte bei sich selbst und sprach: »Erlauchter Zeus, größter der ewigen Götter, wähle den Teil, den dir dein Herz im Busen anrät zu wählen.« Zeus ergrimmte im Herzen, aber geflissentlich faßte er mit beiden Händen das weiße Unschlitt. Als er es nun auseinandergedrückt und die bloßen Knochen gewahrte, stellte er sich an, als entdeckte er jetzt eben erst den Betrug, und zornig sprach er: »Ich sehe wohl, Freund Iapetionide, daß du die Kunst des Truges noch nicht verlernt hast!«
Zeus beschloß, sich an Prometheus für seinen Betrug zu rächen, und versagte den Sterblichen die letzte Gabe, die sie zur vollendeteren Gesittung bedurften, das Feuer. Doch auch dafür wußte der schlaue Sohn des Iapetos Rat. Er nahm den langen Stengel des markigen Riesenfenchels, näherte sich mit ihm dem vorüberfahrenden Sonnenwagen und setzte so den Stengel in glostenden Brand. Mit diesem Feuerzunder kam er hernieder auf die Erde, und bald loderte der erste Holzstoß gen Himmel. In innerster Seele schmerzte es den Donnerer, als er den fernhinleuchtenden Glanz des Feuers unter den Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, da des Feuers Gebrauch den Sterblichen nicht mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte Feuergott Hephaistos mußte ihm das Scheinbild einer schönen Jungfrau fertigen; Athene selbst, die, auf Prometheus eifersüchtig, ihm abhold geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang es mit einer goldenen Binde, die gleichfalls Hephaistos seinem Vater zulieb kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten herrlich verziert hatte. Hermes, der Götterbote, mußte dem holden Gebilde Sprache verleihen und Aphrodite allen Liebreiz. Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Gutes ein blendendes Übel geschaffen; er nannte das Mägdlein Pandora, das heißt die Allbeschenkte, denn jeder der Unsterblichen hatte ihr irgendein unheilbringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben.
Erschaffung der Pandora
Darauf führte er die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern lustwandelten. Alle miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu Epimetheus, dem argloseren Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen. Vergebens hatte diesen der Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Herrscher anzunehmen, damit dem Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort zurückzusenden.
Pandora wird von den Charitinnen und Horen geschmückt
Epimetheus, dieses Wortes uneingedenk, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden auf und empfand das Übel erst, als er es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen, von seinem Bruder beraten, frei vom Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit. Das Weib aber trug in den Händen ihr Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen.
Pandora wird von den Göttern und Menschen bewundert
Kaum bei Epimetheus angekommen, schlug sie den Deckel zurück, und alsbald entflog dem Gefäße eine Schar von Übeln und verbreitete sich mit Blitzesschnelle über die Erde.
Pandora wird von Hermes zur Erde gebracht
Ein einziges Gut war zuunterst in dem Fasse verborgen, die Hoffnung; aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel wieder zu, ehe sie herausflattern konnte, und verschloß sie für immer in dem Gefäß.
Epimetheus empfängt Pandora aus Hermes Händen
Das Elend füllte inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tag und bei Nacht unter den Menschen umher, heimlich und schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben; eine Schar von Fiebern hielt die Erde belagert, und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen beschleichend, beflügelte seinen Schritt.
Pandora öffnet das Gefäß
Hephaistos, Kratos und Bia fesseln Prometheus
Darauf wandte sich Zeus mit seiner Rache gegen Prometheus. Er übergab den Verbrecher dem Hephaistos und seinen Dienern, dem Kratos und der Bia (dem Zwang und der Gewalt). Diese mußten ihn in die skythischen Einöden schleppen und hier, über einem schauderhaften Abgrund, an eine Felswand des Berges Kaukasus mit unauflöslichen Ketten schmieden. Ungerne vollzog Hephaistos den Auftrag seines Vaters, er liebte in dem Titanensohne den verwandten Abkömmling seines Urgroßvaters Uranos, den ebenbürtigen Göttersprößling. Unter mitleidsvollen Worten und von den roheren Knechten gescholten, ließ er diese das grausame Werk vollbringen. So mußte nun Prometheus an der freudlosen Klippe hängen, aufrecht, schlaflos, niemals imstande, das müde Knie zu beugen. »Viele vergebliche Klagen und Seufzer wirst du versenden«, sagte Hephaistos zu ihm, »denn des Zeus Sinn ist unerbittlich, und alle, die erst seit kurzem die Herrschergewalt an sich gerissen,1 sind hartherzig.« Wirklich sollte auch die Qual des Gefangenen ewig oder doch dreißigtausend Jahre dauern. Obwohl laut aufseufzend und Winde, Ströme, Quellen und Meereswellen, die Allmutter Erde und den allschauenden Sonnenkreis zu Zeugen seiner Pein aufrufend, blieb er doch ungebeugten Sinnes. »Was das Schicksal beschlossen hat«, sprach er, »muß derjenige tragen, der die unbezwingliche Gewalt der Notwendigkeit einsehen gelernt hat.« Auch ließ er sich durch keine Drohungen des Zeus bewegen, die dunkle Weissagung, daß dem Götterherrscher durch einen neuen Ehebund mit der Thetis Verderben und Untergang bevorstehe, näher auszudeuten. Zeus hielt Wort; er sandte dem Gefesselten einen Adler, der als täglicher Gast an seiner Leber zehren durfte, die sich, abgeweidet, immer wieder erneuerte. Diese Qual sollte nicht eher aufhören, bis ein Ersatzmann erscheinen würde, der durch freiwillige Übernahme des Todes gewissermaßen sein Stellvertreter zu werden sich erböte.
Prometheus von Zeus in den Abgrund gestoßen
Jener Zeitpunkt erschien früher, als der Verurteilte nach dem Spruch des Göttervaters erwarten durfte. Als er viele Jahre an dem Felsen gehangen, kam Herakles des Weges, auf der Fahrt nach den Hesperiden und ihren Äpfeln begriffen. Wie er den Götterenkel am Kaukasus hängen sah und sich seines guten Rates zu erfreuen hoffte, erbarmte ihn sein Geschick, denn er sah zu, wie der Adler, auf den Knien des Prometheus sitzend, an der Leber des Unglücklichen fraß. Da legte er Keule und Löwenhaut hinter sich, spannte den Bogen, entsandte den Pfeil und schoß den grausamen Vogel von der Leber des Gequälten hinweg. Hierauf löste er seine Fesseln und führte den Befreiten mit sich davon. Damit aber Zeus’ Bedingung erfüllt würde, stellte er ihm als Ersatzmann den Zentauren Chiron, der erbötig war, an jenes Statt zu sterben; denn vorher war er unsterblich. Auf daß jedoch des Kroniden Urteil, der den Prometheus auf weit längere Zeit an den Felsen gesprochen hatte, auch so nicht unvollzogen bliebe, so mußte Prometheus fortwährend einen eisernen Ring tragen, an welchem sich ein Steinchen von jenem Kaukasusfelsen befand. So konnte sich Zeus rühmen, daß sein Feind noch immer an den Kaukasus angeschmiedet lebe.
Okeanos eilt Prometheus zu Hilfe
Die Okeaniden schwimmen zum gefesselten Prometheus
Zeus hatte den Kronos (Saturn), seinen Vater, und mit ihm die alten Götterdynastie gestürzt und sich des Olymps mit Gewalt bemächtigt. Iapetos und Kronos waren Brüder, Prometheus und Zeus Geschwisterkinder. <<<
Die Menschenalter
(Diese Sage ist unabhängig von der vorigen und stimmt nicht mit ihr überein.)
Die ersten Menschen, welche die Götter schufen, waren ein goldenes Geschlecht. Diese lebten, solange Kronos (Saturnus) dem Himmel vorstand, sorgenlos und den Göttern selbst ähnlich, von Arbeit und Kummer entfernt. Auch die Leiden des Alters waren ihnen unbekannt; an Händen, Füßen und allen Gliedern immer rüstig, freuten sie sich, von jeglichem Übel frei, heiterer Gelage. Die seligen Götter hatten sie lieb und schenkten ihnen auf reichen Fluren stattliche Herden. Wenn sie verscheiden sollten, sanken sie nur in sanften Schlaf. Solange sie aber lebten, hatten sie alle möglichen Güter; das Erdreich gewährte ihnen alle Früchte von selbst und im Überflusse, und ruhig, mit allen Gütern gesegnet, vollbrachten sie ihr Tagewerk. Nachdem jenes Geschlecht dem Beschlusse des Schicksals zufolge von der Erde verschwunden war, wurden sie zu frommen Schutzgöttern, welche, dicht in Nebel gehüllt, die Erde rings durchwandelten, als Geber alles Guten, Behüter des Rechts und Rächer aller Vergehungen.
Das goldene Zeitalter
Hierauf schufen die Unsterblichen ein zweites Menschengeschlecht, das silberne; dieses war schon weit von jenem abgeartet und glich ihm weder an Körpergestaltung noch an Gesinnung. Sondern ganze hundert Jahre wuchs der verzärtelte Knabe noch unmündig an Geist unter der mütterlichen Pflege im Elternhause auf, und wenn einer endlich zum Jünglingsalter herangereift war, so blieb ihm nur noch kurze Frist zum Leben übrig. Unvernünftige Handlungen stürzten diese neuen Menschen in Jammer; denn sie konnten schon ihre Leidenschaften nicht mehr mäßigen und frevelten im Übermute gegeneinander. Auch die Altäre der Götter wollten sie nicht mehr mit den gebührenden Opfern ehren. Deswegen nahm Zeus dieses Geschlecht wieder von der Erde hinweg; denn ihm gefiel nicht, daß sie der Ehrfurcht gegen die Unsterblichen ermangelten. Doch waren auch diese noch nicht so entblößt von Vorzügen, daß ihnen nach ihrer Entfernung aus dem Leben nicht einige Ehre zum Anteil geworden wäre, und sie durften als sterbliche Dämonen noch auf der Erde umherwandeln.
Das silberne Zeitalter
Nun erschuf der Vater Zeus ein drittes Geschlecht von Menschen; das hieß das eherne. Das war auch dem silbernen völlig ungleich, grausam, gewalttätig, immer nur den Geschäften des Krieges ergeben, immer einer auf des andern Beleidigung sinnend. Sie verschmähten es, von den Früchten des Feldes zu essen, und nährten sich vom Tierfleische; ihr Starrsinn war hart wie Diamant, ihr Leib von ungeheurem Gliederbau; Arme wuchsen ihnen von den Schultern, denen niemand nahekommen durfte. Ihre Wehr war Erz, ihre Wohnung Erz, mit Erz bestellten sie das Feld; denn Eisen war damals noch nicht vorhanden. Sie kehrten ihre eigenen Hände gegeneinander; aber so groß und entsetzlich sie waren, so vermochten sie doch nichts gegen den schwarzen Tod und stiegen, vom hellen Sonnenlichte scheidend, in die schaurige Nacht der Unterwelt hernieder.
Das eherne Zeitalter
Als die Erde auch dieses Geschlecht eingehüllt hatte, brachte Zeus, der Sohn des Kronos, ein viertes Geschlecht hervor, das auf der nährenden Erde wohnen sollte. Dies war wieder edler und gerechter als das vorige. Es war das Geschlecht der göttlichen Heroen, welche die Vorwelt auch Halbgötter genannt hat. Zuletzt vertilgte aber auch sie Zwietracht und Krieg, die einen vor den sieben Toren Thebens, wo sie um das Reich des Königes Ödipus kämpften, die andern auf dem Gefilde Trojas, wohin sie um der schönen Helena willen zahllos auf Schiffen gekommen waren. Als diese ihr Erdenleben in Kampf und Not beschlossen hatten, ordnete ihnen der Vater Zeus ihren Sitz am Rande des Weltalls an, im Ozean, auf den Inseln der Seligen. Dort führen sie nach dem Tode ein glückliches und sorgenfreies Leben, wo ihnen der fruchtbare Boden dreimal im Jahr honigsüße Früchte zum Labsal emporsendet.
Das eiserne Zeitalter
»Ach wäre ich«, so seufzet der alte Dichter Hesiod, der diese Sage von den Menschenaltern erzählt, »wäre ich doch nicht ein Genosse des fünften Menschengeschlechtes, das jetzt gekommen ist; wäre ich früher gestorben oder später geboren! denn dieses Menschengeschlecht ist ein eisernes! Gänzlich verderbt, ruhen diese Menschen weder bei Tage noch bei Nacht von Kümmernis und Beschwerden; immer neue nagende Sorgen schicken ihnen die Götter. Sie selbst aber sind die größte Plage. Der Vater ist dem Sohne, der Sohn dem Vater nicht hold; der Gast haßt den ihn bewirtenden Freund, der Genosse den Genossen; auch unter Brüdern herrscht nicht mehr herzliche Liebe wie vorzeiten. Dem grauen Haare der Eltern selbst wird die Ehrfurcht versagt, Schmachreden werden gegen sie ausgestoßen, Mißhandlungen müssen sie erdulden. Ihr grausamen Menschen, denket ihr denn gar nicht an das Göttergericht, daß ihr euren abgelebten Eltern den Dank für ihre Pflege nicht erstatten wollet? Überall gilt nur das Faustrecht; auf Städteverwüstung sinnen sie gegeneinander. Nicht derjenige wird begünstigt, der die Wahrheit schwört, der gerecht und gut ist, nein, nur den Übeltäter, den schnöden Frevler ehren sie; Recht und Mäßigung gilt nichts mehr, der Böse darf den Edleren verletzen, trügerische, krumme Worte sprechen, Falsches beschwören. Deswegen sind diese Menschen auch so unglücklich. Schadenfrohe, mißlaunige Scheelsucht verfolgt sie und grollt ihnen mit dem neidischen Antlitz entgegen. Die Göttinnen der Scham und der heiligen Scheu, welche sich bisher doch noch auf der Erde hatten blicken lassen, verhüllen traurig ihren schönen Leib in das weiße Gewand und verlassen die Menschen, um sich wieder in die Versammlung der ewigen Götter zurückzuflüchten. Unter den sterblichen Menschen blieb nichts als das traurige Elend zurück, und keine Rettung von diesem Unheil ist zu erwarten.«
Scham und Scheu flüchten auf den Olymp
Deukalion und Pyrrha
Als das eherne Menschengeschlecht auf Erden hauste und Zeus, dem Weltbeherrscher, schlimme Sage von seinen Freveln zu Ohren gekommen, beschloß er, selbst in menschlicher Bildung die Erde zu durchstreifen. Aber allenthalben fand er das Gerücht noch geringer als die Wahrheit. Eines Abends in später Dämmerung trat er unter das ungastliche Obdach des Arkadierkönigs Lykaon, welcher durch Wildheit berüchtigt war. Er ließ durch einige Wunderzeichen merken, daß ein Gott gekommen sei; und die Menge hatte sich auf die Knie geworfen. Lykaon jedoch spottete über diese frommen Gebete. »Laßt uns sehen«, sprach er, »ob es ein Sterblicher oder ein Gott sei!« Damit beschloß er im Herzen, den Gast um Mitternacht, wenn der Schlummer auf ihm lastete, mit ungeahntem Tode zu verderben. Noch vorher aber schlachtete er einen armen Geisel, den ihm das Volk der Molosser gesandt hatte, kochte die halb lebendigen Glieder in siedendem Wasser oder briet sie am Feuer und setzte sie dem Fremdling zum Nachtmahle auf den Tisch. Zeus, der alles durchschaut hatte, fuhr vom Mahle empor und sandte die rächende Flamme über die Burg des Gottlosen. Bestürzt entfloh der König ins freie Feld. Der erste Wehlaut, den er ausstieß, war ein Geheul, sein Gewand wurde zu Zotteln, seine Arme wurden zu Beinen: er war in einen blutdürstigen Wolf verwandelt.
Zeus kehrte in den Olymp zurück, hielt mit den Göttern Rat und gedachte das ruchlose Menschengeschlecht zu vertilgen. Schon wollte er auf alle Länder die Blitze verstreuen; aber die Furcht, der Äther möchte in Flammen geraten und die Achse des Weltalls verlodern, hielt ihn ab. Er legte die Donnerkeile, welche ihm die Zyklopen geschmiedet, wieder beiseite und beschloß, über die ganze Erde Platzregen vom Himmel zu senden und so unter Wolkengüssen die Sterblichen aufzureiben. Auf der Stelle ward der Nordwind samt allen andren die Wolken verscheuchenden Winden in die Höhlen des Äolos verschlossen und nur der Südwind von ihm ausgesendet. Dieser flog mit triefenden Schwingen zur Erde hinab, sein entsetzliches Antlitz bedeckte pechschwarzes Dunkel, sein Bart war schwer von Gewölk, von seinem weißen Haupthaare rann die Flut, Nebel lagerten auf der Stirne, aus dem Busen troff ihm das Wasser. Der Südwind griff an den Himmel, faßte mit der Hand die weit umherhangenden Wolken und fing an, sie auszupressen. Der Donner rollte, gedrängte Regenflut stürzte vom Himmel; die Saat beugte sich unter dem wogenden Sturm, darnieder lag die Hoffnung des Landmanns, verdorben war die langwierige Arbeit des ganzen Jahres. Auch Poseidon, des Zeus Bruder, kam ihm bei dem Zerstörungswerke zu Hilfe, berief alle Flüsse zusammen und sprach: »Laßt euren Strömungen alle Zügel schießen, fallt in die Häuser, durchbrechet die Dämme!« Sie vollführten seinen Befehl, und Poseidon selbst durchstach mit seinem Dreizack das Erdreich und schaffte durch Erschütterung den Fluten Eingang. So strömten die Flüsse über die offene Flur hin, bedeckten die Felder, rissen Baumpflanzungen, Tempel und Häuser fort. Blieb auch wo ein Palast stehen, so deckte doch bald das Wasser seinen Giebel, und die höchsten Türme verbargen sich im Strudel. Meer und Erde waren bald nicht mehr unterschieden; alles war See, gestadelose See. Die Menschen suchten sich zu retten, so gut sie konnten; der eine erkletterte den höchsten Berg, der andere bestieg einen Kahn und ruderte nun über das Dach seines versunkenen Landhauses oder über die Hügel seiner Weinpflanzungen hin, daß der Kiel an ihnen streifte. In den Ästen der Wälder arbeiteten sich die Fische ab; den Eber, den eilenden Hirsch erjagte die Flut; ganze Völker wurden vom Wasser hinweggerafft, und was die Welt verschonte, starb den Hungertod auf den unbebauten Heidegipfeln.
Ein solcher hoher Berg ragte noch mit zwei Spitzen im Lande Phokis über die alles bedeckende Meerflut hervor. Es war der Parnassos. An ihm schwamm Deukalion, des Prometheus Sohn, den dieser gewarnt und ihm ein Schiff erbaut hatte, mit seiner Gattin Pyrrha im Nachen heran. Kein Mann, kein Weib war je erfunden worden, die an Rechtschaffenheit und Götterscheu diese beiden übertroffen hätten. Als nun Zeus, vom Himmel herabschauend, die Welt von stehenden Sümpfen überschwemmt und von den vielen tausendmal Tausenden nur ein einziges Menschenpaar übrig sah, beide unsträflich, beide andächtige Verehrer der Gottheit, da sandte er den Nordwind aus, sprengte die schwarzen Wolken und hieß ihn die Nebel entführen; er zeigte den Himmel der Erde und die Erde dem Himmel wieder. Auch Poseidon, der Meeresfürst, legte den Dreizack nieder und besänftigte die Flut. Das Meer erhielt wieder Ufer, die Flüsse kehrten in ihr Bett zurück; Wälder streckten ihre mit Schlamm bedeckten Baumwipfel aus der Tiefe hervor, Hügel folgten, endlich breitete sich auch wieder ebenes Land aus, und zuletzt war die Erde wieder da.
Deukalion blickte um sich. Das Land war verwüstet und in Grabesstille versenkt. Tränen rollten bei diesem Anblick über seine Wangen, und er sprach zu seinem Weibe Pyrrha: »Geliebte, einzige Lebensgenossin! Soweit ich in die Länder schaue, nach allen Weltgegenden hin, kann ich keine lebende Seele entdecken. Wir zwei bilden miteinander das Volk der Erde, alle andren sind in der Wasserflut untergegangen. Aber auch wir sind unsres Lebens noch nicht mit Gewißheit sicher. Jede Wolke, die ich sehe, erschreckt meine Seele noch. Und wenn auch alle Gefahr vorüber ist, was fangen wir Einsamen auf der verlassenen Erde an? Ach, daß mich mein Vater Prometheus die Kunst gelehrt hätte, Menschen zu erschaffen und geformtem Tone Geist einzugießen!« So sprach er, und das verlassene Paar fing an zu weinen; dann warfen sie vor einem halb zerstörten Altar der Göttin Themis sich auf die Knie nieder und begannen zu der Himmlischen zu flehen: »Sag uns an, o Göttin, durch welche Kunst stellen wir unser untergegangenes Menschengeschlecht wieder her? O hilf der versunkenen Welt wieder zum Leben!«
»Verlasset meinen Altar«, tönte die Stimme der Göttin, »umschleiert euer Haupt, löset eure gegürteten Glieder und werfet die Gebeine eurer Mutter hinter den Rücken.«
Lange verwunderten sich beide über diesen rätselhaften Götterspruch. Pyrrha brach zuerst das Schweigen. »Verzeih mir, hohe Göttin«, sprach sie, »wenn ich zusammenschaudre, wenn ich dir nicht gehorsame und meiner Mutter Schatten nicht durch Zerstreuung ihrer Gebeine kränken will!« Aber dem Deukalion fuhr es durch den Geist wie ein Lichtstrahl. Er beruhigte seine Gattin mit dem freundlichen Worte: »Entweder trügt mich mein Scharfsinn, oder die Worte der Götter sind fromm und verbergen keinen Frevel! Unsere große Mutter, das ist die Erde, ihre Knochen sind die Steine; und diese, Pyrrha, sollen wir hinter uns werfen!«
Beide mißtrauten indessen dieser Deutung noch lange. Jedoch, was schadet die Probe, dachten sie. So gingen sie denn seitwärts, verhüllten ihr Haupt, entgürteten ihre Kleider und warfen, wie ihnen befohlen war, die Steine hinter sich. Da ereignete sich ein großes Wunder: das Gestein begann seine Härtigkeit und Spröde abzulegen, wurde geschmeidig, wuchs, gewann eine Gestalt; menschliche Formen traten an ihm hervor, doch noch nicht deutlich, sondern rohen Gebilden oder einer in Marmor vom Künstler erst aus dem Groben herausgemeißelten Figur ähnlich. Was jedoch an den Steinen Feuchtes oder Erdichtes war, das wurde zu Fleisch an dem Körper; das Unbeugsame, Feste ward in Knochen verwandelt; das Geäder in den Steinen blieb Geäder. So gewannen mit Hilfe der Götter in kurzer Frist die vom Manne geworfenen Steine männliche Bildung, die vom Weibe geworfenen weibliche.
Diesen seinen Ursprung verleugnet das menschliche Geschlecht nicht, es ist ein hartes Geschlecht und tauglich zur Arbeit. Jeden Augenblick erinnert es daran, aus welchem Stamm es erwachsen ist.
Io
Inachos, der uralte Stammfürst und König der Pelasger, hatte eine bildschöne Tochter mit Namen Io. Auf sie war der Blick des Zeus, des olympischen Herrschers, gefallen, als sie auf der Wiese von Lerna der Herden ihres Vaters pflegte. Der Gott ward von Liebe zu ihr entzündet, trat zu ihr in Menschengestalt und fing an, sie mit verführerischen Schmeichelworten zu versuchen: »O Jungfrau, glücklich ist, der dich besitzen wird; doch ist kein Sterblicher deiner wert, und du verdientest des höchsten Gottes Braut zu sein! Wisse denn, ich bin Zeus. Fliehe nicht vor mir. Die Hitze des Mittags brennt heiß. Tritt mit mir in den Schatten des erhabenen Haines, der uns dort zur Linken in seine Kühle einlädt; was machst du dir in der Glut des Tages zu schaffen? Fürchte dich doch nicht, den dunklen Wald und die Schluchten, in welchen das Wild hauset, zu betreten. Bin doch ich da, dich zu schirmen, der Gott, der den Zepter des Himmels führt und die zackigen Blitze über den Erdboden versendet.« Aber die Jungfrau floh vor dem Versucher mit eiligen Schritten, und sie wäre ihm auf den Flügeln der Angst entkommen, wenn der verfolgende Gott seine Macht nicht mißbraucht und das ganze Land in Finsternis gehüllt hätte. Rings umqualmte die Fliehende der Nebel, und bald waren ihre Schritte gehemmt durch die Furcht, an einen Felsen zu rennen oder in einen Fluß zu stürzen. So kam die unglückliche Io in die Gewalt des Gottes.
Traumbilder künden Io die Liebe des Zeus
Hera, die Göttermutter, war längst an die Treulosigkeit ihres Gatten gewöhnt, der sich von ihrer Liebe ab- und den Töchtern der Halbgötter und der Sterblichen zuwandte; aber sie vermochte ihren Zorn und ihre Eifersucht nicht zu bändigen, und mit immer wachem Mißtrauen beobachtete sie alle Schritte des Gottes auf der Erde. So schaute sie auch jetzt gerade auf die Gegenden hernieder, wo ihr Gemahl ohne ihr Wissen wandelte. Zu ihrem großen Erstaunen bemerkte sie plötzlich, wie der heitere Tag auf einer Stelle durch nächtlichen Nebel getrübt wurde und wie dieser weder einem Strome noch dem dunstigen Boden entsteige, noch sonst von einer natürlichen Ursache herrühre. Da kam ihr schnell ein Gedanke an die Untreue ihres Gatten; sie spähte rings durch den Olymp und sah ihn nicht. »Entweder ich täusche mich«, sprach sie ergrimmt zu sich selbst, »oder ich werde von meinem Gatten schnöde gekränkt!« Und nun fuhr sie auf einer Wolke vom hohen Äther zur Erde hernieder und gebot dem Nebel, der den Entführer mit seiner Beute umschlossen hielt, zu weichen. Zeus hatte die Ankunft seiner Gemahlin geahnt, und um seine Geliebte ihrer Rache zu entziehen, verwandelte er die schöne Tochter des Inachos schnell in eine schmucke, schneeweiße Kuh. Aber auch so war die Holdselige noch schön geblieben. Hera, welche die List ihres Gemahls alsbald durchschaut hatte, pries das stattliche Tier und fragte, als wüßte sie nichts von der Wahrheit, wem die Kuh gehöre, von wannen und welcherlei Zucht sie sei. Zeus, in der Not und um sie von weiterer Nachfrage abzuschrecken, nahm seine Zuflucht zu einer Lüge und gab vor, die Kuh entstamme der Erde. Hera gab sich damit zufrieden, aber sie bat sich das schöne Tier von ihrem Gemahl zum Geschenke aus. Was sollte der betrogene Betrüger machen? Gibt er die Kuh her, so wird er seiner Geliebten verlustig; verweigert er sie, so erregt er erst recht den Verdacht seiner Gemahlin, welche der Unglücklichen dann rasches Verderben senden wird! So entschloß er sich denn, für den Augenblick auf die Jungfrau zu verzichten, und schenkte die schimmernde Kuh, die er noch immer für unentdeckt hielt, seiner Gemahlin. Hera knüpfte, scheinbar beglückt durch die Gabe, dem schönen Tier ein Band um den Hals und führte die Unselige, der ein verzweifelndes Menschenherz unter der Tiergestalt schlug, im Triumphe davon. Doch machte der Göttin dieser Diebstahl selbst Angst, und sie ruhte nicht, bis sie ihre Nebenbuhlerin der sichersten Hut überantwortet hatte. Daher suchte sie den Argos, den Sohn des Arestor, auf, ein Ungetüm, das ihr zu diesem Dienste besonders geeignet schien. Denn Argos hatte hundert Augen im Kopfe, von denen nur ein Paar abwechslungsweise sich schloß und der Ruhe ergab, während die übrigen alle, über Vorder- und Hinterhaupt wie funkelnde Sterne zerstreut, auf ihrem Posten ausharrten. Diesen gab Hera der armen Io zum Wächter, damit ihr Gemahl Zeus die entrissene Geliebte nicht entführen könne. Unter seinen hundert Augen durfte Io, die Kuh, des Tags über auf einer fetten Trift weiden; Argos aber stand in der Nähe, und wo er sich immer hinstellen mochte, erblickte er die ihm Anvertraute; auch wenn er sich abwandte und ihr das Hinterhaupt zukehrte, hatte er Io vor Augen. Wenn aber die Sonne untergegangen war, schloß er sie ein und belastete den Hals der Unglückseligen mit Ketten; bittre Kräuter und Baumlaub waren ihre Speise, ihr Bett der harte, nicht einmal immer mit Gras bedeckte Boden, ihr Trank schlammige Pfützen. Io vergaß oft, daß sie kein Mensch mehr war; sie wollte, Mitleiden erflehend, ihre Arme zu Argos erheben, da ward sie erst daran erinnert, daß sie keine Arme mehr hatte. Sie wollte ihm in Worten rührende Bitten vortragen, dann entfuhr ihrem Munde ein Brüllen, daß sie vor ihrer eigenen Stimme erschrak, welche sie daran mahnte, wie sie durch ihres Räubers Selbstsucht in ein Tier verwandelt worden sei. Doch blieb Argos mit ihr nicht an einer Stelle, denn so hatte es ihn Hera geheißen, die durch Veränderung ihres Aufenthalts sie dem Gemahl um so gewisser zu entziehen hoffte. Daher zog ihr Wächter mit ihr im Lande herum, und so kam sie auch mit ihm in ihre alte Heimat, an das Gestade des Flusses, wo sie so oft als Kind zu spielen gepflegt hatte. Da sah sie zum ersten Mal ihr Bild in der Flut; als das Tierhaupt mit Hörnern ihr aus dem Wasser entgegenblickte, schauderte sie zurück und floh bestürzt vor sich selbst. Ein sehnsüchtiger Trieb führte sie in die Nähe ihrer Schwestern, in die Nähe ihres Vaters Inachos; aber diese erkannten sie nicht; Inachos streichelte wohl das schöne Tier und reichte ihm Blätter, die er von dem nächsten Strauche pflückte; Io beleckte dankbar seine Hand und benetzte sie mit Küssen und heimlichen menschlichen Tränen. Aber wen er liebkoste und von wem er geliebkost wurde, das ahnete der Greis nicht. Endlich kam der Armen, deren Geist unter der Verwandlung nicht gelitten hatte, ein glücklicher Gedanke. Sie fing an, Schriftzeichen mit dem Fuße zu ziehen, und erregte durch diese Bewegung die Aufmerksamkeit des Vaters, der bald im Staube die Kunde las, daß er sein eigenes Kind vor sich habe. »Ich Unglückseliger«, rief der Greis bei dieser Entdeckung aus, indem er sich an Horn und Nacken der stöhnenden Tochter hing, »so muß ich dich wiederfinden, die ich durch alle Länder gesucht habe! Wehe mir, du hast mir weniger Kummer gemacht, solange ich dich suchte, als jetzt, wo ich dich gefunden habe! Du schweigst? Du kannst mir kein tröstendes Wort sagen, mir nur mit einem Gebrüll antworten! Ich Tor, einst sann ich darauf, wie ich dir einen würdigen Eidam1 zuführen könnte, und dachte nur an Brautfackel und Vermählung. Nun bist du ein Kind der Herde…« Argos, der grausame Wächter, ließ den jammernden Vater nicht vollenden, er riß Io von dem Vater hinweg und schleppte sie fort auf einsame Weiden. Dann klomm er selbst einen Berggipfel empor und versah sein Amt, indem er mit seinen hundert Augen wachsam nach allen vier Winden hinauslugte.
Zeus konnte das Leid der Inachostochter nicht länger ertragen. Er rief seinem geliebten Sohne Hermes und befahl ihm, seine List zu brauchen und dem verhaßten Wächter das Augenlicht auszulöschen. Dieser beflügelte seine Füße, ergriff mit der mächtigen Hand seine einschläfernde Rute und setzte seinen Reisehut auf. So fuhr er von dem Palaste seines Vaters zur Erde nieder. Dort legte er Hut und Schwingen ab und behielt nur den Stab; so stellte er einen Hirten vor, lockte Ziegen an sich und trieb sie auf die abgelegenen Fluren, wo Io weidete und Argos die Wache hielt. Dort angekommen, zog er ein Hirtenrohr, das man Syrinx nennt, hervor und fing an, so anmutig und voll zu blasen, wie man von irdischen Hirten zu vernehmen nicht gewohnt ist. Der Diener Heras freute sich dieses ungewohnten Schalles, erhob sich von seinem Felsensitze und rief hernieder: »Wer du auch sein magst, willkommener Rohrbläser, du könntest wohl bei mir auf diesem Felsen hier ausruhen. Nirgends ist der Graswuchs üppiger für das Vieh als hier, und du siehst, wie behaglich der Schatten dieser dicht gepflanzten Bäume für den Hirten ist!« Hermes dankte dem Rufenden, stieg hinauf und setzte sich zu dem Wächter, mit welchem er eifrig zu plaudern anfing und sich so ernstlich ins Gespräch vertiefte, daß der Tag herumging, ehe Argos sich dessen versah. Diesem begannen die Augen zu schläfern, und nun griff Hermes wieder zu seinem Rohre und versuchte sein Spiel, um ihn vollends in Schlummer zu wiegen. Aber Argos, der an den Zorn seiner Herrin dachte, wenn er seine Gefangene ohne Fesseln und Obhut ließe, kämpfte mit dem Schlaf, und wenn sich auch der Schlummer in einen Teil seiner Augen einschlich, so wachte er doch fortdauernd mit dem andern Teile, nahm sich zusammen, und da die Rohrpfeife erst kürzlich erfunden worden war, so fragte er seinen Gesellen nach dem Ursprunge dieser Erfindung. »Das will ich dir gerne erzählen«, sagte Hermes, »wenn du in dieser späten Abendstunde Geduld und Aufmerksamkeit genug hast, mich anzuhören. In den Schneegebirgen Arkadiens wohnte eine berühmte Hamadryade (Baumnymphe), mit Namen Syrinx. Die Waldgötter und Satyrn, von ihrer Schönheit bezaubert, verfolgten sie schon lange mit ihrer Werbung, aber immer wußte sie ihnen zu entschlüpfen. Denn sie scheute das Joch der Vermählung und wollte, umgürtet und jagdliebend wie Artemis, gleich dieser in jungfräulichem Stande verharren. Endlich wurde auf seinen Streifereien durch jene Wälder auch der mächtige Gott Pan der Nymphe ansichtig, näherte sich ihr und warb um ihre Hand, dringend und im stolzen Bewußtsein seiner Hoheit. Aber die Nymphe verschmähte sein Flehen und flüchtete vor ihm durch unwegsam Steppen, bis sie zuletzt an das Wasser des versandeten Flusses Ladon kam, dessen Wellen doch noch tief genug waren, der Jungfrau den Übergang zu wehren. Hier beschwor sie ihre Schwestern, die Nymphen, ehe sie in die Hand des Gottes fiele, ihrer sich zu erbarmen und sie zu verwandeln. Indem kam der Gott herangeflogen und umfaßte die am Ufer Zögernde; aber wie staunte er, als er, statt eine Nymphe zu umarmen, nur ein Schilfrohr umfaßt hielt; seine lauten Seufzer zogen vervielfältigt durch das Rohr und wiederholten sich mit tiefem, klagendem Gesäusel. Der Zauber dieses Wohllautes tröstete den getäuschten Gott. ›Wohl denn, verwandelte Nymphe‹, rief er mit schmerzlicher Freude, ›auch so soll unsre Verbindung unauflöslich sein!‹ Und nun schnitt er sich von dem geliebten Schilfe ungleichförmige Röhren, verknüpfte sie mit Wachs untereinander und nannte die lieblich tönende Flöte nach dem Namen der holden Hamadryade; und seitdem heißt dieses Hirtenrohr Syrinx…«
So lautete die Erzählung des Götterboten, bei welcher er den hundertäugigen Wächter unausgesetzt im Auge behielt. Die Märe war noch nicht zu Ende, als er sah, wie ein Auge um das andere sich unter der Decke geborgen hatte und endlich alle die hundert Leuchten in dichtem Schlaf erloschen waren. Nun hemmte der Götterbote seine Stimme, berührte mit seinem Zauberstabe nacheinander die hundert eingeschläferten Augenlider und verstärkte ihre Betäubung. Während nun der hundertäugige Argos in tiefem Schlafe nickte, griff Hermes schnell zu dem Sichelschwerte, das er unter seinem Hirtenrocke verborgen trug, und hieb ihm den gesenkten Nacken, da wo der Hals zunächst an den Kopf grenzt, durch und durch. Kopf und Rumpf stürzten nacheinander vom Felsen herab und färbten das Gestein mit einem Strome von Blut.
Nun war Io befreit, und obwohl noch unverwandelt, rannte sie ohne Fesseln davon. Aber den durchdringenden Blicken Heras entging nicht, was in der Tiefe geschehen war. Sie dachte auf eine ausgesuchte Qual für ihre Nebenbuhlerin und sandte ihr eine Bremse, die das unglückliche Geschöpf durch ihren Stich zum Wahnsinn trieb. Diese Qual jagte die Geängstigte mit ihrem Stachel landflüchtig über den ganzen Erdkreis, zu den Skythen, an den Kaukasus, zum Amazonenvolke, zum Kimmerischen Isthmos und an die Mäotische See; dann hinüber nach Asien, und endlich nach langem, verzweiflungsvollem Irrlaufe nach Ägypten. Hier am Strande des Nilufers angelangt, sank Io auf ihre Vorderfüße nieder und hob, den Hals rücklings gebogen, ihre stummen Augen zum Olymp empor, mit einem Blicke voll Haders gegen Zeus. Den jammerte dieses Anblickes; er eilte zu seiner Gemahlin Hera, umfing ihren Hals mit den Armen, flehte um Barmherzigkeit für das arme Mädchen, das schuldlos an seiner Verirrung war, und schwor ihr beim Wasser der Unterwelt, bei dem die Götter schwören, von seiner Neigung zu ihr hinfort ganz abzulassen. Hera hörte während dieser Bitte das flehentliche Brüllen der Kuh, das zum Olymp emporstieg. Da ließ sich die Göttermutter erweichen und gab dem Gemahle Vollmacht, der Mißgestalteten den menschlichen Leib zurückzugeben. Zeus eilte zur Erde nieder und an den Nil. Hier strich er der Kuh mit der Hand über den Rücken. Da war es wunderbar anzuschauen: die Zotteln flohen vom Leibe des Tieres, das Gehörn schrumpfte zusammen, die Scheibe der Augen verengte sich, das Maul zog sich zu Lippen zusammen, Schultern und Hände kehrten wieder, die Klauen verschwanden, nichts blieb von der Kuh übrig als die schöne weiße Farbe. In ganz verwandelter Gestalt erhob sich Io vom Boden und stand aufrecht, in menschlicher Schönheit leuchtend. Am Nilstrome gebar sie dem Zeus den Epaphos, und weil das Volk die wunderbar Verwandelte und Errettete göttergleich ehrte, so herrschte sie lange mit Fürstengewalt über jene Lande. Doch blieb sie auch so nicht ganz von Heras Zorne verschont. Diese stiftete das wilde Volk der Kureten auf, ihren jungen Sohn Epaphos zu entführen, und nun trat sie aufs neue eine lange vergebliche Wanderung an, den Geraubten aufzusuchen. Endlich, nachdem Zeus die Kureten mit dem Blitz erschlagen, fand sie den entführten Sohn an der Grenze Äthiopiens wieder, kehrte mit ihm nach Ägypten zurück und ließ ihn an ihrer Seite herrschen. Er heiratete die Memphis, und diese gebar ihm Libya, von der das Land Libyen den Namen erhielt. Mutter und Sohn wurden von dem Nilvolke nach beider Tode mit Tempeln geehrt und erhielten, sie als Isis, er als Apis, göttliche Verehrung.
Phaëton
Auf herrlichen Säulen erbaut stand die Königsburg des Sonnengottes, von blitzendem Gold und glühendem Karfunkel schimmernd; den obersten Giebel umschloß blendendes Elfenbein, gedoppelte Türen strahlten in Silberglanz, darauf in erhabener Arbeit die schönsten Wundergeschichten zu schauen waren. In diesen Palast trat Phaëthon, der Sohn des Sonnengottes Phöbos, und verlangte den Vater zu sprechen. Doch stellte er sich nur von ferne hin, denn in der Nähe war das strahlende Licht nicht zu ertragen. Der Vater Phöbos, von Purpurgewand umhüllt, saß auf seinem fürstlichen Stuhle, der mit glänzenden Smaragden besetzt war; zu seiner Rechten und seiner Linken stand sein Gefolge geordnet, der Tag, der Monat, das Jahr, die Jahrhunderte und die Horen; der jugendliche Lenz mit seinem Blütenkranze, der Sommer mit Ährengewinden bekränzt, weinfarben der Herbst, der eisige Winter mit schneeweißen Haaren. Phöbos, in ihrer Mitte sitzend, wurde mit seinen allschauenden Augen bald den Jüngling gewahr, der über so viele Wunder staunte. »Was ist der Grund deiner Wallfahrt«, sprach er, »was führt dich in den Palast deines göttlichen Vaters, mein Sohn?« Phaëthon antwortete: »Erlauchter Vater, man spottet mein auf Erden und beschimpft meine Mutter Klymene. Sie sprechen, ich heuchle nur himmlische Abkunft und sei der Sohn eines dunklen Vaters. Darum komme ich, von dir ein Unterpfand zu erbitten, das mich vor aller Welt als deinen wirklichen Sprößling darstelle.« So sprach er; da legte Phöbos die Strahlen, die ihm rings das Haupt umleuchteten, ab und hieß ihn näher herantreten; dann umarmte er ihn und sprach: »Deine Mutter Klymene hat die Wahrheit gesagt, mein Sohn, und ich werde dich vor der Welt nimmermehr verleugnen. Damit du aber ja nicht ferner zweifelst, so erbitte dir ein Geschenk! Ich schwöre beim Styx, dem Flusse der Unterwelt, bei welchem alle Götter schwören, deine Bitte, welche sie auch sei, soll erfüllt werden!« Phaëthon ließ den Vater kaum ausreden. »So erfülle mir denn«, sprach er, »meinen glühendsten Wunsch, und vertraue mir nur auf einen Tag die Lenkung deines geflügelten Sonnenwagens.«
Schrecken und Reue ward sichtbar auf dem Angesichte des Gottes. Drei-, viermal schüttelte er sein umleuchtetes Haupt und rief endlich: »O Sohn, du hast mich ein sinnloses Wort sprechen lassen! O dürfte ich dir doch meine Verheißung nimmermehr gewähren! Du verlangst ein Geschäft, dem deine Kräfte nicht gewachsen sind; du bist zu jung; du bist sterblich, und was du wünschest, ist ein Werk der Unsterblichen! Ja, du erstrebest sogar mehr, als den übrigen Göttern zu erlangen vergönnt ist. Denn außer mir vermag keiner von ihnen auf der glutensprühenden Achse zu stehen. Der Weg, den mein Wagen zu machen hat, ist gar steil, mit Mühe erklimmt ihn in der Frühe des Morgens mein noch frisches Rossegespann. Die Mitte der Laufbahn ist zuoberst am Himmel. Glaube mir, wenn ich auf meinem Wagen in solcher Höhe stehe, da kommt mich oft selbst ein Grausen an, und mein Haupt droht ein Schwindel zu erfassen, wenn ich so herniederblicke in die Tiefe und Meer und Land weit unter mir liegt. Zuletzt ist dann die Straße ganz abschüssig, da bedarf es gar sicherer Lenkung. Die Meeresgöttin Thetis selbst, die mich in ihren Fluten aufzunehmen bereit ist, pflegt alsdann zu befürchten, ich möchte in die Tiefe geschmettert werden. Dazu bedenke, daß der Himmel sich in beständigem Umschwunge dreht und ich diesem reißenden Kreislaufe entgegenfahren muß. Wie vermöchtest du das, wenn ich dir auch meinen Wagen gäbe? Darum, geliebter Sohn, verlange nicht ein so schlimmes Geschenk und bessere deinen Wunsch, solange es noch Zeit ist. Sieh mein erschrecktes Gesicht an. O könntest du durch meine Augen in mein sorgenvolles Vaterherz eindringen! Verlange, was du sonst willst von alle Gütern des Himmels und der Erde! Ich schwöre dir beim Styx, du sollst es haben! – Was umarmst du mich mit solchem Ungestüm?«
Die Horen schirren die Rosse von Heras Wagen
Aber der Jüngling ließ mit Flehen nicht ab, und der Vater hatte den heiligen Schwur geschworen. So nahm er denn seinen Sohn bei der Hand und führte ihn zu dem Sonnenwagen, Hephaistos’ herrlicher Arbeit. Achse, Deichsel und der Kranz der Räder waren von Gold, die Speichen Silber; vom Joche schimmerten Chrysolithen und Juwelen. Während Phaëthon die herrliche Arbeit beherzt anstaunte, tat im geröteten Osten die erwachte Morgenröte ihr Purpurtor und ihren Vorsaal, der voll Rosen ist, auf. Die Sterne verschwanden allmählich, der Morgenstern ist der letzte, der seinen Posten am Himmel verläßt, und die äußersten Hörner des Mondes verlieren sich am Rande. Jetzt gibt Phöbos den geflügelten Horen den Befehl, die Rosse zu schirren; und diese führen die glutsprühenden Tiere, von Ambrosia gesättigt, von den erhabenen Krippen und legen ihnen herrliche Zäume an. Während dies geschah, bestrich der Vater das Antlitz seines Sohnes mit einer heiligen Salbe und machte es dadurch geschickt, die glühende Flamme zu ertragen. Um das Haupthaar legte er ihm seine Strahlensonne, aber er seufzte dazu und sprach warnend: »Kind, schone mir die Stacheln, brauche wacker die Zügel; denn die Rosse rennen schon von selbst, und es kostet Mühe, sie im Fluge zu halten; die Straße geht schräg in weit umbiegender Krümmung; den Südpol wie den Nordpol mußt du meiden. Du erblickst deutlich die Gleise der Räder. Senke dich nicht zu tief, sonst gerät die Erde in Brand; steige nicht zu hoch, sonst verbrennst du den Himmel. Auf, die Finsternis flieht, nimm die Zügel zur Hand; oder – noch ist es Zeit; besinne dich, liebes Kind; überlaß den Wagen mir, laß mich der Welt das Licht schenken, und bleibe du Zuschauer!«
Der Jüngling schien die Worte des Vaters gar nicht zu hören, er schwang sich mit einem Sprung auf den Wagen, ganz erfreut, die Zügel in den Händen zu haben, und nickte dem unzufriedenen Vater einen kurzen, freundlichen Dank zu. Mittlerweile füllten die vier Flügelrosse mit glutatmendem Wiehern die Luft, und ihr Huf stampfte gegen die Barren. Ohne etwas vom Lose ihres Enkels zu ahnen, öffnete Thetis, die Mutter Klymenes, die Schranken; die Welt lag in unendlichem Raume vor den Blicken des Knaben, die Rosse flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor ihnen lagen.
Inzwischen fühlten die Rosse wohl, daß sie nicht die gewohnte Last trugen und das Joch leichter sei als gewöhnlich; und wie Schiffe, wenn sie das rechte Gewicht nicht haben, im Meere schwanken, so machte der Wagen Sprünge in der Luft, ward hoch emporgestoßen und rollte dahin, als wäre er leer. Als das Rossegespann dies merkte, rannte es, die gebahnten Räume verlassend, und lief nicht mehr in der vorigen Ordnung. Phaëthon fing an zu erbeben, er wußte nicht, wohin die Zügel lenken, wußte den Weg nicht, wußte nicht, wie er die wilden Rosse bändigen sollte. Als nun der Unglückliche hoch vom Himmel abwärts sah, auf die tief, tief unter ihm sich hinstreckenden Länder, wurde er blaß, und seine Knie zitterten von plötzlichem Schrecken. Er sah rückwärts; schon lag viel Himmel hinter ihm, aber noch mehr vor seinen Augen. Beides ermaß er in seinem Geiste. Unwissend, was beginnen, starrte er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an; er wollte den Rossen rufen, aber er kannte ihre Namen nicht. Mit Grauen sah er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in abenteuerlichen Gestalten am Himmel herumhingen. Da ließ er, von kaltem Entsetzen gefaßt, die Zügel fahren, und wie diese herabschlotternd den Rücken der Pferde berührten, so verließen die Rosse ihre Spur, schweiften seitwärts in fremde Luftgebiete, gingen bald hoch empor, bald tief hernieder; jetzt stießen sie an den Fixsternen an, jetzt wurden sie auf abschüssigem Pfade in die Nachbarschaft der Erde herabgerissen. Schon berührten sie die erste Wolkenschicht, die bald entzündet aufdampfte. Immer tiefer stürzte der Wagen, und unversehens war er einem Hochgebirge nahe gekommen. Da lechzte vor Hitze der Boden, spaltete sich, und weil plötzlich alle Säfte austrockneten, fing er an zu glimmen; das Heidegras wurde weißgelb und welkte hinweg; weiter unten loderte das Laub der Waldbäume auf, bald war die Glut bei der Ebene angekommen; nun wurde die Saat weggebrannt; ganze Städte loderten in Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versengt; rings brannten Hügel, Wälder und Berge. Damals sollen auch die Mohren schwarz geworden sein. Die Ströme versiegten oder flohen erschreckt nach ihrer Quelle zurück, das Meer selbst wurde zusammengedrängt, und was jüngst noch See war, wurde trockenes Sandfeld.
Hera gebietet Helios, den Tag zu beenden
An allen Seiten sah Phaëthon den Erdkreis entzündet; ihm selbst wurde die Glut bald unerträglich; wie tief aus dem Innern einer Feueresse atmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Sohlen, wie der Wagen erglühte. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand emporgeschleuderte Asche nicht mehr ertragen; Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelgespann riß ihn nach Willkür fort; endlich ergriff die Glut seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend wurde er durch die Luft gewirbelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den Himmel zu schießen scheint. Ferne von der Heimat nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und bespülte ihm sein schäumendes Angesicht. Phöbos, der Vater, der dies alles mit ansehen mußte, verhüllte sein Haupt in brütender Trauer. Damals, sagt man, sei ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht vorübergeflogen. Der ungeheure Brand leuchtete allein.
Europa
Im Lande Tyrus und Sidon erwuchs die Jungfrau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der tiefen Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes. Zu dieser ward nachmitternächtlicherweile, wo untrügliche Träume die Sterblichen besuchen, ein seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es kam ihr vor, als erschienen zwei Weltteile in Frauengestalt, Asien und der gegenüberliegende, und stritten um ihren Besitz. Die eine der Frauen hatte die Gestalt einer Fremden; die andere – und dies war Asien – glich an Aussehen und Gebärde einer Einheimischen. Diese wehrte sich mit zärtlichem Eifer für ihr Kind Europa, sprechend, daß sie