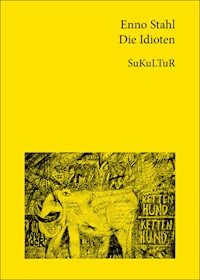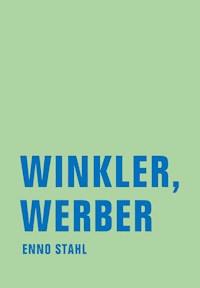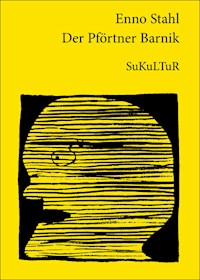Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor zehn Jahren: drei Menschen am Wasserturmplatz. Lynn ist Praktikantin in einem Architekturbüro und lernt das, was sie in ihrer Studie zu Sanierungsgebieten in Berlin erarbeitet hat, am eigenen Leibe kennen. Donata hingegen ist alleinerziehende Mutter und Redakteurin einer Gewerkschaftszeitung, sie muss sich durchbeißen – und aufsteigen. Ihr Ex-Freund, der Schriftsteller Otti, will dagegen an die Traditionen der Poeten des Prenzlauer Bergs anknüpfen und arbeitet an widerständigen Zeitschriftenprojekten. Stone wiederum hat sich von allen abgewandt, er will den Niedergang seines Kiezes nicht miterleben und zieht nach Neukölln – doch auch da holt ihn die Umwälzung der Stadtlandschaft ein. Enno Stahl zeigt in seinem großen Roman "Sanierungsgebiete", wie die Gentrifizierung den Menschen zunehmend die Partizipation am urbanen Leben versagt. Und wie sie die Kieze selbst verändert, wenn nicht verödet. Dies tut er als Erzähler, doch in die Geschichten seiner Figuren bettet er immer wieder historische Exkurse, Statistiken und Interviews mit realen Menschen ein, die die Umwandlung ihrer Straßen erleben mussten. So komponiert er ein mitreißendes vielstimmiges Konzert, das schließlich der Stadt selbst eine Stimme verleiht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 804
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vor zehn Jahren: drei Menschen am Wasserturmplatz. Lynn ist Praktikantin in einem Architekturbüro und lernt das, was sie in ihrer Studie zu Sanierungsgebieten in Berlin erarbeitet hat, am eigenen Leibe kennen. Donata hingegen ist alleinerziehende Mutter und Redakteurin einer Gewerkschaftszeitung, sie muss sich durchbeißen – und aufsteigen. Ihr Ex-Freund, der Schriftsteller Otti, will dagegen an die Traditionen der Poeten des Prenzlauer Bergs anknüpfen und arbeitet an widerständigen Zeitschriftenprojekten. Stone wiederum hat sich von allen abgewandt, er will den Niedergang seines Kiezes nicht miterleben und zieht nach Neukölln – doch auch da holt ihn die Umwälzung der Stadtlandschaft ein.
Enno Stahl zeigt in seinem großen Roman »Sanierungsgebiete«, wie die Gentrifizierung den Menschen zunehmend die Partizipation am urbanen Leben versagt. Und wie sie die Kieze selbst verändert, wenn nicht verödet. Dies tut er als Erzähler, doch in die Geschichten seiner Figuren bettet er immer wieder historische Exkurse, Statistiken und Interviews mit realen Menschen ein, die die Umwandlung ihrer Straßen erleben mussten. So komponiert er ein mitreißendes vielstimmiges Konzert, das schließlich der Stadt selbst eine Stimme verleiht.
Enno Stahl, geboren 1962, lebt in Neuss. Herausgeber von etwa »Popliteraturgeschichte(n)« oder dem »Karl Otten Lesebuch«. Zahlreiche Stipendien und Preise. 2004 erschien sein Roman »2PAC AMARU HECTOR«. Im Verbrecher Verlag erschienen außerdem die Romane »Diese Seelen« und »Winkler, Werber«, »Spätkirmes«, sowie der Essayband »Diskurspogo. Über Literatur und Gesellschaft«. Mit Ingar Solty gab er den Band »Richtige Literatur im Falschen? Schriftsteller – Kapitalismus – Kritik« heraus. 2019 erscheint außerdem im Alfred Kröner Verlag sein Essay »Die Sprache der Neuen Rechten. Populistische Rhetorik und Strategien«.
ENNO STAHL
SANIERUNGSGEBIETE
ROMAN
Gefördert durch Arbeitsstipendien der Filmstiftung NRW, des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Kultur und Sport des Landes NRW und der Stiftung Literatur – begründet von Dieter Lattmann. www.stiftung-literatur.de
Erste Auflage
Verbrecher Verlag Berlin 2019
www.verbrecherei.de
© Verbrecher Verlag 2019
Einband: Christian Walter
Satz: Laura Jacobi
Druck: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISBN: 978-3-95732-405-4
eISBN: 978-3-95732-419-1
Printed in Germany
Für KikiFür Siri
Inhalt
I. TEIL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
II. TEIL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Anhang / Danksagung
I. TEIL
I
Sssssssssirrrrrennnnde, silberhelle Delfinschnauze des ICE Heinrich Böll, Delfin Heinrich Böll verdrängt eistrockene Luft, die Luft Brandenburgs. Delfinschnauze, silberhell mit Sonnenamuletten, und windschnell, am Rande büscheln Birken, der Sand, der lichte Grund der sandigen Mark, und der Himmel steht so hoch, aus eisigem Blau gegossen, so ein Quadrathimmel, so ein umgekehrtes Terrarium das Ganze, in dem der ICE Heinrich Böll und die Birken und der Sand und die Felder und die paar Dorfflecken und die starren, gott- und autoverlassenen Straßen und die Menschen alle, die man nicht sieht, die Menschen und das alles – die Dekoration sind … ICE Heinrich Böll, Raketenwurm, rast über versehrte, ausgelaugte, wasserarme Böden, vorbei an diesen ehemaligen LPG-Höfen, in Konkurs gegangenen Betrieben, geschleiften Gewerbehallen, Ruinen von Betrieben, Brandmauern von Betrieben, Ruinen von Ansiedlungen, tote, unbelebte Gegend, von ihren Bewohnern keine Spur, wenn es denn Bewohner geben sollte …
Der Zug eilt der Hauptstadt zu, einer Hauptstadt im Sand, die Landschaft macht freundliche Miene, sie lockt mit Pappeln in kleinen Reihen, Pappelpartien mit Mistelkletten, dann mit einem Waldstück mit Eichen, Kiefern auch. Dieses flache Land in Staubgrau und Blattbraun, ein Maler bräuchte keine anderen Töne. Halt, hier kommt Grün, hier kommt Bauernland, hier kommt Landwirtschaft und Zivilisation, die Äcker sind sauber geharkt, und jetzt sogar Windräder, sehr viele Windräder, Energie für den Osten, Energie für Berlin. Selten ein schmuckes Gehöft hineingeworfen, winzige Oasen. Doch jetzt: Berlin-Spandau, eine Fabrik, aus deren Kühltürmen zäher Rauch quillt, eine gibt es noch in Berlin, eine Fabrik, und Schrebergärten, vereinzelt. Media Markt. Eine weitere Fabrik, eine Krähe steht in der Luft wie festgefroren, Vorortbahnhöfe, Messe-Süd, Charlottenburg, der alte Funkturm, längst ausgedientes Wahrzeichen, Herbstlaub, Kanal links, die Häuser auf Stelzen, und der Zug erst recht. Durchgrünter Beton, Graffiti, überall Graffiti, auf den Lärmschutzwänden rollt rauschend ein Farbfilm ab, Gedächtniskirche, Opernwerbung im XXL-Format, kleine Statuetten auf einem Hausabsatz, Heiligenfiguren direkt in Kopfhöhe, mit denen hätte man nicht gerechnet, so was Katholisches, Gläubiges, im steinernen Herzen Preußens. Nun wieder ein Aufbruch, Baustellen, Schneisen, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir, und übers weit gestreckte Gelände neumodische Quader gestreut, der Reichstag mit dieser Glaskuppel, Berlin Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links, ein paar Menschen verlieren sich im Regierungsterrain, dies das Zentrum des Geschehens, das Zentrum des Landes, des Staates, man sieht das nicht, und weiter der Zug, schlüpft unters Dach jetzt, die Stahl-Glas-Röhre, Kernspintomograph Hauptbahnhof, alles aussteigen, alles, was nicht in den Osten will, aussteigen …
Otti Wieland läuft die Straße entlang, die Rykestraße, seine Straße, in der er seit all den Jahren wohnt, lebt, arbeitet, die Straße, die er seit all den Jahren kaum je verlässt. Er bewegt sich wenig, sein Leben spielt sich hauptsächlich in seiner Wohnung ab, denn, je weiter man sich wegbewegt, so Otti, desto größer die Gefahr, dass man ungenau wird. Er schaut auf, schickt seinen Blick in die Höhe, zu den Traufen der Mietskasernen und dann noch weiter, in den weißlichen Himmel, der nach Westen in graue Moirés übergeht. Der Himmel über Berlin, Thema von Filmen, ein ums andere Mal ist er bedichtet worden und endlos viele Bilder mag es geben, Aquarelle von Experten wie von Dilettanten, der Himmel über Berlin wird von Webcams ins Netz übertragen und von Meteorologen gewissenhaft studiert. Heute, wie eigentlich immer, steht er kilometerhoch über den Häusern, die selbst fünf bis sechs Stockwerke aufragen, sich ihm dunkel und stabil entgegenstemmen, vertraut für Wieland und doch fremd, weil die Fremde ihn umgibt, ihm beständig folgt, und er selbst sich fremd ist, fremd den Menschen und ihren Verrichtungen, nicht ihrer Vergangenheit, doch ihrer Gegenwart und Zukunft.
Ottis Vergangenheit ist die Zeit vor dem Mauerfall, Zeit des alten Systems, in der vieles besser gewesen ist, weil es einfacher schien, weil die Fronten ausgemacht waren und das Leben möglich. Auch heute ist das Leben möglich, doch es ist schwerer geworden, die Gemeinschaft von einst ist zerfallen, alle kämpfen ihren eigenen Kampf, kämpfen ums Geld, ums Überleben. Früher war alles besser, denkt Otti, amüsiert über sich selbst, aber ja, in diesem Fall ist es richtig, man hat mehr zusammengehalten und sich geholfen, heute steht jeder allein. Nicht ganz allein indes. Sie existieren noch, kleine Zellen, rebellische Einheiten, aufmüpfige Dorfgemeinschaften im Herzen des Imperiums, und Otti ist Teil einer solchen, hat immer in den Reihen der Widerständigen gestanden, nie in denen der Herrschenden, einmal Untergrund, immer Untergrund, und nie höher.
Auch jetzt ist er auf dem Weg zu einem konspirativen Treffen, wie er es nennt, dabei geht es nur um eine Zeitschrift, mal wieder eine Zeitschrift, die gegründet werden muss. Es gibt keinen Anlass, es gibt kein Ziel, schon gar kein ökonomisches, es gibt nur die Notwendigkeit, und die ist für Wieland Grund genug, ist für Pielenbrock Grund genug, für Jensen, für Kruse, für Vohl und die anderen.
Seit es möglich ist, Zeitungen zu drucken, nicht nur Samisdat, sondern wirkliche Auflagen, die offen vertrieben werden, in denen man sagen kann, was man will – das immerhin ein Vorteil des neuen Systems – seit das möglich ist, hat Wieland sich an zahlreichen Projekten beteiligt. Ohne groß nach dem Warum zu fragen, das ist nicht nötig, letztlich liegen die Ursachen auf der Hand, man muss nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, und das tut er, auch wenn sein Radius minimal ist, was er sieht, reicht ihm völlig aus.
Die Kneipe gerät in Sicht, die anderen werden bereits an ihrem runden Tisch hocken, weil sie jeden Tag dort verbringen. Die Kneipe wirkt als ruhender Pol im abendlichen Verkehrslärm, ein sicherer Hafen, in den Otti Wieland einlaufen und alle Fremdheit abstreifen wird, die ihm auf der Straße als Schutz unerlässlich ist, und dann wird er zu etwas kommen, was man sein Wesen, seine Eigenart nennen könnte, wenn es so etwas tatsächlich gäbe, aber das bezweifelt er stark. Wir sind gemacht, meint er, nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von den Erwartungen der Anderen, niemals, nicht einmal, wenn wir ganz mit uns allein sind, auf der Toilette, im Bett, lassen sie uns los. Immer sind sie da und wohnen uns bei, Stimmen von heute, Stimmen von früher: Sozialkontext, Jugend, Erziehung, all die Stempel, die unsere Entwicklung uns aufgedrückt hat.
Auf der Straße fährt Donata vorbei, auf einem Fahrrad mit Kindersitz, und in dem Kindersitz Jonathan, Otti sieht Donata, aber er ruft nicht, lässt sie fahren, mit ihr zu sprechen, wäre ein Fehler.
Verdammtes Arschloch, denkt sie, was glaubst du, was das hier für ein Viertel ist? Das ist ein Menschenviertel, ein Kinderviertel, verkehrsberuhigt und nicht der Nürburgring. Meinst du, dass du hier fahren kannst wie ein gottverdammtes Arschloch? »Siehst du nicht«, ruft sie, »dass ich ein Kind auf dem Rücksitz habe?«
Das Arschloch im BMW nimmt keine Notiz von Donatas Flüchen und ihrem gestreckten Mittelfinger, sondern tritt das Gaspedal durch und jaulend jagt der Wagen davon, prasselndes Donnerwetter der Reifen über Kopfsteine, rein in die Sredzkistraße, und Donata gibt sich wohligen Fantasien hin, dass er dort in eine Zeitfalte gerate, die Straße tue sich auf, der BMW plumpse hinein und lande direkt in der Hölle, heiße Flammen mit leckenden Zungen, der Fahrer verkohlt in seinem Bonzengefährt, nur eine seltsam geschrumpfte schwarze Lederleiche bleibt auf dem Sitz zurück.
»Mama, Eis!«, sagt Jonathan in diesem Augenblick, er sagt es gebieterisch, in diesem Ton, der keinen Widerspruch duldet, vielmehr sofortige Bedürfnisbefriedigung erforderlich macht. Andernfalls folgt Weinen und Quengeln, minutenlang, stundenlang, etwas, das Donata jetzt unmöglich brauchen kann, nach diesem anstrengenden Arbeitstag, und an einem Eis ist noch niemand gestorben, obgleich der Abend schon anbricht und der Junge eher etwas Vernünftiges essen müsste. Verbote beschert uns die Welt schon genug, findet Donata, mein Junge soll frei aufwachsen, so wenig Frust wie möglich, und dass er seine Wünsche bereits jetzt so deutlich artikuliert, mit zweieinhalb Jahren, das ist gut, das verrät einen starken Willen, nicht zuletzt ist es ein Zeichen von hoher Intelligenz.
Sie lehnt das Rad an die Häuserwand, es wackelt, fällt aber nicht um, fast wäre es umgefallen. Donata hat es schon umfallen sehen, aber sie hätte es auffangen können, sie ist immer wachsam, man muss die Gefahren ahnen, sehen, was passiert, passieren könnte, sie schnallt Jonathan los. Hebt ihn aus dem Sitz und schwingt ihn schnell über den Sattel, trotzdem gibt es diesen Stich im unteren Rückenbereich, das hat man davon, wenn man keine junge Mutter ist, sondern eine Mutter im fortgeschrittenen, im besten Alter, sie stellt Jonathan auf die Füße und schließt das Rad ab. Beäugt den Jungen dabei aufmerksam, nicht dass er auf die Straße rennt, aber Jonathan denkt gar nicht daran, sondern widmet sich einem lila-farbigen Kaugummi, der auf dem Pflaster klebt, bückt sich, macht Anstalten, daran rumzuknibbeln, Donata stöhnt auf: »Jonathan, nein, fass das bitte nicht an!« Sie merkt selbst, wie ihre Stimme kippt, schrill, doch sie findet das absolut eklig, auch wenn er ein Kind ist und das nicht wissen kann, sie zieht ihn weg, nimmt ihn an der Hand und stemmt die Eingangstür zur »Glacerie« auf, in der sie wirklich gutes Eis anbieten, allerdings schweineteuer. Der Laden ist mit klar konturierten Paneelen verkleidet in Mint- und Pastelltönen. Viele Leute warten, der Verkäufer operiert nach dem Prinzip, dass gute Dinge Weile haben wollen, sicher ist er aus Schwaben, angesichts dieser Gemütlichkeit, Donata wird unruhig, kann aber mit Jonathan unmöglich hier ohne ein Eis raus.
Nachdem sie endlich an der Reihe gekommen ist, dem Jungen halbwegs seine Vorlieben entlockt, sich selbst auch ein Eis geordert und gezahlt hat und wieder vor die Tür tritt, lässt Jonathan sein Eis fallen, mitten in den Dreck.
»Nicht schlimm!«, ruft Donata mit etwas zu liebevoller Stimme. »Du musst nicht weinen, sieh hier, du nimmst einfach mein Eis!« Jonathan weint aber doch, da ihr Eis nicht das richtige für ihn ist, er heult wie ein Wolfsjunges, stampft mit dem Fuß auf und wirft Donatas Eis dahin, wo das andere schon liegt.
Nun spürt Donata eine jener seltenen Anwallungen von Hass, Hass auf das Kind, Hass auf die Welt, Hass auf ihren Platz darin, sie muss sehr an sich halten, schreit Jonathan jedoch nur an, dass es nun gut sei, sonst könne er hierbleiben, sie lasse ihn einfach hier stehen und fahre allein nach Hause zurück. Das bewirkt nicht viel, aber Donata schaltet auf Durchzug, lässt die negativen Gedanken einfach weiterziehen, beschäftigt sich stattdessen mit dem Notwendigen, greift Jonathan und hebt ihn hoch, schnallt seinen strampelnden Körper wortlos fest, steigt selbst aufs Rad und fährt los. Zum Glück entdeckt Jonathan einen der Umzugswagen mit den Robben darauf, sie sagt schnell: »Schau mal, die Robben, weißt du noch letzten Monat im Zoo, da haben wir echte Robben gesehen«, und prompt stammelt er: »Robbe, Robbe …«, vergisst Eis und Weinen.
Beinahe haben sie es geschafft.
Auf Höhe der Synagoge sieht Donata im Vorbeifahren dieses Mädchen, die kommt ihr bekannt vor, das Mädchen jedenfalls läuft die Straße entlang und spricht in ihr Handy, nicht so, als telefoniere sie, sondern eher, als diktiere sie etwas. Was macht die?, denkt Donata. Nur einen Moment lang, denn hier tut jeder irgendwas, kein Innehalten ist das wert, kein Gedanke darüber, wer hier was macht oder nicht, Donata bremst und erneut startet die ganze Prozedur, Jonathan runternehmen, Tür aufschließen, das Rad in den Flur wuchten, im Auge behalten, ob Jonathan wirklich nachkommt, das Rad in den Hinterhof schieben und abschließen, Donata schaut auf die Armbanduhr, seufzt.
»Liste Rykestraße:
Trattoria Ca’ Nova.
Die Synagoge.
Ambiente und Lebensart.
Mode für Andersdenkende.
Geschenke für Leib und Seele.
Gegenüber: Hier wohnte der antifaschistische Widerstandskämpfer Franz Huth, ermordet neunzehnunddreiunddreißig.
Surya – Ayurveda Wellness Zentrum.
Ein Hundepflegesalon. Gegenüber die Lampenmanufaktur.
Was ist das? Zimmerpflanzen, nein, Interieur: Rotec.
Antiquariat.
Yard. Eine Kneipe.
Nummer zehn ist das Saunabad. Erste finnische Blockhaussauna am Prenzlauer Berg.
Schon klar. Ein Lampenladen.
Rahmen und Bilder.
Maybach, ein Schicki-Café.
Boutique Dorock. Die Kinderstube.
Leporello, Papeterie.
Seeblick. Tandoor, indische Spezialitäten.
Duana, anatolische Spezialitäten.
Uluru-Ressort.
Kleine Gesellschaft, Kinderladen.
Albrecht. Eine Patisserie mit Edelkuchen.«
Hm, stehe ja schon an der Ecke, Sredzkistraße, nicht gemerkt, versunken … zu versunken ins Tun, alles schön systematisch, alles komplett erfassen, Verteilung von Geschäftsraum und Wohnraum, Verhältnis der Flächen, so was Demografisches auch. Das ist der Text der Stadt, Oberflächen. Wer weiß. Kann man vielleicht noch was völlig Anderes mit machen. Hörspiel. Oder sogar ein Drehbuch. Vor allem des Ganzen erst mal habhaft werden. Habhaft, das heißt auch handhabbar, eine Basis, auf der man aufbauen kann.
Weiter geradeaus? Nein, zur Danziger runter ist langweilig, reines Wohnviertel, bringt nichts, also linksrum. Halt, zunächst mal kontrollieren, ob das Ding überhaupt aufgenommen hat, das wäre noch schöner … »Trattoria Ca’ Nova. Die Synagoge.« Nee, alles okay, gut verständlich, also weiter:
»Ich biege ein in die Sredzkistraße.
Nummer 56, Extra-Tapete.
Bei Jakob, Schuhe.
Tisch und Tafel, Wohnkultur.«
Telefon. Es brummt wie ein müder, hungriger Bär, gib mir Essen, Honig, Rindfleisch oder Lachs … wer? Ah, Oksana … Höchste Zeit … Wo sie nur … Dann kann ich ihr endlich davon erzählen. …
Lynn, was tust du? Na, was ist denn das für ’ne Frage … Möchte mal lieber wissen, was sie so tut, die ganze Zeit …
Wo warst du?
Uni. Klausur geschrieben. Endlich vorbei, der horror. Bestimmt
vergeigt.
Abwarten.
Und du?
Ich arbeite.
Oho. Du? ;-) ;-)
Traust du mir das nicht zu, oder was? Das ist traurig. Sehr, sehr traurig, eine ernsthafte Beschäftigung erwartet sie von mir also nicht. Ein starkes Stück. Oh, halt, Vorsicht, der fährt aber schnell. Bisschen nah an der Straße. Dass dem die Scheiben nicht splittern, so wie die klappern auf dem Kopfsteinpflaster, na, sind wohl gut festgeschnallt, trotzdem: geradezu verwunderlich …
Heute: idee meines lebens.
???
Für die abschlussarbeit. Mal fertig werden.
Ach was.
Schreibe über meinen kiez. Geil, oder?
Ja muss auch fertig werden prof macht druck
Nee, da lass ich mich jetzt nicht unterbrechen, keine Konkurrenz-Story bitte. Jetzt erst mal ich bitte:
Sredzki / ryke. Geschichte, stadtentwicklung
Toll glückwunsch
Freue mich total. War schon beim prof.
Was machen wir? Feiern?
Wo bist du?
Zu hause.
Grüne wiese. Cocktail trinken?
Yep.
SANIERUNGSGEBIET KOLLWITZPLATZ
Durch die Neunte Verordnung über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten vom 21. September 1993 wurde die Umgebung des Kollwitzplatzes im Absatz 3 des §1 als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Diese Fläche wird begrenzt durch die Danzigerstraße (damals: Dimitroffstraße) im Norden, die Torstraße (damals Wilhelm-Pieck-Straße) im Süden, die Schönhauser Allee im Westen und die Prenzlauer Allee im Osten – insgesamt eine Fläche von 60,6 ha mit 482 Grundstücken, 7.040 Wohnungen und 11.412 Einwohnern (Stand 31.12. 2007). Es handelt sich dabei größtenteils um unversehrt erhaltene, gründerzeitliche Blockrandbebauung mit annähernd gleichen Traufhöhen, Seitenflügeln und Quergebäuden nebst in den Block integrierter Infrastruktureinrichtungen. Für die Sanierung dieses Terrains wurde ein »umfassendes Verfahren« angesetzt, was nach den §§ 152–156 BauGB die Anwendung besonderer sanierungsrechtlichen Vorschriften vorsieht, die unter anderem die Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungszahlungen, die Festlegung der Kaufpreise und Fragen der Finanzierung regeln.
Erklärtes Ziel der Sanierung sollte sein, das Gebiet Kollwitzplatz durch die bauliche Aufwertung von Wohn- und Gewerbegebäuden, sozialen und kulturellen Einrichtungen als innerstädtisches Wohnquartier zu stärken. Dazu sollte zudem eine Verbesserung der Spiel- und Grünflächen nebst Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Straßenraum, etwa durch Einführung von Tempo-30-Zonen, beitragen. Diese Aktivitäten dienten der Stärkung selbstgenutzten Wohneigentums, zur Entwicklung neuer Nachbarschaftsformen und Lebenstile sowie zur Erhaltung und Sicherung einer sozial und funktional gemischten Stadt. Durch Wohneigentum sollte die Bindung an das Viertel erhöht werden.
Mit Wirkung vom 28. Januar 2009 hat der Senat von Berlin die Sanierungssatzung förmlich aufgehoben, da die Sanierungsziele erreicht seien.
Der Club ist in Rotlicht getaucht, dabei ist es draußen noch fast hell. Drinnen merkt man nichts davon, drinnen könnte man wochenlang sitzen, es käme einem vor wie ein einziger Tag. Dazu passt die Musik, schwach modulierte Elektronik, moduliert, onduliert, sie strömt dahin, als wolle sie das für immer tun, tagelang, wochenlang. Oksana ist schon da, als Lynn zur Tür hereinspaziert, sie wohnt nur zwei Häuser weiter, kein Wunder, dass dies ihr Stammquartier ist. Sie umarmen sich, Küsschen links, Küsschen rechts. Es ist nicht viel los. Oksana und Lynn einigen sich darauf, dass die frühe Stunde daran Schuld trage, der Club sei sicher nicht schon wieder passé.
»Obwohl, das geht so schnell …«
Daiquiri für jede, dann spielt Lynn Oksana vor, was sie aufgenommen hat: »Tisch und Apfel, Wohnkultur …«
»Und wieso aufnehmen?«
»Ich muss doch wissen, wie die Straße aussieht!«
»Warum nicht schreiben?«
»Soll ich wunde Finger kriegen?«
»Kriegst du sowieso. Musst es eh abtippen. Wunde Finger. Das schreckliche Los aller Examenskandidaten …«
»Ich krieg’ gar nichts.«
Lynn erzählt, wie es zu dieser Studienabschlussidee gekommen ist, die nicht auf ihrem Mist gewachsen ist, sondern auf Franks.
»Wir haben einfach nur so dahergeredet. Frank und ich. Ich so, mein Leid geklagt, keine Ahnung, wie ich fertig werden soll, kein Thema undsoweiter. Und er so: ›Warum machste nichts über deinen Kiez?‹ Ich so: ›Wie, über meinen Kiez?‹, steh’ voll aufm Schlauch, weißte?! Und er so: ›Ja, mach doch was über deine Straße!‹ Da hab’ ich erst kapiert, was der meinte, klar, das Sanierungsgebiet, das größte seiner Art in Europa, Supersache, Superthema.«
»Und der Prof hat’s abgesegnet?«
»Ja, genau. Das ist das Allerbeste, ich bin direkt hin und hab’ alles klar gemacht: ›Sanierungsgebiet Kollwitzplatz. Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich Sredzkistraße/Rykestraße‹. Der Lüders ist gleich darauf angesprungen. Der meinte sogar, das läge voll im Trend, angesichts all dessen, was sich in Berlin baulich ereigne, das solle ich machen, nur zu.«
»Schade, dass wir nicht was zusammen machen können«, seufzt Oksana.
»Klar, ’ne Arbeit in Architekturbiologie oder?«
»Warum nicht? Kriegen wir den Nobelpreis. Neue Fächerkombination entwickelt, Pionierleistung auf dem Gebiet der Wissenschaften … wie viel Uhr ist überhaupt?«
»Was interessiert dich die Uhrzeit? Wir sitzen doch hier schön.«
»Ich muss gleich Donatas Kind hüten. Sie hat heute Abend wieder einen dringenden Termin!« Oksana betont das »dringend« affektiert, sie ahmt dabei Donatas Sprechweise nach, Lynn kennt das und kann sich die Frau leibhaftig vorstellen, ohne sie je gesehen zu haben.
Etwas Zeit bleibt, sie können noch an ihren Drinks nuckeln, dann muss Oksana los und Lynn bleibt zurück, telefoniert ein bisschen, um ein Anschlussdate hinzukriegen, was auch klappt, der Abend ist gerettet, Mouse on Mars in der Volksbühne, das hat sie ganz vergessen, Ralf kommt in einer Stunde vorbei.
Otti sitzt mit den anderen um den runden Tisch – wie angeschraubt. Er hat keineswegs vorgehabt, so lange zu bleiben, doch erst nachdem sie ziemlich lange über dies und das gesprochen haben, nordische Mythologie, neue Platten, etymologische Fragen und den allgegenwärtigen Wandel im Viertel, dem haufenweise alteingesessene Kneipen und Geschäfte zum Opfer gefallen sind, gelangen sie zum eigentlichen Thema, der Zeitschrift. Es soll eine historisch-politische Kulturzeitschrift sein. Das bedeutet nicht weniger als die kontinuierliche Weiterarbeit am Projekt »Expressionismus, Bohême und Anarchismus in Berlin«, das sich mit den maßgeblichen Gestalten des linken Kulturmilieus im Berlin der Zwischenkriegszeit beschäftigt und dem sich die meisten Zeitschriften, die Otti und die anderen seit der Wende herausgegeben haben, verschrieben haben – Leuten wie Franz Jung, Franz Pfemfert und seiner »Aktion«, dem revolutionären Psychoanalytiker Otto Gross, Karl Otten, Gustav Landauer, den Herzfeldes, Ernst Fuhrmann. Neben dem philologischen steht das politische Interesse an diesen Literaten und Intellektuellen im Vordergrund, die nicht von ungefähr vom Mainstream-Literaturbetrieb geflissentlich übergangen werden, dem Vergessen anheimgestellt. Hier walten politische Motive, demgemäß muss es eine lohnende Aufgabe sein, sich den Bestrebungen entgegen zu stemmen, solche zuwiderlaufenden Strömungen der deutschen Literaturgeschichte totzuschweigen, es ist ein Akt literarhistorischer Guerilla.
Den politischen Literaten von damals erging es kaum anders als ihnen heute, verstrickt in einen zähen Kampf, fast gegen jede geschichtliche Logik, die Segnungen der Zustimmung stolz missachtend, der Zustimmung zum ästhetischen Common Sense, zur bürgerlichen Perspektive, die ihnen Schutz und sorglose Existenz hätte verheißen können. Nein, sie agierten dagegen und außerhalb des Geltungsbereichs der herrschenden Konvention, wie Aussätzige beinahe, immer mit dem Rücken zur Wand, gerade nur so überlebensfähig, auf niedrigstem Niveau, dafür ohne entwürdigende Lohnarbeit.
Das Projekt nimmt Konturen an, während das Bier in Strömen fließt, das soll und muss so sein, schließlich ist das kein lässiger Spaß, sondern sozialer Ernst. Nach einigem Hin und Her einigen sie sich endgültig auf den Titel: »Der Weg nach unten« soll das Blatt heißen, genauso wie Franz Jungs berühmte Autobiografie, denn das fasst es zusammen, auf dem Weg nach unten sind alle und alles, nur keine falschen Hoffnungen, capitalism eats itself, wie Otti zu sagen pflegt, verrecken wird er an seinen eigenen Widersprüchen, dieser Mär von endlos steigender Konjunktur, dem sich selbst regulierenden Markt, all diese sozialen Aporien, welche die Globalisierungsfanatiker zu verbreiten nicht müde werden. Dabei zeigt die Krise, die größte Krise seit 1929, die Risse mehr als deutlich, handfeste Systemfehler, Geld, virtuell, Ströme, von nichts gelenkt als Panik und Gier.
Ganz ohne Geld geht es allerdings auch bei ihnen nicht, Otti findet das bedauerlich, aber Drucker, die im Tausch gegen Sachleistungen arbeiten, gibt es nicht. Sie diskutieren bestimmte Finanzierungsmodelle, und Pielenbrock erklärt sich bereit, die bestehenden Verlagskontakte auszuloten, um dem Projekt einen geeigneten Vertriebs- und Öffentlichkeitsrahmen zu verschaffen, sie schreiten voran, wie sie immer voranschreiten. Manchmal dauert es, mitunter Jahre, schließlich jedoch kommt alles in die Spur.
»Was ist mit den Autoren? Machen wir mal eine Liste!«, schlägt Jensen vor, doch die anderen winken ab: Autoren sind kein Problem, Autoren haben sie wirklich zu Genüge an der Hand, in Berlin findet man Autoren wie Sand am Meer, Lyriker, Dramatiker, Romanciers, Dreh- und Sachbuchautoren, politische Essayisten, Autoren jeder Façon und Facette, Männer, Frauen, Diverse, wie es in diesem Film heißt: Man braucht nur mit einem Stein zu werfen, dann trifft man einen. Jedoch sind die Autoren, derer sie bedürfen, unleugbar ein besonderer Schlag, da gelten andere Voraussetzungen, stilistische oder gedankliche Brillanz sind weniger wichtig als Haltung. Die Autoren ihrer Zeitschriften müssen Position beziehen, nicht unbedingt jene der Redaktion, nur das Widerständige des Projekts ist verbindlich, und sei es der Widerstand gegen das Projekt. Auf jeden Fall eint die Redaktion und die zukünftigen Mitarbeiter die Opposition gegen das Bestehende. Potenzielle Beiträger aufzustöbern, ist nicht schwer, so viele sehen sich geistig längst auf den Barrikaden, nicht in den Straßen, sondern am Schreibtisch. Die einzige Möglichkeit zur Gegenwehr, ist der Stift oder der Laptop, hinter den viele sich verschanzen und ihre Umsturzfantasien ausleben, und deshalb werden sie froh sein, wenn ein Sprachrohr wie das neue Blatt entstehen wird, ein letztes Forum für Meinungsäußerungen abseits des Hauptstroms, den nurmehr zynische Attitüde und ubiquitäre Ironie bestimmen, so dass alles anschlussfähig scheint, nichts mehr resistent, nichts mehr unterwandernd, stattdessen überall Individualismus, der jedes politische Thema dem Spott aussetzt und nicht begreift, dass hinter ihm, der sich nicht einmal selbst ernst nehmen kann, nichts mehr liegt, kein offenes Gelände, keine Freiheit, nichts, was bleiben könnte.
Klackklack die Treppe runter, Vorsicht, die Pfennigabsätze … Dieser warme, staubige Wind wieder, wieso, woher kommt der? Wallt hoch aus dem Schacht, Windfang, die U-Bahnstation, sie fängt den Wind, Fänger im Roggen, Fänger des Windes, huch, mein Kleid, Marylin Monroe über dem Lüftungsschacht, hatte die denn auch so ein Kleid? Nee, das war weiß … Mist. Was ist das? Sand, Fremdkörper, Insekt? Brennt, tränt. Nicht dran reiben, sonst geht das Make-up vor die Hunde.
»Hast’n Euro für Essen? Oder ’ne Fahrkarte?«
Nein, hab’s eilig, eilig, eilig. Im Grunde halb so schlimm, wenn die Party ohne mich beginnt. Obwohl es Teil des Jobs ist, klar. Vor Ort sein, Kontakte pflegen, Networking, Socializing, wer zu spät kommt, hat den besseren Auftritt, nicht nur so eine Nummer im Gedränge. Der Zeitdruck … beinahe wie eine zweite Haut. Bei allen … Einfach, weil es nie aufhört, weil es permanent weiter geht. Und dann die Wege, immer eine kleine Expedition … So, raus aus der gelben Raupe, und weiter hetzen, jedes Mal nervig … Umsteigen auf’m Alex … Werbeplakate, »Was Ihr wollt« im Berliner Ensemble, Tango auf dem Pfefferberg, Eric Burdon im Tempodrom, seit Jonathans Geburt nicht mehr dran zu denken, zwei-, dreimal im Jahr Volksbühne, mal ’ne kleinere Abendveranstaltung mit dem Kind, wenn es durchhält … Sich aufraffen, früher einfach hingehen, jetzt … ganze Maschinerie, Zeitmanagement, Oksana … geht schon, aber … Der Job verlangt bereits gehöriges Organisationstalent, Sondertermine wie heute … wann kann ich mal Freunde sehen? Mitunter, ganz selten, will ich nicht jedes Mal zu mir einladen, haben die auch keinen Bock drauf … Wie lange ist das her, Clara und Rieke … schon wieder sechs Wochen, siehst du …
Den Überblick behalten, wenigstens ausschnitthaft, was kulturell passiert, aber wenn ich die anderen so reden höre … Niemand geht mehr irgendwohin. Womöglich besteht das Publikum der vielen hundert Kulturveranstaltungen nur aus Touristen und Studenten?
Klaustrophobisch niedrige Decke, Echos der Absätze, wenn ich jetzt allein wäre, nachts, eine Szene für einen Thriller … Die Leute wie an der Schnur gezogen, Androiden, alle aufs gleiche unbekannte Ziel zustrebend. Energietankstelle, Seelensprit, da hängen sie zuckend an Drähten … So S-Bahn, ultrakurz, wackelt und quietscht … Riesenrakete im klaren Blau, gleich hebt er ab … ach, guck mal, da sind sie ja, na, sicher, Bernrieder, unser großer Vorsitzender, so ein Zufall, der Zug hält auf Höhe des Gewerkschaftshauses, da stehen sie Spalier, viele Männer in ihren schwarzen Anzügen oder Zweireihern, nur wenige Frauen … Wie andächtig sie lauschen, mit ihren Sektgläsern in der Hand … den heiligen Worten Bernrieders, bevor sie endlich das Büffet stürmen dürfen.
Eigenartig … so zufällig da rein geraten, keine zwei Jahre her, alles hat sich gewandelt seitdem, anders organisiert und orientiert als alle Projekte vorher. Waren ja auch gute Sachen … halt ohne Bezahlung oder sehr wenig. Mit Kind kann man sich das nicht leisten, egal, heute ist die Bezahlung in Ordnung, und die Ziele, für die wir eintreten, auch. Am Anfang … nach der Geburt, Hartz IV, dahin möchte ich nie mehr zurück … Zum Glück ganz weit weg. So, raus hier. Treppen runter und rein ins Gebäude … los geht’s … Showtime …
»Hi! Wie ist es? Wie waren eure Veranstaltungen in Westdeutschland?«
»Super! Superzulauf, Superresonanz!«
»Freut mich.«
»Toll, dass du da bist, Donata.«
»Toll auch, dass du da bist, Johanna.«
Das ist ja nett. Ist schon fertig mit seiner Rede und muss gleich weiter … »Herr Bernrieder, guten Abend! Nun habe ich glatt Ihre Rede verpasst.«
»Frau Finkenstein, da haben Sie nicht viel verpasst, das kennen Sie sowieso schon alles. Aber schön, dass ich Sie noch sehe!« … und das noch mit Handkuss, schade, dass es keiner fotografiert hat, macht auch so was her, wer ist diese schöne … die der Gewerkschaftsboss … gutes Bild, so oder so …
»Herr Bernrieder, wie reizend!« Guter Beginn. Bisschen Sekt für die Stimmung, her damit. Aber nicht zu viel, Jonathan wird morgen keine Gnade haben, pünktlich wie ein Uhrwerk, immer um sechs. Manchmal, wenn dieser morgendliche Reizhusten, solange, bis er ganz wach ist, wenn er dann quengelt und quengelt, war zwar schon länger nicht mehr, dennoch, lieber keinen Kater …
Da hinten ist Rasmussen, eingekeilt in der Menge, sieht nicht aus, als gefiele ihm das … Von der Zeitung … hm, sehe niemanden, nee … doch, Hartmut ist da, die anderen meiden diese Anlässe. Muss ja auch niemand. Wenn man keine weiteren Ambitionen hat. Büffet? Hm, hm, hm. … Lieber nicht … Hatte schon den Salat … Traumfigur mit achtunddreißig fällt nicht vom Himmel, immer Diät halten und dazu Sport, muss man knallhart durchziehen. Klappt auch eigentlich immer, zweimal die Woche, das kriege ich wenigstens hin, diese Woche das Pensum schon erfüllt, zwei Kilometer, genau eine Stunde, das geht noch ganz gut. In der DDR war ich ein Fisch, das Wasser mein zweites Element, Übergang von einem ins andere, das Licht, die Reflexe, gedimmte Klänge, montags bis freitags, jahrein, jahraus, Schwimmkader, Leistungsgruppe, da lernt man Disziplin, sich nicht hängen lassen, niemals … Glücklicherweise nicht talentiert genug, dass sie mich mit Medikamenten vollgestopft hätten …
Essen ist deshalb bescheuert, weil man so Scheiße aussieht, sich eine fettige Gabel aus dem Mund ziehen, wenn eine Größe aus Wirtschaft oder Politik das Wort an einen richtet, geht wohl nicht … Hab’ hier schließlich was zu tun, der »Voran« wird nicht meine letzte Etappe sein, ganz gewiss nicht. Zu Ostzeiten, alles vorbestimmt, nur Widerstand, Zusammenrücken, Verkapselung, doch keine Entwicklung, nichts, wo es hätte hingehen können … Nach der Wende haben sich Möglichkeiten eröffnet, für mich allerdings … dieser Einigungsprozess, da musste man erst mal einen Weg für sich finden. Gibt so Leute, sicher. Die packten sofort ihre Chance beim Schopf, dagegen war ich Spätentwicklerin … Nun. Keine Müdigkeit vorschützen. Der ständige Kontakt zu Funktionsträgern, Leuten, die Weichen stellen können …
»Der Gruyère sieht ja verlockend aus.«
»Ja, das ist ein Direktimport aus der Schweiz, wissen Sie, so ein winziger Käsemacher, nur so hundert Käse im Jahr …«
»Da muss die Gewerkschaft sich wahrscheinlich ganz schön strecken, dass sie einen abbekommt …«
»Man hat so seine Beziehungen.«
»Ein bisschen nehme ich mir auch.«
»Ach, Sie können sich ’s doch leisten!«
Charmeur. Das reicht. Nur probieren. Die Szenerie erleuchtet, Stimmung gut. Das ist das Wichtigste. Lachende Gäste. Der ist aber wirklich gut. Vielleicht nehme ich mir doch noch ein Stückchen. Kann das Sünde sein? Ja. Trotzdem. Die anderen mit ihren übervollen Tellerchen … Da muss man balancieren wie ein italienischer Kellner, damit man die Situation im Griff behält. Scheint ganz locker, aber … Wenn man kleckert, peinlich. Auch sonst. Abstand halten, eine Berührung ist ein Schock, wie ein elektrischer Schlag, das geht durch, du zuckst zusammen. Das ist schließlich der Job, Berührungen sind privat, Berührungen sind Privatleben, das gehört nicht hierher.
»Die Gesetzesnovelle … nein, gelesen habe ich sie noch nicht, die ist mir erst gestern auf den Schreibtisch geflattert.«
»Ich halte nicht viel davon. Wenn die Opposition die Wahl gewinnt, die machen das sofort rückgängig.«
»Ein paar Nachbesserungen wären schon nicht schlecht.«
Der Staatssekretär … den muss ich unbedingt sprechen, über die … ach ja, der, wer war das? Irgendein hohes Tier aus der Landesvertretung … die üblichen Verdächtigen, Jürgens, Reinhard, und der … wie heißt der, auch so ein regionaler Gewerkschaftsführer, jede Menge zu tun, jetzt direkt, viel Zeit darf man sich nicht lassen, ist schneller vorbei, als man gucken kann. Und je bedeutender die Persönlichkeiten, desto rascher entschlüpfen sie. Eben waren sie noch da, jeder hat sie gesehen, schau mal, Herr X, Frau Y ist auch hier, und flutsch! sind sie verschwunden, zum nächsten Termin, zum nächsten Büffet. Worum geht es ihnen in Wirklichkeit? Wenn man sich hier eine halbe Stunde rumdrückt, was kann man in so kurzer Zeit bewirken? Einen geschäftlichen Deal einfädeln, Absprachen treffen?
Vielleicht. Vor allem muss man sich eben blicken lassen, politischer Catwalk, im Small Talk ist so manches möglich, Herr Minister, ich brauche dafür noch etwas Unterstützung, sonst … An wie viel dachten Sie … Naja, hundert … Nein, hundert nicht, fünfzig, das würde gehen … Danke, Herr Minister, in Ordnung, immerhin etwas, nicht genug, doch schon mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein … Oder alles ganz anders? Womöglich nur die Fiktion von Verfügbarkeit, hier ist der Staatssekretär, er steht zur Verfügung, man kann mit ihm reden. Und deshalb kleben alle an ihm wie ein Fliegenschwarm. Da muss man sich durchboxen, wenn man was will, keine falsche Scheu, die Time Slots sind mega-eng.
Innere Blockaden hat wohl fast jeder, Frauen mehr als Männer. Die leugnen das, und manchen, wirklich, denen ist rein gar nichts peinlich. Wenn man sich das vorstellt, andauernd diese Bittsteller, Speichellecker, so ein Minister muss es doch leid sein, ständig angeschnorrt zu werden. Nein, ein bisschen Contenance schadet nicht, das sollte man sogar pflegen, sich zurückhalten und auf den günstigen Moment warten. Wenn’s dann so weit ist, muss mich keiner ins Ziel tragen. Bestimmt nicht. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Damit habe ich kein Problem. Bin neugierig auf Menschen, das darf man nicht verlieren, ich mache das nicht nur für mich, sondern für Jonathan, vor allem für Jonathan. Er soll eine optimale Startposition bekommen, wo er schon auf einen Vater verzichten muss – dieser … Nie hätte der sich gekümmert, was hätte das gebracht? Und klappte alles wie geschmiert, direkt neue Wohnung, ohne Übergangsphase, keine Experimente, so konnte er Jonathan nicht schaden, wo sein Nutzen schon so verschwindend gering gewesen war.
Rasmussen. Winkt, »Hey, Donata, komm mal her«, will mich vorstellen, na gut, wer ist denn das? Kenne ich die? Nee. Also. Den Käse stillschweigend auf dem Büffet verschwinden lassen, sieht ja keiner, oder? Nein. Und lächeln … ein strahlendes Lächeln. Ja, das verfängt. Wie es immer verfängt. Jetzt brennen sie darauf, mich kennen zu lernen …
Otti hat ziemlich einen im Kahn. Zum Glück ist das Bier billig, fast wie in einer alten Oststampe, besonders verglichen mit all den neuen Läden ringsum, diesen auf Hochglanz getrimmten Etablissements gastronomischer Wendegewinner und reicher Westwirte, die hier rübergeschwappt sind wie die Beulenpest. Die haben mit ihrem Geld Schneisen geschlagen, Cafés, Bistros, Bodegas, Tapas, Antipasti, Sushi, Törtchen und Fingerfood, diese ganze Mischpoke, Salatfresser, Körnerverehrer, all dieser Quatsch, gib mir ein deutsches Schnitzel, gib mir ein Berliner Bier, gäbe es nur noch das, wäre der Prenzlauer Berg längst eine No-Go-Area, mutiert, exterritorialisiert, so wird es wohl kommen, doch jetzt ist es noch nicht so weit, die Widerständler besitzen Widerstandsnester, in denen sie sich versammeln, wie das LUZ: OUR SOLIDARITY AGAINST THEIR RACISM … Tacheles bleibt … Libertäre Tage Dresden … Gegeninformation … trans* … Grundeinkommen Berlin … Am 1. Mai schlauer als die Polizei! … Wohnen Würde Widerstand … Genderfucking … Freiheit für Tobias … Nazifaschismus Verfolgte Widerstand … Keine/r muss allein zum Amt! … Soliparty … Haïti / Ayiti … Burasi kimin Berlin? Whose Berlin? Wem gehört Berlin? Wände und Displays und Klos zeugen beredt von Kontrapunkten und Kontrapositionen, Sprüche, Graffiti, Flyer, Booklets und Zeitschriften, geschmückt mit roten und schwarzen Sternen, mit Aufrufen, Erklärungen und Protestbekundungen, Verlautbarungen der Anarchisten, neuzeitlicher K-Gruppen, der Anti-Deutschen und Post-Kolonialisten, queerer Aktivist*innen, der Kriegsgegner*innen, Hausbesetzer*innen, Studienabbrecher*innen und Rätselfreund*innen. Für sie alle steht dieser Ort offen, ein Marktplatz der Meinungen und Strömungen, für die Agenten neuer ökonomischer Konzepte, die als Selbstausbeuter hier an ihren Laptops sitzen, da die Kneipe Zugang ins Internet gewährt, offenen Zugang, offene Quellen, Telearbeit bei Milchkaffee oder Hefeweizen, sie hocken da, nennen es Arbeit und vermutlich ist das die Realität heute.
Selbstverständlich sitzen da viele, mit deren Aktivitäten und Meinungen es nicht so weit her ist, da alles, was sie meinen oder tun können, sich auf den Bierpreis verengt. Bierpreise sind keine Herrenpreise, für Otti gilt das nicht minder, einen Redaktionsabend in irgendeiner anderen Kneipe des Viertels könnte er sich nicht leisten, deshalb ist das LUZ so wichtig, ohne das LUZ wüsste niemand von ihnen wohin.
Eigentlich ist die Runde längst aufgehoben, Pielenbrock und Kruse schon zu Hause, Vohl und Rudi auch, Otti findet mal wieder nicht den Absprung, redet mit Jensen, über Jung und dessen Husarenstück, die Entführung des Fischdampfers Senator Schröder im Jahr 1920, mit vorgehaltener Waffe hatten sie das Schiff umgelenkt, Jung und sein Genosse Appel, nach Murmansk, um die Aufnahme ihrer Partei, der linksradikalen KAPD, in die Komintern zu erreichen. Jensen ist sicher, dass dies nicht der einzige Grund war, nicht bei einem Typen wie Jung, der auch etwas Wetterwendisches hatte, einfach mal in den Sack haute, wenn ihm die Sache nicht mehr passte, und was ganz Anderes anfing, da unterbricht ihn jemand, so ein Knabe aus Westdeutschland, der sich ins Gespräch drängt, ohne dass ihn jemand kennt: »Aber wieso«, will der wissen, »sind die nicht einfach mit dem Zug gefahren?«
»Sag mal, du Hansel«, fährt Otti ihm über den Mund, »Hast du überhaupt ’ne Vorstellung davon, wie dit damals aussah? Der Mann wurde steckbrieflich jesucht, der konnte sich nicht einfach so in ’nen Zug setzen wie du heute. Wenn die Konterrevolutionäre ihn ergriffen hätten, wär’ kurzer Prozess jemacht worden, pamm, pamm, pamm, oder tot geschlagen hätten’sen wie Landauer … Wieso sitzt du überhaupt hier an unserem Tisch …?«
Gemurmel, allgemeine Ächtung, der Knabe trollt sich, recht so, das hier ist kein Fortbildungsseminar für Westlinke, sondern: »Das ist ernsthafte Arbeit! Arbeit am gesellschaftlichen Widerspruch!«, dröhnt Otti, »Genau!« brüllen die anderen und bestellen gemeinschaftlich noch ein Bier.
Für Otti ist das sein Letztes, irgendwann muss Schluss sein. Es nieselt leicht, als er vor die Tür tritt, er zieht den Kopf ein, torkelt geübten Schrittes los, er kennt jeden Stein, jedes Bauloch. Auf einmal hört er die Dünung, die Ostsee, sein Herkunftsmeer, und der Dampfer stampft durch die schwere See, die betagte Maschine müht sich und ringt mit den Wellen. Trotz des Dunkels vernimmt er den heiseren Schrei einer Möwe, Gischt spritzt über Bord, die Stöße der Wogen werfen sie an die Reling, aber niemand sieht sie, bei dem Wetter sind alle unter Deck, nur die Brücke ist hell erleuchtet, sie pirschen sich an, ein Ziellicht in der düsteren Endlosigkeit des Ozeans, sie pirschen sich an, fühlen die Klinke, fühlen in der Hosentasche den kalten Stahl, dann reißen sie die Tür auf …
Otti steht in seiner Wohnung, nichts hat sich verändert, das Bild der marschierenden Masse, das Filmplakat, die Revolution schreitet voran, die streikenden Landarbeiter, rebellierende Bergleute, Germinal, Otti kracht aufs Bett, einfach so, nur keine Umstände, Monsieur, der Schlaf ist nicht nur nah, sondern da, Otti schläft bereits im freien Fall.
Auch Oksana schläft und träumt vom Biologieunterricht in einer Junior High, sie trägt dieselben Sachen wie die amerikanischen Teenager in Filmen und hält ein Referat über Genetik, da weckt sie ein Lichtschein, die Wohnungstür hat sich geöffnet, es ist Donata, und sie ist nicht allein.
»Hallo, Oksana, alles in Ordnung. Entschuldigung, ist ein bisschen spät geworden.«
Oksana gähnt und sagt nur: »Ist okay, bin … bin kurz eingenickt. Bisschen vorgeschlafen. Jonathan hat keinen Mucks von sich gegeben, schlummert wie ein Murmeltier.«
Donata spricht zu ihrer Begleitung, einem Mann, der im Flur verharrt: »Da hinten ist die Küche, mach uns doch was zu trinken. Einen Martini oder was du willst.« Ihre Stimme rutscht in ein höheres Register, sie hat wohl schon ein paar Drinks gehabt, den Mann kann Oksana nicht erkennen, weil er im Schatten bleibt und stumm in die Küche gleitet. Sie packt ihre Sachen zusammen, Donata reicht ihr das Geld: »Für die Verspätung lege ich noch einen drauf.«
»Dankeschön«, sagt Oksana artig, dabei entspricht Donatas Zulage exakt dem, was ihr für die Überstunden ohnedies zustünde. Oksana nimmt ihre Tasche, schlüpft in den Mantel und nichts wie nach Hause, halb zwei zeigt das Display ihres Handys. Donata öffnet die Tür des Kinderzimmers, lauscht ins stille Schwarz, Jonathans gleichmäßige Atemzüge, alles in Ordnung. Nach und nach gewöhnen sich ihre Augen an das Dunkel, sie erspäht die Konturen seines kleinen Körpers, gut zugedeckt liegt er. Eine Welle von Liebe überschwemmt sie, sie möchte den Jungen an sich ziehen und küssen, doch er würde nur aufwachen, also schließt sie leise die Tür und tritt zu ihrem nächtlichen Gast in die Küche.
II
Lynn (23), klein, sie würde sagen: »Ich bin doch nicht klein, guck’ dir mal die richtigen Zwerge an.« Lynn, blond, schlank, zierlich sogar, seit drei Jahren wohnhaft in Prenzlauer Berg. Zugezogen aus Düsseldorf zwecks Aufnahme eines Architekturstudiums, das sie anfangs mit größtem Eifer betrieben, später vernachlässigt hat, soweit die Studienordnung es zulässt, man studiert nur einmal, lebt nur einmal, die Zeit der Arbeit kommt früh genug.
Zum Glück studiert sie noch auf Diplom, der letzte, ein auslaufender Jahrgang, die Bachelorstudenten nach ihr können sich keine Freiheiten mehr erlauben, modularisierter Stundenplan, Abschlussprüfungen, Klausuren. Lynn ist froh, dass dieser Kelch an ihr vorüber gegangen ist, bei anderen aus ihrem Bekanntenkreis, die ein Jahr später angefangen haben, ist Stress angesagt, Büffeln, nicht von ungefähr haben viele das Studium bereits geschmissen und machen längst was anderes. Verstehen kann man das, weil, auf dich wartet keiner, besser du stellst selbst was auf die Beine, besonders in Berlin, wo sich alles permanent bewegt. Eckhart zum Beispiel macht Filme, nur Dokumentar, nur Super 8, letztlich hat er im Kaffee Burger ein paar gezeigt, ganz nett, mal was anderes, hat Oksana erzählt, Lynn hat es nicht geschafft, es läuft ja so viel, sind auch nur wenige Leute da gewesen. Walter ist Trainee in einer Werbeagentur, vielleicht wird er übernommen. Evi arbeitet bei einem Schulbuchverlag, in der Oderberger. Maike hat gerade ihre erste Ausstellung, Wahnfried, nicht zu vergessen, der heißt nicht wirklich so, unter dem Namen macht er elektronische Musik, außerdem arbeitet er als DJ im Zapata. Osian hat anfangs mit Lynn studiert, nach drei Semestern hat er’s drangegeben und diesen Laden für Accessoires eröffnet, gehobenes Second-Hand-Design. Ole mit seiner Computerklitsche kommt ganz gut klar, Rosa auch, doch die arbeitet von zu Hause aus, mehr so Webdesign. Wolfgang und Frank studieren mit ihr Architektur. Und dazu und vor allen Dingen Oksana, die Lynn dank Osian an der Uni getroffen hat, obwohl die Bio macht, ihre erste Freundin in Berlin. Ausgerechnet in der Mensa unter Tausenden und Abertausenden hungriger Studenten haben sie sich kennengelernt, ein wunderbarer Zufall, so eine Freundin hat Lynn zu Hause nicht gehabt.
»Was ist, sehen wir uns gleich?«
»Nein, Schatz, heute mal nicht. Keine Zeit. Ich treffe mich gleich mit Stone.«
»Stone? Du Ärmste!«
»Ja. Er ist ein Schrat. Aber sehr lustig. Und er kann mir Ratschläge geben für die Arbeit.«
»Ruf ihn an und verschieb’s …«
»Nee, ich muss.«
»Sie muss. Völlig neue Töne.«
»Von wegen. Ganz wie man mich kennt. Disziplin und Gewissenhaftigkeit. Damit es bald heißt: Uni ade.«
»Und damit: Hallo Arbeitsagentur.«
»Ja. Genau.«
»Wir sehen uns.«
»Morgen. Wenn du willst.«
»Na klar … Sauna … hatten wir doch gesagt?!«
GELÄNDEGESCHICHTE, NAMENSKUNDE
Einst war hier Wald, dann Ackerland, nach umfänglichen Rodungen im 13. Jahrhundert, Feldmark Berlin im Nordosten der Stadt. 1748 wurden auf den Lehmbergen erste Windmühlen gebaut, deren Zahl rasch anwuchs, bald betrieben dreißig Müller ihr Geschäft auf der Anhöhe vor dem Prenzlauer Tor, einem Terrain, das heute im Rechteck zwischen Prenzlauer Allee, Straßburger und Saarbrücker Straße läge.
Im Zuge der preußischen Agrarreform, speziell Hardenbergs »Edikt, die Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend« von 1811, wurde auch in der nördlichen Feldmark das feudale Besitzrecht abgeschafft. Die Bauern waren so dem Joch der Lehnsherrschaft enthoben, freie Landmänner konnten sie werden, jedoch nur, wenn sie die Hälfte ihrer Flächen abgaben oder das Achtzehnfache eines Jahresertrags an Ablöse zahlten. Wer konnte sich das schon leisten? Die meisten Böden blieben somit bei den ursprünglichen Eigentümern, andere wurden frei verpachtet. Der Löwenanteil gehörte den drei Familien Griebenow, Büttner und Bötzow. Die kleinen Bauern verlegten sich aufs Müllern oder Bierbrauen.
Als neue Querverbindungslinie wurde 1822 der Communicationsweg angelegt, die heutige Danziger Straße (ab 1875), zwischen 1950 und 1995 hieß sie Dimitroffstraße, benannt nach jenem bulgarischen Kommunisten, der aufgrund seines rhetorischen Talents im nazistischen Schauprozess zum Reichstagsbrand freigesprochen werden musste. Seit 1995 darf so viel kommunistische Heldenverehrung nicht mehr sein. Verzeichnet ist die Danziger Straße bereits im »Separationsplan« von 1822, der auch die damaligen Besitzer der anliegenden Grundstücke ausweist, allen voran die Großgrundbesitzer Wilhelm G. Büttner und Julius Bötzow. Letzterer eröffnete 1864 ebenfalls eine Brauerei, im großen Stil, errichtete auf dem Windmühlenberg einen riesigen Lagerkeller und einen Biergarten für 6000 Besucher. Der Prenzlauer Berg wurde zum wichtigsten Brauereistandort und war mit zahlreichen Ausflugslokalen ein beliebtes Ziel der Naherholung. Die weiteren Parzellen verteilten sich auf verschiedene kleinere Besitzer wie den Professor Goenner, einige Schäfer, die Krone, den Magistrat, die Probstei und mehrere Kirchengemeinden.
Daraus resultierte ein Raster sich rechtwinklig-schneidender Straßenzüge, die (späteren) Bauflächen, die Karrees, wurden so definiert. An diesen Flurlagen orientierte sich James Hobrechts »Bebauungsplan der Umgebungen von Berlin«, aus dem der Stadtteil Prenzlauer Berg hervorging. Die intensivste Bauphase war zwischen 1871 und 1890, in dieser Zeit schritt die Bebauung bis über die Danziger Straße hinaus fort.
Zunächst waren erst einmal kleine, zweigeschossige Häuser gebaut worden, die nach und nach aufgestockt wurden, so dass Ende der 1850er Jahre durchgängig vierstöckige Gebäude vorherrschten. Hinter den Vorderhäusern wurden Wirtschaftsgebäude und Werkstätten angelegt, die in der Folge mit dem Vorderhaus verbunden und dann nach und nach aufgestockt wurden. Eine Wohnraumnutzung war zunächst untersagt und wurde erst in den 1870er Jahren üblich. Ein erster Bauboom setzte nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1871 ein, nicht zuletzt begünstigt durch die Reparationszahlungen der Franzosen. Nach kurzzeitigem Einbruch in den 1880er Jahren, kam es zwischen 1895 und 1910 wieder zu einer forcierten Bautätigkeit. Das typische Prenzlauer-Berg-Haus entstand: 18 Meter breit, fünfgeschossiges Vorderhaus, Geschäftslokale im Erdgeschoss, darüber teurere Wohnungen für Bessergestellte. Im Hinterhaus, wo weniger Licht einfiel und auch die Gebäudestandards zu wünschen übrigließen, befanden sich die Quartiere der Arbeiter und Erwerbslosen. Diese architektonische Zweiteilung besaß zwar den Charakter einer sozialen Segregation, immerhin aber wohnten damals noch alle in einer Straße, die Besser- wie die Schlechterverdienenden. Ganze dreißig bis vierzig Wohneinheiten barg solch ein Haus, Berlin stellte damals die größte Mietskaserne der Welt dar.
Die Franseckystraße – benannt nach dem preußischen Infanteriegeneral und Gouverneur von Berlin (1879–1882), Eduard Friedrich Karl von Fransecky – ist bei Hobrecht bereits verzeichnet, der heutige Name Sredzkistraße geht auf den kommunistischen Widerstandskämpfer Siegmund Sredzki zurück, der 1944 im KZ Sachsenhausen ermordet wurde. Nach ihm wurde die Straße 1952 benannt, daran wurde – auch nach dem Fall der Mauer – nichts geändert. Sie verbindet Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee in westöstlicher Horizontale.
Die Rykestraße schneidet sie rechtwinklig, indem sie sich vom Wasserturm in nordöstlicher Richtung bis zur Danziger Straße zieht. Bei Hobrecht war sie aufgeführt, noch unbenannt, war jedoch in den Plänen bereits genauso gezeichnet, wie später angelegt. Die endgültige Bebauung der Rykestraße wurde wohl erst nach der Jahrhundertwende erstellt. Benannt ist die Straße seit 1891 nach einem mittelalterlichen Bürgermeister Berlins, Bernhard Ryke, dem ratsfähigen Patriziergeschlecht der Rykes entstammten zwischen 1400 und 1600 eine ganze Reihe von Berliner Stadtoberhäuptern.
Lynn sieht die Sredzkistraße jetzt mit anderen Augen: Es ist eine Verbundenheit, die es vorher nicht gab, es ist jetzt ihre Straße, ihr Thema. Ihre Zukunft basiert womöglich auf diesen beiden Straßen. Stone hingegen hat sich geweigert, sie am Prenzlauer Berg zu treffen. »Zu den Szene-Wichsern kriegste mich nich’«. Er ist vor kurzem nach Neukölln gezogen und hat darauf bestanden, dass Lynn zu ihm komme, »da gibt’s ne Superkneipe, die musst du kennenlernen«, dort also oder nirgendwo. Zu allem Überfluss hat er ihr den Weg erklärt, wie jemandem, der sich überhaupt nicht auskennt, dabei ist sie seit mehr als drei Jahren in der Stadt und den Hermannplatz kennt sie selbstverständlich wie ihre Westentasche, gerade deshalb will sie da nicht hin, Expedition ins Assi-Land, danke sehr, muss nicht sein.
Schon in der Bahn fällt auf, wie das Publikum wechselt, gleich hinterm Kotti sinkt das Niveau, von der sozialen Teilhabe her betrachtet, der Ausländeranteil steigt, auch die Prozentzahl der Alkohol- und Drogenkonsumenten nimmt zu. Ein Typ mit langen Haaren, Wildlederjacke und ohne Schuhe steht da, mit nackten Füßen in der Großstadt, autsch, Lynn malt sich aus, wie sehr man sich verletzen kann, sie schüttelt sich innerlich. Wie gebannt stiert sie auf diese Füße, die nicht so schmutzig aussehen, wie sie sein müssten, angesichts der Berliner Trottoirs. Daraufhin dreht sie den MP3-Player lauter und schließt die Augen, für die Rückfahrt muss eine Zeitung her, besser noch ein Buch, denn Zeitungen sind unhandlich und genau genommen steht darin nichts, was Lynn interessiert. Der Hermannplatz ist umtost vom Feierabendverkehr, eine bessere Verkehrsinsel, mittendrin werden Bratwürste und chinesisches Fast Food feilgeboten, sehr bleihaltig, allein der Gedanke daran, so etwas zu essen, lässt Lynn schaudern, die ganzen Abgase müssen ja irgendwohin, die armen Leute, die dort arbeiten, tagein, tagaus, manche wird es die Leber kosten oder gleich das Leben, keine Frage.
Die Kneipe, »Zum Blauen Affen«, entspricht in etwa ihren Erwartungen. Schummrig dringt ein bisschen Sonnenlicht durch die Scheiben. Ein Mann sitzt an der Theke, vor Bier und Korn, daneben liegt sein Gebiss, wahrscheinlich zur Schonung, denkt Lynn, die restlichen Insassen haben ihre Dritten zum Glück drinbehalten, obwohl auch sie bestimmt damit aufwarten könnten. Was für ein Bild wäre das, wenn sie alle, wie sie da sitzen, ihre Zähne auf dem Tresen parken würden. Lynn überlegt, ob sie das anregen soll, ein Foto davon könnte ihr eine Stange Geld einbringen, leider hat sie nur das Handy, keine Kamera dabei, die Qualität kann man vergessen. Die Theke ist aus nachgedunkeltem Massivholz, neben den verankerten Tresenhockern verteilen sich noch einige Stehtische im Raum, sie und die dazugehörigen Stühle sind fest verschraubt, unverrückbar, wahrscheinlich seit ewiger Zeit. Etwa so lange, wie die anwesenden Kneipengäste diesen Laden frequentieren. Nur hat der »Blaue Affe« inzwischen eine Renovierung erfahren, die Gäste dagegen nicht.
Natürlich alle Augen auf Lynn, die den Altersdurchschnitt rapide senkt, nicht feindselig, eher neugierig, ›was machst du denn in unserem Wohnzimmer, du junges Ding?‹ Danke, Stone, denkt Lynn, dass du mich in ein solches Etablissement bestellst und selbst mal wieder nicht pünktlich bist. Lynn macht gute Miene, gleitet unverdrossen auf einen freien Barhocker und wägt die Getränkemodalitäten ab. Bier mag sie nicht, Wein oder Kaffee sind hier sichere Katastrophen, also bestellt sie Wodka-Lemon, der aber so stark ist, dass sie husten muss.
Da kommt Stone: »Lynn! Und wie jeht’s? Haste dich schon mit alle anjefreundet?«
»Harhar.«
Stone trägt wie üblich Cowboystiefel und dazu eine Motorradlederjacke, die aussieht, als starte er in der 125ccm-Klasse, der ganzen Werbeaufdrucke wegen, Zigaretten, Bier, Reifen, da freut sich die Industrie, das ist Stone allerdings scheißegal, denn Stone ist das meiste scheißegal. Lynn verhindert Wangenküsse, reicht ihm stattdessen die Hand.
Sie weiß gar nicht mehr recht, woher sie ihn kennt, wahrscheinlich aus dem Siemeck, das längst dichtgemacht hat. Jedenfalls hat er sie angebaggert, lustig zwar, aber aussichtslos, er ist überhaupt nicht ihr Typ, die Abfuhr hat er weggesteckt wie ein Gentleman, hat nur gelacht und damit war’s gut. Proll, Prahlhans, astreiner Trinkpartner, gleichgültig, was Oksana sagt, die nichts mit ihm anfangen kann, das ist einer der wenigen Punkte, in dem sie und Lynn unterschiedliche Ansichten haben. Bei oberflächlicher Betrachtung hat Oksana Recht: Stone sieht aus wie ein Troglodyt und redet unglaublich schnell, laut und viel, spult, wo er geht und steht, ein Unterhaltungsprogramm für die gesamte Umgebung ab, egal ob die das will oder nicht. Ganz gleich, ob im »Blauen Affen«, im Einwohnermeldeamt oder in der Oper, alle müssen zuhören, drunter macht er es nicht. Stone ist ein waschechter Berliner, in Prenzlauer Berg gebürtig, der einzige Mensch, den Lynn kennt, der dort geboren und aufgewachsen ist.
»Else, lass dit Mädchen in Ruhe, ja?« Wie immer hat er seinen Schäferhund dabei, genauer gesagt, eine Hündin, die an Lynn hochspringt.
»Ist nicht schlimm, hat unser Hund auch immer bei mir gemacht.«
Gerade als es nervt, ruft Stone mit kompromissloser Stimme: »Else, Platz!« und die Hündin gehorcht sofort, mit Tieren kann er umgehen.
Heute ist Lynn nicht nur zum Vergnügen hier, daher will sie direkt, nachdem er sein Bier bestellt und den Schnurrbart in den Schaum getunkt hat, zur Sache kommen, will Infos, Fakten, Klartext und Erfahrungswerte: »So, Stone, bevor wir das Ziel des Abends aus den Augen verlieren, bitte teile doch dein reichhaltiges Wissen zum Prenzlauer Berg mit mir, wie er ist und wie er war.«
»Ziel? Du hast ’n Ziel? Dit is’ ja schon mal janz falsch. Immer mit der Ruhe. Nischt überstürzen … Ick hab ja noch nich’ mal meen erstes Bier wech … Aaaaaaaaaah! … Ja, klar, Uwe, noch eens.«
Und dann erzählt Stone erst mal lang und breit von einer Reise nach Westdeutschland inklusive Stadionbesuch bei seinem Lieblingsverein Schalke 04. Allerdings sei er ganz enttäuscht gewesen, so wenige Hooligans. Das sei in Köln schon gleich viel besser gewesen. Ausführlich berichtet er von den dortigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und rivalisierenden Fangruppen. Bei diesem Thema werden auch die anderen Thekenhocker wach: »Wat haste denn mitte Hools am Kopp?«
»Na, ick war selber mal eener. Als ick noch jung un’ dämlich war … BFC, det war meen Verein.« Und es folgt der nächste Vortrag über gewaltbereite Fußballfans in der Ex-DDR, Schneisen der Verwüstung hätten Stone und seine Genossen durch die DDR gezogen. Lynn kennt die Geschichte. Als er ihr zum ersten Mal davon erzählte, wollte sie es gar nicht glauben. In der BRD hat man nichts darüber erfahren, die DDR-Oberen haben das sehr konsequent unter der Decke gehalten, Ausflüsse westlicher Dekadenz im Sozialismus? Durfte nicht sein, aber inzwischen gibt es umfangreiche Bücher über dieses Phänomen. Stone hat ihr Bilder gezeigt, Fußballgewalt im Osten, auf einem Foto sei er sogar selber abgebildet. Lynn hat da nur einen keilenden Mob gesehen, mittendrin ein Langhaariger mit Kutte von hinten, auf den Stone tippte, »das bin ich, keine zwanzig, mitten im Gefecht«, warum soll das nicht stimmen? Immerhin hat er deswegen gesessen, zwei Jahre Bautzen, danach hat er sich die Schlägereien abgewöhnt.
»Der Grund, wieso ich dich treffen wollte … Weißt du noch?«
»Wie? Und ick denk’, det Mädchen will dich ma’ wiedersehn. Wo wa’ uns jetze jar nich’ mehr über den Wech laufen, ick hier inne Zivillesation und du da oben bei’de Zombies …«
»Na ja. Nein. Doch. Klar. Du weißt schon.«
»War nur’n Witz. Du weeßt doch, Stone is’ immer und konkret hilfsbereit! Aber eens sarick dir jleich: Da haste dir wat vorjenommen. Det is’ ’n Thema, aber sooo jroß.« Um das Unmaß angemessen zu akzentuieren, breitet Stone seine langen Arme aus. »Det war schon zu Ostzeiten ’n Thema jewesen. Da iss’ die Frare: Womit sollick anfangen? Ick könnte den janzen Abend drüber quatschen, weeßte, und die Nacht jleich noch mit durch.«
»So lange lieber nicht. Wir wollen uns schließlich auch betrinken.«
»Det is schon zu Ostzeiten ’n Thema jewesen. Rykestraße, die wollten det ja allet abreißen.
»Echt?«
»Aber ja. Sollten Plattenbauten hin. ›Mietskasernen bilden die Widersprüche des Kapitalismus ab, der Sozialist wohnt in der Platte.‹ Det war sooo kurz davor. Aber wir ham’t verhindert!«
»Du?«
»Ja, icke. Und die Inizjativen. Wir sind einfach in den WBA eingetreten …«
»In den was?«
»Ach ja, det kennst du nich’. Du Westjewächs. WBA. Wohnbezirksausschuss. In jedem Block jab’s ditte. Die Wohnbezirksausschüsse dienten dem Aufbau der Nationalen Front.«
»Bitte was? … Egal, red’ einfach weiter. Du hast also den Abriss der Ryke verhindert?«
»Nuja, ick war mehr Sympathisant.«
»Mich interessiert die jüngste Zeit. Die Neunziger. Als dann wirklich saniert wurde.«
»Ja, Horror.«
»Wie man’s nimmt.«
»Wenn’de darüber wat wissen willst, muss’de mit’n Leuten reden, die dabei waren. Noch besser die jetzt noch drinstecken. Jibt ’ne Betroff’nenvatretung für’t Viertel, warste da schon? Kollwitzstraße. Nee …? Kennste nich’? Mensch, det is do’ det erste, wat ick machen würde. Jeh’ da mal hin. Such die Leute, sar’ ick, Architekten, Leute vonne Inizjativen, Leute, die da jewohnt haam und jetzt nicht mehr. Erfährste allet aus erster Hand. Ick kenn da schon einije. Ick kenn’ ne Menge. Die können dir erzählen, wat da abjing. Diese janze Scheiße …«
»Ich sehe das nicht nur negativ. Das war schon auch ’ne Aufwertung. War doch alles völlig runtergekommen.«
»Wo kommst du noch mal her? Düsseldorf? Dann ist klar. Für uns hier in Berlin ist dit keene Uffwertung. Nur wat die Mieten anjeht. Ja. Det stimmt. Die sind uffjewertet wor’n, janz erheblich sojar. … Uwe, Bananenweizen!«
Süß, det Meedchen, jetzt isse wech, die letzte U-Bahn … weil sie noch immer da oben wohnt bei de’ Großwesire’ und Mandarine’ aus Besserverdienenden-Land, süß und so schmal, die kannste mit eener Hand um die Hüfte packen.
»Else, zerr nicht so!« Kennt sich aus, der Hund, riecht die Hasenheide … »Ja, ick weeß, da jeht’et inn’et Jemüse. Aber jetze nich’, Else, wir kieken noch ma’ in die Billardschänke, stimmt’s? Hattenwa doch jesacht?« Hatte wirklich ’n bisschen wenig Auslauf heute. »Ja, Else, det darfste. Darauf wart ick jern. … Feiner Hund, bist ’ne feine Else, ja, janz prima.« Die is’ schon immer konkret dankbar, diese Augen, treue Hundeaugen, wirklich. Hm? Was’n da los? Nur die Nasen vorm Spätkauf, krakeelen rum, ja, muss dit denn so laut sein? Die armen Leute wolln doch schlafen. Hoffentlich schlagen’se sich nich’ wieder die Köppe ein. Die Russen wahrscheinlich, die lieben dit, draußen trinken, die billigen Bier- und Wodka-Preise, und dann entweder Kloppe oder Tränen. »Und, Else, allet klar?« Nase klebt am Boden, wie ein Magnet, diese Nase, und dit bei der Jeschwindigkeit, det ist für Else wie Lesen, weiter im Text, Asphalt-Literatur, klar, die Hunde wissen Bescheid, die können die Jerüche deuten, und welcher Wissenschaftler kann denn saren, wat die Tiere beim Riechen tatsächlich fühlen oder denken, wat jenau denen det bringt? Und wat die allens verstehen … Else liest das Pflaster Neuköllns … »Wenn du nur sprechen könntest, Else!«
Da sind wir. Wie gut, dass die nich’ auch schon zu haben. In Berlin is’ nischt mehr los, um een, zwee Uhr allet tote Hose. Auf Walt is’ Verlass immerhin. Oder? Doch nach Hause? Weiter im Jünger lesen oder am Roman was tun? Hm, Roman, na ja, ganze neunzehn Seiten bisher, nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Roman kannste dit nich’ nennen, neunzehn Seiten, kaum mehr als ein Vorwort, aber aufschreiben muss ick et, so oder so, wenn’t nur nich’ so schwer wär, sich aufzuraffen. Noch dazu, Schreibmaschine, Einfingersuchsystem. Ja, dit Problem ha’m noch janz andere jehabt. Hemingway oder so. Dieser dunstije Jeruch in dem Laden, immer dasselbe: »Los, Else, rin in die jute Stube!«
So, bamm, aber genau so! »Strike!«
»Geiler Stoß, Alter! Hier …!«
Na, noch’n Zwanzijer in die Hand, Trinkgeld, immerhin, zusammen mit dem von vorher.
»Immer ’ne Freude, mit dir Jeschäfte zu machen, Murat.«
Hm, gähnende Leere, verwaiste Tische mit Rauchschwaden drüber, wie in so Spielerfilmen, Walt knipst schon die ersten Lampen aus, ist es doch schon wieder so spät geworden … Ja, Dämmerung und Else pennt und pennt … Wie sie mit den Läufen zuckt, träumt wilde Jagden mit anderen Hunden. »Else …!« Wie immer schlagartig wach, wie die Hunde det so können. Wenn ’de det bei mir machst, da kannste lange warten … »Brav, Else, komm wir gehen. Ab nach Hause. … Ciao, Walt! Mach et jut!«
»Denn bis morgen …«
»Morjen, morjen, Walt, wat denkss du von mir? Bin ick ’n Zocker …?«
Die Karl-Marx-Straße riecht wie frisch jewaschen, dip dip dip, in the water, nee, in the night und dann geht die Nacht jestärkt und jesäubert daraus hervor. Natürlich Quatsch mit Soße. Der janze Dreck, die Plastiktüten, Verpackungen, Essensreste, Kotze – allet noch da. Sieht man nur nich’ so, die Dämmerung mildert den Eindruck, vielleicht mildert sie auch nur den Blick des Betrachters, kann ooch sein.