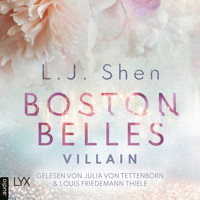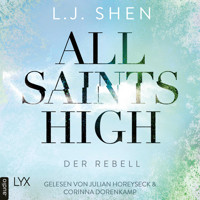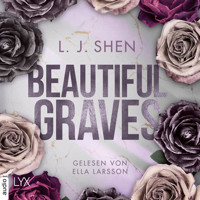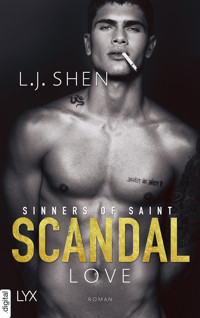
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sinners of Saint
- Sprache: Deutsch
Sie sind skrupellos, böse und verboten - aber es ist unmöglich, ihnen nicht zu verfallen
Trent Rexroth ist kalkuliert und skrupellos. Einzig seine vierjährige Tochter Luna erwärmt sein kaltes Herz. Doch seit ihre Mutter vor drei Jahren sang- und klanglos aus ihrem Leben verschwand, spricht Luna nicht mehr. Egal, was Trent versucht - seine Tochter scheint sich völlig von der Welt zurückgezogen zu haben. Das Letzte, was Trent nun braucht, ist ein verwöhntes, reiches Mädchen wie Edie Van Der Zee als Praktikantin. Doch Edie wirbelt nicht nur seine Multi-Milliarden-Dollar-Firma durcheinander, sie baut als Einzige auch eine Verbindung zu Luna auf - und weckt Gefühle in Trent, von denen er glaubte, sie nie wieder spüren zu können ...
"Das beste Buch des Jahres!" ANGIE'S DREAMY READS
Band 3 der SINNERS-OF-SAINT-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin L. J. Shen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungSoundtrackZitatPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33EpilogDanksagungDie Autorin LeseprobeImpressumL. J. SHEN
SCANDAL LOVE
Sinners of Saint
Roman
Ins Deutsche übertragen vonPatricia Woitynek
Zu diesem Buch
Trent Rexroth ist kalkuliert und skrupellos. Einzig seine vierjährige Tochter Luna erwärmt sein kaltes Herz. Doch seit ihre Mutter vor drei Jahren sang- und klanglos aus ihrem Leben verschwand, spricht Luna nicht mehr. Egal, was Trent versucht, seine Tochter scheint sich völlig von der Welt zurückgezogen zu haben. Das Letzte, was Trent nun braucht, ist ein verwöhntes, reiches Mädchen wie Edie Van Der Zee als neue Assistentin – zumal sie auch noch die Tochter seines größten Konkurrenten in der Firma ist. Doch Edie wirbelt nicht nur Vision Heights Holdings durcheinander, sie baut als Einzige auch eine Verbindung zu Luna auf. Wenn Edie in ihrer Nähe ist, kommt Luna Stück für Stück aus ihrem Schneckenhaus heraus, und Trent weiß, dass er Edie nicht mehr gehen lassen kann. Dabei ahnt er, dass die Achtzehnjährige sein Untergang sein könnte. Nicht nur weil er mit seinen dreiunddreißig Jahren zu alt für sie ist, sondern auch weil sie Gefühle in ihm weckt, von denen er glaubte, sie nie wieder spüren zu können.
Für Sunny Borek und Ella Fox
Soundtrack
»Believer« – Imagine Dragons
»Girls and Boys« – Blur
»Just the Two of Us« – Grover Washington Jr.
»Pacific Coast Highway« – Kavinsky
»Sweater Weather« – The Neighbourhood
»Lonely Boy« – The Black Keys
»Shape (Of My Heart)« – Sugababes
Die zu den wenigen monogam lebenden Tierarten zählenden Seepferdchen schwimmen überwiegend paarweise, wobei sie ihre Schwänze miteinander verschlingen. Zu ihrem achtstündigen Balztanz gehört, dass sie sich synchron nebeneinanderher treiben lassen und ihre Farbe wechseln. Sie sind romantisch, anmutig und zerbrechlich.
Genau wie die Liebe.
Sie führen uns vor Augen, dass die Liebe stürmisch sein sollte wie der Ozean.
Prolog
EDIE
Maßlosigkeit:
Üppiges und unmäßiges Essen und Trinken.Übermäßiges Verlangen nach Luxus und Genuss; dem Land wird ein maßloser Umgang mit Ressourcen vorgeworfen.Die schlimmste der sieben Todsünden. Jedenfalls sah ich das so. Und meine Meinung war die einzige, auf die es ankam, als ich mich an diesem Mainachmittag in der unbarmherzigen südkalifornischen Sonne gegen die weiße Brüstung lehnte, welche die quirlige Strandpromenade von Todos Santos vom glitzernden Ozean und den atemberaubenden Jachten trennte, und die Passanten abcheckte, weil ich dringend Bargeld benötigte.
Fendi, Dior, Versace, Chanel, Burberry, Bulgari, Louboutin, Rolex.
Gier. Ausschweifung. Korruption. Laster. Hochstapelei. Blendwerk.
Ich versuchte, mir ein Urteil über sie zu bilden. An der Art und Weise, wie sie ihre Bio-Smoothies für zehn Dollar tranken und auf ihren individuell gefertigten, farbenfrohen, von Tony Hawk signierten Skateboards dahinglitten. Ich versuchte, mir ein Urteil über sie zu bilden in dem Bewusstsein, dass sie dasselbe nicht mit mir tun konnten. Weil ich praktisch unsichtbar war, vermummt mit einem dicken schwarzen Kapuzenpulli, die Hände tief in den Taschen meiner engen schwarzen Jeans vergraben, dazu ein Paar alte ungeschnürte Dr. Martens und ein ramponierter JanSport-Rucksack, der von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde.
Ich wirkte androgyn.
Ich bewegte mich wie ein Geist.
Ich fühlte mich wie ein Scharlatan.
Und ich war im Begriff, etwas zu tun, was meiner Selbstachtung einen erheblichen Dämpfer verpassen würde.
Wie bei jedem riskanten Spiel galt es, einige Regeln zu beachten: keine Kinder, keine Senioren, keine sich abstrampelnden Durchschnittsmenschen. Ich zielte auf die Reichen ab, die Prototypen meiner Eltern. Die Frauen mit den Gucci-Taschen und die Männer in den Brunello-Cucinelli-Anzügen. Die Damen, die ihre Pudel in nietenbesetzten Michael-Kors-Handtaschen spazieren trugen, und die Herren, die aussahen, als hätten sie eine Schwäche für Zigarren im Gegenwert der Monatsmiete eines Normalbürgers.
Es war beschämend einfach, auf der Promenade potenzielle Opfer auszumachen. Laut der Erhebung von 2018 war Todos Santos die wohlhabendste Stadt in Kalifornien, und sehr zum Missfallen des alten Geldadels ließen sich immer mehr Neureiche wie mein Vater auf diesem Flecken Erde nieder, mitsamt ihren monströsen, aus Italien importierten Limousinen und genug Klunkern, um damit ein Schlachtschiff zu versenken.
Kopfschüttelnd bestaunte ich das Kaleidoskop aus Farben, Gerüchen und gebräunten, spärlich bekleideten Körpern. Konzentrier dich, Edie.
Beute. Ein guter Jäger witterte sie schon von Weitem.
Meine heutige Mahlzeit war soeben flotten Schrittes an mir vorübergezogen und lenkte unbeabsichtigt meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie warf den Kopf zurück und ließ ihre makellosen perlweißen Zähne sehen. Es war eine in Chanel gewandete, von Kopf bis Fuß nach dem neuesten Trend ausstaffierte Vorzeigefrau mittleren Alters. Ich interessierte mich nicht sonderlich für Mode, aber mein Vater mochte es, seine Geliebten mit Luxusklamotten auszustatten und sie bei gesellschaftlichen Anlässen vorzuzeigen, wo er sie als seine ganz persönlichen Assistentinnen vorstellte. In dem verzweifelten Bemühen, seinen jungen Gespielinnen zu ähneln, legte sich auch meine Mutter diese Designerstücke zu. Ich erkannte Übermaß auf den ersten Blick. Und diese Frau verspürte keinen Hunger. Weder nach Essen noch nach Liebe, den einzigen beiden Dingen, die wirklich zählten.
Sie ahnte nicht, dass ihr Geld mir Liebe erkaufen würde. Ihre bald leere Brieftasche würde mein Herz bis zum Rand damit füllen.
»Ich würde alles für diesen Entensalat in der Brasserie geben. Meinst du, wir könnten morgen hingehen? Vielleicht hätte Dar Lust mitzukommen«, sagte sie affektiert und bauschte mit einer manikürten Hand ihren kinnlangen platinblonden Bob.
Erst als sie mir bereits den Rücken zukehrte, bemerkte ich, dass sie Arm in Arm mit einem großen, attraktiven Mann ging, der mindestens zwanzig Jahre jünger war als sie. Er war gebaut wie Robocop und gekleidet wie ein gepflegter David Beckham. War er ihr jugendlicher Liebhaber? Ihr Ehemann? Ein guter Freund? Ihr Sohn? Es machte so gut wie keinen Unterschied für mich.
Sie war das perfekte Opfer. Abgelenkt, zerstreut, versnobt. Wenn sie und ihr Portemonnaie getrennte Wege gehen müssten, wäre das für diese Frau nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Sie hatte vermutlich eine persönliche Assistentin oder eine andere arme, bedauernswerte Person, die sich um die lästigen bürokratischen Konsequenzen kümmern würde, indem sie ihr neue Kreditkarten und einen Ersatzführerschein besorgte.
Jemanden wie Camila.
Diebstahl war mit einem Drahtseilakt vergleichbar. Voraussetzung waren ein sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, nicht in den Abgrund zu schauen oder in meinem Fall in die Augen der Zielperson. Ich war klein, zierlich und flink. Meinen Blick unverwandt auf die schwarz-goldene YSL-Handtasche geheftet, die an ihrem Arm baumelte, bahnte ich mir den Weg durch den Pulk von ausgelassenen Mädchen in Bikinis und Eis schleckenden Familien.
Die Geräuschkulisse wurde gedämpft, Menschen und Imbisswagen verschwanden aus meinem Blickfeld, ich sah nur noch diese Tasche und mein Ziel vor Augen.
Ich rief mir ins Gedächtnis, was ich von Bane gelernt hatte, holte tief Luft und hechtete danach. Ich riss sie ihr vom Arm und sprintete schnurstracks in Richtung einer der vielen schmalen Gassen, die sich zwischen den Geschäften und Restaurants an der Uferpromenade entlangzogen. Ohne mich umzuschauen, rannte ich blindlings und wie besessen drauflos.
Wumm, wumm, wumm. Meine Docs dröhnten auf dem heißen Asphalt, aber die Folgen, die es nach sich zöge, das benötigte Geld nicht aufzutreiben, ließen mein Herz lauter hämmern. Das schrille Gelächter der Mädchen auf der Promenade schwächte sich ab, während ich den Abstand zu meinem Opfer vergrößerte.
Ich hätte eine von ihnen werden können. Es wäre noch immer möglich. Wieso tue ich das? Warum kann ich es nicht einfach lassen?
Noch eine Ecke, dann wäre ich bei meinem Auto, würde die Tasche öffnen und meinen Schatz begutachten. Berauscht von Adrenalin und Endorphinen entschlüpfte mir ein hysterisches Kichern. Ich hasste es, Leute auszurauben. Noch mehr hasste ich jedoch die Empfindung, die mit der Tat einherging. Doch am allermeisten hasste ich mich selbst. Den Menschen, zu dem ich geworden war. Dennoch versetzte mich das befreiende Gefühl, etwas Böses zu tun und ungestraft davonzukommen, in Hochstimmung.
Tiefe Erleichterung durchströmte mich, als mein Wagen in Sicht kam. Der alte schwarze Audi TT, den mein Vater seinem Geschäftspartner Baron Spencer abgekauft hatte, war das Einzige, was ich in den letzten drei Jahren von ihm bekommen hatte, aber selbst dieses Geschenk ging mit einer Erwartungshaltung einher. Mich seltener zu Hause anzutreffen war sein oberstes Ziel. Darum kam er an den meisten Abenden einfach gar nicht heim. Problem gelöst.
Ich fischte den Schlüssel aus meinem Rucksack und legte den Rest der Strecke hechelnd wie ein kranker Hund zurück.
Die Fahrertür war fast schon in Reichweite, als die Welt plötzlich aus dem Lot geriet und meine Knie nachgaben. Ich brauchte mehrere Sekunden, um zu realisieren, dass ich nicht aus Ungeschicklichkeit gestolpert war. Die Luft wurde aus meinen Lungen gepresst, als eine große, harte Hand meine Schulter packte und mich herumwirbelte. Bevor ich den Mund öffnen und irgendetwas tun konnte – schreien, beißen oder Schlimmeres –, schloss sie sich brutal um meinen Arm und zog mich in die Gasse zwischen einem Fast-Food-Lokal und einer französischen Boutique. Ich stemmte mich mit den Stiefeln dagegen und versuchte verzweifelt, mich seinem Griff zu entwinden, aber der Kerl war viel größer als ich und der reinste Muskelberg. Der Zorn verstellte mir die Sicht zu sehr, als dass ich ihn genauer in Augenschein nehmen konnte. Der Tumult, der in mir wütete, wuchs sich zu einem Inferno aus, das mich für einen Moment blind machte. Ich knallte mit dem Rücken gegen eine Hauswand, und mir entfuhr ein Keuchen, als der Schmerz bis in mein Steißbein schoss. Instinktiv stieß ich die Arme nach vorn, um ihm das Gesicht zu zerkratzen, während ich gleichzeitig schrie und nach ihm trat. Meine Angst glich einem Orkan. Unmöglich, durch ihn hindurchzusegeln. Der Unbekannte packte meine Handgelenke und presste sie über meinem Kopf gegen die kühle Fassade.
Das war’s, dachte ich. Jetzt bist du erledigt. Wegen einer dummen Handtasche, an einem Samstagnachmittag, auf einer der meistfrequentierten Strandpromenaden Kaliforniens.
Ich machte mich darauf gefasst, dass seine Faust mit meinem Gesicht kollidieren oder – schlimmer noch – sein fauliger Atem über meinen Mund streichen würde, während seine Hand mir die Hose herunterzog.
Dann hörte ich den Fremden lachen.
Ich runzelte die Stirn und kniff die Augen zusammen, versuchte, das Entsetzen wegzublinzeln und meine klare Sicht wiederzuerlangen.
Er nahm peu à peu Gestalt an, wie ein in Arbeit befindliches Gemälde. Als Erstes kamen seine graublauen Augen hinter dem Nebel aus Furcht zum Vorschein. Sie hatten die Farbe von Mondstein, von mit Silber durchzogenen Saphiren. Dann seine gerade Nase, die symmetrischen Lippen, die Wangenknochen, scharfkantig genug, um damit Diamanten zu schneiden. Doch es war nicht seiner extrem maskulinen, einschüchternden Optik geschuldet, dass ich ihn sofort wiedererkannte. Sondern der gefährlichen Wildheit, die in Wellen von ihm abstrahlte. Er war ein dunkler, barbarischer Ritter, der durch sein Schweigen bestrafte, mit seiner Autorität Angst einflößte. Wir waren uns erst einmal begegnet, auf einer Gartenparty von Dean Cole vor ein paar Wochen, hatten jedoch kein Wort miteinander gewechselt.
Er hatte mit überhaupt niemandem geredet.
Trent Rexroth.
Wir waren nicht einmal Bekannte, und alles, was ich über ihn wusste, sprach gegen ihn. Er war Millionär, Single und demzufolge wahrscheinlich ein Playboy. Kurz gesagt, die jüngere Ausgabe meines Vaters, was bedeutete, dass ich so versessen darauf war, ihn kennenzulernen, wie mir die Cholera einzufangen.
»Du hast fünf Sekunden, um zu erklären, warum du meine Mutter beklaut hast.« Seine Stimme war staubtrocken, aber seine Augen glitzerten. »Fünf.«
Seine Mutter. Kacke. Ich steckte bis zum Hals in der Patsche. Trotzdem bereute ich es nicht, sie ausgewählt zu haben. Es hatte genau die Richtige getroffen. Sie war eine weiße reiche Frau aus der Vorstadt, die weder die Kohle noch die Tasche vermissen würde. Dumm nur, dass ihr Sohn seit sechs Monaten ein Geschäftspartner meines Vaters war.
»Lass meine Handgelenke los«, zischte ich durch zusammengebissene Zähne. »Sonst ramm ich dir das Knie in die Eier.«
»Vier.« Ungerührt verstärkte er den Griff um meine Unterarme, während er mich mit den Augen herausforderte, meine Drohung wahr zu machen, wenngleich wir beide wussten, dass ich zu feige war, es auch nur zu versuchen. Ich verzog das Gesicht, obwohl er mir nicht wirklich wehtat. Er übte gerade so viel Druck aus, um mir extremes Unbehagen zu bereiten und einen höllischen Schrecken einzujagen.
Noch nie hatte mir jemand körperliche Schmerzen zugefügt. Unter den Reichen und Vornehmen galt das ungeschriebene Gesetz, dass man seine Kinder zwar ignorieren, sie auf ein Internat in der Schweiz schicken oder bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag in der Obhut eines Kindermädchens lassen, jedoch – Gott bewahre – niemals die Hand gegen sie erheben durfte. Von Verwirrung und Panik erfasst, schaute ich mich nach der YSL-Tasche um. Rexroth ahnte sofort, was ich vorhatte, und kickte die Tasche zwischen uns. Sie prallte gegen meine Stiefel.
»Verguck dich nicht zu sehr in sie, Schätzchen. Drei.«
»Mein Vater bringt dich um, wenn er erfährt, dass du mich angefasst hast«, spie ich ihm entgegen und versuchte, mein Gleichgewicht wiederzufinden. »Ich bin –«
»Jordan Van Der Zees Tochter«, vollendete er sachlich und ersparte mir somit, mich ihm vorzustellen. »Es tut mir leid, aber ich muss dir sagen, dass mich das einen Scheißdreck interessiert.«
Mein Vater war geschäftlich mit Rexroth verbunden und hielt neunundvierzig Prozent der Anteile an Vision Heights Holdings, der Firma, die Trent zusammen mit seinen Freunden von der Highschool gegründet hatte. Das machte Jordan zu einer Bedrohung für Rexroth, auch wenn er nicht wirklich dessen Boss war. Trents in Falten gezogene Stirn bestätigte, dass er tatsächlich nicht eingeschüchtert war. Aber ich wusste, mein Vater würde austicken, sollte er erfahren, dass Trent sich an mir vergriffen hatte. Jordan Van Der Zee würdigte mich kaum je eines Blickes, doch wenn er es tat, dann um seiner Macht über mich Geltung zu verleihen.
Es drängte mich, Trent im Gegenzug zu verhöhnen, warum, das wusste ich selbst nicht. Vielleicht, weil er mich demütigte – wenngleich ich insgeheim einsah, dass ich es verdient hatte.
Aus seinen Augen schossen Blitze, die meine Haut versengten, wo immer sie auftrafen. Meine Wangen wurden flammend rot, und das ärgerte mich maßlos, weil er fast doppelt so alt war wie ich und außerdem absolut tabu. Die Schmach, auf frischer Tat ertappt worden zu sein, wurde jetzt noch dadurch getoppt, dass ich unwillkürlich die Schenkel zusammenpresste, während er die Finger in meine Handgelenke grub, als wollte er sie zerfleischen.
»Was hast du vor? Willst du mich schlagen?« Ich reckte das Kinn vor, mein Blick so aufsässig wie meine Stimme und meine Körperhaltung. Seine Mutter war weiß, folglich musste sein Vater farbig sein. Trent war ein großer, muskulöser Mann mit brauner Haut und schwarzem, militärisch kurz geschorenem Haar. Er trug eine anthrazitgraue Hose, ein weißes Hemd und eine Vintage-Rolex. Dieser umwerfende, atemberaubende, arrogante Bastard.
»Zwei.«
»Du zählst jetzt schon seit zehn Minuten von fünf runter, Klugscheißer«, bemerkte ich und zog spöttisch eine Braue hoch. Er quittierte das mit einem derart teuflischen Grinsen, dass ich hätte schwören können, Reißzähne zu sehen, bevor er meine Handgelenke so abrupt losließ, als stünden sie in Flammen. Ich fing sofort an, sie zu massieren, während er wie ein dunkler Schatten über mir aufragte und seinen Countdown mit einem geknurrten »eins« beendete.
Wir starrten einander an, ich ihn mit ängstlicher Miene, er mich belustigt. Mein Puls schnellte in die Höhe, und ich fragte mich, was in meinem Inneren vor sich gehen mochte, ob Blut und Adrenalin in meinen Herzkammern rauschten. Aufreizend langsam hob er die Hand und zog mir die Kapuze vom Kopf, sodass sich meine wellige blonde Mähne bis zu meiner Taille ergoss. Es machte mich schrecklich nervös – so entblößt, wie ich mich fühlte. Er nahm mich gemächlich in Augenschein, als wäre ich eine Ware und er unentschlossen, ob er sie kaufen sollte oder nicht. Ich war ein hübsches Mädchen – ein Umstand, der meine Eltern gleichermaßen freute wie beunruhigte –, aber Trent war ein erwachsener Mann, während ich die zwölfte Klasse der Highschool besuchte, zumindest noch die nächsten zwei Wochen. Ich wusste, dass reiche Typen junge Frauen bevorzugten, aber von Teenagern ließen sie in der Regel die Finger.
Es verging eine ganze Weile, bevor ich das Schweigen unterbrach. »Und was jetzt?«
»Jetzt warte ich.« Er schien drauf und dran, meine Wange zu streicheln. Meine Lider flatterten, und mein Herz schlug einen Purzelbaum, der bewirkte, dass ich mich sowohl jünger als auch älter fühlte, als ich war.
»Du wartest?« Ich zog die Stirn in Falten. »Worauf denn?«
»Darauf, dass das Druckmittel, das ich gegen dich in der Hand habe, sich als nützlich erweist, Edie Van Der Zee.«
Er kannte meinen Vornamen. Es war schon erstaunlich genug, dass er mich als Jordans Tochter wiedererkannt hatte, obwohl er mich auf der Party seines Freundes vor mehreren Wochen nur von Weitem gesehen hatte, aber dies hier … war irritierend aufregend. Woher sollte Trent Rexroth meinen Namen wissen, außer er hatte sich danach erkundigt? Mein Vater erwähnte mich in der Firma nicht. Das war eine unumstößliche Tatsache. Er versuchte nach Möglichkeit zu vergessen, dass ich existierte.
»Was könntest du wohl von mir brauchen?« Ich zog skeptisch die Nase kraus. Er war ein einflussreicher Mogul in den Dreißigern und spielte in einer ganz anderen Liga, sodass wir nicht mal auf demselben Spielfeld antraten. Damit ging ich nicht zu hart mit mir ins Gericht. Immerhin war es meine freie Entscheidung. Ich könnte so reich sein wie er – Korrektur: Ich war potenziell fünfzig Mal reicher als er. Die Welt hatte mir zu Füßen gelegen, aber ich trat sie zur großen Bestürzung meines Vaters beiseite, anstatt es mir darin gemütlich zu machen.
Doch davon hatte Trent Rexroth keine Ahnung. Er wusste absolut nichts davon.
In seiner Nähe, unter seinem prüfenden Blick fühlte ich mich unglaublich lebendig. Er beugte sich ganz nah zu mir und verzog seine für Poesie und Sünde und Wonne geschaffenen Lippen zu einem Lächeln. »Ich brauche deinen Vater an einer kurzen Leine«, raunte er. »Gratuliere. Du hast dich soeben zum latenten Bauernopfer gemacht.«
Er richtete sich auf und geleitete mich zu meinem Audi, indem er meinen Nacken umfasste, als wäre ich ein wildes Tier, das dringend gezähmt werden musste, und ich konnte an nichts anderes denken als daran, dass mein Leben soeben um ein Vielfaches komplizierter geworden war.
Er klopfte auf das Wagendach und lächelte mich durch das heruntergelassene Fenster an, bevor er sich seine Ray-Ban auf die Nase schob. »Fahr vorsichtig.«
»Leck mich.« Meine Finger zitterten, als ich die Handbremse löste.
»Nicht in einer Million Jahre, Mädel. Du bist die Zeit im Knast nicht wert.«
Ich war schon achtzehn, nur machte das praktisch keinen Unterschied. Ich konnte mich gerade noch davon abhalten, ihm ins Gesicht zu spucken, als er etwas Kleines, Hartes aus der Tasche seiner Mutter kramte und zu mir ins Auto warf. »Reiseproviant. Noch ein gut gemeinter Rat: Halte dich vom Eigentum anderer Leute fern. Nicht jeder ist so nachsichtig wie ich.«
Er war nicht nachsichtig. Sondern das Musterexemplar eines Wichsers. Bevor ich mir eine Retourkutsche überlegen konnte, hatte er sich schon abgewandt und schlenderte davon, zurück blieben nur eine Spur seines berauschenden Dufts und die Blicke interessierter Frauen. Noch immer wie benebelt und außerdem verärgert über seinen letzten Kommentar schaute ich nach, was er auf meinen Schoß geworfen hatte.
Einen Snickers-Riegel.
Anders ausgedrückt, er behandelte mich wie ein Kind, indem er mir befahl, mich abzuregen. Für ihn war ich nichts als ein Witz.
Ich fuhr von der Promenade auf direktem Weg nach Tobago Beach und besorgte mir von Bane ein kleines Darlehen, um den nächsten Monat finanziell über die Runden zu kommen. Ich war zu aufgewühlt, um einen weiteren Taschendiebstahl zu riskieren.
Aber dieser Tag veränderte etwas und gab meinem Leben irgendwie eine Richtung, die ich nicht für möglich gehalten hätte.
Es war der Tag, an dem ich erkannte, dass ich Trent Rexroth hasste.
An dem ich ihn auf meine schwarze Liste setzte, ohne Aussicht auf Bewährung.
Und an dem ich realisierte, dass ich mich in den richtigen Armen immer noch lebendig fühlen konnte.
Schade nur, dass es zugleich die völlig falschen waren.
KAPITEL 1
TRENT
Sie ist ein Labyrinth ohne Ausgang.
Ein ätherischer steter Puls. Präsent und doch nur zu erahnen.
Ich liebe sie so sehr, dass ich sie manchmal hasse.
Und es macht mir Angst, weil ich tief im Inneren ahne, was sie ist.
Ein unlösbares Rätsel.
Und ich weiß, wer ich bin.
Der Idiot, der versuchen wird, es zu entschlüsseln.
Um jeden Preis.
»Wie war dir zumute, als du das verfasst hast?« Sonya hielt das von einem Whiskyring verunzierte Blatt so vorsichtig, als handelte es sich um ein Neugeborenes. In ihren Augen glänzten Tränen. Das Dramalevel war hoch in dieser Sitzung. Ihre Stimme klang brüchig, und ich wusste, worauf sie hoffte: auf einen Durchbruch. Einen Wendepunkt. Diese Schlüsselszene in einem Hollywoodstreifen, nach der sich alles ändert. Das seltsame Mädchen überwindet seine Hemmungen, der Vater erkennt, dass er ein kaltherziger Mistkerl ist, und gemeinsam arbeiten sie an ihren Gefühlen … bla, bla, bla, her mit den Taschentüchern.
Ich rieb mir übers Gesicht und warf einen Blick auf meine Rolex. »Ich war stockbesoffen, als ich es schrieb, darum war mir vermutlich nach einem Burger zumute, um den Alkohol aufzusaugen«, antwortete ich mit ausdruckslosem Gesicht. Ich redete nicht viel – welch eine Überraschung –, darum nannte man mich den Stummen. Wenn ich es tat, dann mit Sonya, die meine Grenzen kannte, oder mit Luna, die diese ebenso ignorierte wie mich.
»Betrinkst du dich oft?«
Sonyas Miene offenbarte Gereiztheit. Meist überspielte sie ihre Regungen, aber ich sah durch die dicke Schicht aus Make-up und Professionalität.
»Nicht dass dich das etwas anginge, aber die Antwort lautet Nein.«
Überlaute Stille senkte sich über den Raum. Ich trommelte mit den Fingern auf das Display meines Handys, während ich mich zu erinnern versuchte, ob ich den Koreanern den Vertrag nun zugeschickt hatte oder nicht. Ich hätte netter sein sollen, immerhin saß meine vierjährige Tochter neben mir und bekam alles mit. Ich hätte vieles sein sollen, aber über meine Arbeit hinaus waren in mir nur Ärger, Zorn und Verwirrung. Warum, Luna? Was zum Teufel habe ich dir getan?Wie hatte es dazu kommen können, dass ich zu einem dreiunddreißigjährigen alleinerziehenden Vater mutiert war, der für kein anderes weibliches Wesen als für seine Tochter Zeit oder Muße aufbrachte?
Sonya verschränkte die Finger. »Lasst uns über Seepferdchen sprechen«, schlug sie vor, um das Thema zu wechseln. Das tat sie immer, wenn mir der Geduldsfaden zu reißen drohte. Ihr Lächeln war warm, aber neutral, genau wie ihr Büro. Mein Blick wanderte über die Bilder von lachenden Kindern, die hinter ihr an der Wand hingen – der typische IKEA-Mist –, die zartgelbe Tapete, die hübschen geblümten Sessel. Bemühte sie sich zu sehr oder ich mich zu wenig? Das war im Augenblick schwer zu sagen. Ich schaute zu meiner Tochter und schenkte ihr ein Lächeln. Sie erwiderte es nicht. Was ich ihr nicht verübeln konnte.
»Möchtest du deinem Dad erzählen, warum Seepferdchen deine Lieblingstiere sind, Luna?«, zwitscherte Sonya.
Ihr verschwörerischer Ton entlockte Luna ein Grinsen. Obwohl sie schon vier war, sprach sie nicht. Überhaupt niemals. Nicht ein Wort, nicht einmal eine Silbe. Mit ihren Stimmbändern war alles in Ordnung. Wenn sie sich wehtat, schrie sie, wenn sie erkältet war, hustete sie, wenn im Radio ein Song von Justin Bieber lief (was an sich schon eine Tragödie war, würde manch einer wohl behaupten), summte sie gedankenverloren mit.
Luna sprach nicht, weil sie nicht wollte. Es war kein physisches, sondern ein psychologisches Problem unbekannter Ursache. Ich wusste nur, dass meine Tochter anders war, teilnahmslos und wunderlich. Die Leute drückten ihr das Etikett »speziell« auf, als Rechtfertigung dafür, dass sie sie wie eine Kuriosität behandelten. Ich konnte sie nicht länger vor den befremdeten Blicken, den fragend hochgezogenen Augenbrauen schützen. Tatsächlich wurde es zunehmend schwierig, ihre Schweigsamkeit als Introvertiertheit zu verkaufen, und ich war es ohnehin leid, es zu vertuschen. Luna war schon immer unglaublich klug, und das wird sie auch immer sein. Sie hat bei den unzähligen Tests, die im Lauf der Jahre mit ihr durchgeführt wurden, ausnahmslos überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Sie verstand jedes Wort, das man an sie richtete. Sie war aus freien Stücken stumm und gleichzeitig zu jung, um eine solche Entscheidung zu treffen. Sie davon abbringen zu wollen war ebenso absurd wie aussichtslos. Aus diesem Grund unterbrach ich zweimal wöchentlich meinen Arbeitstag und fand mich in Sonyas Praxis ein, in dem verzweifelten Bemühen, meine Tochter dazu zu bringen, ihren Boykott gegen die Welt aufzugeben.
»Ich kann dir sagen, weshalb Luna Seepferdchen liebt.« Sonya spitzte die Lippen und legte mein in trunkenem Zustand verfasstes Gedicht auf ihren Schreibtisch. In ihrer Gegenwart sprach Luna hin und wieder ein paar Worte, allerdings nie, wenn ich dabei war. Sie hatte mir erzählt, dass Lunas Stimme so ruhig war wie ihr Blick. Sanft und zart, ohne jeden Sprachfehler. »Eben die eines kleinen Mädchens, Trent. Eines Tages wirst du sie auch hören.«
Müde von alldem runzelte ich die Stirn und stützte den Kopf auf eine Hand, während ich die vollbusige rothaarige Psychologin ansah. Im Büro warteten drei Geschäftsabschlüsse, mit denen ich mich befassen musste – vier, falls ich vergessen haben sollte, den Koreanern den Vertrag zu schicken. Meine Zeit war zu kostbar für Geschwafel über Seepferdchen.
»Ach ja?«
Sonya fasste über den Schreibtisch und legte ihre zierliche weiße Hand auf meine bronzefarbene Pranke. »Seepferdchen sind deshalb ihre Lieblingstiere, weil deren männliche Vertreter die einzigen Geschöpfe in der Natur sind, die anstelle des Weibchens den Nachwuchs austragen. Sie werden trächtig und brüten die Eier aus. Ist das nicht wundervoll?«
Ich blinzelte mehrmals und warf einen Blick zu meiner Tochter. In Anbetracht der Tatsache, dass mir schon der Umgang mit Frauen meines Alters schwerfiel, hieß die Verantwortung für Luna, ein ganzes Arsenal an Kugeln im Dunkeln abzufeuern und darauf zu hoffen, dass wenigstens eine ins Ziel traf. Frustriert durchstöberte ich mein Hirn nach irgendetwas, was meiner Tochter ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde.
Wenn das Jugendamt wüsste, was für ein emotionaler Krüppel ich war, würde man mir Luna wegnehmen, ging es mir durch den Sinn.
»Ich …«, setzte ich an. Sonya räusperte sich und kam mir zu Hilfe.
»Hör mal, Luna? Wieso hilfst du Sydney nicht dabei, einen Teil der Sommerlager-Deko draußen anzubringen? Darin bist du doch sehr geschickt.«
Sydney war Sonyas Assistentin. Luna hatte sich während unserer Wartezeiten im Empfangsbereich mit ihr angefreundet. Sie nickte und sprang von ihrem Stuhl.
Ihre tiefblauen, von karamellfarbener Haut und hellbraunen Locken umrahmten Augen funkelten wie Diamanten. Meine Tochter war wunderschön, und die Welt war hässlich. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihr helfen sollte.
Es brachte mich um wie ein Krebsgeschwür. Langsam, qualvoll und unausweichlich.
Nachdem die Tür mit einem dumpfen Laut ins Schloss gefallen war, richtete Sonya die Augen auf mich. Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht.
Ich schaute erneut auf die Uhr. »Wie sieht’s aus, kommst du heute Abend auf eine Nummer vorbei?«
»Herrgott, Trent.« Sie schüttelte den Kopf und verschränkte die Finger im Nacken. Ich nahm ihre Entrüstung gelassen, immerhin war ich vertraut damit. Aus mir unbegreiflichen Gründen bildete sie sich ein, mich zurechtstutzen zu können, nur weil sie mir gelegentlich einen blies. In Wahrheit verdankte sie jeden Funken Macht, den sie über mich hatte, allein Luna. Meine Tochter betete sie an und ließ sich in ihrer Gegenwart öfter mal zu einem Lächeln hinreißen.
»Ich werte das als ein Nein.«
»Wieso betrachtest du es nicht als einen Weckruf? Mit ihrer Liebe zu Seepferdchen drückt Luna ihre Wertschätzung dafür aus, dass du dich um sie kümmerst. Deine Tochter braucht dich, Trent.«
»Ich bin für sie da«, stieß ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. Es war die Wahrheit. Was hätte ich denn sonst noch für Luna tun können als bisher ohnehin schon? Ich war ihr Vater, wenn sie jemanden brauchte, der das Glas Essiggurken für sie aufschraubte, und ihre Mutter, wenn es darum ging, ihr Unterhemd in ihre schwarze Ballettstrumpfhose zu stopfen.
Vor drei Jahren hatte Lunas Mutter sie in ihr Bettchen gelegt, sich ihre Schlüssel und zwei große Koffer geschnappt und war aus unserem Leben verschwunden. Val und ich waren kein Paar gewesen. Unsere Tochter war das Produkt einer kokainseligen Junggesellenparty in Chicago, die aus dem Ruder gelaufen war. Sie war im Hinterzimmer eines Stripclubs gezeugt worden, wo Val mich geritten hatte, während eine zweite Stripperin auf meinem Gesicht saß. Rückblickend betrachtet hätte ich für meine Dämlichkeit, es ohne Kondom zu treiben, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde verdient. Ich war achtundzwanzig und beim besten Willen nicht mehr grün hinter den Ohren, sondern erfahren genug, um zu wissen, worauf ich mich einließ.
Aber damals hatte ich das Denken noch meinem Schwanz und meinem Geldbeutel überlassen.
Jetzt, mit dreiunddreißig, benutzte ich meinen Verstand und hatte das Lebensglück meiner Tochter im Hinterkopf.
»Wann beenden wir endlich diese Scharade?«, konfrontierte ich Sonya. Ich hatte es satt, das eigentliche Thema zu umschiffen. »Nenn mir deinen Preis, und ich werde ihn bezahlen. Was verlangst du dafür, Luna exklusiv zu betreuen?«
Sonya arbeitete für eine private Einrichtung, die teils vom Staat und teils von Personen wie meiner Wenigkeit finanziert wurde. Sie konnte nicht mehr als achtzig Riesen im Jahr verdienen, darum war ich ziemlich optimistisch. Ich hatte ihr hundertfünfzigtausend für denselben Aufwand wie bisher angeboten, wenn sie sich ausschließlich um Luna kümmerte, zuzüglich der besten verfügbaren Krankenversicherung für sie und ihren Sohn. Sonya seufzte leidgeprüft und kniff ihre azurblauen Augen zusammen. »Begreifst du denn nicht, Trent? Du solltest Luna dazu bringen, sich mehr Menschen zu öffnen, anstatt ihr zu erlauben, mit niemandem außer mir zu kommunizieren. Abgesehen davon ist sie nicht das einzige Kind, das mich braucht. Ich lege Wert darauf, mit einem breiten Spektrum von Patienten zu arbeiten.«
»Sie liebt dich«, argumentierte ich und zupfte ein paar Fusseln von meinem eleganten dunklen Gucci-Anzug. Glaubte sie etwa, ich wollte nicht, dass meine Tochter mit mir redete? Mit meinen Eltern? Meinen Freunden? Ich hatte alles versucht. Luna gab nicht nach. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, sicherzustellen, dass sie nicht völlig im Kopf vereinsamte.
»Luna liebt dich auch. Sie braucht einfach noch mehr Zeit, um aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen.«
Ich erhob mich. »Dann lass uns hoffen, dass es passiert, bevor ich einen Weg finde, es zu zerbrechen.« Es war nur halb scherzhaft gemeint. Meine Tochter flößte mir ein Gefühl von Hilflosigkeit ein, wie ich es nie gegenüber einem erwachsenen Menschen gespürt hatte.
»Trent«, sagte Sonya flehentlich, als ich die Tür erreichte. Ich blieb stehen, drehte mich jedoch nicht um. Nein. Scheiß drauf. Sie redete nicht viel über ihr Privatleben, wenn sie für eine schnelle Nummer bei mir vorbeikam, nachdem Luna und das Kindermädchen zu Bett gegangen waren, aber ich wusste, dass sie geschieden war und einen Sohn hatte. Scheiß auf die normale Sonya und ihren normalen Sohn. Sie verstanden Luna und mich nicht. In der Theorie vielleicht. Aber die gebrochenen, gepeinigten, absonderlichen Menschen, die wir in Wirklichkeit waren? Nie im Leben. Sonya war eine gute Psychologin. War sie unmoralisch? Möglich, aber selbst das war fraglich. Wir hatten Sex, mehr war nicht im Spiel, das wussten wir beide. Keine Gefühle, keine Komplikationen, keine Erwartungen. So fähig sie in ihrem Job auch war, begriff sie wie alle anderen trotzdem nicht, was ich durchmachte. Was wir durchmachten.
»Gerade haben die Sommerferien angefangen. Bitte, hör auf mich, und nimm dir mehr Zeit für Luna. Du arbeitest zu viel. Sie würde wirklich davon profitieren, dich mehr um sich zu haben.«
Ich wandte mich zu ihr um und sah sie prüfend an.
»Was schlägst du vor?«
»Wie wäre es, wenn du dir jede Woche einen Tag freinimmst, um ihn mit ihr zu verbringen?«
Mein bedächtiges Augenzwinkern verriet ihr, dass sie eindeutig den Bogen überspannte. Sonya ruderte zurück, wenn auch nicht kampflos. Sie presste die Lippen aufeinander, um mir zu bedeuten, dass sie gleichermaßen genug von mir hatte.
»Ich versteh schon. Du bist eine große Nummer und kannst dir keine Freizeit leisten. Versprichst du mir wenigstens, dass du sie einmal pro Woche mit in die Arbeit nehmen wirst? Camila kann auf sie aufpassen. Ich weiß, dass es in eurer Firma ein Spielzimmer und andere Einrichtungen für Kinder gibt.« Camila war Lunas Kindermädchen. Die Zweiundsechzigjährige würde in Kürze zum zweiten Mal Großmutter werden, darum war es nur eine Frage der Zeit, bis sie uns verlassen würde. Kein Wunder, dass mich jedes Mal, wenn ich ihren Namen hörte, ein unbehagliches Gefühl beschlich.
Ich nickte. Sonya schloss die Augen und stieß den Atem aus. »Danke.«
In der Lobby griff ich mir Lunas Dora-Rucksack und verstaute ihr Plüsch-Seepferdchen darin. Ich streckte ihr die Hand hin, und sie nahm sie, bevor wir uns wortlos zum Aufzug begaben.
»Lust auf Spaghetti?«, fragte ich, wohl wissend, dass ich enttäuscht würde. Sie würde mir nicht antworten.
Stille.
»Wie wäre es mit einem Frozen Yogurt?«
Keine Reaktion.
Die Fahrstuhltür glitt auf. Wir stiegen ein. Luna hatte ihre schwarzen Chucks, ein Paar Jeans und ein weißes T-Shirt an. Die Art von Outfit, wie das Van-Der-Zee-Mädchen es vermutlich trug, wenn es nicht gerade unschuldige Passanten ausraubte. Luna besaß optisch keinerlei Ähnlichkeit mit Jaimes Tochter Daria oder den anderen Mädchen in ihrer Kindergartengruppe, die auf Kleider und Rüschen standen. Aber das war nicht weiter schlimm, weil meine Tochter sich auch für sie nicht die Bohne interessierte.
»Was hältst du von Spaghetti und Frozen Yogurt?« Ich feilschte, was ich sonst niemals tat.
Ihr schlaffer Griff um meine Hand wurde einen Tick fester. Wir kamen der Sache näher.
»Wir geben den Frozen Yogurt auf die Spaghetti und essen, während wir Stranger Things gucken. Zwei Folgen. Deine übliche Schlafenszeit ist somit von acht auf neun verschoben.« Scheiß der Hund drauf. Es war Wochenende, und meine üblichen willigen Betthäschen konnten warten. Heute Abend würde ich mit meiner Tochter Netflix gucken. Ein Seepferdchen sein.
Luna stimmte wortlos zu, indem sie kurz meine Hand drückte.
»Aber es gibt keine Schokolade oder Kekse nach dem Essen«, warnte ich sie. Ich führte ein strenges Regiment, was Ernährung und feste Abläufe betraf. Luna drückte abermals meine Hand.
»Ich lasse nicht mit mir handeln, Fräulein. Ich bin dein Vater, darum bin ich derjenige, der die Regeln festlegt. Keine Schokolade. Und keine Jungs – weder nach dem Abendessen noch sonst irgendwann.«
Der Anflug eines Lächelns huschte über ihr Gesicht, bevor es wieder ernst wurde und sie ihren Rucksack mit dem Seepferdchen darin an ihre Brust drückte. Meine eigene Tochter hatte mich bisher niemals angelächelt, kein einziges Mal, noch nicht einmal versehentlich.
Sonya irrte sich. Ich war kein Seepferdchen.
Ich war der Ozean.
KAPITEL 2
EDIE
Schwerelosigkeit.
Dieses Gefühl verlor nie seinen Reiz.
Auf einer fetten Welle zu surfen, eins zu werden mit dem Ozean. Sie mit gebeugten Knien und angespannten Bauchmuskeln geschickt hinabzugleiten, das Augenmerk auf das Einzige gerichtet, was wirklich zählt im Leben: nicht hinzufallen.
Mein schwarzer Neoprenanzug klebte an meiner Haut und hielt meinen Körper selbst um sechs Uhr morgens in den salzigen Fluten warm. Am Rande meines Blickfelds sah ich, wie Bane eine andere Welle bezwang, sie auf dieselbe Weise ritt, wie er seine Harley fuhr: waghalsig, aggressiv, rücksichtslos. Die See war laut. Tosend schlug die Brandung an den weißen Strand, sie übertönte meine negativen Gedanken und schaltete die an mir nagenden Ängste und Komplexe stumm. Für eine kurze Stunde gab es keine Dramen in meinem Leben, keine finanziellen Sorgen, keine Pläne, die es zu fassen galt, keine Träume, die zu platzen drohten. Weder Jordan noch Lydia Van Der Zee, keine Erwartungen und Drohungen, die wie ein Damoklesschwert über meinem Kopf schwebten.
Da war nur ich.
Das Meer.
Der Sonnenaufgang.
Oh, und Bane.
»Das Wasser ist verflucht kalt«, knurrte er auf seinem Brett und ging in die Hocke, um seinen Ritt auf einer der herausforderndsten Naturgewalten bis zur letzten Sekunde auszukosten. Bane war um einiges größer und schwerer als ich, dabei aber immer noch gut genug für eine Profikarriere, wenn das wirklich sein Bestreben gewesen wäre. Er navigierte entlang der besonders krassen Wellen, indem er sich mit seinem Board regelrecht daran festklammerte. Surfen war wie Sex – jedes Mal anders, egal, wie viel Übung man hatte. Es gab immer wieder etwas Neues zu entdecken, jede Begegnung war einzigartig und von wildem Potenzial erfüllt.
»Kein guter Tag, um deinen Schwanz in den Wind zu hängen«, bemerkte ich grunzend, während ich mit eingezogenem Bauch parallel zu einem Wellenkamm glitt, um meine Dynamik beizubehalten. Bane liebte es, nackt zu surfen. Weil ich es hasste, wenn er das tat, und er es genoss, mir Unbehagen einzuflößen. Seinen langen Schniedel im Wind flattern zu sehen lenkte mich ab und irritierte mich.
»Du wirst den Anblick noch vermissen, Gidget«, konterte er und spielte mit seiner gepiercten Zunge an dem Ring in seiner Unterlippe. Gidget war der Spitzname für zierliche weibliche Surfer, und Bane nannte mich nur dann so, wenn er mich ärgern wollte. Er hatte schon jetzt mit seiner Balance zu kämpfen und schaffte es nur mit Mühe, seiner Welle standzuhalten. Wenn jemandem sein Brett flöten ginge, dann ihm.
»Träum weiter!«, schrie ich, um das Tosen der See zu übertönen.
»Nein, im Ernst. Dein Vater ist hier.«
»Mein Vater ist … was?« Ich musste ihn falsch verstanden haben. Ganz bestimmt sogar. Jordan hatte mich nie zuvor aufgespürt, schon gar nicht in aller Herrgottsfrühe an einem Sandstrand, der seinem Faible für teure Anzüge entgegenstand. Ich verlor den Halt, und das nicht nur körperlich, als ich zum Ufer spähte, das von Palmen sowie pinken, grünen, gelben und blauen Bungalows gesäumt wurde. Kein Zweifel, inmitten des Potpourris aus Bars, Hotdog-Ständen und zusammengeklappten gelben Liegestühlen stand Jordan Van Der Zee am Strand, während hinter ihm die Sonne aufging, als stiege ein Inferno direkt aus der Hölle empor. Er war mit einem dreiteiligen Brooks-Brothers-Anzug bekleidet und trug eine missbilligende Miene zur Schau. Auch am Ende eines Arbeitstags legte er nichts von beidem ab.
Selbst aus der Ferne konnte ich sehen, dass sein linkes Augenlid verärgert zuckte.
Ich fühlte geradezu, wie sein heißer Atem über mein Gesicht strich, während er zweifellos wieder einmal einen Befehl blaffte.
Vor Verzweiflung schnürte sich meine Kehle zu, als sei er zu nah, zu fordernd, zu viel für mich.
Ich rutschte vom Brett und schlug rücklings auf dem Wasser auf. Schmerz schoss durch meine Wirbelsäule bis hoch in meinen Kopf. Bane kannte meinen Vater nicht, aber wie jeder in der Stadt wusste er von ihm. Jordan gehörte das halbe Stadtzentrum von Todos Santos – die andere Hälfte war im Besitz von Baron Spencer –, und er hatte kürzlich angekündigt, dass er mit dem Gedanken spiele, als Bürgermeister zu kandidieren. Er lächelte breit in jede Kamera, die auf ihn gerichtet wurde, umarmte ortsansässige Geschäftsinhaber, küsste Babys und war sogar bei einigen Veranstaltungen an meiner Highschool aufgetaucht, um seine Unterstützung des Gemeinwesens zu demonstrieren.
Er wurde entweder verehrt, gefürchtet oder gehasst. Ich zählte zu letzterer Fraktion, wusste ich doch aus eigener Erfahrung, dass sein Zorn ein scharfes Schwert war, das tiefe Wunden schlagen konnte.
Ich schmeckte Salz auf der Zunge und spuckte aus, bevor ich mein gelbes Surfbrett an der Verbindungsleine um meinen Fußknöchel zu mir heranzog. Ich kletterte darauf und legte mich flach auf den Bauch, dann paddelte ich mit flinken Bewegungen Richtung Ufer.
»Lass den Wichser warten«, rief Bane mir hinterher. Ich warf einen Blick zu ihm. Er saß rittlings auf seinem schwarzen Board und starrte mich mit brennender Intensität an. Sein langes blondes Haar haftete an seiner Stirn, seinen Wangen; seine waldgrünen Augen sprühten Feuer. Ich betrachtete ihn aus dem vermuteten Blickwinkel meines Vaters. Ein abgerissener Strandgammler mit Tätowierungen, die den größeren Teil seines Oberkörpers und seinen Hals bedeckten. Ein Wikinger, ein Höhlenmensch, ein Neandertaler, der gern am Rande der Gesellschaft lebte.
Ein verdorbener Apfel.
Wir Van Der Zees verkehren nur mit der Crème de la Crème, Edie.
Ich richtete den Blick zurück zum Strand und paddelte noch schneller.
»Verdammter Schisser!«, brüllte Bane laut genug, damit Jordan es hörte.
Ich gab keine Antwort, und das nicht, weil mir etwa die Worte gefehlt hätten. Bane kannte nicht die ganze Geschichte. Ich musste meinem Vater weiterhin höflich begegnen. Er hielt meine Zukunft in seinen schwieligen Händen. Ich wollte sie wiederhaben.
Bane hatte seinen Spitznamen nicht ohne Grund. Ganz ohne Scheuklappen betrachtet, war er eigentlich nicht mehr als ein besserer Rüpel. Er wurde nur deswegen nie der Schule verwiesen, weil seine Mutter ganz dicke mit dem Stadtrat war. Aber er herrschte über uns alle, jeden einzelnen Schüler an der Highschool. Über die reichen Snobs. Die korrupten Footballer. Die Cheerleader, die den anderen Mädchen das Leben zur Hölle machten.
Bane war kein guter Kerl. Er war ein Lügner, ein Dieb und ein Drogendealer.
Und mein Exfreund.
Er hatte ins Schwarze getroffen, indem er meinen Vater als einen Wichser bezeichnete. Wohingegen dieser in einem anderen Punkt recht hatte: Die Lebensentscheidungen, die ich traf, waren zweifellos fragwürdig.
»Jordan?« Ich klemmte mir mein Brett unter den Arm und steuerte auf ihn zu. Der kalte Sand klebte an meinen Füßen und machte sie taub. Noch war mein Adrenalinspiegel hoch von meinem Ritt auf den Wellen, aber er würde bald sinken und ich zu frieren anfangen. Ich verzog keine Miene, weil ich wusste, dass mein Vater sich an meinem Missbehagen weiden und das Gespräch absichtlich in die Länge ziehen würde.
Die Augen zu Schlitzen verengt, wies er mit dem Kinn über meine Schulter. »Ist das der Protsenko-Junge?«
Ich zog die Nase kraus, ein nervöser Tick von mir. Obwohl Jordan selbst ein Immigrant der ersten Generation war, störte es ihn, dass ich mich mit einem russischen Jungen angefreundet hatte, der nach dem Zerfall der Sowjetunion mit seiner Mutter nach Kalifornien gekommen war.
»Ich hatte dir gesagt, dass du dich von ihm fernhalten sollst.«
»Er ist nicht der einzige Mensch, bei dem du das von mir verlangt hast«, schnaubte ich und schaute mit zusammengekniffenen Augen zum Horizont. »Ich schätze, wir können uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind.«
Er hakte die Daumen in seinen Hemdkragen, um ihn ein Stück zu weiten. »Was das betrifft, bist du auf dem Holzweg, Edie. Dieser Meinung war ich nie. Nur stelle ich mich den Herausforderungen. Man nennt das Elternkompetenz, und ich versuche, der Vaterrolle so gerecht wie möglich zu werden.« Jordan war ein Chamäleon, im höchsten Maß anpassungs- und wandlungsfähig. Er kaschierte seine Rücksichtslosigkeit mit Sorge, seine diktatorische Persönlichkeit mit Enthusiasmus und Zielstrebigkeit. Es waren seine Taten, die ihn zu dem Ungeheuer machten, das er in meinen Augen geworden war. Doch für Außenstehende war er einfach nur ein ganz normaler gesetzestreuer Bürger. Ein armer holländischer Junge, der mit seinen Eltern in die Staaten ausgewandert war und den amerikanischen Traum wahr gemacht hatte, indem er dank harter Arbeit und messerscharfem Verstand zum Selfmade-Millionär geworden war.
Er klang besorgt, und vielleicht war er das sogar, wenn auch nicht um mein Wohlergehen.
Ich wischte mir mit dem Arm übers Gesicht. »Vater.« Ich hasste es, ihn so nennen zu müssen, nur um ihn milde zu stimmen. Er hatte sich diese Anrede nicht verdient. »Du bist nicht hier, um über den ›Protsenko-Jungen‹ zu sprechen. Wie kann ich dir heute Morgen behilflich sein?« Ich rammte das Surfboard in den Sand und lehnte mich dagegen. Er streckte die Hand aus, um mein Gesicht zu berühren, bevor er sich entsann, dass ich nass war, und sie wieder in seine Tasche steckte. In diesem Moment wirkte er wie ein Mensch, so als hätte er keine Hintergedanken.
»Wo hast du die schriftlichen Zusagen der Boston und der Columbia University versteckt?« Er stemmte die Hände in die Hüfte, während mir die Kinnlade runterfiel. Eigentlich sollte er davon nichts wissen. Ich war an fünf Hochschulen angenommen worden. Harvard, Stanford, Columbia, Brown und Boston. Meine Durchschnittsnote war eins Komma eins, und mein Nachname lautete Van Der Zee. Folglich wussten die Verantwortlichen, dass mein Vater der Elite-Uni, die ihn von meiner Gegenwart erlöste, einige Millionen Dollar und notfalls auch noch eine Niere spenden würde. Bedauerlicherweise hatte es mich nie wirklich interessiert, an einer Hochschule in einem anderen Bundesstaat zu studieren. Der offensichtliche Grund war meine Leidenschaft fürs Surfen, das ich so dringend brauchte wie die Luft zum Atmen. Die Sonne und der weite Himmel waren Balsam für meine Seele. Aber noch wichtiger war, dass der einzige Mensch auf der Welt, der mir etwas bedeutete, hier in Kalifornien war. Ich würde nicht fortgehen. Nicht einmal rauf nach Stanford.
Jordan wusste das ganz genau.
»Ich habe sie nicht versteckt. Sondern verbrannt.« Das Neopren klatschte schmerzhaft gegen meine Haut, als ich mich aus meinem Nassanzug schälte, unter dem mein knapper violetter Bikini zum Vorschein kam. »Ich bleibe in seiner Nähe.«
»Ich verstehe«, sagte er. Ihm war klar, dass ich nicht von Bane sprach. Er hatte dieses Gespräch nur deshalb hierher an den Strand verlegt, weil er nicht riskieren konnte, dass meine Mutter es mitbekam. Lydia Van Der Zee war psychisch labil, ihre geistige Gesundheit hing ständig an einem seidenen Faden. Geschrei brachte sie an ihre Grenzen, und dieses Thema war brisant genug, um in einen heftigen Streit auszuarten.
»Sag es doch einfach.« Ich schloss die Augen und stieß einen Seufzer aus.
»Ich habe als Vater versagt, Edie, und dafür möchte ich mich entschuldigen.«
Der Adrenalinrausch vom Windsurfen war längst verebbt, und ich fröstelte. Praktisch halb nackt und hilflos wartete ich darauf, dass die Sonne höher stieg und meine Haut wärmte.
»Entschuldigung angenommen.« Ich kaufte sie ihm keine Sekunde ab. »Also, was ist der Plan? Ich bin sicher, du hast einen. Denn du bist bestimmt nicht hergekommen, um nach mir zu sehen.«
»Da du dieses Jahr nicht aufs College gehen wirst – was nicht automatisch auch für das nächste gilt, nur damit wir uns richtig verstehen – und du deinen Highschool-Abschluss in der Tasche hast, bin ich der Meinung, dass du für mich arbeiten solltest.«
Für mich. Nicht bei mir. Was einen kleinen feinen Unterschied macht.
»In einem Büro? Nein danke«, sagte ich tonlos. Ich gab dreimal die Woche Surfunterricht für Kinder. Da die Sommerferien angebrochen waren, hoffte ich darauf, mehr zu tun zu bekommen. Und ja, seit mein Vater mir den Geldhahn zugedreht hatte, betätigte ich mich zusätzlich regelmäßig als Taschendiebin. Ich hatte kein schlechtes Gewissen deswegen, immerhin musste ich für meine Gasrechnung, meine Versicherungen, meine Kleidung aufkommen, mein Leben und ihn finanzieren. Wenn ich keine Leute ausraubte, versetzte ich irgendwelchen Kram aus dem Haus meines Vaters in Todos Santos, den er gekauft hatte, kaum dass er dem Drei-Komma-Club beigetreten war. Schmuck. Elektrogeräte. Musikinstrumente. Jawohl, ich würde sogar unseren Hund versetzen, wenn wir einen hätten. Wenn es darum ging, den Menschen, den ich liebte, glücklich und zufrieden zu machen, kannte ich praktisch keine Grenzen. Nein, es kostete mich nicht viel Überwindung zu stehlen. Schließlich beklaute ich nur Leute, die es finanziell verkraften konnten. Das stellte ich hundertprozentig sicher.
»Das war keine Bitte. Betrachte es als einen Befehl«, entgegnete mein Vater und zog an meinem Ellbogen. Ich grub die Fersen tiefer in den Sand.
»Und wenn ich mich weigere?«
»Wird Theodore aus deinem Leben verschwinden«, drohte er seelenruhig. Die Ungerührtheit, mit der er seinen Namen aussprach, brach mir das Herz. »Er lenkt dich sowieso zu stark ab. Manchmal frage ich mich, wie viel mehr du aus dir gemacht hättest, wenn ich mich schon vor Jahren dazu durchgerungen hätte.«
In mir braute sich ein Sturm zusammen. Ich wollte ihn wegschubsen, ihm ins Gesicht spucken, ihn anschreien, aber ich konnte es nicht, weil er recht hatte. Jordan besaß diese Macht über mich. Von seinen weitreichenden Beziehungen ganz zu schweigen. Wenn er wollte, dass Theo von der Bildfläche verschwand, würde er dafür sorgen. Mit links.
»Was müsste ich tun?« Ich biss mir auf die Innenseite meiner Wange, bis sich der metallische Geschmack von Blut in meinem Mund ausbreitete.
»Was immer im Büro gerade anfällt. Hauptsächlich Zuarbeit. Keine Aktenablage, kein Telefondienst. Du brauchst eine ordentliche Dosis Realität, Edie. An mehreren Elitehochschulen angenommen zu werden und ihnen allen eine Absage zu erteilen, damit du deine Tage damit vertrödeln kannst, mit einem Kiffer zu surfen? Diese Zeiten sind vorüber. Ab jetzt wirst du dich nützlich machen. Du wirst mich jeden Morgen um sieben in die Firma begleiten und das Büro aufschließen – und erst gehen, wenn ich es dir erlaube, und sei es auch um sieben oder acht Uhr abends. Haben wir uns verstanden?«
Mein Vater war noch nie so weit gegangen, mich zu bestrafen, und ich war immerhin schon eine ganze Weile achtzehn – nur bedeutete das rein gar nichts. Ich lebte immer noch unter seinem Dach, stellte immer noch meine Füße unter seinen Tisch und – noch viel wichtiger – war immer noch seiner Gnade ausgeliefert.
»Warum tust du mir das an? Wieso gerade hier? Wieso jetzt?«
Sein linkes Augenlid zuckte wieder, sein Kiefer spannte sich an. »Oh bitte. Du hast dir das mit deinem leichtfertigen Lebensstil selbst eingebrockt. Es ist an der Zeit, dass du deinem Namen gerecht wirst. Spar dir diese Theatralik.«
Er wandte sich ab und marschierte zu dem Range Rover, der am Straßenrand der verwaisten Uferpromenade parkte. Der Motor lief, und sein Fahrer schaute abwechselnd zu uns und auf die Uhr. Ein schmales Lächeln strich über seine Lippen. Mein Vater hatte keine zehn Minuten gebraucht, um mich auf Linie zu bringen.
Ich stand da, festgefroren wie eine Eisskulptur. Ich hasste Jordan mit einer Leidenschaft, die normalerweise der Liebe vorbehalten ist. Mein Hass auf ihn war abgrundtief, er vergiftete meine Seele und verdarb meine Stimmung.
»Mein Gefühl sagt mir, dass du es inzwischen bereust, nicht auf mich gehört und ihn einfach ignoriert zu haben«, kommentierte Bane, als er neben mich trat und die Kante seines Boards in den Sand stieß, bevor er seine wilde blonde Mähne zu einem Männerdutt zwirbelte. Ich antwortete nicht.
»Scheint, als wäre er dir aufs Dach gestiegen.« Er stupste mich mit dem Ellbogen an und fischte ein Budweiser aus seinem Rucksack, der im Sand lag. Wen kümmerte es, dass es erst sieben Uhr morgens war?
Ich umklammerte die Muschelkette um meinen Hals. »Du hast ja keine Ahnung«, presste ich zähneknirschend hervor.
KAPITEL 3
EDIE
Einfach absurd.
Dieser Ort war das reinste Tollhaus.
Ich war nie zuvor in Jordans Firma gewesen, aber ich erkannte Anarchie, wenn sie mir entgegenschlug. Und was mich im fünfzehnten Stockwerk des Oracle-Gebäudes in Beverly Hills erwartete, wo Vision Heights Holdings seinen Sitz hatte, war Chaos in Reinkultur.
Und in Gestalt des einzigen Menschen, dessen Irrsinn es mit Banes aufnehmen konnte.
Baron »Vicious« Spencer.
Die ganze Etage war ein Tohuwabohu aus klingelnden Telefonen, tratschenden Frauen in Bleistiftröcken von St. John und debattierenden Männern in Maßanzügen. Elfenbeinfarbener Granit und Sitzmöbel aus antikem dunkelbraunem Leder prägten die Optik des Empfangsbereichs von VHH. Deckenhohe Fenster boten eine phänomenale Aussicht auf das hässlich-schöne, künstlich-reale, harsche Los Angeles in all seiner Pracht.
Und inmitten dieser luxuriösen, verschwenderischen, Macht verströmenden Umgebung begegnete ich dem Mann, der an der All Saints High sogar mehr als zehn Jahre später noch einen derart legendären Ruf genoss, dass man kürzlich eine Bank nach ihm, Vicious, benannt hatte.
»Wenn Sie schon einen ganzen Artikel über das Börsenwesen abkupfern, dann doch verflucht noch mal nicht ausgerechnet aus der Financial Times. Wer hat Sie Schwachkopf als Leiter der PR-Abteilung angeheuert? Wer?« Der Typ mit dem glatten rabenschwarzen Haar und den dunkelblauen Augen schleuderte einem schockiert dreinblickenden jungen Mann einen Stapel Unterlagen entgegen. Sie fielen wie Hagelkörner auf den Fußboden, nicht wie Konfetti. Vicious’ Kiefermuskel zuckte, als er seinem Gegenüber den Finger in die von einem gebügelten Hemd verhüllte Brust stieß.
»Bringen Sie diese Scheiße in Ordnung, bevor Sie die zweieinhalb Fotos von ihrer beschissenen Familie einpacken, die Sie vermutlich mitgebracht haben, um Ihr briefmarkengroßes Büro zu schmücken, Sie geistiger Tiefflieger. Sie haben Zeit bis um fünf, weil ich bei meinem Sechs-Uhr-Meeting so auftreten möchte, als wäre das alles hier nie passiert. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Fast alle Personen auf der Etage hatten sich in einem Halbkreis versammelt, um sich die Show anzusehen. Niemand wies Vicious wegen seines schofeligen Benehmens zurecht. Nicht einmal mein Vater. Alle schienen zu viel Angst vor ihm zu haben. Mir tat der PR-Bursche, der murmelte, dass sein Name Russell sei, zwar furchtbar leid, aber ich wollte meinen ersten Arbeitstag nicht damit beginnen, noch mehr Leute gegen mich aufzubringen.
»Bitte, Sir. Sie können mich nicht feuern.« Russell schien nahe dran, auf die Knie zu fallen. Es war die reinste Folter, ihm zuzusehen. Ich machte mich ganz klein in dem zweckmäßigen schwarzen Wollkleid eines französischen Designers, das ich an diesem Morgen aus dem Kleiderschrank meiner Mutter gemopst hatte, und versuchte, keine Miene zu verziehen.
»Ich kann, und ich werde. Verflucht, wo bleibt mein Kaffee?« Vicious warf einen Blick in die Runde und tippte mit dem Finger auf seine Unterlippe. Er trug einen Ehering. Man sollte meinen, dass er seit seiner Hochzeit sanftmütiger geworden wäre. Falsch gedacht.
Plötzlich trat Stille ein. Die Gruppe aus Anzugträgern teilte sich, um drei Männer durchzulassen, die ich aus den Wirtschaftsmagazinen, die bei uns zu Hause herumlagen, auf den ersten Blick wiedererkannte.
Dean Cole, Jaime Followhill und Trent Rexroth.
Die beiden Erstgenannten, die Trent flankierten, waren nur schmückendes Beiwerk. Sie waren einige Zentimeter kleiner als er, schmaler und insgesamt weniger Ehrfurcht gebietend. Es war der mit einem hellblauen Button-down-Hemd und einer hellgrauen Hose bekleidete Trent, der den Raum einnahm und allen die Show stahl. Er sah aus wie Sex auf zwei Beinen, und offensichtlich war ich nicht die Einzige, die das fand, weil mindestens drei Frauen in meiner Nähe ein atemloses Kichern entschlüpfte.
»Spencer.« Einen Becher von Starbucks in der Hand maß Trent ihn mit einem kühlen Blick. »Hast du gerade deine Tage? Reiß dich mal am Riemen. Wir haben Montagfrüh um acht.«
»Ja, wieso bist du so angepisst, V?«, schaltete nun auch Dean Cole sich ein. Sein breites Lächeln bewirkte, dass die Atmosphäre sofort erheblich entspannter und weniger bedrohlich wurde.
»Mäßigen Sie Ihre Ausdrucksweise«, blaffte mein Vater neben mir und verstärkte den Griff um meinen Arm. Ich hatte ganz vergessen, dass er ihn festhielt. Das erste Mal hatte er mich grob angepackt, als ich sechzehn war und mit zwei Ringen in meinem linken Nasenflügel nach Hause kam, und nachdem ich mir ein riesiges schwarzes Kreuz auf den Bauch hatte tätowieren lassen, handelte ich mir blaue Flecken ein. Der Druck seiner Finger war nie allzu fest – wie schon gesagt, misshandelten reiche Leute ihre Kinder nicht –, und er tat es auch nur, weil er wusste, wie sehr ich es hasste, neben ihm zu stehen. Dass manchmal Blutergüsse zurückblieben, war in seinen Augen wahrscheinlich nur ein netter Nebeneffekt.
Das Kreuz hatte keinen religiösen Hintergrund. Es war eine in schwarzer Tinte gestochene Botschaft.
Legt euch nicht mit mir an.
»Die Flachpfeife ist gefeuert. Bis Mittag will ich seinen Laptop auf meinem Schreibtisch. Außerdem seine Passwörter, sein Firmenhandy und seinen Parkausweis. Ich werde den Scheiß jemandem geben, der es verdient. Vielleicht dem Botenjungen, der morgens die Obstkörbe liefert.« Vicious machte eine vage Handbewegung in Russells Richtung, bevor er Jaime einen seiner zwei Kaffeebecher abnahm. Mein Herz krampfte sich zusammen.
Trent schob lautlos mit dem Fuß eine Tür auf, hinter der ich sein Büro vermutete. Es war wahrscheinlich kein schöner Zug von mir, dass ich pure Schadenfreude darüber empfand, wie sie alle meinen Vater mit Missachtung straften. »Niemand wird heute gefeuert. Abgesehen davon haben wir Wichtigeres zu tun. Rein mit euch.«
»Erstens: Leck mich. Zweitens: Erteil mir keine Befehle.« Vicious leerte seinen Becher in zwei langen Zügen und reichte ihn der nächststehenden Person. »Drittens: Ich brauche mehr Kaffee. Und zwar sofort.«
»Vicious …« Jaime räusperte sich, während der Mitarbeiter mit dem Becher zum Aufzug flitzte, um Nachschub zu besorgen.
»Dieser Idiot hat einen Artikel aus der Financial Times kopiert und in unsere Homepage eingefügt. Uns hätte eine Klage oder Schlimmeres blühen können.«
»B-bitte«, stammelte Russell. Seine Schwäche weckte den Blutdurst eines jeden Raubtiers in der Nähe, inklusive meinen. »Es war ein Fehler. Ich hatte nicht die Zeit, den Text selbst zu verfassen. Meine Tochter ist zwei Wochen alt. Sie schläft nachts nicht viel …«
Ich ertrug es nicht länger.
»Zeigt etwas Nachsicht mit dem Mann!«, platzte ich heraus. Ich entwand mich dem Griff meines Vaters, indem ich seine Hand abschüttelte, und ging mit entschlossenen Schritten auf die HotHoles zu. Alle vier sahen mich überrascht an, aber Trent war der Einzige, in dessen Miene sich außerdem Verachtung spiegelte. Ich ignorierte ihn und zeigte mit dem Finger auf Russell.
»Er hat sich entschuldigt. Wieso sollte er absichtlich einen solchen Bock schießen? Kommt schon, er hat eine Familie, für die er sorgen muss.«
»Das gefällt mir.« Cole lachte kopfschüttelnd und gab Spencer einen Klaps auf den Rücken. »Ein Teenager, der sich als Boss aufspielt. Niedlich.«
Mir schoss das Blut in die Wangen. Vicious gab sich gleichgültig. Er schien meine Anwesenheit kaum zur Kenntnis zu nehmen, aber immerhin ersparte er Russell die Entlassung und bedeutete ihm mit einem Handzeichen zu verschwinden, während Trent die Zähne bleckte und seine Aufmerksamkeit mir zuwandte.
»Ist heute der Tag, an dem man seine Kinder mit zur Arbeit bringen darf? Weil ich mich nämlich nicht erinnere, dieses Memo bekommen zu haben.« Das Gift in seiner Stimme hätte gereicht, um einen Wal zu töten. Kühl erwiderte ich seinen Blick, täuschte ein Selbstvertrauen vor, das ich nicht empfand.
Du hast dichsoeben zum potenziellen Bauernopfer gemacht, hallten seine Worte in meinem Kopf wider und machten jeden positiven Gedanken zunichte, den ich in Bezug auf ihn und sein Aussehen gehegt haben mochte. Obwohl es nur ein paar Wochen her war, dass er das zu mir gesagt hatte, dämmerte mir erst jetzt, wie problematisch die Zusammenarbeit mit ihm werden könnte.
»Edie wird eine Weile hier aushelfen.« Jordan zog mich wieder an seine Seite, als wäre ich sein Eigentum.
»Sagt wer?«
»Ich sage das.«
»Ich habe das nicht abgesegnet. Keiner von uns hat das.«
»Dann ist es ja gut, dass ich nicht gefragt habe.« Mein Vater lächelte kalt und grub seine langen schlanken Finger in meinen Arm. Ich blendete den Schmerz aus. Würde ich einen weiteren Streit mit ihm vom Zaun brechen, könnte es passieren, dass er mich Theo am Samstag nicht sehen ließe, und das wollte ich nicht riskieren. Trent kam auf uns zu, und mit jedem seiner Schritte schien mich eine Strömung zu erfassen, als ruderte ich in stürmisches Gewässer.
»Bei allem gebotenen Respekt für die Klüngeleien der weißen Oberschicht und Ihre Entscheidung, Ihrer unqualifizierten Tochter einen Job zuzuschanzen, für den viele weit besser geeignete Kandidaten töten würden, wird jede wichtige Personalentscheidung mit sämtlichen Partnern abgesprochen. Ist das korrekt?« Er wandte sich seinen Freunden zu, die ernst nickten. Der arme Russell war ganz und gar in Vergessenheit geraten. Sie hatten in mir ein neues, hilf- und rückgratloses Opfer gefunden, das sie peinigen konnten. Eine kleine Maus, die sich in das Reich großer Tiere verirrt hatte.
»Jetzt machen Sie mal halblang, Rexroth. Edie wird als Assistentin fungieren und nicht als Kundenbetreuerin.« Jordan winkte ungeduldig ab, was die Lage nicht besser machte. Sein Griff um meinen Arm wurde so fest, dass meine Knochen sich durch meine Haut bohren wollten.
»Sie wird sich auf dieserEtage aufhalten und Zugang zu unseren Interna haben. Es interessiert mich nicht, ob ihre Tätigkeit darin besteht, in der Küche Bananen zu schälen. Über diese Sache wird morgen bei einer Vorstandssitzung entschieden. Ende der Diskussion«, knurrte Trent.
Alle starrten ihn an, es herrschte eine dunkle Energie im Raum, sirrende Betroffenheit. Der Stumme hatte gesprochen. Nicht nur einzelne Worte, sondern ganze Sätze. Und zwar wegen niemand Geringerem als mir.
Ich hatte ihn endlich gefunden, den Mann, der noch furchteinflößender war als mein Vater. Nicht dass ich nach ihm gesucht hätte. Vicious war zwar ein Krawallmacher, Trent hingegen ein lautloser Jäger, der sich stundenlang geduldig an seine Beute heranpirschte und angriff, wenn man es am wenigsten erwartete.
Ein einsamer Panther. Wild, leise und raffiniert. Seine hellen kalten Augen maßen meinen Vater von oben bis unten, als wäre er Abschaum, bevor sie auf seiner Hand verharrten, die meinen Arm wie ein Schraubstock umfangen hielt. Ich hatte noch nie erlebt, dass jemand meinem Vater solche Geringschätzung entgegenbrachte. Jordan lockerte den Druck seiner Finger.