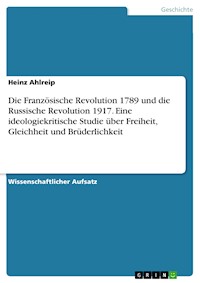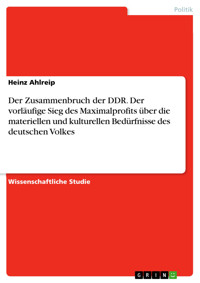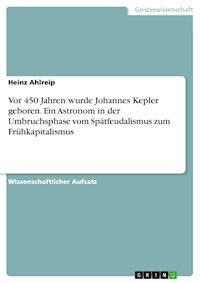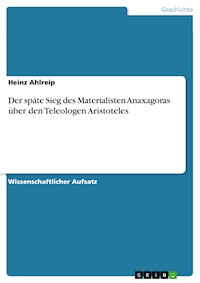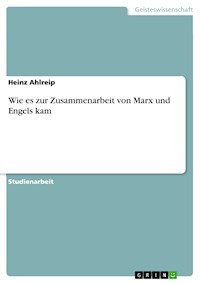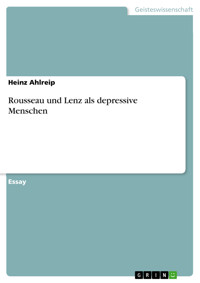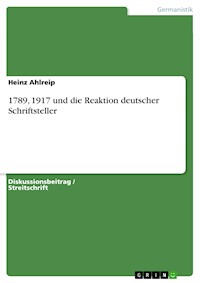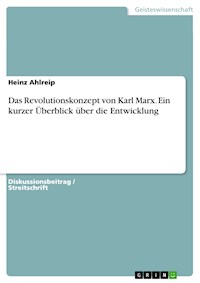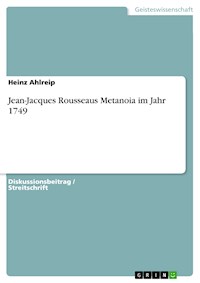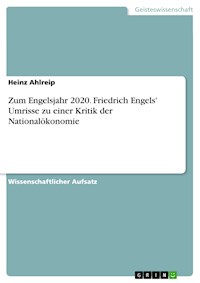36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Essay aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, , Sprache: Deutsch, Abstract: Rückblickend auf die Vergegenwärtigung des Geistes in Aufklärung und Revolution schrieb der alte Hegel: „Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert...“. Diese einmalige Durchschauerung ist das Urerlebnis, von dem aus die preußischen Reformer und die preußischen Philosophen entschlüsselt werden können. Die Aufklärung hatte letztendlich nicht den Durchblick gehabt, hatte die Welt nicht durchschaut. Das Stichwort heißt „durchschauern“. Es fehlt dem Gemüt in Deutschland die cartesianische Tradition des Rationalismus, für einen Franzosen ist es klar, dass die Aufklärung die Dinge durchschaut habe, es gibt in der französischen Sprache nicht einmal das dyonisische Wort „durchschauern“. In Frankreich gibt es die mächtige Tradition der ratio, zugleich gleichwertig das besonders durch Helvétius verbreitete Wissen, dass der Mensch von Bedürfnissen gesteuert wird, dass die Leidenschaften die Welt in Bewegung halten, ja dass der Mensch dadurch manipulierbar ist, was in jakobinistischen Prozessmanipulierungen ansatzweise auch versucht worden war als Kombination beider Stränge. Fatal war nur, dass die Revolutionäre sich gegenseitig unter die Guillotine manipulierten, die Revolutionsjustiz bekam Vorgaben. Der Einfluß von Helvétius ist von Scharnhorst auf seinen Schüler Clausewitz weitergegeben worden, denn bei ihm finden wir den Satz, dass die meisten Menschen nur durch unsichtbare Hebel auf der Sandbank ihrer Vorurteile flottgemacht werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.comhochladen und weltweit publizieren.
Inhaltsverzeichnis
SCHARNHORST
ANMERKUNGEN:
LITERATURLISTE:
SCHARNHORST
Ein General des Fortschritts ?
“Meine Karriere ist ganz mein eigen Werk, vom zehnten Jahre an.”
(mit einem Bleistift auf einen Zettel für seine Tochter geschrieben,
als er im März 1809 wegen eines Nervenfiebers mit dem Tod rang.
Das Nervenfieber wurde ausgelöst durch ungerechtfertigte Verleum-
dungen durch den König anläßlich der sogenannten Pillauer Affäre).
Wie der spätere preußische Staatskanzler Freiherr von Hardenberg kam auch Scharnhorst ausdem Hannoverschen, aber seine soziale Herkunft war eine ganz andere. Als Sohn des Kleinbauern (Brinksitzers) und Dragonerunteroffiziers Ernst Wilhelm Scharnhorst (7. Oktober 1723 bis 5. August 1782) am 12. November 1755 in Bordenau (Kreis Neustadt) geboren 1., nach seinem Großvater Gerhard Johann David getauft, wird er später in Offizierskreisen stets ein Fremdling bleiben, erst verachtet, dann beneidet. Es war damals und ist auch heute noch ungewöhnlich, dass ein Bauernsohn höchste Positionen bis zum General bekleidete. Das Bäuerliche blieb an ihm haften, noch 1812 schrieb Ernst Moritz Arndt: “Einen solchen Mann mag ich leiden, treu, grad, wahr wie ein Bauersmann, und lustig und fröhlich wie kein anderer. Ich sage Dir, ich habe lange nicht so Liebes und Tüchtiges gesehen als diesen alten Soldaten.” 2. Als Ernst Moritz Arndt diesen Eindruck gewann, war Scharnhorst bereits General geworden, aber bis dahin war es ein langer, oft beschwerlicher Weg. So hatte er zunächst keine geordnete Schulbildung erhalten. Mit sieben Jahren ging er zu einem kirchlichen Schulmeister in Anderten, der ihm die elementaren Anfänge des Lesens, Schreibens und Rechnens beibrachte, sodann betrieb er autodidaktische Studien und äußerte sich später bedauernd, dass er in fast keiner Wissenschaft einen mündlichen Vortrag genossen hätte. Mit zehn Jahren muß er miterleben, wie das elterliche Vorwerk Hämelsee völlig abbrannte. Als seine Eltern einen Erbstreit gewannen, hatten sie endlich etwas Geld, um ihrem Sohn Privatunterricht in Mathematik zu finanzieren. Diese zehn Jahre und sieben Monate dauernde „Kabale“ hatte ihm schon in jungen Jahren gezeigt, wieviel „Katzbalgerei“ - ein von ihm gebrauchtes Wort - es in dieser Welt gibt. Und auch in alten Jahren blieb er dabei, diese werde die Vernunft immer überwiegen. In Hannover kam er nach Aussage des Hannoverschen Historikers Pertz, der Biografien über den Freiherrn vom Stein und den Feldmarschall von Gneisenau geschrieben hatte, mit Rehberg, einem Sekretär der Hannoverschen Staatskanzelei, Dr. h.c. der Göttinger Universität und Brandes zusammen, politische Theoretiker, letzterer mit philosophischen Neigungen, die unter dem Einfluß des konservativen Ideologen Edmund Burke standen, der einer der schärfsten Kritiker der französischen Revolution war. Sein Widersacher Thomas Paine bezeichnete sein Wirken als “Darkness, attempting to illuminate Light“ (Dunkelheit, die versucht, das Licht zu erleuchten). Prägend wurde sein Aufenthalt in der Theoretischen Artillerieschule des Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe, die er mit 17 ½ Jahren nach einem Bittbrief an (und nach einer Prüfung am 29. April 1773, die beim Bauernsohn natürlich noch Lücken aufzeigte, durch) den Grafen bezog, verpflichtet hatte er sich beim Ingenieur- und Artilleriekorps für zehn Jahre, aber er wird nur fünf Jahre (von 1773 bis 1777) auf dem Wilhelmstein bleiben, auf dem zwölf Kadetten unterrichtet wurden. Vormittags war die Teilnahme am Unterricht Pflicht, nachmittags freiwillig. 3. Aus dem zunächst Mittelmäßigen wird bald ein Musterschüler. Der Freidenker Graf Wilhelm, der in Schaumburg-Lippe mit seinen 20 000 Seelen (davon 1200 Soldaten) von 1748 bis zu seinem Tode 1777 regierte, hatte auf einer in den Jahren 1761 bis 1767 künstlich angelegten Insel im Steinhuder Meer eine Liliputfestung bauen lassen, die als kleine Pflanzschule für die technischen Waffengattungen gedacht war. Über das Fachspezifische hinaus vermittelte er seinen Schülern, fremde Autorität stets auf ihren Gehalt zu prüfen, ihr nicht blind zu folgen. Da dieser Graf, den Goethe einen „wundervollen Mann“ nannte, der vielen als Sonderling vorkam und der das Außenseitertum an seinen Schüler vererben sollte, sehr bedeutsam für das Leben Scharnhorsts wurde, sollten wir etwas bei ihm verweilen. In London geboren, in Genf konfirmiert, in Leiden und Montpellier ausgebildet, hatte er durch Reisen nach England, Italien und Ungarn seine Weltkenntnisse erweitert. England durchstreifte er als Bettler, um Land und Leute wirklich kennenzulernen. Er beherrschte vier Sprachen fließend, las viel und wandte sich auch den Naturwissenschaften zu. Der bekannte, in Hannover praktizierende Arzt Zimmermann hatte durch sein Buch „Über die Einsamkeit“ überliefert, dass er bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Grafen einen zweistündigen Vortrag über Hallers große Physiologie über sich ergehen lassen musste. Er erkannte die zukünftige Bedeutung der Artillerie und sein Spitzname „Kanonengraf“ kam nicht von ungefähr, das Artilleriewesen wurde nach dem Buch von Struensee gelehrt. Im Siebenjährigen Krieg errang er mit britisch-hannoverschen Truppen, die auf der Grundlage der Konvention von Westminster fochten, bei Minden einen Sieg über die Franzosen. Bei der Belagerung von Kassel harrte er bei rauhem und schmutzigen Aprilwetter mit einfachen Soldaten aus und verzichtete auf das Privileg des Rasierens. 4. Als (vom englischen Kabinett) empfohlenen Organisator der portugiesischen Armee im Range eines „Generalissimus der Armeen Seiner Allergetreuesten Majestät des Königs von Portugal“ nimmt er noch heute einen bedeutenden Platz in der Geschichte Portugals ein. Das Land hatte sich damals der mit Frankreich verbündeten Spanier zu erwehren. Schon in Lissabon hatte der Graf, ab 1762 Oberbefehlshaber des portugiesischen Heeres, eine Offiziersschule für das portugiesische Heer gegründet. In seinem kleinen “Musterländle” Schaumburg-Lippe sorgte er für die Errichtung einer Seidenfabrik und einer Stückgießerei. Schon um 1760 gab es in seinem Duodez eine staatliche Armenfürsorge, Waisenhäuser, eine Brandversicherung sowie eine Krankenkasse, die die Rezepte beim Apotheker bezahlte. Von den militärtheoretischen Gedanken des Grafen wissen wir nur aus der einzig überlieferten Abhandlung: “Über die Kunst des Verteidigungskrieges”, die nur in wenigen Exemplaren erschienen war. Unter dem Einfluß der Aufklärung stehend, zum Beispiel durften auf dem Wilhelmstein Offiziersanwärter nicht mehr geschlagen werden, war auch für ihn nur noch der Defensivkrieg sittlich gerechtfertigt. (Mémoires pour servir à l‘ art militaire défensif 1775/76). 5. Jeder Angriff sei unter der Würde eines rechtschaffenden Mannes. Scharnhorst wird später immer vertreten, dass es sich im Krieg um die Vernichtung der Eindringlinge handelt, es gehe nicht um die Eroberung von Territorien. Die Abschaffung der Armee aber war tabu, den Ultrapazifismus der Aufklärung erachtete er als illusionär. Er betonte mehrmals, dass es für den fähigen Offizier darauf ankomme, den Ehrgeiz des je einzelnen Soldaten zu wecken, auf dass er mit einer inneren Anteilnahme kämpfe. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Graf Wilhelm neben dem stehenden Heer teilweise bereits die Bewaffnung seiner Bürger durchgeführt hatte und in seinem Kriegsplan auch den Bauern auf den umliegenden Feldern Verteidigungsaufgaben zuwies. Jeder 16. Bewohner in seinem Musterländle war Soldat. Die vorgesehene Kampfweise war der Tirailleurtaktik 6. gar nicht unähnlich, getragen wurde Wilhelms Konzept vom Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht. Seine soldatischen Gedanken kreisten um das Problem, wie verteidige ich mein kleines Land gegen ein größeres ? Und Scharnhorst hat sich oft an Schaumburg-Lippe erinnert, als er vor dem kolossalen Problem „Napoleon“ stand. Graf Wilhelm hatte rege Beziehungen zu den beiden bedeutendsten Vorkämpfern der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland im 18. Jahrhundert, zu Justus Möser (1720 bis 1794) und zu dem Philosophen Thomas Abbt (1738 bis 1766), der die Schrift „Vom Tode für das Vaterland“ verfasst hatte, stand über das rein Militärische hinaus auch in Kontakt mit Mendelssohn und Voltaire. Seine Position als Fürst begriff er im Sinne des Naturrechts als Auftrag zur Wohlfahrt im Sinne der Herderschen Beförderung der Humanität. Herder, der Abbt zugeneigt war und über ihn geschrieben hatte, war von Wilhelm als Pfarrer nach Bückeburg berufen worden. Ist es daher verwunderlich, dass auf der Feste Wilhelmstein Scharnhorst mit den Büchern von Lessing und Goethe bekannt wurde ? Mit den Gedichten Schubarts ( u.a. die Hymne über Friedrich den Großen)und mit Edward Youngs „Nachtgedanken“. Aber auch mit handwerklichen Fähigkeiten, auch das ein Zug der Aufklärung, in Frankreich hatten ja bekanntlich die Enzyklopädisten in ihrem großen Lexikon zum ersten Mal auch alle damaligen Handwerke abgehandelt und bildlich dargestellt. Es versteht sich von selbst, dass der Graf gar nicht auf den Gedanken kam, seine Soldatenkinder nach Amerika zu verkaufen, wie das damals in anderen deutschen Kleinstaaten gang und gäbe war. (30 000 Deutsche wurden von den englischen Kolonialherren mit 9,254 Millionen Pfund Sterling gekauft, Hessen-Kassels Landgraf Friedrich II. (1720 bis 1785) tat sich bei diesem schäbigen Geschäft besonders hervor, aber nicht nur Hessen-Kassel, auch Hanau, Waldeck, Braunschweig, Ansbach-Bayreuth und Anhalt-Zerbst). Bei einem friedlichen Gang der Dinge wäre dieses vielleicht alles Episode geblieben, aber durch die Turbulenzen der napoleonischen Ära wurde Scharnhorst später gezwungen, sich an die sich abzeichnenden Konturen einer Wehrverfassung für nur 1 200 Soldaten in Bückeburg zu erinnern. Diese Mikrotruppe sollte bald eine geschichtliche Bedeutung bekommen, die weltbewegend zu nennen ist. Wer konnte in den Jahren vor 1800 ahnen, dass das folgende Jahrhundert gleich zu Beginn eine blutige „große Menschenkonsumtion" (Scharnhorst) mit sich bringen würde ? Er hatte übrigens selbst zwei Aufsätze über seinen Wilhelmsteinaufenthalt verfasst, einen über den Grafen, dem noch Friedrich der Große den Schwarzen Adlerorden verliehen hatte, und einen 1781/82 in Professor Schlözers „Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts“ veröffentlichten über die Schule (Von den Militäranstalten des verstorbenen regierenden Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe). Scharnhorst rühmt an ihm vor allem, dass es des Grafen ständiges Bemühen war, sich und die Welt mehr aufzuklären. Er experimentierte ruhelos, legte großen Wert auf einen durch Wettbewerb zu steigernden persönlichen Ehrgeiz, auch das hatte sich bei Scharnhorst tief eingeprägt und wird noch der preußischen Armee zur Auflage gemacht. „Man wird selten so viel unbedingliche Güte des Herzens mit so vielen großen Eigenschaften des Geistes wie bei ihm vereint sehen...Er hat viele junge Leute glücklich gemacht...Ich kann ohne eine Art von Enthusiasmus mich nicht der Anordnungen dieses Herren erinnern“. 7. Auch der junge Jurist Theodor Schmalz, dessen Schwester Scharnhorst am 24. April 1785 in der Bordenauer Kirche ehelichen wird, ein Jahr, nachdem er Leutnant geworden war, hatte einen viel beachtete „Lebensbeschreibung des Grafen zu Bückeburg“ veröffentlicht. Er sah in dem Grafen eine Art „Friedrich der Große in Niedersachsen“. Einer der besten Schüler des Grafen war 22 Jahre alt, als die Schule auf der Wilhelmsfeste nach dem Tode des Grafen am 10. September 1777 nach 12jähriger Existenz geschlossen werden mußte. Er hatte gute Noten bekommen, im sprachlichen Zweig war er eine Nuance schlechter. Graf Wilhelm hatte keine direkten Erben. Als Gneisenau später in Bückeburg weilte, studierte er die Handschriften des Grafen und staunte nicht schlecht: „Unsere ganze Volksbewaffnung vom Jahr 1813, Landwehr und Landsturm, das ganze neue Kriegswesen hat der Mann ausführlich bearbeitet...Alles hat er schon gewußt, gelehrt, ausgeführt...Was ist das für ein Mann gewesen, dessen Geist der Zeit so weit voraus...die größten Kriegsgedanken sich entwickelt, an deren Verwirklichung zuletzt die ganze Macht Napoleons eigentlich zusammengebrochen ist“. 8.
Scharnhorst betätigte sich zunächst durch den Ruf des hannoverschen Generals Emmerich Otto von Estorff ab Oktober 1778 als Lehrer im Range eines Fähnrichs an der Militärschule in Northeim und nach vier Jahren ab Juli 1782 als zweiter Lehrer an der neugegründeten Artillerieschule Hannover, an der er zugleich auch einen Vertrag als Artillerie-Bibliothekar bekam. Rasch vermehrte er die Anzahl der Bücher. Er unterrichtete „nach der Methode des hochseligen Grafen“ in so verschiedenen Fächern wie Mathematik, Ingenieurswissenschaft, Zeichnen, Fortifikationslehre, Taktik, Geschichte und Geografie. Wert wurde auf die Zusammenarbeit der Schüler untereinander gelegt. In Northeim erfand er 1780 eine Neuerung am Mikrometer-Fernrohr, so dass jetzt auch zugleich die Entfernung eines jeden Objektes gemessen werden konnte und veröffentlichte ein dreiteiliges “Handbuch für Offiziere in den anwendbaren Theilen der Kriegswissenschaften” (1787 bis 1790). Aber er wies auch seine Schüler daraufhin, dass sie mehr als ein Handbuch zu Rate ziehen sollten, „was bei dem einen dunkel, wird bei dem anderen helle“. Dieser Lehrer lernte, er besuchte in der wegen ihrer Praxisbezogenheit fortschrittlichen Göttinger Universität Vorlesungen über die Kriegsgeschichte, u.a. bei dem Geschichtsprofessor Schlözer, bei dem er die Vorlesung „Lehre von den Staatsverfassungen“ hörte und hatte auch selbst kriegsgeschichtliche Vorlesungen auf Honorarbasis gehalten. Das „Göttingsche historische Magazin“ las er regelmäßig. Den in ihm erschienenen Aufsatz „Über den Wandel des Ehrbegriffs unter den Völkern“ von Christoph Meiners hatte er auch in seinem „Militärischen Journal“ abgedruckt, auch eine Rede, die Karl von Grothaus 1778 über das Militär in Gegenwart des hessischen Prinzen Carl, General en chef der dänischen Armee, gehalten hatte. 9. Die französische Geheimpolizei Fouchés führte ihn als „ancien professeur de Goettingen, homme savant“. Zudem fand er noch Zeit, eine Studienreise durch Deutschland zu unternehmen, während der er auch die preußische Armee unter die Lupe nahm, immerhin bemerkenswert die Äußerung, dass sich die preußischen Offiziere irren, alles durch Disziplin regeln zu wollen, man könne es auch zu weit treiben. In Spandau und Potsdam besuchte er Gewehrfabriken. Schwerpunktmäßig nahm Scharnhorst auf dieser Reise die Artillerie in Augenschein, auch die österreichische in Wien und Prag. Er war äußerst ehrgeizig, „... das Gefühl meiner Kräfte, etwas Außerordentliches tun zu können, wird nicht aufhören, mich zu quälen“. 10. In Hannover waren seine ab dem Herbst 1783 gehaltenen Vorlesungen so geschätzt, dass er sie geradezu halböffentlich hielt. Der Freiherr Knigge erwähnt seinen Namen ausdrücklich in seiner Reisebeschreibung. 11. Die Weiterbildung durch Theorie und Vorlesung fand im Winterhalbjahr statt, im Sommer praktizierten die Schüler draußen. Er überzeugte durch die Kraft des historischen Beispiels, die Kriegsgeschichte war ihm nicht nur Quelle der Erkenntnis, sondern auch überzeugender, sich aus Tatsachenzusammenhängen bildender Argumente. „Nichts ist...gefährlicher als eigene Erfahrung ohne Benutzung der Erfahrung, welche die Kriegsgeschichte uns darbietet“. 12. Sein Hausschatz an historischen Beispielen, aus dem er sich souverän bediente, war seine unbedingte Stärke. Er war also ein glänzender Militärhistoriker, aber ein nicht so glänzender Militärpädagoge. Einhellig wird überliefert, dass er in seiner Ausdrucksweise sehr unbehilflich wirkte, ein langsamer Hannoverscher Dialekt kam hinzu. Clausewitz überlieferte uns die Mängel: Weitläufigkeit, Unbestimmtheit und Langsamkeit, und fügte hinzu, dass er selbst diesen Mangel seines Geistes sehr gut kannte. Sein Schüler Strantz weiß zu berichten, sein Vortrag war nicht belebend, war eintönig. 13. Dieser „Mangel der Geläufigkeit der Sprache“ wirkte später auf seinen politischen und militärischen Missionen hemmend auf seinen Redefluß. Es klingt bitter, wenn er in einem Brief aus Memel vom 17. November 1827 an Clausewitz schreibt: „Ich bin nicht dazu gemacht, mir Anhang und Zutrauen durch persönliche Bearbeitung zu verschaffen“. Auch im Schriftlichen waren Unvollkommenheiten vorhanden. Er ließ sich in jungen Jahren von seinen Geschwistern jeden Tag eine Seite aus seinem Lehrbuch diktieren und verglich dann, unterstrich das Falsche. Liest man heute Texte von ihm, so sind sie stellenweise holprig. Er, jetzt weitgehend Autodidakt, ging mehreren militärwissenschaftlichen Zeitschriftenprojekten nach, so erschien 1782 die Zeitschrift „Militär-Bibliothek“, die sogar in Lissabon gelesen wurde und die 1785 in „Bibliothek für Offiziere“ umbenannt wurde. Ihr Erscheinen wurde noch im gleichen Jahr eingestellt. Ab 1788 erschien dann das “Neue Militärische Journal”, in dem er später die Siege der französischen Revolutionsarmeen als begründet in den rückständigen inneren Verhältnissen der royalistischen Staaten deutete. Schon in diesen Zeitschriften vertrat er die Auffassung, dass insbesondere die preußische Armee die Ursache staatlichen Wohlstands sei, diese blieb durchgehend in seinen Schriften erhalten. (Nebenbei schrieb er eine gründlich durchdachte Darstellung der Belagerung von Gibraltar). Schon hier zeigte sich eine Abkehr von der rein militärischen Denkweise. Die Offiziere belächelten den gelehrten Sonderling, der seinerseits von einer wahren „Geistessperre“ in unserem Land sprach. Dieser Kastengeist veranlaßte den Freiherrn vom Stein von Hannover als vom „deutschen China“ zu sprechen. Die „ (chinesisch-aristokratischen) Eliten“ ignorieren in ihrer Ständeverkalkung seine Studien völlig und diese geistige Mißhandlung des Bauernsohnes durch den Hannoverschen Adel mag der ausschlaggebende Grund gewesen sein, nach zwei Jahrzehnten in preußische Dienste zu treten, von der Provinz nach Berlin zu gehen. Eine Frucht der französischen Revolution war die Erkenntnis des engen Wechselverhältnisses zwischen Politik und Krieg, Napoleon äußerte sich noch auf St. Helena, dass die Politik unser Schicksal sei. Scharnhorst wußte, dass dort keine großen Dinge geschehen, wo nicht Politik und Kriegskunst innigst miteinander vereint sind. Der General hat tiefere Einsichten in das Militärwesen, muß aber auch politische haben, der Staatsmann hat tiefere Einsichten in das Wesen der Politik, muß aber auch militärische haben. Der Krieg genügt sich also nicht selbst, er folgt den gesellschaftspolitischen Konstellationen wie umgekehrt diese auf ihn wirken. Die Politik hatte die Religion als die die Menschen prägende Bestimmungsinstanz verdrängt, Rousseau erkannte dies als erster durch seine Machiavellistudien während seines Venedigaufenthaltes, 1743 und eine Folge der Säkularisation war die zunehmende Bedeutung der Gesellschaftswissenschaften, die mit der der Naturwissenschaften Hand in Hand ging. Aus einer Drillmaschine wurde der Soldat durch die Totalisierung des Krieges (Zugriff auch auf alle zivilen Kraftquellen) ein Gesellschaftswissenschaftler, primär ein Pädagoge. Nach den Niederlagen von Jena und Auerstädt wurde die Armee erneuert, statt stets fluchtwilligen Vagabunden und Abenteurern setzte sie sich sozial anders zusammen und die Stockdressur konnte entfallen. Offiziere wurden jetzt „Erzieher und Anführer“ eines „achtbaren Teils der Nation“. Insbesondere durch die Aufklärung gewann im politischen Leben ein Element zunehmend an Gewicht: die öffentliche Meinung und in der Tat gab es einen Erlaß des Pariser Konvents, auch einen antiroyalistischen Propagandakrieg zu entfachen. Die ersten „Ingenieure der Seele“ traten auf, denn die Messe wurde nicht mehr in lateinischer Sprache gelesen, stattdessen bildeten sich zivile und soldatische Lesegesellschaften. In Hannover gehörte Scharnhorst der Gansschen Lesegesellschaft im Hause der Buchhandlung Hahn an, er war auch an ihrer Umgestaltung zu einem „Museum“ beteiligt. Aufsätze und Übersetzungen besserten den kargen Sold des Leutnants auf. Zeitlebens vermißte man an ihm den soldatischen Habitus, er glich, nach einem Wort seines Freundes Professor Steffens mehr einem „Gelehrten in Uniform“, ja einem Rousseau in Uniform. Rousseau wird später in Berlin angerufen bei der Gründung der militärischen Gesellschaft. Dessen Pathos für Wahrheit teilte er. Der Wahlspruch des Philosophen lautete: „Vitam impendere vero“ („Sein Leben dem Wahren hingeben“). Scharnhorst schrieb an den General Georg Friedrich von Tempelhoff: „Ich habe einen außerordentlichen Enthusiasmus für Wahrheit und Gerechtigkeit, und ich liebe die, welche so wie ich denken, wie meine Brüder“. 14. Er las begeistert Matthias Claudius, der an seinen Sohn geschrieben hatte, dass sich die Wahrheit nicht nach uns, wir uns aber nach ihr richten müssen. Aber politisch log er viermal im Sinne einer Kriegslist: das Krümpersystem war aus Bauernschläue geboren, im Frühjahr 1811 ließ er Truppen in die Festungen Kolberg und Pillau einmarschieren, um angeblich eine Landung der Engländer abwehren zu können. Und dann zur Täuschung die falschen Angaben beim französischen Gesandten in Berlin, er sei immer ein Bewunderer Napoleons gewesen und trete deshalb aus dem preußischen Staatsdienst aus. In Wirklichkeit übernahm er nach seinem Ausscheiden Missionen, die geheim bleiben mussten. Seinem traditionsverhafteten König wollte er unterjubeln, dass die Franzosen in ihrer Revolution durch Carnot nur das preußische System des Kantonreglements des Soldatenkönigs von 1733 übernommen hätten. Klaus Hornung sieht Scharnhorst dagegen als einen entschiedenen Kritiker Rousseaus, der den Gesellschaftsvertrag als zu individualistisch ausgerichtete Fehlkonstruktion ablehnte und der das allgemein Beste nicht ermögliche - allein, Hornung schreibt selbst: „Jetzt, wo die Nation mit Unterjochung bedroht wird, bedurfte es des Aufrufs des allgemeinen Willens, der volonté generale, wie Scharnhorst ohne Bedenken formulierte, einer mündigen Staatsbürgernation. Eine Epochengrenze war zu überschreiten“.15. Allein, Scharnhorst sagt selbst: „Der einzelne muß oft dem Allgemeinen aufgeopfert werden...“ 16. Die Widersprüchlichkeit Rousseaus entzieht sich eben politischen Lagerzuweisungen, sein Denken ist viel zu eruptiv, sprunghaft und schlüpfrig und stellt noch heute der Rousseauforschung Aufgaben, die kaum zu lösen sind. Die Stellung von Scharnhorst zu Rousseau kann daher nur ambivalent sein. In der Einleitung seines Handbuchs der Artillerie finden sich wichtige Bemerkungen zur menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit: „...daß wir nie auf einmal zu einer großen Vollkommenheit gelangen und nur nach und nach uns derselben durch Theorie, Versuche und Erfahrungen nähern können, und daß wir nicht müde werden dürfen, diesen Weg zu verfolgen, indem wir auf demselben, wenn auch noch so langsam, dennoch weiter kommen, als wir anfangs zu glauben Ursache hatten“. 17. Es ist von einem Schneckengang die Rede und davon, dass wir uns einer großen Vollkommenheit nur annähern können. Beides steht im Gegensatz zu dem markantesten Theoretiker und zu dem markantesten Praktiker der französischen Revolution, zur Metanoia Rousseaus, der 1749 auf dem Weg nach Vincennes, plötzlich wie von tausend Lichter geblendet, erkannte, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass es nur die Institutionen sind, die ihn verderben - es ist ganz wichtig, die Plötzlichkeit zu betonen - und zur unbedingten, absoluten Perfektibilitätsgläubigkeit Robespierres. Von 1782 – 1793 ging Scharnhorst völlig in seiner bis ins 37. Jahr ausgeübten Lehrtätigkeit auf. Seinen Schülern vermittelte er, dass die Ausarbeitung eines kleinen Aufsatzes oft lehrreicher für den Verfasser sei als die Lektüre eines dicken Buches. Da haben wir den ganzen Scharnhorst als Pädagogen. 18. 1792 erschien das praxisorientierte „Militärische Taschenbuch zum Gebrauch im Felde“, in dem er die Infanterie zur bedachten Schießweise anhielt. 19. Der in diese Zeit fallenden bürgerlichen Revolution der Franzosen stand er reserviert gegenüber. In einem Brief an Clausewitz aus dem Jahr 1807 findet man die Äußerung, dass er eine “Abneigung gegen die ewige Umformung der Verhältnisse” 20. habe. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass Scharnhorst noch 1792 für den Fortbestand des friderizianischen Kriegswesens eintrat, ja dass er den Bürger sogar für unfähig hielt, Krieg zu führen. Er hielt den „Unterricht des Königs von Preußen an die Generale seiner Armee“ (Roy de Prusse Instructions à ses Generaux) zeitlebens für das beste Unterrichtswerk an Militärschulen. Für die Kriegführung waren der Große König und seine Soldaten für ganz Europa Muster. Es spielt hier mit hinein, dass sein Lehrer Graf Wilhelm König Friedrich verehrte. Aber natürlich konnte der intelligente Bauernsohn kein Anhänger des Adels sein, was im ersten Koalitionskrieg gegen Frankreich sehr deutlich wurde. Die Revolution in Frankreich brachte ganz Europa in Bewegung, wertete alle Werte um, Jahrhunderte unhinterfragt Gültiges zerbrach fast über Nacht, sie warf die bisherigen Fesseln des Krieges beiseite und es bildeten sich wechselnde Koalitionen, um die Lava aufzuhalten, die aus dem revolutionären Krater in Paris schoß. Begeistert schrieb der Ehrenbürger der französischen Republik Friedrich Schiller in den „Räubern“: Das Gesetz hat zu Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Die Koaltionen wurden aus dem Hintergrund von dem finanzstarken England unter der Federführung von Pitt angestachelt. Schon im Siebenjährigen Krieg gab England auf der Grundlage des Subsidienvertrages vom 11. April 1758 Preußen 5,3 Millionen Taler. Insgesamt gab es sieben Koalitionskriege, die mehrere „Konstanten“ aufwiesen, Konstanten in Anführungszeichen, denn strenggenommen gibt es keine Konstanten in der Geschichte, der Historiker braucht aber diese, um vom lebendigen Tatsachenmaterial abstrahieren zu können. Also einmal der Finanzier Pitt, dann die immer vorliegende, durch Trafalgar (Seeschlacht am 21. Oktober 1805) bewiesene maritime Überlegenheit der Engländer und drittens der Koloss im Hinterland Europas: das Zarenreich, das quantitativ immer die große Masse an Soldaten für die europäische Reaktion stellte. England galt es zu schlagen, deshalb die Boulogne-Armee, auch bereits „Große Armee“ genannt, die den Ärmelkanal überqueren sollte, deshalb die Kontinentalsperre, deshalb die Strafaktion 1812 gegen den Zaren, um von Moskau nach Indien weiterzumarschieren. Nach der Kriegsordre König Georg III., König von England und Kurfürst von Hannover (diese Personalunion bestand seit 1714), mußte Hannover die Hälfte seiner Armee der anti-französischen Koalition stellen: fünfzehn Bataillone, acht Regimenter Reiterei und eine Abteilung Artillerie. Den Äußerungen Scharnhorsts ist zu entnehmen. dass er ungern in diesen Krieg in den österreichischen Niederlanden für die Aristokraten gezogen war. Er sprach verächtlich von der bloß verzehrenden Klasse. “Das dümmste Vieh kommt hier fast so gut durch wie der Einsichtsvollste…Wir werden von den Aristokraten zurückgesetzt und streiten für die Aristokraten”. 21. Das dumme Vieh erklärte sich unter anderem auch daraus, dass die meisten aristokratischen Familien ihre unfähigsten Söhne als Offiziere ausgeguckt hatten. Dennoch zeichnete er sich bei den Kämpfen um Hondschoote, dennoch zeichnete er sich am 30. April 1794 beim Durchbruch aus dem Belagerungsring der 20 000-Mann starken Moreau- und Vandammearmee bei Menin (flämisch Meenen) aus. Am 29. April hielt Moreau die Festung für übergabereif, aber der Kommandant von Hammerstein antwortete ihm: „Nous sommes habitués à faire notre devoir; on ne se rendra pas“. Der kühnen Initiative von Scharnhorst war es weitgehend zu verdanken, dass die bei Menin eingeschlossenen 1800 Koalitionssoldaten, darunter auch viele royalistische Emigranten („Loyal Emigrants“), trotz knapper Munition den nächtlichen Durchbruch gegen eine zehnfache Überlegenheit der Belagerer schafften. 14 Offiziere und 431 Soldaten aus den Mannschaften waren gefallen, 1510 Kombatanten, darunter 147 Verwundete, kamen durch und sammelten sich wieder in Brügge, vier Fünftel war der Ausbruch aus dem Kessel also gelungen, man hatte sogar noch zwei französische Geschütze erbeutet. Unter den tapfer kämpfenden Infanteristen hörte jede Subordination auf, man kämpfte kollektiv. Scharnhorst hielt fest: „Gemeinschaftliche große Gefahr und große Leiden verwischen alle gegenseitigen kleinlichen Verhältnisse, die sonst die Menschen beunruhigen und betrüben. - Daher die Herzlichkeit, die unbedingte Hilfeleistung, das große gegenseitige Vertrauen und die innigste Brüderschaft der Kriegsgefährten in und nach blutigen Auftritten“. 22. Menin blieb, wie später Stalingrad, wo der Ausbruch nicht gelang, als „Schutthaufen“ zurück. (Ein merkwürdiges Detail tauchte bei diesem gelungenen Ausbruch auf, man mußte eine Brücke überqueren, die den Namen „Beresina“ trug). Die meisten Emigranten sind so den Todesurteilen der Jakobinerkommissare entkommen. Bitter beklagte Scharnhorst sich in einem Brief an seine Frau, daß sein Sold in keinem Verhältnis zu seinen „Kapitänsdiensten“ stehe. Überhaupt sind anklagende Töne in seinen Briefen aus dem Koalitionskrieg zu vernehmen. „Der Mann ohne Bildung ist doch ein wahres Vieh, ein grausames Tier; überhaupt habe ich gefunden, daß nur wohlgebildete Leute die Greuel des Krieges zu mildern suchten und daß ungebildete Offiziere ebenso tierisch als die Gemeinen waren“. 23. Im Jahre 1803 erschien die von ihm verfasste „Beschreibung der selbsterlebten Verteidigung der Stadt Menin und der Selbstbefreiung der Garnison unter dem Generalmajor von Hammerstein im Jahre 1794". In der Einleitung schreibt er, dass man kein Beispiel in der Geschichte finde, wo eine sehr unbedeutende Garnison von Infanterie, aus einem Orte, der von einem acht- bis zehnmal stärkeren Feind eingeschlossen und belagert wurde, sich durchgeschlagen hätte. Generalmajor von Hammerstein, dessen Gehilfe Scharnhorst war, schrieb in seinem Gefechtsbericht an seinen Vorgesetzten General Graf Wallmoden, daß er bei allen Ausführungen der Erste und Letzte war und schwärmte geradezu von diesem einem Jedem zum Muster aufzustellenden Offizier 24., der im Kugelregen Stich hielt. Scharnhorst, begabt mit einem erstaunlichen Scharfblick für die Wirklichkeit, beobachtete in den Feldzügen neben den Fehlern seiner Truppe - unter anderem den Übermut (man sprach auf Grund des falschen Kriegsbildes durch die Emigranten von einem Spaziergang nach Paris) und von daher auch kein „gerader Gang zu großen Zwecken“ 25. - sehr genau die Kampfweise der Sansculotten, die völlig mit den alten Kriegsbräuchen gebrochen hatten. In sein Tagebuch notierte er: „Der jetzige französische Krieg wird das jetzt angenommene taktische System in einigen Punkten gewaltig erschüttern“. 26. Der Scharnhorst-Biograph Klaus T. Stark sieht die Ursache für die Überlegenheit der französischen Soldaten in einem „persönlichen Interesse“, für die Parolen „Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit“ zu kämpfen. Dafür kämpften sie nicht, wohl aber für ihre kleinen Landparzellen, die sie aus der Zerschlagung des feudalen Grundbesitzes erhalten hatten. Diese „petite culture“ war die Grundlage für die Siege der „Grande Armee“. Den gleichen Fehler wie Stark begeht auch Heribert Händel, der die Kraft der französischen Heere in ihrer geistigen Haltung ausmacht. 27. Es war viel einfacher: der Bauer, der gegen die feudalabsolutistischen Heere aufstand, war satt. Die neue französische Kriegführung wurde auf Grund dieser Erschütterung zum Schwerpunkt seiner Studien und es ist bezeichnend, dass der junge Mann, der sein erstes Kriegserlebnis zu verarbeiten hatte, sich bis in die inneren Beweggründe vertiefte, die Literatur, die er sich nach den Frankreichfeldzügen besorgte, läßt auf einen immensen Forschungsdrang schließen, nacheinander wurden Montesquieus “Geist der Gesetze” und Rousseaus “Gesellschaftsvertrag” gelesen, besonders interessierten ihn die beiden Hauptwerke des wichtigsten Gesellschaftstheoretikers des französischen Materialismus Helvetius: “De l´Esprit” und “De l`Homme”, in denen der Philosoph eine Psychologie der Menschenführung entwickelt hatte. (Ein Kerngedanke war, dass die Bedürfnisse der Ursprung der Tätigkeit und des Glücks der Menschheit seien). Bei Helvetius konnte er lernen, dass die Menschen oft nur durch versteckte Hebel von ihren Vorurteilen befreit werden können, eine Methode, die er später, wie wir sehen werden, am preußischen König anwandte. Mit Diderots „Hausvater“ (1758) lernte er übrigens französisch. Er las Werke von Voltaire und Edward Gibbons „Verfall und Untergang des römischen Reiches“, zugleich auch Fergusons „Geschichte der römischen Republik“ und auch eine Schrift des französischen Generals Dumouriez über die französische Revolution. Die wichtigste Frucht dieser Zeit war sicherlich seine auch heute noch für das Verständnis der bürgerlichen Umwälzung in Frankreich empfehlenswerte Studie: “Entwickelung der allgemeinen Ursachen des Glücks der Franzosen in dem Revolutions-Kriege und insbesondere in dem Feldzuge von 1794”, die das Resultat einiger Unterredungen mit seinem Freund Johann Friedrich Graf von der Decken war. Dieser war nun allerdings ein glühender Feind der Revolution in Frankreich und wir horchen auf, wenn Scharnhorst von Decken, dem späteren Generalleutnant in englischer Uniform, in einem Brief als den Besten meiner Freunde anspricht. Die Quellen der Ursachen mussten tief in den inneren Verhältnissen der Staaten liegen. Das Glück der Franzosen war ihre Revolution. Aus ihr erwuchs die revolutionäre Schöpferkraft, eine bis dahin ungekannte Energie. Durch sie wurde der Krieg einer der mobilen Massen. An den anderen Militärtheoretikern, die sich mit den Sansculottenkriegen auseinandersetzten, kritisierte er, dass sie die Tatsachen nicht ruhig erzählen konnten. Der Krieg aber als der große Lehrmeister des Soldaten zwingt ihn, die Wirklichkeit richtig widerzuspiegeln. Es war verkürzt, die Ursachen der Niederlagen der Koalition im Verrat, in Führungsfehlern und Mißgeschicken zu suchen. (Das ist ganz die Argumentationsstruktur, die Friedrich Engels über die Ursachen der Niederlage der 48er Revolution anwendet, diese sei nicht deswegen gescheitert, weil Bürger X oder Bürger Y sie verraten habe). Verrat gab es ja auch auf Seiten der Franzosen gleichermaßen, es war nicht nur der bekannte General Dumouriez, „die ersten Anführer ihrer Armeen wurden Verräter derselben“. 28. Mit der rein militärischen Betrachtungsweise war diesem Kriegsbild nicht mehr beizukommen, politische und moralische Faktoren galt es zu berücksichtigen. In den Koaltionskriegen wurden neue Kriegselemente deutlich: die aus Massen gebildeten Armeen waren in Divisonen eingeteilt worden, die als kleine, selbständig operieren könnende Armeen äußerst mobil waren und verschiedene Formationen der Gefechtsordnung kombinieren konnten: Schützen - Kolonnen - Linien. „Wenn sich in einer Schlacht die Armee trennen oder die Stellung wechseln müsse, wenn neue Angriffe zu unternehmen seien, wenn ein Rückzug die ursprüngliche Ordnung zerreiße, dann seien die Divisionen gewissermaßen kleine Armeen, die sich immer noch regieren ließen. Der Divisionsgeneral könne, da er über alle Waffen verfüge, alle Mittel des Widerstandes anwenden und dem Oberbefehlshaber die Zeit verschaffen, die Divisionen wieder in Verbindung zu bringen und zu einem gemeinschaftlichen Zweck in Wirksamkeit zu setzen. In der divisionsweisen Organisation der französischen Armeen sah Scharnhorst eine der Ursachen für ihre Erfolge auf allen Kriegsschauplätzen. Dieser vollkommene Mechanismus erkläre die Schnelligkeit ihrer kombinierten Angriffe und die Leichtigkeit, mit der sie in verwickelten Lagen immer die den Umständen angemessenen Maßregeln ergriffen“. 29. Aus den Elementen „Masse“ und „Mobilität“ ergab sich dann die Strategie, die rasche Vernichtung des Feindes durch entscheidende Schläge herbeizuführen. Die 1800 stattfindende Schlacht von Marengo im zweiten Koalitionskrieg gab von französischer Seite das Muster ab: nie konzentriert zu stehen - aber sich immer konzentriert zu schlagen. Es sei ein falscher Grundsatz, seine Armee nie zu teilen. Bedarf es noch näherer Erwähnung, dass Scharnhorst in der Militärgeschichte das Hauptaugenmerk auf die neuere legte ?
„Jede Koalition führt schon den Keim des heimlichen Betrugs mit sich“. 30.