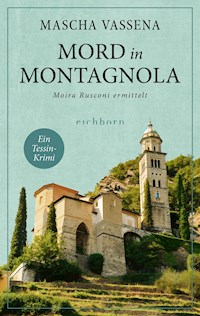9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Krimi
- Serie: Moira Rusconi ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ambrogio muss zur Kur, der Tessiner Rotwein und das Osteria-Essen sind ihm auf die Hüften geschlagen, und Moira begleitet ihren Vater kurz entschlossen. Sie begeben sich in die todschicke Wellnessklinik Villa Carasso und versuchen dort zu entspannen. Doch das ist bei Spürnase Moira natürlich zum Scheitern verurteilt, denn eine der Kurteilnehmerinnen verschwindet plötzlich spurlos. Was ist mit der jungen Frau passiert - hat sie das Interesse am Klinikprogramm verloren oder ist etwas Schlimmeres geschehen?
Moira und Ambrogio nehmen - als Kurgäste getarnt - die Ermittlungen auf. Und stoßen bald auf ein Geflecht aus familiären Konflikten, Betrügereien und gebrochenen Herzen. Von wegen Wellness!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Ähnliche
INHALT
ÜBER DIESES BUCH
Ambrogio muss zur Kur, der Tessiner Rotwein und das Osteria-Essen sind ihm auf die Hüften geschlagen, und Moira begleitet ihren Vater kurz entschlossen. Sie begeben sich in die todschicke Wellnessklinik Villa Carasso und versuchen dort zu entspannen. Doch das ist bei Spürnase Moira natürlich zum Scheitern verurteilt, denn eine der Kurteilnehmerinnen verschwindet plötzlich spurlos. Was ist mit der jungen Frau passiert – hat sie das Interesse am Klinikprogramm verloren oder ist etwas Schlimmeres geschehen? Moira und Ambrogio nehmen – als Kurgäste getarnt – die Ermittlungen auf. Und stoßen bald auf ein Geflecht aus familiären Konflikten, Betrügereien und gebrochenen Herzen. Von wegen Wellness!
ÜBER DIE AUTORIN
Mascha Vassena wurde 1970 geboren, studierte Kommunikationsdesign, war Mitherausgeberin einer Literaturzeitschrift und organisierte Poetry Slams. Nach dem Studium arbeitete sie als freie Journalistin und Redakteurin in Hamburg. Für ihre Texte erhielt sie mehrere Auszeichnungen, u. a. den Hamburger Literaturförderpreis und ein Stipendium der Akademie Schloss Solitude. Von ihr sind bislang der Erzählband RÄUBER UND GENDARM sowie fünf Romane erschienen. Neben dem Schreiben hält sie Workshops für Autor:innen und ist als freie Literaturagentin tätig. Seit 2004 wohnt sie mit ihrer Familie am Luganer See und möchte nie mehr weiter als einen Spaziergang vom Wasser entfernt leben.
MASCHA VASSENA
SCHATTEN überMONTE CARASSO
Moira Rusconi ermittelt
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © Mascha Vassena 2024. Dieses Werk wurde vermittelt
durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und
Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Michelle Stöger, München
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Umschlagmotiv: © Reisememo.ch – ein Schweizer Reiseblog
Karte Innenklappen: © Christl Glatz | Guter Punkt, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-5962-5
eichborn.de
luebbe.de
lesejury.de
1
Sie rannte die dunkle Straße entlang, nur einen Gedanken im Kopf, der sie vorantrieb: Weg, weg von ihm. Er war irgendwo hinter ihr, doch sie hielt nicht inne, um nachzusehen, wie dicht er ihr auf den Fersen war. Laufen, laufen, die unbeleuchtete Straße entlang, nur das Geräusch ihres eigenen Atems in den Ohren. Schweißrinnsale liefen über ihre Schläfen in die Augen. An manchen Gartentoren hingen Laternen, die matte Lichtstreifen über den Asphalt warfen. Sie hatte keine Zeit, auszuprobieren, ob eines davon sich öffnen ließ. Er würde sie einholen, bevor sie die weiter oben liegenden Häuser erreichte. Also weiter, trotz der Uhrzeit auf ein Auto hoffend, das sie anhalten könnte. Löcher und Risse im Straßenbelag wurden zu Fallen, doch nach jedem Straucheln riss sie sich wieder hoch. Ihr Atem ging so laut, dass sie nicht hören konnte, ob seine Schritte näher kamen.
Nun wagte sie doch im Lauf einen kurzen Blick über die Schulter nach hinten. Dunkelheit, die sich in der Dunkelheit bewegte. Er war noch da, und so, wie sie ihn kannte, würde er nicht aufgeben. Was geschehen würde, wenn er sie einholte, löste blankes Entsetzen in ihrem Kopf aus, das sie nicht zu einem Bild formen wollte.
Vor ihr drang ein Licht zwischen Büschen hervor, und als sie um eine Kurve jagte, ragte in zwanzig oder dreißig Metern der Umriss eines Metallstegs auf Stelzen auf. An die Seilbahnstation hatte sie gar nicht gedacht. Dünne, helle Linien zogen sich vor dem Nachthimmel parallel zum Hang aufwärts und eine beleuchtete Gondel schaukelte mit leisem Surren bergauf, während eine andere ins Tal hinabglitt. Dort war Licht, war Bewegung, ein Seilbahnwärter, Zuflucht, Rettung.
Neben dem Aufstieg stand eine Art Kassenhäuschen, in dem Licht brannte. »Hallo? Ist jemand da?« Um Hilfe zu rufen, kam ihr absurd vor, als spielte sie jemandem einen Streich. Sie näherte sich und spähte hinein. Doch der Stuhl hinter der Scheibe war leer. Sie sah sich panisch um und entdeckte das Schild neben dem Schalter:
24–6 Uhr morgens automatischer Betrieb. Benutzung auf eigene Gefahr.
Keuchend, jeder Atemzug ein Schmerz in der Lunge, ein Schnitt in den Kehlkopf, nahm sie die Stufen zur Plattform, auf der man die Gondeln bestieg. Das Gerüst zitterte und knirschte metallisch unter ihren Schritten. Eine Lampe erhellte das Schild, das am Trägermast angebracht war: Stazione I Gasg. Die Gondel, die von oben herabschwebte, war fast da und geriet ins Schaukeln, als sie abgebremst wurde und beinahe zum Stillstand kam, während die Tür automatisch aufglitt.
Unten, am Fuß des Gerüsts, bewegte sich jemand.
»Wo bist du?!« Ein keuchender Ruf. Ihr Verfolger war ebenso außer Atem wie sie, doch von der Plattform gab es nur einen Ausweg. Sie setzte einen Fuß in die Kabine und zog sich an den seitlichen Haltegriffen ins Innere. Die Türe schloss sich, während die Gondel wieder Fahrt aufnahm und sie mit sich in die Dunkelheit des Berges emportrug. Für den Moment war sie in Sicherheit.
Sie sank auf die schmale Sitzbank und blickte auf die schnell kleiner werdenden Lichter von Bellinzona tief unter ihr, während sie nach Luft rang. Allmählich beruhigte sich ihr Atem, doch schon zwei oder drei Minuten später wurde die Gondel wieder langsamer. Von Ausflügen wusste sie, dass der nächste Halt Curzútt war. Vielleicht hatte sie Glück, und es war noch jemand im Restaurant, den sie um Hilfe bitten konnte. Ganz oben auf dem Gipfel würde sie nach Mitternacht sicher niemanden mehr antreffen. Als die Tür sich öffnete, stieg sie aus.
Sie hetzte den Weg hinauf zum Ausflugsrestaurant, hinter dessen Fenstern gedimmtes Licht leuchtete, rüttelte an der Tür, doch sie war verschlossen. Sie hämmerte dagegen, in der Hoffnung, dass trotz der späten Stunde noch jemand da sein würde.
»Aiuto! Das ist ein Notfall! Bitte machen Sie auf!«
Nichts rührte sich. Es war so still hier oben, dass das Rauschen der fernen Autobahn zu ihr heraufdrang. Als etwas in dem Rosenbusch neben dem Eingang raschelte, hätte sie beinahe geschrien.
Sie wandte sich vom Restaurant ab und blickte über die dunklen Schieferdächer der kleinen Häuser, die sich zusammendrängten wie eine Schafherde. Irgendwo musste doch jemand sein! Das Dorf war unbewohnt, doch wenn das Schicksal es gut mit ihr meinte, schliefen Gäste im Hostel unterhalb des Restaurants.
Sie musste an ihren Sohn denken, der jetzt in seinem Bett lag und schlief.
Eine weitere Gondel schwebte aus dem Tal herauf und hatte beinahe die Haltestelle erreicht. Im Inneren konnte sie undeutlich eine Gestalt erkennen. Panik überflutete sie. Sie machte einen Schritt nach rechts, einen nach links, drehte sich dann im Kreis. Wohin? Hier, auf der Terrasse des Restaurants stand sie auf einem beleuchteten Präsentierteller. Wenn sie zum Hostel rannte, würde sie ihrem Verfolger in die Arme laufen, der gerade die Gondel verließ. Daher floh sie in die entgegengesetzte Richtung und jagte den schmalen, mit Natursteinen gepflasterten Weg entlang auf die schwarze Wand des Waldes zu.
Sie mied den Schein der Laternen, die anfangs alle paar Hundert Meter den Weg beleuchteten, und war froh, als sie immer tiefer in den Wald eintauchte wie in eine Welle. Nach einem Dutzend Schritte musste sie stehen bleiben, weil es um sie herum vollständig dunkel war. Voller Angst lauschte sie auf Bewegungen hinter sich. Um sie herum raschelte und huschte es, doch vor den kleinen und großen Tieren, die nachts unterwegs waren, fürchtete sie sich nicht. Eine Begegnung mit einem Wildschwein konnte gefährlich werden, doch dem würde sie rechtzeitig ausweichen können.
Nach einigen Minuten begannen ihre Augen, das Restlicht aufzunehmen, das der Mond durch die Baumkronen schickte, und sie folgte dem Weg. Es war eher ein Vorantasten als ein Gehen. Sie hielt die Arme ausgestreckt und suchte Orientierung an den Felsbrocken und Bäumen, die den Weg säumten. Links, wo der Abhang steil abfiel, war es heller, sodass sie nicht Gefahr lief, abzustürzen. Sie wusste, wohin der Weg führte und würde noch Stunden unterwegs sein, bis sie wieder auf Häuser traf. Doch es gab keinen anderen Ausweg.
Eine Zeit lang dachte sie, er habe aufgegeben, doch dann hörte sie Äste unter schweren Schuhen knacken: Er war noch immer hinter ihr und trieb sie vor sich her. Ihre leichten Turnschuhe waren für den unebenen, von Wurzeln und Gestein durchzogenen Grund nicht geeignet. Sie stolperte immer wieder, rutschte aus, knickte um. Es war hier oben selbst im Sommer kühl, und sie trug nur ein ärmelloses T-Shirt und wadenlange Baumwollhosen. Sich in der Dunkelheit mühsam voranzuarbeiten, zehrte an ihren Kräften, und das Bedürfnis, sich einfach am Boden zusammenzurollen, die Augen zu schließen und sich ihrem Schicksal zu ergeben, wurde beinahe unwiderstehlich. Doch dann dachte sie erneut an ihren Sohn. Sie würde ihn wiedersehen. Sie sah sie beide an einem gedeckten Frühstückstisch sitzen, auf den die Sonne schien. Sie lachten, tranken Orangensaft und aßen Rühreier mit Speck, die er so liebte. Alles war hell und warm und unbeschwert. Irgendwie hielt dieses Bild in ihrem Kopf sie aufrecht, bis der Weg vor ihr heller wurde und eine einzelne Laterne durch dichtes Gebüsch schien. Eine letzte Wegbiegung, dann stand sie am Rand des tiefen Einschnitts, den die Sementina im Lauf der Zeit durch den Fels geschliffen hatte. Unten schmal, öffnete sich das Tal nach oben hin, und jahrtausendelang waren Vögel die einzigen Lebewesen, die von einer Seite des Tals auf die andere gelangen konnten. Bis die Hängebrücke kam. Nicht, um den Bewohnern beider Talseiten den Kontakt zu erleichtern, sondern als Touristenattraktion. Sie hatte sie schon einmal bei Tageslicht überquert, verblüfft davon, dass die Leute auf der gegenüberliegenden Seite so klein wurden, dass man sie nicht mehr erkennen konnte.
Jetzt war die andere Talseite nur eine dunkle Masse, und die Brücke, kaum einen Meter breit, schwang sich in die Dunkelheit und verlor sich darin.
Sie stand einen Moment zwischen den Betonankern, die die Stahlseile hielten, und sah ins Nichts, dann setzte sie einen Fuß auf die Planken und lief, so schnell sie es wagte. Mehrmals blickte sie sich um, doch von ihrem Verfolger war nichts zu sehen. Hatte er endlich aufgegeben?
Die Konstruktion unter ihr schwankte im Wind, der von der Ebene durch die Talöffnung wehte. Sie hatte beinahe die Mitte der Brücke erreicht, als ihr zugleich schwindlig und übel wurde und sie gegen das Geländer aus Drahtgeflecht prallte, weil ihr Gleichgewichtssinn nicht mehr funktionierte. Sie brauchte einen Referenzpunkt, an dem ihre Augen Halt finden konnten. Sie umklammerte das eiskalte Stahlseil, das oberhalb des Geländers entlanglief, und starrte auf die weit entfernten Lichter von Bellinzona. Kurz stellte sie sich die vielen Menschen vor, die dort unten friedlich in ihren Betten lagen. Doch sie stand ganz alleine im Schatten der Berge, die wie eine Bleidecke über dem Tal lagen. Allmählich vergingen Schwindel und Übelkeit. Sie schloss die Augen, hielt ihr Gesicht in den Wind und atmete tief ein. Gerade wollte sie weiterlaufen, als die miteinander verbundenen Bohlen im Rhythmus näher kommender Schritte zu vibrieren begannen.
2
Moira trat an die Fensterbank, schüttete ihren Kaffee in den Blumentopf mit dem Philodendron, schenkte sich aus der Kanne mit dem Blumenwasser nach und führte die Tasse zum Mund.
»Mama, bist du völlig daneben?« Luna umfasste ihr Handgelenk und hielt es fest. Moira blickte auf und bemerkte erst jetzt, was sie im Begriff war zu tun. »Ich Idiot.« Sie schüttete die Tasse noch einmal aus. »Na ja, Kaffee soll dem Pflanzenwachstum zuträglich sein.«
»Kaffeesatz schon, aber ich glaube nicht, dass das auch für einen doppelten Espresso mit Zucker gilt.« Luna ließ ihr Handgelenk los und sah sie fragend an. »Alles in Ordnung?«
Moira starrte durch die Scheibe hinter dem Philodendron in den Frankfurter Regen, der so dicht fiel, dass das Mietshaus gegenüber zu flimmern schien. »Ich habe einfach schlecht geschlafen.«
Wieder einmal hatte sie sich in dem Albtraum verfangen, der sie seit ihrer Rückkehr aus dem Tessin verfolgte. Zwar hatte sie der Polizei geholfen, einen Todesfall aufzuklären, doch der Traum von endlosen Höhlen, in denen Schreie widerhallten und Fledermausflügel rauschten, verfolgten sie. Sie träumte ihn nicht jede Nacht, aber wenn, klebte er noch Stunden nach dem Aufstehen an ihr wie Spinnweben.
Sie lächelte Luna an und fuhr ihr mit der freien Hand durch die heute petrolfarbenen Haare. Luna schüttelte sie ab. »Mama, ich bin schon für die Schule gestylt!«
»Entschuldige.« Sie wandte sich von dem Trauerspiel vor dem Fenster ab. »Ich mache mir mal frischen Kaffee.« Was für ein Euphemismus, dachte sie, während sie die Plastikkapsel in die Maschine schob und den Brühvorgang startete. Kein Vergleich zu Ambrogios in der Aluminiumkanne auf dem Herd zubereiteten Espresso, aber besser als gar kein Koffein am Morgen.
Während der heiße Kaffee in die Tasse floss, kontrollierte sie ihr Mobiltelefon und stellte ein wenig enttäuscht fest, dass Luca keine neue Nachricht geschickt hatte. Sie schrieben sich nicht oft, und Moira hütete sich, allzu ausführliche Antworten zu verfassen, um ihre Gefühle im Zaum zu halten, aber jeder kurze Gruß von ihm hellte den Tag um mehrere Nuancen auf. Immer wieder musste sie sich daran erinnern, dass sie nicht mehr als Freunde sein konnten, weil er bereits eine Familie hatte.
Sie knallte das Handy ungewollt heftig auf die Arbeitsplatte, zog die Espressotasse unter dem Auslauf hervor und nippte daran. Der Kaffee schmeckte bitter wie eine unglückliche Liebe. Sie hatte den Zucker vergessen.
Luna steckte ihren Kopf durch die Türöffnung. »Kapselkaffee ist umweltschädlich! Ich muss los. Nach der Schule helfe ich im Tierheim, wir haben einen total süßen Wolfsspitz bekommen, mit dem ich heute Gassi gehen darf! Ciao!« Schon war sie fort, und Moiras Abschiedsgruß wurde vom Zufallen der Wohnungstür verschluckt.
Sie lächelte nachsichtig. Seit Luna das Praktikum im Tierheim gemacht hatte, bekam man sie kaum noch zu sehen, weil sie nun zwei oder drei Mal wöchentlich dort aushalf. Auch wenn das ein bisschen schmerzte, freute Moira sich, dass Luna sich für eine sinnvolle Sache engagierte.
Sie zurrte ihren Bademantelgürtel fest, nahm den frischen Kaffee mit an den Schreibtisch im Wohnzimmer und klappte ihr Laptop auf, um mit der Übersetzung der Bedienungsanleitung für eine Dunstabzugshaube fortzufahren. Bald war sie in die kleinteilige Beschreibung versunken, und der Eindruck des Albtraums zog sich in die abgelegeneren Bereiche ihres Geistes zurück. Sie schrak zusammen, als das Festnetztelefon schrillte, doch ihre Laune besserte sich, als sie auf dem Display sah, wer es war. »Ciao, papà! Alles in Ordnung?«
»Wie man es nimmt, tesoro«, brummte Ambrogios Bass durch den Hörer. Moira richtete sich auf. »Was ist los? Du hast nicht wieder einen Schlaganfall, oder?«
»Noch nicht, aber laut meiner Ärztin kriege ich bald einen, wenn ich mich nicht gesünder ernähre und mich mehr bewege. Deshalb hat sie mir zwei Wochen Aufenthalt in einer sogenannten Wellnessklinik verordnet.« Ambrogio schnaubte. »Das reinste Oxymoron. Erholung und Sport – als ginge beides gleichzeitig!«
»Klingt doch gut.« Moira nahm einen Schluck von ihrem Kaffee und stellte fest, dass er kalt geworden war. Sie verzog das Gesicht und schob die Tasse von sich.
Ambrogio räusperte sich. »Und wie geht’s dir? Hast du immer noch diese Albträume?«
»Leider ja. Aber meine Psychologin sagt, ich habe keine posttraumatische Belastungsstörung, sondern das gehört zum normalen Verarbeitungsprozess. Allerdings hat sie auch versucht, mich zu einer Kur zu überreden. Dabei bin ich froh, wenn ich mich durch die Arbeit ablenken kann.«
»Hmm, hmm«, machte Ambrogio. »Das trifft sich gut, sogar ganz hervorragend.«
»Was meinst du damit?« Moira nahm einen Kugelschreiber und kritzelte eine Fledermaus auf einen aufgerissenen Briefumschlag.
»Tesoro, ich wollte dich fragen, ob du mich begleitest. Zwei Wochen in der Villa Carasso, einem herrschaftlichen Anwesen in den Hügeln bei Bellinzona. Du bist eingeladen.«
»Das ist wirklich großzügig, aber ich bin doch erst vor ein paar Wochen zurückgekommen.«
Moira tippte Villa Carasso in die Suchmaske ihres Browsers. Auf dem Bildschirm erschienen Fotos einer strahlend weißen Villa mit Säulenvorbau, flankiert von zwei modernen Glasanbauten, inmitten einer Parkanlage und mit weitem Blick über die Magadino-Ebene bis hin zu den Alpen. »Wow!«
»Nicht wahr?« Ambrogio klang zufrieden. »Sie bieten auch reine Wellnessaufenthalte an, das wäre doch genau das Richtige für dich: Massagen, Yoga, Meditation. Es gibt sogar ein Schwimmbad und eine Sauna.«
»Klingt großartig.« Moira stöhnte. »Aber ich muss arbeiten.«
Ambrogios Stimme wurde weich wie Katzenfell. »Das kannst du ja trotzdem und sogar besser. Du musst nicht einkaufen, nicht kochen, nicht putzen. Und hier scheint die Sonne.«
»Und wenn ich nicht mitkomme?«
»Dann fahre ich auch nicht.«
Moira stützte die Stirn in die Handfläche und seufzte. »Du bist wirklich hartnäckig. Okay, ich denke drüber nach und rede mit Luna. Aber ich verspreche nichts!«
3
Die Augusthitze brachte die Tessiner Berge zum Flimmern. Unerbittlich brannte die Sonne von einem Himmel, dessen intensives Blau jede Hoffnung auf Regen zunichtemachte. Moira steuerte den klapprigen Geländewagen ihres Vaters die Kantonalstraße entlang. Auf der Rückbank stapelten sich Koffer und Reisetaschen – ihr Vater hatte anscheinend seine komplette Garderobe eingepackt.
In einer lang gezogenen Kurve wurde sie von einer Goldwing in Metallicblau überholt. Ambrogio hob grüßend die Hand, bevor er beschleunigte und innerhalb von Sekunden aus ihrem Blickfeld verschwand. Er hatte darauf bestanden, eines seiner geliebten Motorräder mitzunehmen, weil er so gerne kurvenreiche Bergstrecken fuhr.
»Angeber«, sagte Moira laut, schaltete einen Gang zurück und drückte das Gaspedal durch. Gleich darauf wurde sie langsamer, denn der Motor des alten Autos gab ein grauenhaftes Heulen von sich, als würde er sich in Qualen winden. In gesittetem Tempo gelangte Moira zur nächsten Ausfahrt, wo Schilder auf die Villa Carasso und auf die tibetanische Hängebrücke hinwiesen. Nach dem Abbiegen wurde die Straße einspurig und wand sich in lang gezogenen Serpentinen bergauf, flankiert von kleineren Weinbergen, Privatgärten und Natursteinmauern. Immer wieder bot sich weite Sicht über die Magadino-Ebene und die jenseits gelegene Hügelkette. Sie wagte allerdings nur kurze Blicke, denn die Kurven verlangten ihre ganze Aufmerksamkeit.
Ganz unvermittelt führte die Straße durch ein offen stehendes Eisentor, das zu beiden Seiten von geflügelten Sphinxen auf Granitpfeilern bewacht wurde. Am rechten Pfeiler hing ein unaufdringliches Messingschild mit der Gravur Villa Carasso in eleganter Schrift, das Moira beinahe übersehen hätte. Sie war also richtig. Links und rechts ragten jetzt Palmen auf, dazwischen wuchsen dicht belaubte Sträucher und Farne. Der Geländewagen rollte knirschend über Split. Mit wachsender Neugier folgte Moira dem Weg, der in einer Kurve aus dem Gehölz herausführte, direkt auf die Villa zu, die weiß in der Sonne leuchtete als wäre sie frisch gestrichen. In der Glasverkleidung der Seitenflügel spiegelte sich die Auffahrt mit ihren Blumenrabatten und Palmen. Vor der Eingangstreppe stand Ambrogio neben seinem Sofa auf zwei Rädern in Metallicblau, den Helm unter dem Arm, und winkte ihr. Moira nahm schwungvoll die Biegung, brachte den Geländewagen vor der Treppe zum Stehen und zog die Handbremse an. »Das ist ja wie bei Downton Abbey!«
»Fehlt nur noch der Butler.« Ambrogio öffnete seine recht eng sitzende Lederjacke und ächzte, als sein Bauch endlich wieder ausreichend Raum erhielt.
Offensichtlich hatte ihre Ankunft Aufsehen erregt, denn die zweiflügelige Eingangstür aus schwarz lackiertem Holz öffnete sich, und ein Mann Mitte zwanzig, ganz leger in eine locker sitzende Jeans und ein weißes T-Shirt gekleidet, trat auf den Treppenabsatz. »Entschuldigung, hier können Sie nicht stehen bleiben«, sagte er auf Italienisch mit einem schweren deutschen Akzent. »Bringen Sie die Hähnchen? Der Lieferanteneingang liegt hinten.« Seine Augen hatten einen etwas schläfrigen Ausdruck, waren aber gleichzeitig auffallend groß und hell, sodass er sowohl müde als auch erstaunt wirkte.
»Junger Mann, wir sind Gäste«, entgegnete Ambrogio würdevoll.
»Oh, scusate!« Der Mann zog die Schultern hoch und rieb sich einen Oberarm wie ein verlegener Teenager. »Ich kann Ihr Motorrad parken, wenn Sie möchten.«
»Meine Goldwing rührt niemand an außer mir«, erklärte Ambrogio. »Aber die Klapperkiste da können Sie abstellen – meinetwegen in der nächsten Schlucht.«
Der Mann nickte gehorsam und kam die Treppe herunter.
»Der normale Parkplatz tut es auch«, sagte Moira auf Deutsch, stieg aus und gab ihm den Schlüssel, der an einem Katzenkopf aus Silber hing. Der Mann zupfte an seinem T-Shirt und nuschelte: »Okay.«
Moira bedankte sich, dann stieg sie zusammen mit Ambrogio die Treppe hinauf und betrat die Eingangshalle, wo sie von einer Atmosphäre aus herrschaftlicher Eleganz und klinischer Klarheit umhüllt wurden. Die Treppe aus hellem Marmor und die dorischen Halbsäulen entlang der Wände wurden von einer blitzenden Empfangstheke aus Stahl und Glas kontrastiert, und von der fünf bis sechs Meter hohen Decke hing ein Gebilde, bei dem es sich entweder um moderne Kunst oder eine Deckenleuchte handelte. Die Akustik war hervorragend: Schon am Eingang verstand man jedes Wort der Tirade, die aus dem Mund einer Dame im weißen Bademantel und mit einem Handtuchturban über dem Haar auf den dunkelhaarigen Mann mit auffallend kantigen Zügen, der hinter dem Tresen stand, niederging.
»Wie würden Sie sich fühlen, wenn man Sie erst zur Massage bestellen und dann fast eine Stunde lang warten lassen würde?« Die Frau klopfte mit dem Knöchel auf die Glasplatte, und der Rezeptionist hob entschuldigend die Hände. »Ich werde mich sofort erkundigen, was schiefgegangen ist, Signora.« Er griff zum Telefon und sprach aufgeregt, aber leise in den Hörer. Ambrogio und Moira traten neben die Frau an den Empfang, die ihnen einen kurzen Blick zuwarf, sich abwandte und dann wieder umdrehte, diesmal mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht.
»Neue Gäste, wie aufregend!« Sie hielt Ambrogio, der ihr am nächsten stand, eine Hand mit kurzen, unlackierten Fingernägeln hin, den Handrücken nach oben gedreht, als erwartete sie einen Handkuss. »Muriel Valadon, sehr erfreut.«
Ambrogio nahm die Hand, dachte jedoch nicht daran, sich zum Handkuss darüber zu beugen, sondern schüttelte sie herzlich. »Valadon wie die Malerin? Schöner Name. Ambrogio Rusconi.«
Die Miene der Signora legte sich in freundliche Falten, als sie erneut lächelte, diesmal natürlicher. »Ein Mann, der etwas von Kunst versteht! Sie müssen unbedingt im Speisesaal an meinem Tisch sitzen, ich bin sicher, wir haben zahlreiche Gesprächsthemen.«
Der Rezeptionist legte den Hörer auf. »Signora Valadon, es gab eine Doppelbuchung, mi spiace tantissimo. Carlo ist jetzt frei und erwartet Sie. Die Massage geht natürlich aufs Haus.«
»Wie schön, danke für Ihre Hilfe.« Muriel Valadon neigte gnädig den Kopf. Zu Ambrogio gewandt, flötete sie: »Wir sehen uns beim Abendessen, mein Lieber.« Sie winkte ihm zu und entschwand in einen Korridor neben der Theke, der einem Schild zufolge in den Wellnessbereich führte.
Der Rezeptionist straffte die Schultern und wandte sich Ambrogio zu. »Benvenuti, ich heiße Lorenzo. Womit kann ich dienen?«
Moira trat auf den Balkon und legte ihr Handy auf die Marmorbalustrade, die an den Ecken von stilisierten Pinienzapfen dekoriert wurde. Ihr Zimmer blickte nach hinten und bot einen Blick über die breite Ebene und Bellinzona hinweg auf die bläuliche Bergkette, deren Grate und Gipfel sich im Dunst auflösten. Moira hielt ihr Gesicht in die leichte Brise, die hier oben die Sommerhitze erträglich machte.
Unterhalb von Moiras Balkon waren cremefarbene Sonnenschirme aufgespannt, unter denen Stimmen und das leise Klimpern von Löffeln gegen Kaffeetassen hervordrangen. Von dort schlängelten sich sandbestreute Wege durch den Park, der durch die geschickte Platzierung von Hecken und Büschen größer wirkte, als er war. Es gab einen kleinen Teich, in dem weiße und rot-goldene Flecken schwammen, wahrscheinlich Kois, außerdem kleine geschützte Bereiche mit Ruhebänken. Auf einer von ihnen saß ein lesender Mann mit Strohhut. Ein paar Leute schlenderten herum, und eine zierliche Frau mit dunklem Haar fütterte die Karpfen mit Brotstücken. Weiter hinten harkte der Hausmeister mit einem Rechen einige Blätter zusammen und verschwand dann in einem kleinen Gewächshaus. Obwohl die Leute nichts Besonderes oder Interessantes taten, war es reizvoll, sie zu beobachten, weil sie nichts davon ahnten. Wir sind doch alle Voyeure, dachte Moira. Es verschafft einem das Gefühl, überlegen zu sein.
»Ecco, da wären wir also«, erklang Ambrogios Stimme rechts von ihr. Er war ebenfalls auf seinen Balkon getreten. Seine Bikerkluft hatte er gegen wadenlange Leinenhosen und ein kurzärmeliges Hemd getauscht und breitete jetzt die Arme aus, als wollte er die Szenerie umarmen. »Ich fühle mich wie Hans Castorp, in eine andere Welt versetzt.«
»Ich hoffe doch, du hast nicht vor, sieben Jahre hierzubleiben.«
»Ich würde die Katzen viel zu sehr vermissen.«
»Gabriella wird sich gut um sie kümmern, aber sieben Jahre wären doch etwas zu viel verlangt.«
Moira nahm ihr Handy von der Balustrade und kontrollierte die Uhrzeit. »Genieß die Aussicht, Hans Castorp, ich muss jetzt zur Anfangsuntersuchung.«
»Ich in einer Stunde.« Ambrogio schüttelte sich. »Ich hoffe, sie pieksen einen da nicht.«
Sie pieksten einen. Moira sah zu, wie ihr Blut in der Spritze anstieg, bis sie gefüllt war. Dann tauschte eine gelangweilt wirkende medizinische Assistentin sie gegen eine zweite aus, während die Nadel weiter in Moiras Armbeuge steckte. Glücklicherweise war sie weniger empfindlich als ihr Vater.
»Wozu brauchen Sie das noch gleich? Ich bin eigentlich nur zum Entspannen hier.«
»Eine Kontrolle der Blutwerte ist Standard bei uns.« Die Assistentin, auf deren Namensschild Anna M. stand, zog mit zufriedener Miene die Spritze aus Moiras Arm und drückte ein Stückchen Mull auf den Einstich. »Draufhalten bitte. Wir führen hier, abgesehen von unserer Spezialität, zwar keine größeren medizinischen Behandlungen durch, aber individuell angepasste Ernährung und Bewegung wirken oft genauso gut wie herkömmliche Medikamente oder unterstützen diese maßgeblich.«
Moira hatte nahezu denselben Wortlaut auf der Website der Villa gelesen. »Aha. Mit Spezialität meinen Sie diese Eigenbluttherapie?« Auch das stand auf der Website und hatte Moira beinahe dazu veranlasst, den Aufenthalt abzusagen, aber ihr Vater hatte sie darauf hingewiesen, dass sie sich dieser Behandlung nicht würde aussetzen müssen und er ebenfalls nicht die Absicht habe, das zu tun.
»Dr. Bonvin ist europaweit eine Koryphäe für Eigenbluttherapie.« Anna wurde plötzlich lebhaft. »Das Blut wird mit Vitalstoffen angereichert, und schon nach der ersten Behandlung fühlt man sich wie neugeboren! Ich mache das regelmäßig selbst.«
Mit Mitte zwanzig hatte Moira sich auch noch wie neugeboren gefühlt, auch ohne Eigenbluttherapie. Sie verkniff sich den Kommentar – die Assistentin trug den schwärmerischen Gesichtsausdruck wahrhaft Gläubiger, der jede Diskussion sinnlos machte.
Moira bekam ein Pflaster auf den Einstich, Anna führte sie über den Flur in ein Sprechzimmer, und ließ sie alleine. Moira rutschte auf dem Designerstuhl herum und betrachtete den beinahe leeren Schreibtisch aus Milchglas, der an übereinandergeschobene Eisplatten erinnerte. Die flache, verzierte Porzellanschale voller Visitenkarten mit Golddruck bildete einen geschmackvollen Kontrast dazu. Von der hohen, stuckverzierten Decke baumelte ein antiker Kronleuchter, und der Boden hatte wohl noch den originalen Fliesenboden mit Lilienmuster, doch abgesehen davon war die Einrichtung hochmodern. Moira mochte diese Kombination. Vor dem Fenster wuchsen großblättrige Pflanzen und filterten das Licht. Es war so still, als wäre Moira ganz alleine im Haus, doch nach nur zwei oder drei Minuten öffnete sich die Tür, und eine Frau im weißen Arztkittel trat ein.
»Signora Rusconi, vielen Dank für Ihre Geduld.« Dr. Bonvin lächelte und reichte Moira die Hand, dann nahm sie hinter dem Schreibtisch Platz. Sie sah genauso aus wie auf der Website und in der Broschüre, die im Zimmer auslag: schlank, sauber und makellos. Alles an ihr war glatt: ihre Haut, ihre honigblonden Haare, ihre sehr weißen Zähne. Moira versuchte erfolglos, sich Dr. Bonvin dabei vorzustellen, wie sie abends nach einem harten Tag aufs Sofa plumpste und im Schlabberpulli eine Pizza in sich hineinstopfte.
Dann riss sie sich zusammen und konzentrierte sich auf das, was die Ärztin gerade sagte: »Ihre medizinische Vorgeschichte hatten Sie uns bei der Anmeldung geschickt, aber ich frage dennoch grundsätzlich nach: Leiden Sie unter irgendwelchen Beschwerden physischer oder psychischer Art?«
Moira zögerte und sagte dann: »Ich schlafe manchmal schlecht.«
Die Ärztin notierte sich etwas. »Haben Sie eher Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten?«
»Beides«, gestand Moira und fühlte sich, als hätte sie bei einem Test versagt. So hatte sie sich auch bei ihrem ersten Termin mit ihrer Psychologin in Frankfurt gefühlt. Anderen Leuten zu helfen, war eine Sache – sich einzugestehen, dass man selbst Hilfe brauchte, eine andere.
»Wissen Sie, woher diese Probleme kommen?«
»Keine Ahnung«, log Moira. Sie hätte es nicht genau begründen können, aber sie wollte Dr. Bonvin gegenüber nichts Intimes preisgeben, sich nicht verletzlich zeigen. Die Frau wirkte zu perfekt, um empathisch zu sein.
»Möchten Sie, dass ich Ihnen ein pflanzliches Schlafmittel verschreibe?«
Moira verneinte, und die Ärztin nickte, als hätte sie einen Test bestanden. »Oft ist eine medikamentöse Behandlung gar nicht notwendig. Sie können es mit Meditation versuchen. Und das tägliche Tai Chi vor dem Abendessen wirkt Wunder. Fast all unsere Angebote sind inklusive: Morgengymnastik, Yoga, Meditation, der Wellnessbereich, geführte Wanderungen, die tägliche Teezeremonie im Pavillon um vier Uhr nachmittags und die Thai-Chi-Stunde. Massagen werden extra berechnet. Außerdem bieten wir vegane Kochkurse, Seidenmalerei, Origami und Achtsamkeitsübungen an. Die Termine finden Sie täglich in der Mappe auf Ihrem Zimmer.«
Moira überlegte, wie sich wohl ein Achtsamkeitskurs gestaltete. Beobachtete man Ameisen, zählte Grashalme oder streichelte Bäume?
»Sie können auch gar nichts tun. Da Sie keinen medizinischen Befund haben, können Sie den Aufenthalt hier bei uns einfach genießen.« Dr. Bonvin lächelte, wohl um anzudeuten, dass sie einen Scherz gemacht hatte. »Wir legen unseren Gästen allerdings ans Herz, die Zeit hier zu nutzen, sich an einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil zu gewöhnen. Dazu trägt auch die von mir entwickelte einzigartige Eigenbluttherapie bei. Das Blut wird mit Vitalstoffen angereichert – schon nach der ersten Behandlung fühlen Sie sich wie neugeboren.« Die Ärztin lehnte sich nach vorne und senkte die Stimme. »Bei regelmäßiger Anwendung wird man Sie fünf bis zehn Jahre jünger schätzen.« Sie legte eine Kunstpause ein und lächelte wieder. »Für wie alt halten Sie mich?«
Moira zögerte mit der Antwort. Die straffe Haut von Dr. Bonvin war sicher nicht nur der Eigenbluttherapie, sondern auch der regelmäßigen Gabe von Botox zu verdanken. Wahrscheinlich war sie Mitte vierzig, aber das wollte sie natürlich nicht hören.
»Sechsunddreißig«, schwindelte Moira schamlos, und Dr. Bonvin lehnte sich mit zufriedener Miene zurück.
»Vierundvierzig.«
»Nicht möglich!«, rief Moira und riss die Augen auf, was hoffentlich glaubwürdig genug wirkte.
»Oh doch. Soll ich einen Behandlungstermin für Sie eintragen?«
»Ich würde mich gerne zuerst genauer informieren.« Moira rieb sich unbehaglich den linken Oberarm.
»Natürlich, das verstehe ich sehr gut.« Dr. Bonvin zauberte eine Broschüre auf den Tisch und schob sie in Moiras Richtung. »Falls Sie Fragen haben, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Und sollte die Blutanalyse Auffälligkeiten zeigen, meldet sich Anna bei Ihnen. Noch ein Hinweis: Die gesamte Klinik ist alkoholfrei, da wir auch Alkoholiker behandeln, und wir bitten alle Gäste, darauf Rücksicht zu nehmen.«
Auf dem Weg nach draußen traf Moira ihren Vater und wünschte ihm Glück. »In bocca al lupo.«
»Crepi il lupo«, gab er die rituelle Antwort und wurde von Anna in den Vorraum geleitet. Moira entfernte sich für den Fall, dass gleich ein Tumult entstünde, wenn die Assistentin versuchte, ihm Blut abzunehmen. Eines war sicher: Für eine Eigenbluttherapie war Ambrogio der denkbar ungeeignetste Kandidat.
»Ich sage dir, die wollen mich verhungern lassen«, polterte Ambrogio auf dem Weg zum Abendessen. »Tausendachthundert Kalorien am Tag, nur Fisch, Hühnchen und Gemüse, kein Wein, kein Bier – diese zwei Wochen überlebe ich nicht.«
»Ich glaube, du hast genug Reserven.« Moira blickte auf seinen Bauch. »Der Mensch kann bis zu drei Wochen völlig ohne Nahrung auskommen.«
»Der Mensch vielleicht, der Tessiner nicht. Allein das Sportprogramm wird mich an den Rand des Todes treiben«, klagte ihr Vater weiter. »Jeden Tag, ich wiederhole: JEDEN Tag.«
»Daran gewöhnst du dich schnell. Und Arianna wird begeistert sein, wenn du schlank und muskulös zurückkommst.«
Ambrogios Stimmung hellte sich sofort auf. »Da hast du allerdings recht. Ich tue das nicht nur für mich selbst.«
Sie betraten den Speisesaal durch eine Flügeltür mit geschliffenen Glaseinsätzen. Wahrscheinlich war dies früher der Ballsaal gewesen. Die Decke zierte ein mit Stuck eingefasstes Fresko, das herumtollende Nymphen und Ziegenhirten darstellte, der Boden bestand aus hellem Marmor mit schwarzen Einlegearbeiten. Die hohen Bogentüren des Saals blickten auf einen Säulengang, die Sonnenschirme, jetzt zugeklappt, und den Park dahinter.
Die Atmosphäre war gedämpft, die etwa vierzig anwesenden Gäste unterhielten sich leise.
Ambrogio blieb stehen und sah sich um. »Wo sitzen wir denn?«
»Das können wir uns aussuchen, denke ich. Wie wäre es bei Signora Valadon?« Moira wies auf einen der runden Tische mit langen schneeweißen Tischdecken, an dem ihre neue Bekannte saß und bereits in ihre Richtung winkte.
»Sympathische Person, zumindest sieht sie interessanter aus als die meisten anderen«, flüsterte ihr Vater und setzte sich in Bewegung.
Muriel Valadon trug ein schlichtes weißes Hemdblusenkleid und hatte sich ein pastellblaues Tuch um die kinnlangen grauen Haare gewickelt. Dennoch fiel sie auf, denn sie sprühte nur so vor Tatkraft und Energie. Ihre Augen leuchteten vor Begeisterung, und innerhalb weniger Minuten hatte sie Ambrogio überredet, sie auf eine Wanderung zu begleiten und sich für Tai Chi anzumelden. Zunächst war Moira besorgt, Muriel könnte ein romantisches Interesse an ihrem Vater hegen. Das Drama, das der Besuch von Moiras Mutter bei Ambrogios Lebensgefährtin, Staatsanwältin Arianna Manzoni, verursacht hatte, war ihr allzu gut in Erinnerung, und sie verspürte kein Bedürfnis danach, so etwas noch einmal zu erleben. Doch Muriel flirtete nicht, sondern war einfach freundlich und zugewandt. Bald waren sie und Ambrogio in ein Gespräch vertieft, als wären sie alte Freunde, bis sie von der Kellnerin unterbrochen wurden, die ihnen die Abendkarte brachte, wobei die von Muriel und Moira mehr Auswahl boten als die von Ambrogio. Mit bitterer Miene las er ihnen die Alternativen vor: »Gedämpfter Fisch mit Julienne-Karotten, gedämpftes Huhn mit Curry-Gemüse und roten Linsen, Rohkostplatte mit Joghurt-Dip. Grauenhaft.«
»Das Essen ist hervorragend, keine Sorge«, versicherte Muriel, doch das konnte Ambrogio nicht aufheitern. »Wenn es wenigstens Wein dazu gäbe!« Er seufzte theatralisch und sah zu ihrer Kellnerin auf. »Gut, ich ergebe mich in mein Schicksal und nehme das Curryhuhn.«
Moira stach ein wenig das schlechte Gewissen, weil sie Papardelle mit Thunfischsauce bestellte. Muriel wählte das Carpaccio. Ambrogio ächzte leise. »Euch beim Essen zuzusehen wird mir Tantalus-Qualen bereiten«, sagte er halb ernst, halb scherzhaft.
»Du darfst mal probieren«, tröstete Moira ihn.
»Das ist ja noch schlimmer!«
Während des Essens hatte Moira Zeit, die anderen Gäste zu betrachten. Etwa zwei Drittel waren über fünfzig, ihrer Kleidung nach zu urteilen nicht gerade arm, was sich bei den Preisen der Klinik von selbst erklärte. Ein älteres Paar fiel besonders auf, weil es gekleidet war wie zu einem Galadinner: Er in Frack und Fliege, sie im glitzernden Abendkleid und mit Diamanten behängt. Ein Drittel der Patienten oder Gäste war jünger oder sah zumindest so aus. Etliche von ihnen hatten verpflasterte Nasen, und eine Frau trug eine straff gewickelte Kinnbandage, die ihr etwas Nonnenhaftes verlieh. Was für eine seltsame Gesellschaft.
Muriel erriet anscheinend ihre Gedanken, denn sie sagte: »Man kommt sich vor wie auf einem Ozeandampfer, stimmt’s? Ich bin einmal auf der Queen Elisabeth nach New York gereist, da herrschte eine ähnliche Atmosphäre.«
»Ja, mein Vater hat schon gesagt, er fühlt sich wie auf dem Zauberberg.«
Muriel lachte. »Sehr treffend, Ambrogio! Ein wunderbarer Roman, nicht wahr? Ich lese ihn alle paar Jahre und entdecke jedes Mal eine neue Facette.«
Ambrogios Augen leuchteten auf. »Sie mögen die Klassiker?«
Muriel verdrehte schwärmerisch die Augen. »Ich liebe sie! Fontane, Goethe, Schiller nicht so sehr, eher das späte neunzehnte und frühe zwanzigste Jahrhundert. Die Hülshoff, E. T. A. Hoffmann, Storm, Zweig, Anna Seghers – meine Güte, konnten die schreiben!«
»Auf die Literatur!« Ambrogio hob sein Wasserglas und prostete seiner neuen Seelenverwandten zu. »Ich war Professor für Deutsche Literatur in Zürich, wer Bücher liebt, ist mein Freund!«
»Sie haben erwähnt, dass Sie mit dem Schiff nach New York gefahren sind«, sagte Moira. »Das klingt spannend – sind Sie viel gereist?«
Muriel Valadon nickte. »Ich war geschäftlich viel unterwegs und habe vier von fünf Kontinenten gesehen, nur in Afrika war ich noch nicht.«
»Was haben Sie denn beruflich gemacht?«
Muriel lächelte geheimnisvoll. »Ich bin zwar über das Pensionsalter hinaus, aber immer noch beruflich aktiv, wie so viele Selbstständige.« Mehr gab sie nicht preis, und es wäre unhöflich gewesen, weiter in sie zu dringen, außerdem wurde das Essen serviert. Ambrogios skeptische Miene entspannte sich nach dem ersten Bissen. »Ich würde nicht so weit gehen, es köstlich zu nennen, dafür hat die Küche zu sehr an der Butter gespart, aber es schmeckt.«
»Wenn das Essen nicht gut wäre, würden die Gäste wahrscheinlich meutern.« Muriel lächelte, was freundliche Fältchen um ihre Augen legte. Moira war erleichtert darüber, dass ihr Vater so schnell Anschluss gefunden hatte. In Muriels Gegenwart würde er sich hoffentlich ein wenig zusammenreißen und nicht allzu viel herumjammern.
4
Auf dem Flur vor Moiras Zimmer schlug etwas mit einem dumpfen Ton auf den Boden und zersplitterte, zugleich erklang ein spitzer Schrei. Moira, die sich gerade auf den Weg zu ihrer ersten Yogastunde machen wollte, schrak zusammen und lauschte einen Moment, dann öffnete sie vorsichtig ihre Zimmertür, um nachzusehen, was passiert war.
Der Terrazzoboden des Korridors war mit Porzellansplittern übersät, der Konsolentisch an der gegenüberliegenden Wand, auf dem am Abend zuvor noch eine große chinesische Vase gestanden hatte, war leer. Vor den Scherben stand eine Frau, deren schwarze Haare in vielen schmalen Corn Rows über ihren Kopf liefen und die einen grünen Kittel trug, neben einem Putzwagen und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen wandte sie sich Moira zu. »Mon Dieu! Hab nicht mit Absicht gemacht!«, rief sie mit einem starken Akzent, den Moira nicht zuordnen konnte.
»Natürlich nicht«, sagte Moira. »Ich helfe Ihnen, die Scherben einzusammeln.« Sie machte Anstalten, sich auf den Boden zu kauern, aber die Frau rührte sich nicht, sondern starrte weiter auf die Porzellanstücke. »Docteur Bonvin mich wirft raus!«
»Das wird sie bestimmt nicht. Geben Sie mir mal einen Müllbeutel.«
Die Frau ließ endlich ihre Hände sinken, begann jedoch zu weinen. »Was mache dann? Nicht weiß, wohin soll gehen. Habe kein Zuhause mehr.«
Moira machte einen Schritt aus dem Scherbenfeld auf die Frau zu und strich ihr beruhigend über den Oberarm. »Es wird alles gut.« Sie nahm einen Besen aus seiner Halterung an dem Putzwagen und fegte damit die Scherben unter den Konsoltisch, damit niemand versehentlich darauf treten würde. Dann öffnete sie die Tür ihres Zimmers, winkte die immer noch weinende Frau herein und bugsierte sie in den Ohrensessel am Fenster. Sie versorgte die Frau mit einer Schachtel Kosmetiktücher aus dem Bad und setzte sich ihr gegenüber auf das ungemachte Bett.
»Wie heißen Sie denn?«
»Angela.« Die Frau sah auf und schniefte. Erst jetzt wurde Moira bewusst, dass sie höchstens Mitte zwanzig sein konnte.
»Okay, Angela. Das war nur eine blöde Vase, deswegen wird niemand entlassen. Sie sind nicht in der Schweiz aufgewachsen, oder?«
Angela schüttelte den Kopf. »Ich bin aus Mali. Ich bin hier seit acht Monat.«
Moira wechselte ins Französische: »Sind Sie aus Mali geflüchtet?«
Angelas Gesicht hellte sich auf, und sie antwortete in fließendem Französisch: »Ja, meine Familie dachte, ich bin hier sicherer. Ich bin froh, dass ich hier arbeiten kann, aber eigentlich darf ich das gar nicht.«
»Sie haben keine Arbeitserlaubnis?«
Angela nickte. »Und jetzt wird mich Dr. Bonvin sicher wegschicken. Das ist schon einmal einem der Zimmermädchen passiert. Diese Vasen sind richtig teuer.«
»Moment! Dr. Bonvin beschäftigt illegale Arbeitskräfte. Wenn jemand etwas zu befürchten hat, dann sie.«
»Aber ich kann mich nicht wehren, sonst schicken sie mich zurück nach Mali.« Angelas Miene bekam einen panischen Ausdruck. Sie beugte sich vor und nahm Moiras Hände, wobei die Schachtel mit den Kosmetiktüchern auf den Boden fiel.
»Ich will weiter hier arbeiten, unbedingt. Bitte sagen Sie nichts der Polizei!«
»Keine Sorge, ich sage nichts. Wissen Sie was? Ich sage einfach, dass ich die Vase umgestoßen habe. Einverstanden?«
»Das würden Sie tun? Merci beaucoup!« Angela sank erleichtert im Sessel zurück, dann stand sie auf. »Bon, ich muss weitermachen. Wenn Sie mal etwas brauchen, fragen Sie mich. Ich danke Ihnen!«
Gemeinsam gingen sie zur Tür, und draußen auf dem Flur begann Angela, die Scherben aufzukehren, während Moira hinunter zur Rezeption lief und den Schaden meldete. Lorenzo lächelte und machte sich eine Notiz. »Nessun problema. Wir sind gegen Schäden jeder Art versichert, Signora Rusconi.«
Von der Rezeption aus folgte Moira den Hinweisschildern zur sala 1 in den modernen Anbau, wo die Yogastunde stattfinden sollte. Wegen des Vorfalls mit Angela war sie spät dran, und als sie die schwere Holztür aufzog, saß ein gutes Dutzend Leute bereits im Lotussitz auf dunkelblauen Yogamatten im Raum verteilt. Ein Mann, der seine langen blonden Haare am Hinterkopf zu einem lockeren Knoten zusammengedreht trug, in eine Art weißen Judoanzug mit Gürtel gekleidet, ging barfuß zwischen ihnen umher. Das war also Olivier Bonvin, Dr. Cecile Bonvins Ehemann. Er wandte sich Moira zu, lächelte sie an, wobei seine blauen Augen freundlich blitzten, und deutete stumm auf einen Stapel Yogamatten in einer Ecke. Sie nickte, huschte über den Schwingboden, zog eine Matte vom Stapel und suchte sich einen freien Platz.
»Lasst die Luft ganz tief in euch hineinströmen, und dann atmet ganz langsam wieder aus«, sagte Olivier. Moira hatte auf der Website ein Foto von ihm gesehen, und sogar darauf war sein Charisma spürbar gewesen. Auch jetzt umgab ihn diese Aura, ohne dass er etwas Besonderes tat. Er setzte sich auf die leere Matte an der Fensterseite und verschlang die Beine mühelos im Lotussitz, während Moira sich verzweifelt bemühte, ihren linken Fuß über ihr rechtes Knie zu zerren. Bonvin strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr und lächelte alle Anwesenden einzeln an, schenkte jedem einen Augenblick ungeteilter Aufmerksamkeit. Moira saß endlich richtig und blickte sich verstohlen um: Die meisten Teilnehmenden waren weiblich und hingen mit zumeist verzücktem Blick an ihrem Lehrmeister, doch es gab auch drei Männer: einen sehr dünnen älteren Herrn mit Stirnglatze und rötlichem Bart sowie einen untersetzten, muskulösen Typ mit nach hinten gegeltem Haar, der selbst im Jogginganzug wie ein Manager wirkte. Sie stutzte: Der dritte Mann war Luca. Luca Cavadini, leitender Rechtsmediziner des Kantons, ihre Jugendliebe und der Mann, mit dem sie vor ein paar Wochen eine Nacht verbracht hatte, obwohl er verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes war. Der Mensch, den sie zurzeit am wenigsten sehen wollte, weil sie bis über beide Ohren in ihn verliebt war.
Sie hatte ihn absichtlich nicht darüber informiert, dass sie wieder im Tessin sein würde, und nun tauchte er ausgerechnet in diesem Yogakurs auf. Hatte ihr Vater etwa geplaudert?
Luca nickte ihr zu und grinste, wodurch ihr bewusst wurde, dass sie ihn die ganze Zeit anstarrte. Schnell wandte sie den Blick ab und erhob sich mit den anderen, um den Sonnengruß auszuführen. Während sie ungelenk die fließenden Bewegungen von Bonvin nachahmte, überlegte sie, ob sie einfach davonlaufen sollte. Doch dann ermahnte sie sich. Sie war eine erwachsene Frau von achtunddreißig Jahren und konnte mit solch einer Situation umgehen.
Doch die ganze Stunde über war Lucas Anwesenheit ihr nur allzu bewusst und davon, dass Yoga angeblich den Blutdruck senkte, spürte sie nichts, im Gegenteil. Immer wieder sah sie heimlich zu Luca hinüber. Seine dunklen Haare waren wie immer etwas durcheinander, Kinn und Wangen seit mehreren Tagen unrasiert, was ihm eine gewisse Verwegenheit verlieh. Das schwarze Muskelshirt brachte seine kräftigen Unterarme zur Geltung, und unwillkürlich erinnerte sie sich daran, wie seine Hände sie in jener Nacht berührt hatten. All das, während in ihrem Hinterkopf eine Stimme Mist! Mist! Mist! Mist! rief.
Nach dem Kurs warfen alle ihre Matten auf den Stapel, danach verließen einige den Raum, doch mehrere Frauen blieben und drängten sich um Olivier. Er wirkte wie ein König, der die Huldigungen seiner Untertanen etwas widerwillig, aber freundlich entgegennahm. Moira sah der Szene fasziniert zu und schrak zusammen, als eine Hand sie an der Schulter berührte.
»Ciao, Moira. Dich hätte ich hier nicht erwartet.«
»Dasselbe wollte ich auch gerade sagen.« Sie begrüßten sich mit flüchtigen Wangenküssen, als wären sie nicht mehr als gute Freunde.
»Was machst du im Tessin?«
Moira erzählte ihm von Ambrogios Kur und dass sie ihn begleitete, erwähnte jedoch die Albträume auch Luca gegenüber nicht. Sonst würde er Fragen stellen, und sie wollte dem Schrecken keinen Raum geben.
»Und was machst du in diesem Yogakurs?«, fragte sie zurück.
»Olivier und ich sind alte Freunde, und wenn ich Zeit habe, komme ich ein, zwei Mal die Woche, damit ich nicht völlig einroste. Los, ich stelle euch vor.«
Sobald Bonvin sie bemerkte, verabschiedete er sich von seinen Verehrerinnen, flüsterte jedoch einer zierlichen Dunkelhaarigen noch etwas ins Ohr, als die anderen schon auf dem Weg zur Tür waren. Moira erkannte sie wieder: Es war die Frau, die sie am Fischteich beobachtet hatte. Ihre Finger streiften kurz Olivier Bonvins Hand, bevor sie sich abwandte und den anderen hinausfolgte.
Luca stellte Moira und Bonvin einander vor.
Er reichte ihr eine Hand und legte, als Moira sie ergriff, seine linke Hand über ihre und sah ihr in die Augen. »Olivier, bitte, sonst fühle ich mich zu seriös. Alle duzen mich. Schön, dass du hier bist, Moira.«
Er vermittelte ihr das Gefühl, sie sei für ihn die wichtigste Person auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich machte er das mit jedem, doch es war fast unmöglich, sich nicht davon einnehmen zu lassen.
»Du kennst Luca von früher?«, fragte sie leichthin. »Gibt es irgendwelche peinlichen Geschichten, mit denen ich ihn erpressen könnte?«
Beide Männer lachten, Olivier zuckte mit den Schultern. »Gar keine, das ist ja das Schlimme! Er war ein ekelhafter Streber.«
»Sehr ehrenvoll von dir, für mich zu lügen«, kommentierte Luca. »Außerdem kannst du das gar nicht beurteilen, weil du schon im zweiten Semester ausgestiegen bist – wortwörtlich.«
Olivier hob beide Hände. »Arzt zu werden war eben nichts für mich.«
»Was haben Sie denn stattdessen gemacht?«, wollte Moira wissen.
»Ach, ich war lange in Asien unterwegs, das Übliche: Thailand, Laos, Vietnam, Nepal, später Indien – so habe ich Meditation und Yoga und noch ein paar andere Dinge kennengelernt.«
Olivier bückte sich und holte aus einer Sporttasche eine kleine Packung und riss sie auf. »Auch ein paar Honigmandeln? Die geben Energie nach dem Sport.«
Moira und Luca bedienten sich, dann erzählte Olivier weiter: »Ich habe mich drei, vier Jahre lang treiben lassen, bei Hilfsprojekten mitgearbeitet, manchmal einfach als Barkeeper oder Surflehrer gejobbt, weil ich pleite war.« Er seufzte. »War eine gute Zeit, aber irgendwann ist man dafür auch zu alt.« Er breitete die Arme aus. »Ich bin froh, angekommen zu sein.«
»Hey, du wolltest mir noch den Link zu deiner Meditationsapp schicken«, sagte Luca.
»Mache ich sofort, dann vergesse ich es nicht wieder.« Olivier hob sein Handy auf, das neben der Yogamatte auf dem Boden lag.
»Tolle Schutzhülle, so ein buntes Mandala würde meiner Tochter gefallen«, bemerkte Moira. Olivier lächelte erfreut und nannte ihr die Website, auf der man die Hüllen bestellen konnte. »So, jetzt lasse ich euch gehen, sonst quatschen wir noch den ganzen Tag.« Er umarmte Luca. »War schön, dich zu sehen, mein Bester. Moira, ich hoffe, wir sehen uns oft, während du bei uns bist.«
»Guter Typ«, sagte Moira, während sie den verglasten Korridor des Fitnessbereichs entlangliefen. »Irgendwie schafft er es, wie ein Hippie und gleichzeitig wie ein erfolgreicher Unternehmer rüberzukommen.«
Luca lachte. »Ich mag, dass du immer offen sagst, was dir durch den Kopf geht.«
»Wenn du wüsstest, was ich alles nicht sage!« Sie grinste.
Lucas Ton wurde ernst. »Müssen wir etwas besprechen?«
Sie blieben stehen, und Moira verschränkte die Arme. »Ich denke nicht. Es ist alles richtig so, wie es ist.« Vielleicht war es das, aber es tat trotzdem weh. Sie wollte Luca nicht gehen lassen, und gleichzeitig wünschte sie sich, er würde verschwinden. Sie standen da und blickten sich in die Augen, als sich neben ihnen eine Tür öffnete und sie sich in einem Durcheinander aus schnatternden, verschwitzten Leuten mit Handtüchern um den Hals wiederfanden. Ambrogios hochrotes Gesicht tauchte vor ihnen in der Menge auf. Als er sie sah, arbeitete er sich gegen den Strom zu ihnen durch.
»Eine Stunde Spinning durchgehalten«, keuchte er. »Nicht schlecht für einen alten Kerl, der vor Kurzem dem Tod von der Schippe gesprungen ist, oder?«
Luca nickte anerkennend, doch Moira begutachtete beunruhigt die Gesichtsfarbe ihres Vaters. »Hast du dir auch nicht zu viel zugemutet?«
Ambrogio reckte das Kinn. »Ich bin doch kein Tattergreis! Außerdem wurde die ganze Zeit unsere Herzfrequenz kontrolliert. Ihr dagegen scheint euch nicht sehr angestrengt zu haben.«
»Da irrst du dich, auch wenn man beim Yoga weniger schwitzt«, entgegnete Luca. »Versuch mal, ob du den Herabschauenden Hund hinkriegst.«
»Für das Kamasutra bin ich nun wirklich zu alt.« Ambrogio zwinkerte Moira, zu und sie lachten alle drei.
»Ich habe heute frei, hättet ihr Lust, mit mir essen zu gehen?« Luca blickte in die Runde, doch Ambrogio hob bedauernd die Schultern. »Ich muss jetzt zur Massage, dann noch zum täglichen Wiegen. Und zum Mittagessen bin ich bereits mit Signora Valadon verabredet.«
Luca wandte sich an Moira. »Und du?« Er machte ein hoffnungsvolles Gesicht, doch sie zögerte, obwohl sie nichts lieber getan hätte, als noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. War das gut für sie beide? Sie sah ihn an, und ihr Herz machte diesen kleinen Sprung, der ein bisschen bitter und ein bisschen süß war wie sehr dunkle Schokolade. Dann warf sie ihre Bedenken über Bord. »Wo gehen wir hin?«
Er lächelte geheimnisvoll. »Überraschung.«
Sie fuhren gar nicht weit, nur ein Stückchen den Berg hinunter, dann stellte Luca sein rotes Karmann-Ghia-Cabrio auf einem Parkplatz neben einer Kabinenseilbahn ab. Moira stieg aus und beschirmte ihre Augen mit der Hand, als sie zu der schnurgeraden Schneise im Bewuchs des Hangs und den Stützpfeilern aufblickte.
»Nehmen wir die?«
Luca bestätigte ihre Vermutung, und sie erklommen die Treppe zu der kleinen Station, nicht viel mehr als zwei Mauern mit einem Wellblechdach darüber. Die Frau, die die Seilbahn bediente, verkaufte ihnen zwei Karten und teilte ihnen mit, sie müssten ungefähr zehn Minuten warten.
Sie setzten sich auf eine Bank vor der Station. Luca ächzte kurz, als er sich zurücklehnte.
»Du klingst ein bisschen wie mein Vater«, neckte ihn Moira.
»Anscheinend bin ich ziemlich eingerostet«, gab Luca zu. »Ich war länger nicht beim Yoga, zu viel Arbeit.«
Moira saß entspannt da und genoss die Sonne auf ihrem Gesicht, bis die kleine Kabine den Berg hinab auf sie zu schwebte. Sie hatte sich etwas Größeres vorgestellt. Doch diese Blechkiste schwankte an einem einzigen Haltearm hin und her.
»Du weißt noch, dass ich Höhenangst habe, oder?«
Luca sah sie betroffen an. »Mist, nein, das hatte ich völlig vergessen. Sollen wir lieber das Auto nehmen und das letzte Stück zu Fuß gehen?«
»Auf keinen Fall. Ich muss das ja irgendwann mal überwinden.« Sie stand auf und ging ihm voran durch die jetzt geöffnete Schranke. Als sie einen Fuß in die Gondel setzte, die zwei Handbreit über dem Boden hing und unter ihrem Tritt leicht schwankte, kam sie sich geradezu tollkühn vor. Dennoch setzte sie sich schnell und war froh, dass Luca neben ihr Platz nahm. Ein älteres Ehepaar in Wanderkleidung stieg noch zu und verstaute umständlich seine Trekkingstöcke. Die Tür der Gondel schloss sich, und im selben Moment setzte sie sich auch schon in Bewegung.
»O mein Gott«, rutschte Moira leise heraus. Der männliche Teil des Paares nickte ihr lächelnd zu. »Mer stürze scho ned ab.«
Sogleich lief vor Moiras innerem Auge die Szene ab, wie die Kabine aus ihrer Verankerung rutschte und von hoch oben ins Tal stürzte.
»Hoffen wir’s«, sagte sie fröhlich, als machte sie einen Scherz.
»Wenn du eine Hand zum Festhalten brauchst …«, bot Luca sich an, aber Moira schlug das Angebot aus. »Danke, ich schaffe das schon.«
Kaum hatte sie es ausgesprochen, polterte die Kabine lautstark über die erste Portalstütze und wurde hin und her gerüttelt, sodass Moira instinktiv Lucas Unterarm umfasste. Er grinste. »Irgendwie gefällt mir ganz gut, wenn ich den ritterlichen Helden spielen kann.«
Die Kabine glitt wieder ruhig dahin, und Moira ließ seinen Arm los. »Ach ja? Und was genau hast du Heldenhaftes getan?«
»Na, ich stehe dir zur Seite.« Luca warf sich in die Brust und Moira stieß ihm ihren Ellbogen in die Rippen. Sein Gesicht verzog sich schmerzvoll, und er gab einen Wehlaut von sich. Moira sah ihn verwundert an. »Das kommt aber nicht vom Yoga.« Bevor er etwas dagegen unternehmen konnte, griff sie nach dem Saum seines T-Shirts und zog ihn ein Stück hoch. Ein lilafarbener Bluterguss kam zum Vorschein. Die ältere Frau schnalzte missbilligend mit der Zunge, aber Moira achtete nicht weiter auf sie.
»Was ist denn mit dir passiert?« Sie ließ das T-Shirt los und blickte Luca fragend an. Der zuckte die Achseln. »Ich bin ausgerutscht und gegen das Geländer von unserer Eingangstreppe geknallt. Schau mal, wie klein die Station von hier oben aussieht!«
»Dass ich nach unten schaue, kannst du vergessen.« Moira zeigte ihm einen Vogel und erhaschte den konsternierten Blick der älteren Frau, der ihr sonderbarerweise dabei half, das ungute Gefühl der Höhenangst abzuschütteln. Jetzt konnte sie sogar den Blick zur Seite genießen, wo grün belaubte Baumkronen beinahe die Kabinenfenster streiften. Immer wieder glitten graue Natursteinmauern vorbei, die das steile Gelände gliederten.
»Fühlt sich fast wie Fliegen an«, sagte sie. »Ich glaube, es macht mir sogar ein bisschen Spaß.«
»Der ist allerdings schon wieder vorbei.« Luca stand auf und in diesem Moment stoppte die Gondel so abrupt, dass die Oberkörper des Ehepaars sich erst nach hinten und dann nach vorne neigten. Es sah aus wie eine feierliche Verbeugung und Moira musste sich das Lachen verkneifen.
»Gute Fahrt noch!«
Beim Aussteigen nahm sie dankbar Lucas Hand entgegen und stieg beherzt aus der schwankenden Gondel. Erst dann bemerkte sie, dass sie auf einem Gitterrost standen, einer winzigen Plattform in mehreren Metern Höhe, die nicht einmal ein Geländer besaß.
»O mein Gott. Heilige Scheiße, warum tust du mir das an?« Sie musste sich zusammenreißen, um nicht Halt suchend ihre Arme um Luca zu schlingen. Stattdessen streckte sie die Hände nach dem Geländer der Treppe aus, die nach unten führte und bewegte sich mit schlurfenden, winzigen Schritten darauf zu.
»Es gibt Auffangnetze unter der Plattform, dir kann nichts passieren«, sagte Luca aufmunternd. Moira umklammerte das Geländer nur noch fester und warf ihm einen tödlichen Blick zu.
»Ich habe dich gefragt, ob du laufen willst«, verteidigte er sich.
»Ich weiß. Und ich schaffe das, habe ich doch gesagt.« Mit weichen Knien stieg Moira die Stufen, die ebenfalls aus Gitterrosten bestanden, hinunter. Sobald ihre Füße festen Boden berührten, fiel die Anspannung von ihr ab.
»Gut, ich streiche wohl besser den Bungeesprung von der Liste deiner Geburtstagsgeschenke«, sagte Luca.
»Das würde ich dir raten. Hattest du nicht was von essen gehen gesagt?«
Luca deutete hügelaufwärts, wo zwischen Büschen und Bäumen eine Ansammlung kleiner Häuser aus grauem Naturstein lag.
Sie folgten dem Fußweg und hatten nach wenigen Minuten die Häuser erreicht. Über dem Örtchen lag eine friedliche Ruhe, nur ab und zu erklangen Stimmen in einiger Entfernung, Ziegengemecker und das Klingeln kleiner Glöckchen. Die Häuser waren restauriert, wirkten aber unbewohnt.
»Was für ein verwunschener Ort! Wunderschön, aber was ist das hier?«
»Das ist Curzútt, ein aufgegebenes Dorf, das inzwischen in eine Stiftung umgewandelt wurde. Man kann hier Tagungsräume mieten, übernachten und ziemlich gut essen.«
Luca führte sie durch die schmalen Gassen zu einem größeren Haus mit einer großen Terrasse, wo unter weißen Sonnenschirmen Tische und Stühle standen, ganz ähnlich wie im Garten der Villa Carasso. Mehrere Tische waren besetzt, aber sie fanden problemlos einen Platz im Schatten. Auf dem Weg, der sich am Dorf vorbeischlängelte, waren in beide Richtungen ganze Scharen von Wanderern, Familien mit Kindern und Paare jeden Alters unterwegs.
»Wohin wollen die denn alle?«
»Zur tibetanischen Hängebrücke, eine der großen Attraktionen der Gegend.«
Sie unterbrachen ihr Gespräch, da ein Kellner an den Tisch kam, ihnen die Menükarten reichte und ihre Getränkebestellung aufnahm.
»Den Hinweis auf die Brücke habe ich unten im Tal auf einem Wegweiser gesehen«, sagte Moira. »Aber was genau ist tibetanisch daran?«
»Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es solche Brücken auch in Tibet. Auf jeden Fall ist sie ziemlich beeindruckend. Aber für jemanden mit Höhenangst wohl nicht das richtige Ausflugsziel.«
»Das würde ich nicht unbedingt sagen. Vielleicht ist heute der Tag der kühnen Taten.«
Luca nickte beifällig. »Wenn du nach dem Essen noch Lust auf einen Spaziergang hast, laufen wir hin.«
Moira grinste. »Du kennst mich doch: Wenn mir jemand sagt, ich soll etwas nicht tun, mache ich genau das. Ob ich sie überquere, weiß ich nicht. Aber ansehen will ich mir dieses Weltwunder auf jeden Fall.«