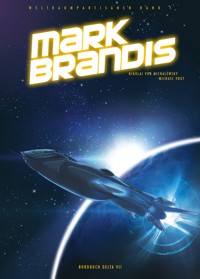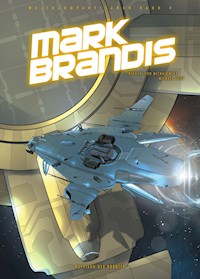3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine kleine Gruppe höchst unterschiedlicher Männer findet sich an Bord der »Solitaire« zusammen, um in den unergründlichen Tiefen des Meeres zwischen Sardinien und Sizilien nach einer untergegangenen spanischen Galeone zu suchen. Bald verführen sportlicher Ehrgeiz und hemmungslose Habgier dazu, unkalkulierbare Risiken einzugehen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Nikolai von Michalewsky
Schatztaucher
Abenteuer unter Wasser
FISCHER E-Books
Inhalt
1.
Der Schlüssel zur Gegenwart liegt immer in der Vergangenheit.
Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte: auch diese.
Als ich erfuhr, daß Toni Brunner einen großen Unterwasser-Dokumentarfilm im Roten Meer drehen wollte, horchte ich auf; und als ich dann einem der vielen Zeitungsberichte über das Vorhaben entnahm, daß die Produktion noch nach einem weiteren erfahrenen Taucher Ausschau hielt, fuhr ich – es war in Palermo – hinaus zum Hafen, wo die Fatima, das Expeditionsschiff, vor Anker lag. Zehn Minuten später war ich engagiert: weil ich ein Schüler von Henri Barrière war.
Toni Brunner, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, behandelte mich ungeachtet meiner knapp fünfundzwanzig Jahre als seinesgleichen; er duzte mich auf Anhieb und bestand darauf, daß ich diese mir angetragene Freundschaft erwiderte. Der österreichische Akzent, den er niemals ablegte, in welcher Sprache auch immer er sich ausdrückte, hatte etwas Bestrickendes – vor allem für mich; denn ich hatte begonnen, mir einzubilden, daß ich an der Seite von Henri Barrière meine besten Jahre vertrödelte.
Henri Barrière, mein väterlicher Freund, war genau das Gegenteil von Toni Brunner: ein großer Taucher, der jegliche Publicity verabscheute. Dafür plünderte er in aller Seelenruhe die reichen Korallenbänke zwischen Sardinien und Korsika – und als diese abgeerntet waren, tauchte er eine Etage tiefer, wohin bislang vor ihm noch nie ein Mensch vorgedrungen war, in den schwarzen, beklemmenden Abgrund, und plünderte sie ein zweites Mal – während rechts und links von ihm an eben diesen verfluchten Korallen die ganze alte Elite zugrunde ging, unter ihnen auch Ennio Falco, der unvergeßliche Neapolitaner.
Inzwischen weiß ich, was mich an Henri Barrière störte: es war seine Einfachheit, seine Vorliebe für stille, weltabgeschiedene Ankerplätze, allein mit Meer, Sonne und Mond, fernab von allem, was auch nur andeutungsweise nach Snob Society und Jet Set roch. Nachdem ich dies Leben einige Jahre lang mit ihm geteilt hatte, begann ich mich zu langweilen.
Toni Brunners Filmprojekt war ein willkommener Anlaß, um mich guten Gewissens von Henri Barrière zu trennen.
Als ich ihm meinen Entschluß kundtat, stand ich noch ganz unter dem Eindruck der Gegensätze. Auf der einen Seite: mein alter Lehrmeister mit seinem behäbigen, um nicht zu sagen schäbigen Schiff, beide gezeichnet von Wind, Wetter und glühender Sonne – auf der anderen Seite: der elegante, weltgewandte Österreicher mit seiner komfortablen Yacht, umringt von Reportern und schönen Frauen.
Henri Barrière ließ mich ausreden. Unter dem gespannten Sonnensegel hatte er sich auf den verwitterten Klappstuhl gesetzt, und während ich nach Worten suchte, um ihm meinen Entschluß verständlich zu machen, rauchte er schweigend die Pfeife.
Als ich geendet hatte, nahm er sie aus dem Mund und zielte mit ihrem Stiel auf meine Brust.
»So weit, so gut, Sohn. Du möchtest einmal etwas anderes erleben. Aber warum fällt deine Wahl ausgerechnet auf Toni Brunner?«
»Warum?« Einen Atemzug lang wußte ich nicht, was ich darauf erwidern sollte – oder, richtiger: ich wußte es, wollte es jedoch für mich behalten. Mit einer einzigen Frage hatte mich Henri Barrière aus der Fassung gebracht. »Er hat mir ein glänzendes Angebot gemacht. So etwas schlägt man nicht aus. Du wärst doch nie auf die Idee gekommen, einen Film zu drehen.«
Henri Barrière ließ sich Zeit, bevor er antwortete. Oder wollte er mir Zeit geben, meinen Entschluß noch einmal zu überdenken und die Dinge, die fortzuwerfen ich im Begriff stand, ein letztes Mal in Augenschein zu nehmen?
Wie dem auch sei; der letzte Augenschein prägte sich mir ein, unverlierbar und unzerstörbar: das alte Schiff, dem keine Welle dieses Meeres unbekannt war, gezeichnet von ehrlicher Arbeit; das halbe Dutzend Atemgeräte auf dem Vorderdeck, eines neben das andere gegen die Reling gelehnt, stumme Zeugen unzähliger Abstiege in unerforschte Tiefen; der ramponierte, rostende, immer wieder überstrichene Kompressor hinter dem Ankerspill; daneben ein demontiertes Harpunengewehr, zu dem eine neue, passende Feder besorgt werden mußte; vor allem aber Henri Barrière selbst mit seinen ruhigen, ehrlichen Augen im alternden Gladiatorengesicht.
Als er schließlich das Wort ergriff, spürte ich erleichtert, daß er mir nichts zum Vorwurf machte.
»Nein«, sagte er, »auf die Idee wäre ich tatsächlich nie gekommen, Sohn. Andererseits habe ich es mir auch nie einfallen lassen, mich in ein archäologisches Sperrgebiet einzuschleichen.«
Henri Barrière spielte auf einen Vorfall an, der sich einige Monate zuvor in den Gewässern vor Paestum zugetragen hatte. Dort waren über Nacht einige bereits markierte archäologische Funde vom Meeresboden verschwunden: Antiquitäten von höchstem Wert. Eine polizeiliche Ermittlung gegen Toni Brunner, dessen Fatima zur fraglichen Zeit vor Paestum gesehen worden war, hatte zu keinem klaren Ergebnis geführt. Das freilich besagte gar nichts. Ich selbst hatte bislang keinen Augenblick daran gezweifelt, daß Toni Brunner beim Verschwinden der Altertümer seine Hand im Spiel gehabt haben mußte. Auf einmal wollte ich davon nichts mehr wissen.
»Du stellst eine Behauptung auf«, sagte ich, »für die es keinerlei Beweise gibt. Alle Taucher in der Umgebung wußten über diese Funde Bescheid. Warum soll es ausgerechnet Toni Brunner gewesen sein?«
Henri Barrière lächelte – wie um mich versöhnlich zu stimmen, doch sein Blick enthielt eine Warnung.
»Nur deshalb, Sohn: weil es seiner Art entspricht. Alles, was ihn interessiert, läßt sich in ein einziges Wort zusammenfassen: Geld.«
»Und du«, sagte ich gereizt, »riskierst wohl nichts, wenn du auf Korallen gehst? Du tauchst schließlich auch für Geld.«
Henri Barrière hob einen Neoprene-Anzug auf und betrachtete gedankenverloren einen quer über die Schulter verlaufenden Riß: eine Erinnerung an meinen letzten Fischzug vor der Küste.
»Eigentlich«, sagte er, »hatte ich vor, den Anzug noch einmal zu kleben. Aber du bekommst jetzt wohl einen neuen. Versuch’s also mit Toni Brunner! Irgendwann wirst du vielleicht selbst einsehen, daß er und ich nicht dasselbe tun. Ich nehme mir vom Meer, was ich zum Leben brauche – und manchmal muß ich dafür etwas riskieren. Dabei bin ich weder ein Dieb noch ein Glücksritter. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich längst Millionär. Aber was dann?«
»Was dann?« Ich war fassungslos. »Dann beginnt das Leben!«
Henri Barrière wiegte den Kopf.
»Ich sehe das anders, Sohn. Dahinter mußt du selbst kommen. Aber eines möchte ich dir gern sagen: Laß dich nicht blenden, Sohn! Leuten wie Toni Brunner steckt die Maßlosigkeit im Blut. Das Gescheiteste ist, man geht ihnen aus dem Weg.«
Nachdem ich von Bord gegangen war, ließ Henri Barrière den schweren Diesel anspringen, warf die Leinen los, holte den Anker ein und führte sein Schiff aus dem Hafen hinaus, um Kurs zu nehmen auf die Straße von Bonifacio: heim zu seinen stillen Korallenbänken.
Henri Barrières plötzlicher Aufbruch überraschte mich; ein ungutes Gefühl überkam mich, während ich ihm nachblickte, und ließ sich nicht abschütteln. Irgend etwas, spürte ich, war unwiderruflich zu Ende gegangen.
Ein Taxi brachte mich, meine Seesäcke und meine Ausrüstung zur anderen Mole, an der die weißleuchtende Fatima vertäut lag. Vor der Gangway wurde ich aufgehalten: ein stämmiger Carabiniere vertrat mir den Weg.
»Wohin, junger Mann?«
»An Bord«, sagte ich heiter und ahnungslos, »um mit Toni Brunner den sensationellsten Film des Jahres zu drehen.«
Der Carabiniere verzog keine Miene; seine ausgestreckte Hand stemmte sich mir gegen die Brust.
»Nehmen Sie Ihr Gepäck, und machen Sie sich damit aus dem Staub, junger Mann, bevor es mit in die Konkursmasse gehört! Es wird keinen Film geben. Der Mann, den Sie da mit Toni Brunner sehen, ist der Gerichtsvollzieher. Die Fatima ist beschlagnahmt. Einige Leute in dieser Stadt nahmen Anstoß an ungedeckten Schecks.«
In der angedeuteten Richtung sah ich einen dunkel und korrekt gekleideten Menschen mit Aktentasche, der auf Toni Brunner einsprach. Und ich sah und hörte auch, wie letzterer ihn plötzlich unterbrach, um mit seinem bestrickenden österreichischen Akzent, an mich gewandt, achselzuckend zu sagen:
»’s nichts geworden aus dem Projekt, Roberto, mein Freund. Tut mir leid. Vielleicht kommen wir ein andermal zusammen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Und nichts für ungut.«
Toni Brunner wäre mir völlig aus dem Gedächtnis geschwunden, wenn ich nicht, wie es in Taucherkreisen üblich ist, gelegentlich von ihm gehört hätte. Einiges davon blieb mir haften: eine Expedition ins Rote Meer, die an unzulänglicher Finanzierung scheiterte; ein Rekord im Freitauchen, der ihm nachträglich wieder aberkannt wurde; ein Schiffbruch im Golf von Tarent, gefolgt von einem Prozeß um die Eigentumsrechte an dem verlorenen Schiff; schließlich ein Bettelbrief an einen meiner Freunde: mit dem Versprechen, ihn gegen entsprechende Vorleistung zu einem reichen Mann zu machen.
Gelegentlich hörte ich auch von Henri Barrière, mit dem wieder zusammen zu arbeiten ich mich scheute: von seinen einsamen Abstiegen in das Reich der roten Korallen, von seinen neuen, unglaublichen Rekorden in dunkler, schweigender Tiefe: und mehr und mehr begann der Mythos um seinen Namen zu wachsen, der eine ganze Epoche der Eroberung des Meeres kennzeichnet. Die Rede war auch von einem Unfall, der ihm übel mitgespielt haben sollte: ein Atemgerät, an dem er an Deck seines Schiffes hantierte, war explodiert. Auf Umwegen fragte ich an, ob ich etwas für ihn tun könnte, bekam jedoch niemals eine Antwort.
Für sich genommen, besagt das alles wenig. Der Zusammenhang kam erst später.
2.
Unmittelbar vor dem Molenkopf löste sich die von Gesang und Gelächter erfüllte Solitaire aus der silbrigen Bahn des jungen Mondes, lenkte sie vorüber an den weißen, roten, grünen und blauen Lichtern des großen Fährschiffes, das sich soeben lautlos in Bewegung zu setzen begann, und hielt Ausschau nach einer Lücke zwischen den Fischerbooten. Nachdem ich diese entdeckt hatte, ließ ich die Solitaire im Hafenbecken behutsam herumschwingen.
Dimmi quando tu verrai,
dimmi quando, quando, quando …
Paolo saß halbnackt auf dem Kabinendach, ließ die Beine baumeln, sang zur Gitarre und unterhielt die Passagiere.
Paolo war mein Matrose. Als solchen jedenfalls hatte ich ihn angeheuert: einen Studenten, der in den Semesterferien das Nützliche mit dem Angenehmen verband, das Geldverdienen mit der Sonne und dem Meer. Inzwischen hatte ich in ihm den Freund gefunden. Ich mochte ihn beneiden, weil er so unbekümmert jung war – er hingegen bewunderte mich.
Als ich das Schiff achteraus der Kaimauer entgegensteuerte, legte Paolo die Gitarre aus der Hand, klinkte den Anker aus und eilte dann, jung und unermüdlich, unter mir vorbei, um die achterlichen Leinen an Land zu geben. Ich stellte die Maschinen ab und winkte einen Gruß hinüber zur Piazzetta, und Lidia, die dort schon auf uns wartete, winkte fröhlich zurück. Für mich wurde es Zeit, mich um die Passagiere zu kümmern, die sich vor der Gangway drängten.
»Ich hoffe, Sie waren mit diesem Tag zufrieden.«
Die üblichen Worte, wie immer um diese Zeit, die üblichen Antworten, die üblichen Händedrücke und – auch dies gehörte zum Ritual – die üblichen verstohlen, fast schamhaft überreichten Trinkgelder: nie für mich, sondern stets für »den netten, jungen Matrosen« oder auch schlicht »für das Schiff«.
»Ich hoffe, Sie waren mit diesem Tag zufrieden.«
Die Leute waren immer zufrieden mit einem langen, bei Sonnenaufgang begonnenen Tag auf dem Wasser; sie begeisterten sich an einem sanften, glatten Meer, an smaragdgrünen Buchten und einigen winzigen, versteckten weißen Stränden. Sobald sie an Bord kamen, gaben sie alle ihre Ansprüche auf und verwandelten sich in bescheidene, freundliche, fast demütige Wesen – bereit, zwölf, vierzehn oder noch mehr Stunden mit dem vorlieb zu nehmen, was die Solitaire ihnen zu bieten vermochte, und das war neben Sonne und Meer meist lauwarmer Wein und – immer wieder – unterwegs geangelter oder geschossener Fisch, auf irgendeiner handgroßen Insel über offenem Feuer gegrillt: Fisch mit Sand, wie Paolo es nannte. Die Leute fanden an seinen Kochkünsten nie etwas auszusetzen, vielleicht, weil für sie ein solcher Tag – zum Festpreis von zwanzigtausend Lire – durchweht war vom Wind des Abenteuers.
Für mich bedeutete ein solcher Tag etwas völlig anderes als für sie: nämlich Arbeit und unablässige Verantwortung für zehn, zwölf oder noch mehr fremde Menschen, und dies setzte sich auch fort, wenn sie längst in ihre Hotels zurückgekehrt waren, denn dann galt es, das Schiff von den Spuren ihrer Anwesenheit zu säubern und für die bevorstehende neue Ausfahrt vorzubereiten. Paolo und ich kamen selten vor Mitternacht in die Kojen – und um fünf Uhr früh schrillte bereits der Wecker.
Freiheit und Unabhängigkeit haben ihren Preis: dies war meine jüngste Erfahrung. Im zwanzigsten Jahrhundert sind sie zum Luxus geworden. Wer sie für sich beansprucht, muß bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Völlige Armut zum Beispiel: das ist die eine Möglichkeit, sie zu erringen – keine, die mir zusagte. Ich bevorzugte die andere.
Lidia stand am Kai, als ich endlich über die Gangway kam: schlank, anmutig und viel zu groß und selbstbewußt für eine Südländerin. Einen Atemzug lang war außer ihr alles wie ausgelöscht; ich sah nur sie: wie sie sich auf einmal in Bewegung setzte und mit jenem federnden, schwebenden Gang, den sie mit Paolo gemeinsam hatte, auf mich zukam. In diesem Atemzug war sie für mich das Leben.
Als ich sie in die Arme nahm, schob sie mich von sich fort.
»Nicht!« sagte sie, halb verärgert, halb lachend. »Gewöhn’s dir endlich ab, vor aller Augen!«
Hierin und in gewissen anderen Dingen war Lidia durch und durch Italienerin aus gutem Hause: schamhaft und konservativ, ja sogar prüde – all dies nach außen hin. Das Hotel Corallo, das sie leitete, genoß einen guten Ruf – und ebenso untadelig hatte ihr eigener zu sein.
»Erzähl lieber!« sagte sie schnell. »Wie war der Tag?«
»Lang und heiß, heiß und lang. Willst du noch mehr wissen?«
Sie schüttelte lachend ihr zerzaustes Haar.
»Das«, sagte sie, »ist eine wahrhaft umwerfende Schilderung. Dabei gibt es genug Leute, die dich um einen solchen Tag beneiden – Leute zum Beispiel, die sich von früh bis spät in einem muffigen Hotel abrackern.«
»Wie du?«
»Wie ich.«
»Was hindert dich daran, deinen Job an den Nagel zu hängen, wenn er dir nicht paßt?«
Lidia tippte mich mit spitzem Zeigefinger an.
»Die Pflicht, Lieber. Aber das ist ein Wort, mit dem du nichts anfangen kannst.«
»Man sollte es aus dem Verkehr ziehen!« stimmte ich zu. »Wer es zu oft in den Mund nimmt, wird alt und häßlich.«
Um uns war die Heiterkeit eines warmen Sommerabends. Wir stritten uns mit der Fröhlichkeit ungebärdiger Kinder. Nur ganz im Hintergrund lauerte der Ernst. Lidia wechselte das Thema.
»Ich hörte was von einem Unfall.«
»Unfall? Ach so!« Ich winkte ab. »Ein altes Mütterchen schwamm zu weit hinaus und bekam es mit der Angst. Paolo brachte es zurück. Seitdem liebt es ihn.«
Paolo schwang sich über die Reling und drückte Lidia einen Kuß auf die Stirn.
»Wie war das?« fragte er. »Was erzählt der Kapitän von einem alten Mütterchen?«
»Er berichtet nur«, erwiderte Lidia mit vorgetäuschtem Ernst, »daß du die Herzen brichst, wie sie gerade kommen.«
Paolo schnaubte entsetzt und schüttelte sich. »Ich fange an, mich intensiv zu fragen, ob das Zufall ist – ich meine, daß Roberto in solchen Fällen immer mich vorschickt. Er selbst rettet nur die jungen Mädchen.«
Lidia zog die Brauen hoch, aber ihre Augen lachten mich an.
»Davon hast du mir nie erzählt!«
»Um mich nicht zu blamieren«, erwiderte ich. »Die Wahrheit ist, daß das junge Gemüse meist besser und schneller schwimmt als ich in meinen besten Zeiten.«
Von der Piazzetta wehte Musik: jemand hatte eine Münze in eine Musikbox geworfen. Die Musik verschmolz mit der lauen Luft: mit dem herben, würzigen Geruch von hölzernen Booten, Teer und trocknenden Fischernetzen. Boote liefen ein und liefen aus; langgedehnte Rufe hallten über das dunkle Wasser. Und zu allem Überfluß war da auch noch Lidia – mit ihrer Geduld, mit ihren anmutigen Bewegungen, mit ihrem heiseren, etwas kehligen Lachen.
Hatte ich Paolo eigentlich je für dieses Glück gedankt? In Rapallo, an einem regnerischen Tag, der auf einen anderen regnerischen Tag gefolgt war, hatte Paolo beiläufig gefragt:
»Was hält uns hier eigentlich, Kapitän?«
»Was?« Ich hatte überlegen müssen. »Eigentlich nichts.«
»Warum wechseln wir dann nicht die Zone?«
»Und wie lautet dein Vorschlag?«
»Sardinien«, hatte Paolo ohne jedes Zögern gesagt. »Dort wird der Tourismus gerade angekurbelt. Wir kämen bestimmt ins Geschäft. Meine Schwester wird uns behilflich sein.«
»Du hast eine Schwester?«
»Lidia. Sie leitet neuerdings ein Hotel, in Golfo Aranci, gleich neben der Costa Smeralda.«
»Eine sehr große Schwester!«
»Groß, alt und häßlich. Sie hat mich aufgezogen – das heißt, was es bei mir aufzuziehen gab.«
So hatte es begonnen: mit Paolos Vorschlag, gefolgt von der Überfahrt in einer windigen, mondlosen Nacht – mit leerer Kasse und fast ebenso leeren Tanks.
Weshalb trat ich diese nächtliche überstürzte Überfahrt an?
Ich kam, so denke ich heute, um noch einmal zu leben, wie ich es bis dahin Jahr für Jahr – wenngleich auch von Jahr zu Jahr ein wenig magerer – zu leben gewohnt war: aus dem Vollen schöpfend, gehüllt in die Glut eines großen, heißen Sommers, ohne die Tage zu zählen, die sich zu Monaten summierten, ohne die Monate zur Kenntnis zu nehmen, die sich zu Jahren reihten, an deren Ende einmal Alter und Tod stehen müssen. Der Sommer war meine Heimat, meine eigentliche Heimat: diese glitzernde Perlenschnur, die sich zwischen den Horizonten spannte – und ich meine auch heute noch, daß Heimat nicht ist, was einem Geburt und Paß bestimmen, sondern was man sich liebend erwählt. Daher ist es auch völlig unwichtig, woher ich stamme und wie ich heiße. In diesem Sommer nannten sie mich Roberto; das mag genügen.
Ein jeder dieser Sommer hatte seinen Preis, und ich zahlte ihn bereitwillig. Seitdem mir Henri Barrière die gläserne Welt der Tiefe erschlossen hatte, war Tauchen mein Beruf – oder doch der einzige, den ich regelmäßig und ernsthaft ausübte. Tag um Tag stieg ich hinab in die lautlose Nacht, um hernach die mit Angst und Gefahr erkaufte Beute – die zuckenden Fischleiber, die roten Korallen – aus vollen Händen zu vergeuden. Das allein ist Leben. Wer seinen Pulsschlag spüren will, darf keine Versicherungen abschließen. Nicht der Tod ist zu fürchten, sondern die Vergeblichkeit des Lebens: das einförmige Gleichmaß, das langsame Altwerden in scheinbarer Sicherheit. Ich jedenfalls lebte, indem ich aus dem Vollen schöpfte.
Als mir Paolo – mein Matrose, mein Freund, mein Partner, mit dem ich alles teilte: Gewinn und Verlust, Spaß und Gefahr, vor allem aber den herrlichen Glanz seiner unbekümmerten Jugend – als mir Paolo seinen Vorschlag machte, war ich soeben fünfunddreißig geworden, und damit war das Unbehagen gekommen.
Eines Morgens wachte ich auf, stellte mich vor den Spiegel und blickte in das Gesicht eines von Arbeitslosigkeit bedrohten Großwildjägers. Das Auge noch scharf wie eh und je, die Hand sicher, der Instinkt wacher und ausgeprägter als zuvor, die Erfahrung überquellend: aber was nutzte das alles, da das Wild fort war? Leergefegt die einst wildreichen submarinen Savannen. Alle drei, vier Tage ein Zackenbarsch: davon konnte man nicht leben und schon gar nicht die gefräßigen Diesel der Solitaire sättigen – und der rettende Ausweg, das Geschäft mit den Touristen, lag in Rapallo wie fast überall fest in den Händen alteingesessener Unternehmer.
Gewiß, auch vor Sardiniens Küste waren die fetten Jahre vorüber: die einst reichen Korallenbänke hatten sich in trostlose Wüsteneien verwandelt, und auch die Harpune allein hätte uns höchst miserabel genährt. Als wahre Goldgrube jedoch erwiesen sich die Sonnenfahrten hinaus zu den Inseln Tavolara und Molara und zu den weißen Stränden von Capo Coda Cavallo. Dank Lidia war die Solitaire ständig ausgebucht. Für alle diese Deutschen, Holländer, Skandinavier und Engländer besaßen die Inseln, Buchten und Strände, zu denen wir fuhren, wie mir scheint, exotischen Zauber. Die Bordkasse begann sich zu erholen – und leere Tanks ließen sich nachfüllen: ein Sprung nach Olbia, der nächstgelegenen Hafenstadt, genügte. Eine halbe Stunde hin, eine halbe zurück – und eine Stunde zum Bunkern. In zwei Stunden war alles erledigt, und die Solitaire war mein autonomes, autarkes Königreich auf dem Wasser.
»Ihr kommt spät!« sagte Lidia.
»Das liegt an deinen Leuten«, antwortete ich. »Sie wollten den Mond sehen.«
»Trotzdem«, sagte Lidia, »du und Paolo, ihr bringt mir den ganzen Hotelbetrieb durcheinander. Die Kellner stehen kurz vor einer Meuterei.«
»Das«, erwiderte ich, ohne mir Lidias Vorwurf zu Herzen zu nehmen, »bringt der Beruf eines Kellners so mit sich.«
An diesem Abend war ich heiter und fast glücklich: das heißt, ich hielt mir vor, daß ich allen Grund hatte, um glücklich und zufrieden zu sein – nicht zuletzt, weil ich von einer Frau wie Lidia erwartet wurde –, aber tief in mir nagte der Verdruß.
Eine seiner Wurzeln mochte die Sehnsucht nach den vergangenen großen, herrlichen Zeiten gewesen sein, als das Meer noch mir und meinesgleichen allein gehörte und wir es nicht zu teilen brauchten mit den lärmenden, schießwütigen Sonntagsjägern, wie ich sie nunmehr auf meiner Solitaire beförderte, die Trauer um das verlorene Paradies: Doch neben dieser einen Ursache gab es noch etliche andere – jene zum Beispiel, daß mir das Geld schneller durch die Finger rann, als ich es verdiente.
Dieser Verdruß ließ sich nicht abschütteln, auch wenn ich ihn nicht benennen konnte; er begleitete mich auf Schritt und Tritt – und er verflüchtigte sich nur, wenn ich mich über den Bootsrand fallen ließ, den amethystblauen Spiegel zertrümmerte und hinabschwebte in die Tiefe: hinab zu den sich türmenden Festungen mit den roten Gorgonenkorallen und zu den sich wiegenden Algenfeldern, die so sehr an Weizenfelder erinnern, über die hinweg ein zärtlicher Sommerwind streicht.
Das Meer war meine wahre Geliebte – und eines Tages, so hoffte ich, würde meine Treue ihren Lohn finden: in Form neuer reicher Fischgründe oder einer jungfräulichen Korallenbank.
Lidia spürte das, und ab und an warf sie mir vor:
»Wenn du schon nicht leben kannst wie vernünftige Leute – dann wenigstens setz Paolo keine Flausen in den Kopf! Er braucht einen vernünftigen Beruf, ein vernünftiges Heim und eine vernünftige Frau.«
»Und ich nicht?« hatte ich gelegentlich gefragt. »Ich brauche wohl keine vernünftige Frau?«
»Du« – Lidia hatte errötend gelacht – »hast doch längst alles, was du brauchst. Im Grunde bist du nur froh, daß es mit meiner Vernunft nicht allzuweit her ist.«
Wie recht sie hatte, begriff ich später. Mehr, als ich besaß, kann niemand besitzen. Frauen ihrer Art mag es zu Tausenden geben – aber Männer wie ich lernen sie nur selten kennen. Das Salz in den Augen macht uns blind für die Schönheit des Einfachen. Wir wollen auffallen: auch mit der Frau an unserer Seite.
Manchmal gibt es Ausnahmen von der Regel – wie im Fall von Lidia und mir.
Lidia erzählte mir die Neuigkeiten des Tages: ihres Tages; und wie immer tat sie es mit viel Witz und Selbstironie. Ich ging neben ihr her, rauchte eine Zigarette und entspannte mich.
Mich an meine Pflichten zu erinnern blieb Paolo vorbehalten. Es war kurz vor Ladenschluß, und an Bord waren die Getränke knapp geworden. Paolo wollte Geld, um einzukaufen.
In Fragen der Ausrüstung war er gewissenhaft, nahezu pedantisch – im Gegensatz zu mir, der ich mir nie gern den Kopf über die Erfordernisse eines Tages zerbrach, der noch nicht angebrochen war.
Paolo eilte davon: mit dem federnden, schwebenden Gang eines jungen Wettkämpfers, der noch nicht weiß, wie die Niederlage schmeckt. Sein knallrotes Hemd, das sich über den breiten Schultern spannte, war eine verwegene Herausforderung an das Leben: Tritt an, Leben, schlag zu – laß sehen, wer stärker ist, ich oder du!
Lidias Wagen parkte auf der Piazzetta. Davor blieb sie plötzlich stehen und schlug sich vor den Kopf.
»Ach«, sagte sie, »das habe ich fast vergessen. Jemand hat nach dir gefragt. Er meint, du könntest ihm helfen. Mit seinem Boot ist was nicht in Ordnung.«