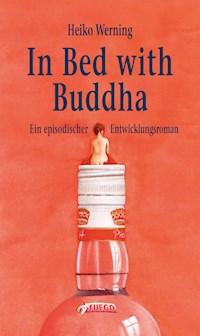7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geplatzte Dates und geplatzte Kondome, schreiende Nachbarn und krakeelende Kinder, billiges Bier und billige Ausreden, Urängste und Selbstzweifel... Es wäre kaum zu ertragen, wenn man nicht wüsste, dass am nächsten Morgen, bei Lichte betrachtet, alles noch viel schlimmer sein wird. Heiko Werning leuchtet in seinen Geschichten die finstersten Ecken der menschlichen Existenz aus: Feten, auf denen Westernhagen gespielt wird, Massagesalons, in denen man "no sex" bestellen muss, Übernachtungen in zerstrittenen WGs oder Saufgelage mit Striptease-Einlagen. Und trifft dabei auf allerlei Nachtgestalten: Künstlerinnen, die sich Sperma in die Haare stricken, Transvestiten, die sich mit vorgehaltenem Messer auf eine Pizza einladen lassen, Lesben, die junge Männer abschleppen, und Freunde, die man gut zu kennen glaubte und die sich dann als Klaus-Hoffmann-Fans entpuppen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Heiko Werning
Schlimme Nächte
Von Abstürzen und bösen Überraschungen
FUEGO
- Über dieses Buch -
Geplatzte Dates und geplatzte Kondome, schreiende Nachbarn und krakeelende Kinder, billiges Bier und billige Ausreden, Urängste und Selbstzweifel...
Es wäre kaum zu ertragen, wenn man nicht wüsste, dass am nächsten Morgen, bei Lichte betrachtet, alles noch viel schlimmer sein wird. Heiko Werning leuchtet in seinen Geschichten die finstersten Ecken der menschlichen Existenz aus: Feten, auf denen Westernhagen gespielt wird, Massagesalons, in denen man »no sex« bestellen muss, Übernachtungen in zerstrittenen WGs oder Saufgelage mit Striptease-Einlagen. Und trifft dabei auf allerlei Nachtgestalten: Künstlerinnen, die sich Sperma in die Haare stricken, Transvestiten, die sich mit vorgehaltenem Messer auf eine Pizza einladen lassen, Lesben, die junge Männer abschleppen, und Freunde, die man gut zu kennen glaubte und die sich dann als Klaus-Hoffmann-Fans entpuppen.
Die Nacht des untoten Kaninchens
Wir waren in der vierten Grundschulklasse. Eine dreitägige Klassenfahrt sollte uns in die Lüneburger Heide führen. Für viele von uns war es das erste Mal, dass sie ohne Eltern verreisten. Es war sehr aufregend.
Es wurde noch aufregender, als wir uns am letzten Abend entschlossen, auf eigene Faust eine Nachtwanderung zu unternehmen. Um neun Uhr mussten alle in den Schlafsälen der Jugendherberge in ihren Betten liegen, um halb zehn unternahm Frau Gerling ihren letzten Inspektionsgang, um zehn schliefen sie alle, die Luschen, diese Langweiler. Da waren wir aber aus anderem Holz geschnitzt! Wir suchten das Abenteuer!
Zu fünft machten wir uns auf. Auf Socken schlichen wir zum Hintereingang der Jugendherberge, erst draußen wagten wir, unsere Schuhe anzuziehen. Und erst, als wir auf einem der zahllosen Wanderwege so weit von den Straßenlaternen entfernt waren, dass ihr Licht kaum noch hinter die Wacholderbüsche reichte, schalteten wir unsere Taschenlampen an. Nun konnte es losgehen.
Gregor erzählte wilde Geschichten von Geistern und Heidemonstern, wir lachten überdreht, um unsere Furcht zu überspielen. Es war nämlich doch ganz schön unheimlich, das Spiel der Schatten im Schein der hin und her irrenden fünf Taschenlampen auf den Heidesträuchern, und mancher Wacholder wirkte vor dem Sternenhimmel zunächst wie eine der Figuren aus dem Gruselrepertoire von Gregor. Der sich zudem immer mal wieder den Spaß erlaubte, uns zu erschrecken, in dem er seltsame Laute von sich gab oder seine Taschenlampe ausschaltete, sich hinter einem Busch versteckte und dann kurz vor einem von uns mit heiserem Gurgeln dahinter hervorsprang.
Plötzlich rief er: »Psst! Seid mal leise, da ist was!«
»Na klar«, gab ich mich betont abgeklärt, »wieder einer von deinen Heidemördern!« (Ein damals noch ganz und gar unpolitischer Begriff.)
»Nein, echt jetzt! Hört doch mal, da, hinter dem Busch, bewegt sich da nicht was?«
Auch wenn klar war, dass es sich wieder um einen seiner blöden Scherze handeln musste, wurde mir die Sache doch etwas unheimlich. Wie überhaupt der ganze Ausflug. Vielleicht wäre ich doch besser im Schlafsaal bei den anderen geblieben. Was wussten wir schon, was nachts in der Heide alles unterwegs sein konnte?
Plötzlich sah ich im fahlen Mondlicht, wie etwas aus einem Busch heraus direkt in meine Richtung sprang. Ich schrie auf. Die anderen richteten ihre Taschenlampen auf mich, ich kniff die Augen zu. »Da, da vor mir, an dem Busch!«, schrie ich.
Als ich die Augen wieder aufmachen konnte, sah ich auf dem Boden vor mir, in der Mitte von fünf zitternden Lichtkegeln – nun ja: ein Kaninchen. Ich seufzte, bereit, das höhnische Gegacker von Gregor und den anderen über mich ergehen zu lassen.
»Oh, ein Karnickel, wie gefährlich!« – »Pass auf, dass es dich nicht packt!« – »Hilfe, hilfe, ein Häschen!« – und so weiter. War ja klar.
Während ich versuchte, meine Gefährten zu ignorieren, betrachtete ich das Tier. Es hüpfte nicht weg, es saß einfach da. Seltsam, eigentlich. So kannte ich Wildkaninchen nun überhaupt nicht. Und wenn man genauer hinsah, war es auch im gelbstichigen Schein der Lampen nicht zu übersehen: Seine Augen glupschten aus den Höhlen, waren blutunterlaufen, das Fell um sie herum war verschmiert und verklebt mit Tränen und Sekreten. Das Tier zitterte am ganzen Körper.
Myxomatose, keine Frage. Oft schon hatte ich von der Kaninchenseuche gehört, zum ersten Mal nun sah ich ein leibhaftiges Opfer. Es war kein schöner Anblick. Das Johlen der anderen war längst verklungen, inzwischen war ihnen wohl auch aufgefallen, dass mit dem Tier etwas nicht stimmte, auch sie schauten nun genauer hin. »Igitt«, fasste Jens den Gesamtzustand durchaus treffend zusammen, und Fridtjof ergänzte: »Kommt, lasst uns schnell weitergehen.« Aber wir zögerten. »Wir können es hier doch nicht einfach so sitzen lassen!«, fand Gregor, »wir müssen etwas tun. Wir müssen ihm helfen! Wie echte Pfadfinder!« Aber mitnehmen, das war uns klar, konnten wir es auch nicht. Man durfte es nicht anfassen, das hatten wir gelernt. Wildtiere, die nicht weglaufen, niemals anfassen. Uns gruselte davor, unsere Augen könnten sonst bald genauso aussehen wie die des Kaninchens, und womöglich hatte es auch noch Tollwut obendrein.
»Lasst uns Hilfe holen«, schlug Jens vor, aber wir sahen uns nur ratlos an. Wen denn? Die Polizei? Die Feuerwehr? Unseren Lehrer gar? Nein, das ging alles auf gar keinen Fall. Mitleid hin oder her – unser nächtlicher Ausflug durfte nicht auffliegen, das würde ordentlich Ärger geben. Wir würden, das wurde uns zunehmend klar, das Problem irgendwie selbst lösen müssen.
Gregor war es, der es als Erster aussprach: »Wir müssen es töten.« Beifälliges Nicken, zustimmendes Murmeln. Ja, wir mussten es töten. Wir sahen Gregor an. Er war der Coole, der Chef unserer Bande, er hatte den ganzen Weg über schon blutige Schauermärchen erzählt, da waren ganz andere Wesen zu Tode gekommen als ein todkrankes Kaninchen, er verjagte die Mädchen. Es war also sozusagen seine natürliche Bestimmung, nun das Kaninchen zu erlösen. Dieser Aspekt war ihm offenbar auch gerade aufgefallen, denn jetzt blickte er sich verwirrt um. »Äh, na ja«, meinte er schließlich, »dann lasst es uns mal tot machen.« Niemand reagierte, alle blickten ihn erwartungsvoll an. »Ähem!«, räusperte er sich, sah auf das bibbernde Fellknäuel, ging einen Schritt näher heran und inspizierte es noch einmal eingehender.
Dann kam ihm die erlösende Idee. »Jens, mach du mal«, entschied er souverän, ganz der Boss, der eine Aufgabe auch mal delegieren kann. Jens war entsetzt: »Ich? Wieso das denn?«
»Ey, ich kann doch nicht immer alles machen! Erst heute morgen noch habe ich die Spacken aus der 4b von unserem Tisch im Frühstückssaal vertrieben, jetzt bist du halt mal dran!« »Aber ...«, Jens’ Blick wurde panisch.
»Trauste dich nicht, oder was?«, setzte Gregor noch einen drauf. Kurz irrlichterte Jens’ Lichtkegel zwischen dem Karnickel und Gregors zu einer hämisch grinsenden Fratze verzogenem Gesicht hin und her – natürlich, er wollte kein Feigling sein. Aber um welchen Preis? Vielleicht würde er sich morgen zu den Spacken aus der 4b setzen müssen, aber nach einem weiteren Blick auf das Kaninchen schien ihm das wohl die preiswertere Lösung. »Was jetzt? Biste zu feige? Trauste dich nicht?«, wiederholte Gregor, und mit der festen Stimme dessen, der sich entschlossen hatte, sein Schicksal anzunehmen, sagte Jens einfach nur: »Ja.« Gregor lachte spöttisch auf, »Feigling!«, zischte er, er wähnte sich noch auf der sicheren Seite, »dann mal los, wer von euch will?«, trieb er die Mutprobe weiter voran.
Aber er hatte zu hoch gepokert, einer nach dem anderen gaben wir es zu: Ja, wir waren zu feige. Wir trauten uns nicht. Ganz allmählich ging Gregor auf, was das bedeutete. Aus der Nummer kam er so nicht wieder heraus. Ein Rückzug in Würde war für ihn nicht mehr möglich. Alles lag auf dem Tisch: Die von ihm selbst erhobene moralische Forderung, das Tier zu töten, ebenso wie sein Verdikt, sich als Feigling zu outen, wenn man dies nicht selbst zu erledigen vermochte. Wir hatten alle etwas von unserem Gesicht verloren, aber für Gregor ging es um die ganze Fresse, von der Schmach würde er sich so schnell nicht wieder erholen. Er atmete tief durch. »Also gut«, knurrte er, und wir erschraken fast ein bisschen. Dann ließ er den Lichtkegel seiner Lampe über den Boden tanzen, bis er plötzlich auf einem großen Ast zur Ruhe kam. Nun ja, eher ein Ästchen. Wie gesagt, ein Heidegebiet, die Vegetation beschränkte sich auf einige größere und viele sehr kleine Büsche. Gregor bückte sich nach dem Stock. »Du willst doch nicht ...«, stieß Jens noch aus, da ging das brüchige Holz schon auf das Kaninchen nieder. Das Tier erschrak und taumelte zwei, drei Schritte auf Gregor zu. Der schrie entsetzt auf und machte einen gewaltigen Satz nach hinten, als sei ein gefährliches Raubtier auf ihn zugestürmt. Wir kicherten etwas, seine panische Flucht vor einem blinden, sterbenden Kaninchen wirkte dann doch nicht so richtig souverän. Ein Fehler, denn nun fühlte er sich wohl endgültig in seiner Ehre herausgefordert, hob den Ast an und ließ ihn mit aller Kraft mehrfach auf das hilflose Tierchen niedergehen. Das kauerte sich nur noch mehr zusammen, ein Schlag hinterließ eine blutende Wunde, dann brach der Ast endgültig, und das Kaninchen war unzweifelhaft noch lebendig. »Verdammt ...«, flüsterte der merklich erbleichte Gregor, »verdammt, lasst uns abhauen. Das ist vielleicht gar kein normales Kaninchen. Das ist vielleicht untot. Man kann es nicht einfach so ... Es ist gekommen, um uns zu holen. Los, schnell weg!« Mir kroch ein Schauer über den Rücken, kurz wollten wir tatsächlich schnell in Richtung des Rettung verheißenden hellen Scheins hinter den Wachholderbüschen zurücklaufen, wo die Jugendherberge sein musste, aber dann siegte eben doch die Vernunft: »Quatsch, Halt!«, rief Jens, »es gibt keine Zombiekaninchen. Und du hast das Tier jetzt erst recht verletzt, schau doch!« Anklagend richtete er den Spot auf die Fleischwunde, die Gregor dem zitternden Fellknäuel zugefügt hatte. Er war es auch, der es aussprach: »Zertreten! Du musst es zertreten! Tritt kräftig auf den Kopf.« Gregor aber begann nun selbst zu zittern, er stand vor dem erbärmlich zugerichteten Tier, er rang mühsam um Fassung.
Dann verlor er sie einfach. Tränen stiegen ihm in die Augen und kullerten seine Wangen herunter. »Ich kann nicht«, flüsterte er wimmernd, »ich kann das einfach nicht«. Diesmal lachte niemand.
»Los, lasst uns abhauen«, verlangte Fridtjof erneut, »das stirbt doch sowieso bald, was haben wir denn damit zu tun, lasst uns einfach schnell abhauen.« »Aber wir können das arme Ding doch nicht einfach so sitzen lassen«, brüllte Jens, schon zunehmend desperat, »jetzt erst recht nicht, guck doch, es blutet, es hat Schmerzen.« Tatsächlich war das Zittern deutlich stärker geworden, es war ein Bild des Jammers.
Ratlos tanzten die Lichtkegel auf dem Boden, bis meiner schließlich über einem fast großen Findling zur Ruhe kam. Er strahlte unwirklich hell wider im Schein der Lampe. Er leuchtete geradezu, als wollte er uns etwas sagen. Wir verstanden ihn.
»Wenn wir alle anfassen, könnte es klappen«, meinte Jens. Fritjof sah ihn entsetzt an: »Das meinst du doch nicht ernst, oder?« Niemand antwortete.
Tatsächlich gelang es uns mühsam, den Stein anzuheben. Mit verzweifelter Kraft wuchteten wir ihn die paar Meter zum Kaninchen herüber, jetzt noch einmal alle Kraft zusammennehmen, um wenigstens ein bisschen Fallhöhe zu erreichen, mit vor Anstrengung und Ekel verzerrten Gesichtern schafften wir es, das Ding vielleicht einen Meter über das Tier zu stemmen, dann ließen wir los – botsch. Es war merkwürdig leise, ein gedämpfter, dumpfer Aufprall, eher war die Erschütterung des Sandbodens zu spüren, als dass man etwas hörte. Aber so riesig, wie er uns schien, war der Stein dann wohl doch nicht gewesen. Das hintere Drittel des Kaninchens guckte noch darunter hervor. Das kleine Schwänzchen zuckte ein bisschen auf und ab, Gregor heulte nun hemmungslos, aber die Bewegungen des Schwanzes wurden sichtbar schwächer. Die Blume, ging es mir sinnlos durch den Kopf, in der Jägersprache heißt der Schwanz von Hasen Blume, und diese hier verblühte, ein bisschen wackelte sie noch. »Das sind nur die Reflexe«, versuchte ich uns zu beruhigen, der Sand an dieser Seite des Steins färbte sich rot. Erstaunlich unspektakulär eigentlich, dachte ich. Dann drehten wir die Taschenlampen weg.
»Gut, wir haben es geschafft«, sagte Jens, »das Tier ist erlöst! Wir haben es gerettet!« Aber Jubelstimmung kam so recht nicht auf. Betreten schlichen wir Richtung Jugendherberge. Immer wieder versicherten wir uns unterwegs gegenseitig, dass es das einzig Richtige war, das arme Tier von seinen Leiden zu erlösen, dass das verdammt noch mal eine wirklich gute Tat war, dass wir stolz auf uns sein konnten. Einzig – es fühlte sich einfach nicht so an. Wir stahlen uns zurück in das Gebäude und gelangten unentdeckt in unseren Schlafsaal, wo wir uns, jeder für sich, in unsere Betten kauerten.
Ich träumte von einem riesigen Hasen, der erst Gregor, dann Jens und Fritjof mit einem großen Felsen zermatscht hatte und der nun hinter mir hersprang und mir immer ein bisschen Vorsprung ließ, bevor er mit einem Satz wieder direkt hinter mir war. Ich fuhr mehrmals in der Nacht nassgeschwitzt hoch. Einmal hörte ich Gregor leise wimmern. Aber, soweit ich das im fahlen Licht der durch die Fenster dringenden Morgendämmerung erkennen konnte, lag er nur unter seiner Decke, nicht unter einem Felsbrocken.
Zum Frühstück setzten wir uns widerspruchslos zu den Spacken aus der 4b. Wir waren sehr schweigsam.
Meine geistig-moralische Wende
Mein Freund Ralf stammte aus einem stramm konservativen Haus, wie eigentlich fast alle meine Mitschüler und auch ich selbst. So war das eben, in den Achtzigern, in einem Vorort der schwarzen westfälischen Metropole Münster. Als 1982 die sozial-liberale Koalition zerbrach, standen wir am Beginn der Pubertät. Unser politisches Bewusstsein war noch äußerst begrenzt und beschränkte sich im Wesentlichen darauf, dass wir CDU waren, weil unsere Eltern auch CDU waren, und jeder in Münster war eigentlich CDU. Bis auf die ganz Wilden. Da waren manche auch SPD. Angeblich. Wir kannten aber niemand von diesen verruchten Typen. Es waren vermutlich dieselben, vor denen uns unsere Eltern immer eindringlich warnten, wenn sie sagten, wir dürften auf keinen Fall mit fremden Leuten mitgehen.
Erster Oktober 1982. In der Schule und in den Elternhäusern bekamen wir natürlich mit, dass sich da etwas Großes anbahnte. Die Aufregung übertrug sich auch auf uns, obwohl wir keinen blassen Schimmer von unechten Vertrauensfragen und Koalitionswechseln hatten. Aber, und noch heute bin ich etwas fassungslos, bei so etwas mitgemacht zu haben, Ralf rief anlässlich des Tags des konstruktiven Misstrauensvotums eine Party bei sich aus, denn es galt zu feiern, dass jetzt bald alles gut werde im Land und letztlich in der Welt. Die Probleme, von denen wir zwar keine sehr konkreten Vorstellungen hatten, aber von denen wir ahnten, dass es sie gab, diese Probleme jedenfalls würden jetzt alle gelöst werden.
Und so sahen wir nachmittags live, wie Helmut Schmidt aufrechten Ganges auf den in der ersten Reihe feixenden Helmut Kohl zuging, ihm die Hand gab und zur Wahl zum Bundeskanzler gratulierte, und wie kurz darauf, um 15:12 Uhr, Kohl, vor Zufriedenheit fast platzend, zur Kenntnis gab: »Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.« Wir stießen darauf mit unseren Fanta-Gläsern an, während Ralfs Mutter zur Feier des Tages ein Tablett mit Negerküssen – die hießen damals noch so – ins Zimmer brachte. Ein rauschendes Fest also. So rauschend, dass mit zunehmendem Zuckerpegel im Blut die Hemmschwellen allmählich fielen. In Wirklichkeit, das brachte das Alter mit sich, waren die real existierenden Mädchen doch letztlich erheblich interessanter als das Duell der Helmuts im Fernsehen. Und diese Mädchen fanden wir seit kurzem nicht mehr grundsätzlich blöd wie noch vor den Sommerferien. Deren Gesellschaft war plötzlich irgendwie cool.
Was soll ich lang reden: An jenem Nachmittag geschah es. Es fing unschuldig an, mit einem Negerkuss, der Zuckerschaum an den Lippen von Martina, ihr albernes Kichern, das vorsichtige Streichen mit dem Finger über ihre Lippen, das Ablecken, das scherzhafte »jetzt schmier’ ich dir auch den Mund ein«. Schließlich küssten wir uns. Mit Zunge. Für mich war es das erste Mal. Mit Negerkussschaum auf den Geschmacksknospen und Helmut Kohl auf dem Bildschirm, der etwas von einer »geistig-moralischen Wende« erzählte. Womit er in meinem Fall eindeutig Recht hatte. Unzählige Male musste ich in den nächsten Monaten an diese erregende Situation zurückdenken. Und fortan richtete sich jedes Mal, wenn ich einen Negerkuss aß, mein winziges Glied keck ein wenig auf.
Martina, die wie Ralf in Münster-Amelsbüren wohnte und nicht auf unsere Schule ging, sah ich erst ein halbes Jahr später wieder. Kohl hatte die Sache mit der uneigentlichen Vertrauensfrage durchgezogen, und so standen Neuwahlen an. Erneut lud Ralf zu sich nach Hause, diesmal zum Abend, damit wir bei dem historischen Machtwechsel live dabei sein könnten. Eine echte Wahlparty also. Aber Helmut Kohl interessierte mich inzwischen einen Dreck. Denn Martina war da! Und: Es gab Negerküsse! Prickelnde Erotik lag also in der Luft, denn meine erste gemeinsame Nacht mit Martina stand bevor – ich würde erst um neun abgeholt werden.
Wir saßen vor dem Fernseher, und ich hatte mich im Lauf des Abends allmählich so vorgearbeitet, dass ich pünktlich zur Prognose wieder neben Martina auf dem Sofa saß. Der Balken für die Union kletterte auf unglaubliche 48 %, wir jubelten. Helmut Kohl dankte für das Vertrauen, das ihm die Deutschen entgegengebracht hätten, wir ließen die Negerküsse kreisen. Graf Lambsdorff hinkte durchs Fernsehstudio, Martina biss herzhaft in einen hinein. Meine kühnsten Träume schienen wahr zu werden. Helmut Schmidt zog traurig an seiner Pfeife, wir sogen glücklich an unseren Mündern.
Schließlich zog Martina mich unauffällig in den benachbarten Spielkeller. Wir verkrochen uns hinter einigen Kisten mit Playmobil, die schon lange niemand mehr ausgepackt hatte, und hier, ganz ungestört, knutschten wir weiter. Und weiter. Und weiter. Allmählich legte sich die erste Euphorie bei mir. Dafür wurde mir zunehmend klar, dass ich nicht die geringste Vorstellung davon hatte, wie das hier weitergehen sollte. Die Situation machte mir Angst. Plötzlich zog Martina den Reißverschluss meiner Hose auf. Ich war starr vor Schrecken. Sie wühlte ein bisschen in meiner Hose herum, dann legte sie, sorgfältig wie ein Chirurg bei der Operation, meine kleine Erektion frei. Und sah mich überrascht an. Und lachte laut auf. »Da ist ja noch gar nichts!«, kicherte sie, »du hast ja noch nicht mal Haare!« Auf der Stelle verlagerte sich mein gesamtes Blut in den Kopf, für den Unterleib waren da leider keine Kapazitäten mehr frei. Das kleine Stängelchen schrumpelte in sich zusammen, da half auch nichts, dass ich protestierend darauf hinwies, dass da sehr wohl schon Haare seien: »Hier! Guck doch!«, und ich zog das T-Shirt ein bisschen höher, damit sie freie Sicht hatte auf den zarten, zu allem Überfluss auch noch hellblonden Flaum, auf den ich so stolz gewesen war in den letzten Wochen, aber sie schüttelte nur lachend mit dem Kopf und zog das Schlüpfergummi nach oben, sodass gnädig alles verhüllt wurde.
Dann gingen wir wieder rüber zu den anderen. Um überhaupt irgendwo hinschauen zu können, guckte ich von nun an konzentriert und stier auf den Fernseher und sah direkt in das feiste Gesicht von Helmut Kohl, der sehr glücklich und zufrieden wirkte. Ich konnte den Blick nicht davon lassen, bloß nicht zu den anderen, bloß niemand ins Gesicht gucken, erst recht nicht Martina, und so starrte ich auf Kohl und hing an jeder Bewegung seiner Lippen. Dieses Bild brannte sich für immer unauslöschlich in mein Gedächtnis. Lange Zeit schmeckte ich unweigerlich den penetranten Geschmack von Negerküssen auf meiner Zunge, wenn ich im Fernsehen Helmut Kohl sah. Und der Mann war lange Zeit wirklich oft im Fernsehen.
Schließlich überfällt mich noch heute ein Gefühl tiefer Scham, wenn ich etwas von Negerküssen höre. Weshalb ich ihre Umbenennung sehr begrüße.
Der Soundtrack meiner Jugend
Ahne war genervt. »Was für eine Scheiß-Musik«, schimpfte er.
Ich lauschte eine Weile: da war in der Alten Kantine der Kulturbrauerei wohl von der letzten Achtzigerjahre-Party noch eine CD liegen geblieben, die ein argloser Techniker jetzt vor dem Kantinenlesen eingelegt hatte. Ein Hit nach dem anderen, und irgendwie überkam mich eine angenehm sentimentale Stimmung. Ich ermahnte den zornigen Kollegen: »Sei doch nicht so herzlos. Scheiß-Musik hin oder her – das wurde früher bei uns immer gespielt! Da wird einem doch ganz warm ums Herz!«
Ahne schaute mich ungläubig an: »Dabei wird dir warm ums Herz? Das ist doch furchtbar.«
»Natürlich ist es furchtbar. Aber damals ...«
»Damals war das auch schon furchtbar«, zeigte Ahne sich unerbittlich.
»Ja, schon«, gab ich zu, »aber trotzdem ... Das war er eben, der Soundtrack einer Jugend in den Achtzigern in Westdeutschland. Es geht doch um Erinnerungen. Um Gefühle. Bei Musik geht’s doch immer zuerst um Gefühle!«
»Ich fühle mich aber schlecht, wenn ich solchen Dreck höre«, sagte Ahne. Ach, was wusste der schon. Die hatten im Osten ja schließlich gar keine Musik damals.
Für mich aber sind so viele schöne Erinnerungen mit diesen Hits verbunden. Scheiß drauf, ob die Songs gut sind! Es ist halt unsere Musik! Ich höre ja praktisch nie Radio und auch nie englischsprachige Musik, aber diese Lieder, die kannte ich alle. Weil sie eben damals liefen. Auf den ersten – huch, jetzt kommt ein Wort, bei dem ich sogar ein bisschen zusammenzucke – auf den ersten Feten. Eine Fete, das hieß: ein dunkler Raum. Und: Mädchen.
Ich fand das schrecklich. Die Musik sowieso. Aber die musste halt laufen, wenn man modern war. I am hai-ai-ai-ai-ai on Emotion. Ich dagegen hörte, wenn ich überhaupt was hörte, Reinhard Mey. Eigentlich hörte ich aber gar nichts, Musik interessierte mich überhaupt nicht. Das war mir – ich weiß auch nicht – zu modern. Genau wie die Sache mit den Mädchen. Das war mir auch zu modern.
Also, nicht, dass ich nicht durchaus Sehnsucht nach Annäherungen verspürte, das schon. Aber dass es für die Befriedigung dieses drängenden Bedürfnisses allen Ernstes nötig sein sollte, in einem dunklen Raum herumzuhoppsen und die Arme und Beine seltsam und unkontrolliert zu bewegen, das fand ich inakzeptabel.
Nun wollte ich mich sozial allerdings auch nicht völlig isolieren, also ging ich halt hin zu den Feten. Und suchte mir zielgerichtet die dunkelste Ecke im abgedunkelten Gemeindesaal, setzte mich dort hin und betrachtete missmutig das Geschehen. Wie die anderen zu dieser furchtbaren Musik tanzten. Und dabei rätselhafterweise irgendwie mit den Mädchen in Kontakt kamen. Und, das wusste ich aus den Erzählungen der anderen, dieser Kontakt wurde dann manchmal, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, auf eine Art und Weise fortgesetzt, die mich durchaus interessiert hätte. Aber deswegen wirklich jede Würde aufgeben? Und zu Big in Japan wild mit den Armen in der Mitte des Saals herumschlenkern? Nein! So groß war meine Verzweiflung nun doch wieder nicht. Das würde sich schon auch irgendwie anders ergeben.
Ich saß also in meiner Ecke und nippte Apfelsaft. Wenn sich versehentlich oder aus Mitleid mal einer der Klassenkameraden kurzzeitig dazu gesellte, versuchte ich, meine soziale Inkompatibilität mit ein paar sarkastischen Bemerkungen zu übertünchen. So galt ich bald schon als intellektuell, was mir einen gewissen Respekt in der Hackordnung sicherte. Später entdeckten wir dann den Alkohol für uns, und die Lage entspannte sich etwas. Jetzt musste ich nicht nur einfach so in der Ecke sitzen, sondern konnte dabei trinken. Damals galt es als cool, Bier zu trinken. Und als sehr cool, sehr viel Bier zu trinken. Eine Technik, die ich rasch erlernte und perfektionierte. Zwar konterkarierte ich den Eindruck der Coolness empfindlich mit meiner Kleidung, die nach wie vor ausschließlich meine Mutter für mich aussuchte, und zwar nach den Geschmackskriterien, die bürgerliche Mittfünfziger-Hausfrauen einer gut situierten westdeutschen Vorortsiedlung an die Begriffe »schick« und »jugendlich« anlegten, was ziemlich genau das Gegenteil von dem war, was unter den Jugendlichen derselben Vorortsiedlung als schick und jugendlich galt. In meinem Fall bedeutete das: Cordhose und bunt gestreifter Nicki. Was meine selbstverständlich Jeans tragenden Mitschüler erstaunlicherweise wiederum als Ausdruck meines Intellektuellentums missinterpretierten, erst recht in Kombination mit meiner Verweigerung, beim Tanzvergnügen mitzumachen, was ich wiederum mit immer zynischeren Kommentaren auszugleichen versuchte. Wenn ich heute manchmal gefragt werde, wie man eigentlich dazu kommt, Satiriker zu werden: so geht’s. In der Ecke sitzen, zugucken, trinken – dann läuft es eigentlich ganz von allein.
Andererseits: Sie machten es einem ja auch wirklich nicht schwer. Wenn eine Horde Fünfzehnjähriger mit von tiefem Empfinden gezeichneter Miene und nach oben gereckter Faust über die Tanzfläche hoppelt und dazu grölt: Verdamp lang her, verdamp lang, verdamp lang her. Oder wenn eine Gruppe von Arztsöhnchen und Anwaltstöchtern mit adretten Scheiteln und steifkragigen weißen Hemden unter den V-Ausschnitt-Strick-Pullovern wie in Extase brüllt: Born to be wild. Oder wenn sich am Ende einer Fete alle umfassen, um gleichgeschaltet und mit Tränen der Ergriffenheit in den Augen zu singen: Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt. Bevor dann um neun Uhr abends das Licht angeht und Mutti vor der Tür im Wagen wartet, um den Nachwuchs nach Hause und ins Bett zu bringen. Was könnte man dazu groß sagen, ohne zum Zyniker zu werden?
Wirklich nachvollziehbar wirkte die Begeisterung nur, wenn Herbert Grönemeyer erklang: Kinder an die Macht! Ich war damals schon dankbar, dass kein auch nur halbwegs bei Sinnen stehender Erwachsener diesen Quatsch in die Tat umzusetzen gedachte. Auch bei Männer aus gleichem Hause wirkte das Mitsingen glaubwürdig: Wann ist ein Mann ein Mann? – das dürfte unterm Strich die vielleicht entscheidende Frage für die meisten Jungs gewesen sein, wenn sie morgens vor dem Spiegel ihre Haut, auf der sie so etwas wie die flaumige Ahnung von Bartkeimung ausfindig gemacht zu haben glaubten, wie besessen abschabten, weil irgendwer ihnen erzählt hatte, dass so die Entstehung von nachweisbaren Stoppeln beschleunigt werden könnte. Und Wann ist ein Mann ein Mann? haben sich fraglos auch alle gefragt, die misstrauisch allabendlich den Baufortschritt ihrer Schambehaarung und der Geschlechtsteile beäugten.
Vielleicht deswegen legte sich die allgemeine Grönemeyer-Begeisterung recht bald wieder. Dafür kam Marius Müller-Westernhagen. Während Herbert unter dem Verdacht stand, eher von uncoolen Typen gut gefunden zu werden, galt Marius als total wild und authentisch. Der Mann wurde rasch ein weiterer Grund, warum ich Feten hasste. Denn ganz und gar nicht lächerlich wirkte es, wenn fünfzig Teenager wie im Wahn herumsprangen und -hantierten, dabei wie die Schweine schwitzten und mit vor Verachtung bebender Stimme brüllten: Dicke schwitzen wie die Schweine / Fressen, stopfen in sich rin. / Dicke, Dicke, Dicke, Dicke – na du fette Sau?
Das war für mich als jemand, der dem Sujet des Liedes unangenehm nahekam, ohne jede Frage eine unangenehme Situation. Natürlich war das irgendwie anders gemeint, das war mir damals schon klar, irgendwas mit Vorurteilen vorführen und so – aber so oder so rückte der Song unweigerlich meine Statur ins Rampenlicht, und das gefiel mir schon mal gar nicht. Und erst recht gefiel mir nicht, dass die Situation mich zwang, mich aus meiner Ecke begeben und mithopsen zu müssen. Denn es war ja ohnehin klar, dass alle bei dem Lied an mich denken würden, und wenn ich dann sauertöpfisch in der Ecke sitzen bleiben würde, könnte ich Bier trinken und intellektuelle Sprüche klopfen, so viel ich wollte, es würde meinen sozialen Status nicht mehr retten. Sie hätten mir meine Souveränität nicht abgekauft, intellektuelle Textexegese hin, Vorurteile vorführen her. In dem Moment war ich einfach der Dicke. Was blieb mir also übrig? Also Angriff.
Ungelenk, unrhythmisch und übellaunig sprang ich also in die Menge hinein und kam mir dabei vor wie eines dieser Barbapapa-Männchen, nur dass ich hier nicht süßlich-klebrig von heiler Welt säuselte, sondern mit der Menge schrie: Dicke müssen ständig fasten / damit sie nicht noch dicker werden / und ham sie endlich zehn Pfund abgenommen / ja dann kann man es noch nicht mal sehn, und wie einer dieser furchtbaren Hüpfbälle, auf denen wir immer durch die Turnhalle hopsen mussten, schlug ich eine Schneise durch meine zunehmend etwas verängstigten Mitschüler, die auch nicht so recht wussten, was sie von der Situation nun halten sollten. Aber ich sprang enthemmt durch den Saal und brüllte jedem, der sich nicht schnell genug wegducken konnte, hysterisch ins Ohr: Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin! Denn Dicksein ist ne Quälerei! Ich fühlte mich unwohl, aber ich wusste, ich musste es durchziehen. Ich bin froh, dass ich so’n dünner Hering bin / denn dünn bedeutet frei zu sein, schrie ich den verunsicherten Mitschülern ins Gesicht und bewegte mich dazu so energisch wie im Sportunterricht der gesamten Mittelstufe nicht, Dicke ham’s so schrecklich schwer mit Frauen / Denn Dicke sind nicht angesagt / drum müssen Dicke auch Karriere machen / Mit Kohle ist man auch als Dicker gefragt, blaffte ich den Mädchen ins Gesicht, mein Gesichtsausdruck bekam etwas Wahnhaftes, ich donnerte weiter wie eine Abrissbirne von einer Seite des Gemeindesaals zur nächsten, meine Mitschüler brachten sich zunehmend in Sicherheit. Als der beschissene Song endlich zu Ende war, sahen mich alle ein wenig furchtsam, aber auch erkennbar respektvoll an.