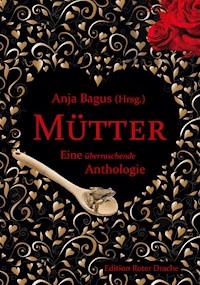Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SALAX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
SM-Schneewittchen, sieben tapfere LARP-Zwerge und vierzig Morde Es war einmal ein Mädchen mit Haut, so weiß, wie Schnee, Lippen, so rot wie Blut, Haaren, schwarz wie Ebenholz … und einer ausgeprägten Vorliebe für BDSM. Und da gab es einen Jäger … der dieses Mädchen über alles liebte … zum Glück ebenfalls mit einer ausgeprägten Vorliebe für BDSM und reichlich Erfahrung … zumindest theoretisch, erworben am heimischen PC Außerdem waren da eine Königin, ein Serienkiller, der obligatorische Glassarg und jede Menge Phobien in einem Berliner Souterrain… Und es war einmal eine Autorin namens Luci van Org, die daraus eine Geschichte machte. Ganz oft zum Lachen. Und manchmal auch zum Weinen. Etwaige Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit gewissen anderen, lebenden oder toten Personen aus einer gewissen anderen Geschichte waren dabei selbstverständlich nicht beabsichtigt und wären rein zufällig Spieglein, Spieglein an der Wand, welches ist das fesselndste Märchen im ganzen Land?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage September 2015
Titelbild: Schrift by Ingo Römling, www.monozelle.de, Wappen by Timo Peter, www.tpgrafik.de©opyright by Luci van Org und U-line
Ebook-Erstellung: nimatypografik
ISBN: 978-3-944154-33-6
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder
eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlags gestattet.
Möchtest Du über unsere Neuheiten auf dem Laufenden bleiben? Oder möchtest Du uns sagen, wie Dir das Buch gefallen hat? Sende uns eine Email an [email protected]. Wir freuen uns!
U-line UG (haftungsbeschränkt)
Neudorf 6 | 64756 Mossautal
www.u-line-verlag.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 1
ARS NECCANDI
Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da beschloss Prof. Dr. phil. Maximilian Enders, sein Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin heute Institut sein zu lassen und lieber eine Flasche Schnaps zu trinken.
So, wie er es jeden Morgen tat.
Weswegen seine Vorlesungen seit vielen Jahren auch ausschließlich nachmittags stattfanden. Erst dann war des Professors Alkoholpegel hoch genug, ihm über die allgegenwärtige Leere seiner Existenz hinwegzuhelfen.
Forschungsaufträge, Preise oder paarungswillige Studentinnen der unteren Semester vermochten diese nämlich nicht zu füllen. Ebenso wenig, wie die Hingabe seiner treuen Ehefrau Clara. Die hatte ihm zwar Maél, den gemeinsamen Sohn geboren, im Zuge dieser selbstlosen Tat nicht nur ihren Studienabschluss in Slawistik, sondern auch ihre perfekte Figur geopfert und dafür Zuneigung und Dankbarkeit erwartet, solche aber nie erhalten. Stattdessen durfte Clara seit Maéls Geburt lediglich den Haushalt führen, das Kind versorgen und es von seinem Vater fernhalten, weil der Kleine bei dessen Studien nur störte.
Schlafen wollte Prof. Dr. phil. Enders mit seiner Frau nicht mehr. Weil er sich vor ihren schlaffen Brüsten ekelte und lieber mehrmals pro Woche sehr junge Frauen, mal allein, mal in kleinen Gruppen, zur privaten Studienberatung in sein Arbeitszimmer einlud. Mit freundlichem Lächeln ließ Clara diese dann persönlich in die große Professorenvilla und verabschiedete sie auch selbst wieder – oft schon nach anderthalb Stunden, manchmal auch erst nach ein paar Tagen, aber immer, ohne weitere Fragen zu stellen.
Der kleine Maél, ein ausnehmend aufgeweckter Junge, tat es seiner Mutter schon bald gleich. Er lächelte höflich und stellte keine Fragen, ganz egal, wie seltsam es hinter des Vaters Arbeitszimmertür auch kicherte, stöhnte und rumpelte. Wofür ihm seine Mutter dankbar war. Weil es ihr so leichter fiel selbst zu lächeln.
Eines eisigen Januarmorgens im Jahr 1981, Maél war mittlerweile zehn Jahre alt, lächelte der Junge ebenfalls, gleich mehrere Stunden hintereinander. Er lächelte erst still für sich, oben in seinem Kinderzimmer und noch immer, als er mit seiner Mutter frühstückte. Er lächelte, während die treue Clara das Paket mit den Pausenbroten in seinem Schulranzen verstaute und auch noch, als er beim Verlassen des Hauses am Arbeitszimmer vorbeiging. Wie üblich flüsterte ihm seine Mutter dabei ein zärtliches «Psst...! Papa braucht Ruhe...!», ins Ohr, woraufhin der Junge sogar noch ein wenig breiter lächelte.
Wusste Maél doch als einziger, dass Prof. Dr. phil. Maximilian Enders seit heute früh um 3:23 Uhr überhaupt gar keine Ruhe mehr brauchte.
Er hatte sie ja schon. Im Überfluss!
Um 3:19 Uhr war Maéls Vater nämlich auf der Liege seines Arbeitszimmers von starken Kopfschmerzen geweckt worden. Was ihn zunächst nicht sonderlich beunruhigte. Ihm tat häufig nachts irgendetwas weh und auch der Ort seines Erwachens war keinesfalls außergewöhnlich, schlief Prof. Dr. phil. Enders doch seit über einem Jahrzehnt in seiner Studierstube im Erdgeschoss.
Clara dagegen nächtigte in der linken Dachkammer. Nur dort oben hatte man nämlich halbwegs Ruhe vor dem Rumpeln, Stöhnen und Kichern aus dem Arbeitszimmer. Weshalb Maél auch die rechte Dachkammer bewohnte, obwohl es in den unteren Stockwerken jede Menge geräumiger, heller Zimmer gab, und so statt der Ferkeleien seines Vaters Abend für Abend mit anhören musste, wie seine Mutter sich in den Schlaf wimmerte oder heulte. Manchmal brüllte sie auch, warf Vasen oder den Radiowecker gegen die dünne Gipswand und behaupte am nächsten Morgen, Maél hätte das alles nur geträumt.
In der Nacht, als Prof. Dr. phil. Enders um 03:19 Uhr mit Kopfschmerzen erwachte, beunruhigte ihn schließlich aber doch etwas. Nämlich, dass es, als er den Schalter seiner Leselampe ertastete und diesen betätigte, völlig dunkel blieb. So dunkel, wie es doch eigentlich gar nicht sein konnte, in einem Raum ohne Gardinen.
Irritiert blickte der Professor hierhin und dorthin, suchte nach dem Licht der Straßenlaterne ganz hinten am Ende des großen Gartens oder den Reflektionen eines Autoscheinwerfers. Doch es blieb schwarz vor seinen Augen.
Während sich dahinter plötzlich alles zu drehen begann!
Sein Wissen um sämtliche Fein- und Besonderheiten der Komparatistik kreisten um den Gedanken an die zuletzt geleerte Flasche Birnenbrand, dazwischen trieselten und taumelten allerlei hypochondrische Ängste, jahrzehntelang gepäppelte Neurosen und gierige Sexfantasien mit den weiblichen Neuzugängen des Wintersemesters. Schneller und schneller, wilder und wilder raste alles im Kreis und dem Professor wurde übler und übler. Denn nirgendwo fanden seine Augen irgendeinen Halt, weil es da nichts als Dunkelheit gab. Nur plötzlich dann die eine, entsetzliche Erkenntnis:
Was, wenn gar nicht alles dunkel war, sondern er – blind?!
Übermannt von Grauen entfuhr dem Professor ein Hilfeschrei.
Genau in dem Moment, als sein Magen vor der Übelkeit kapitulierte, weswegen sein Schrei auch gleich wieder erstickte.
Am Erbrochenen. So, wie auch Prof. Dr. Phil. Maximilian Enders einige Augenblicke später.
Zuvor hatte er sich die restlichen Sekunden seines Lebens mit verzweifeltem Röcheln, Husten und Zucken vertrieben und dabei die Kotze noch ein wenig auf Kopfkissen und Bettdecke verteilt.
Und der kleine Maél hatte ihm dabei zugesehen.
Erst versteckt hinter dem großen Eichenschreibtisch, dann, als dem Jungen klar wurde, dass der Professor ihn nicht sah, am Kopfende des väterlichen Bettes. Gelöst und sehr interessiert beobachtend, wie der teigige Körper seines Erzeugers sich aufbäumte im Todeskampf.
Bis Prof. Dr. phil. Enders schließlich aufgab, noch einmal zuckte, sich entspannte – und dann ganz langsam verschwand. Wie ein sanft verklingender Ton. Wie ein Schiff, das kleiner und kleiner wurde am Horizont und dann plötzlich nicht mehr zu sehen war.
Zurück blieb nur ein großer, schlaffer Klumpen totes Fleisch, eine leere, langsam erkaltende Hülle – und die Erkenntnis, dass nichts von Dauer war. Kein noch so großes Leid, kein noch so schlimmer Schmerz.
Genau diese Erkenntnis war es, die Maél das Lächeln auf sein rosiges Gesichtchen zauberte. Die machte, dass er sich frei fühlte. Endlich frei. Und mächtig. Unendlich mächtig!
Und, die ihn daran erinnerte, dass er nun bald ein richtiges Kinderzimmer bekommen würde. Im ersten Stock, wo die Decken hoch waren und mit Stuck verziert und wo die Sonne helle Flecken auf die modische Rupfentapete malte.
Ein «tragisches Zusammentreffen unglücklicher Umstände» hatte der Arzt es später genannt. So hatte es auch in Todesanzeige gestanden und Maél hatte darüber noch Jahre später schmunzeln müssen.
Für ihn waren die Umstände schließlich mehr als glücklich gewesen.
Zum einen war der Arzt wegen des vielen Erbrochenen in Prof. Dr. phil. Enders Hals gar nicht darauf gekommen, dass es da noch eine andere Todesursache hätte geben können.
Und – was viel wichtiger war – das widerliche Erzeugerschwein wäre mit großer Wahrscheinlichkeit ohne die Kotze überhaupt gar nicht gestorben, sondern lediglich erblindet.
Zwar hatte Maél die tödliche Dosis Methanol sehr gekonnt in seines Vaters liebstem Urlaubsmitbringsel versteckt. Privat gebrannter Grappa aus der Toskana, abgefüllt in Seltersflaschen. Wann immer Professor Maximilian mit seinen Doktorandinnen nach Florenz geflogen war, für ein Studienwochenende oder eine einwöchige Klausurtagung, hatte er zwei Pullen vom «Wasser des Lebens» als Andenken mitgebracht, sie für gewöhnlich am ersten und zweiten Morgen nach seiner Wiederkehr geleert und genau dies auch vor seinem Tod getan. Nach den üblichen 48 Stunden hatte das gepanschte Gesöff dann auch brav seine Wirkung entfaltet. Doch Maél hatte all den anderen Schnaps nicht bedacht, den der Vater zusätzlich zum Grappa noch in sich hineingeschüttet und der einen Teil des Giftes neutralisiert hatte.
Aber er war damals ja auch erst elf Jahre alt gewesen. Und hatte nicht jedes Genie in diesem Alter noch dazulernen müssen, was seine Kunst betraf?
«Ars Neccandi», die «Kunst des Tötens».
Heute ist Maél Enders ein Picasso, ein Albrecht Dürer, ein Rembrandt seines Fachs.
Kapitel 2
PANZERBAND
Ninas sonst so schneeweißes Antlitz leuchtete barbiepink, beglitzert von winzigen Schweißperlen auf ihrer makellosen Mädchenhaut. Und von den Tränen, die aus den Innenwinkeln ihrer fest zusammengekniffenen, von verlaufener Wimperntusche schwarz beschmierten Augen quollen. In zwei feinen Rinnsalen liefen sie links und rechts an ihrer zierlichen Nase herunter, immer neue Tränen bei jedem Schlag. Wegen des Schmerzes, aber auch wegen des Überdrucks in ihren Atemwegen, weil sie ja die ganze Zeit mit geschlossenen Lippen schreien, wimmern und quieken musste.
Ich war skeptisch gewesen, was die Klebkraft des Panzerbandes anging. Speichel, Schweiß, die Bewegungen ihres Mundes. Aber Nina war brav und hielt still, versuchte nur ein ums andere Mal durch ihre geblähten Nasenflügel Luft zu holen, hilflos schnaufend und bisweilen versehentlich grunzend wie ein kleines Ferkel – ein prächtiger Kontrast zu ihren so anmutigen, bis in die letzte Brauenspitze perfekt ausgewogenen Zügen.
Einmal, zweimal, dreimal ließ ich die Gerte in der Luft zischen. Einmal, zweimal, dreimal zuckte ihr ganzer Körper vor Angst. So heftig, dass ich begann, mich um die Heizungsrohre zu sorgen. Mit fast einer Viertelrolle schwarzem Gewebeband hatte ich Ninas zarte Handgelenke dort befestigt. So sorgfältig, dass im Zweifel wohl eher die Leitungen, als ihre Fesseln nachgegeben hätten.
Sicherheitshalber behielt ich deshalb die Rohre im Auge, als ich die Gerte erneut mit voller Wucht auf ihren Hintern niederfahren ließ. Schrilles Quieken hinter dem Panzerbandknebel, Nina zerrte und rüttelte an den Klebestreifen, so heftig, als würde sie lieber auseinanderreißen wollen, als die Schmerzen weiter ertragen zu müssen.
Aber die Heizungsrohre hielten.
Genüsslich wanderte mein Blick über ihre vor Anstrengung zitternden, nackten Schenkel. Zu tief zum Stehen und zu hoch zum Knien hatte ich sie festgemacht. Ohne Chance, eine auch nur halbwegs bequeme Position einzunehmen – außer diese eine mit weit gespreizten Beinen und im Hohlkreuz nach hinten gedrückten Arschbacken.
Auf der rechten, wo eben die Gerte niedergegangen war, erblühte jetzt eine feine, rosenholzfarben puckernde Linie, der man förmlich ansehen konnte, wie viel Schmerz sie ihrer Trägerin bereitete. Bis das Brennen in ein paar Minuten nachlassen und die Pracht sich in das bordeauxrote Gittermuster auf ihrem Hintern einfügen würde, das unser Zusammensein bereits hinterlassen hatte.
Einen Moment hielt ich inne, betrachtete Ninas prachtvoll geschmückte Kehrseite, bettete jeden Quadratzentimeter des himmlischen Bildes behutsam in die Schatzkammer meiner schönsten Erinnerungen. Dann strich ich sachte mit den Fingern darüber.
Erneut jaulte Nina vor Schmerz auf. Weil ihre Haut schon so wund war. Und, weil ich gleich darauf ohne Vorwarnung mit meiner Hand von hinten zwischen ihre nackten Beine fuhr. Derb wühlte ich mich zur empfindlichsten Stelle, rieb dort mit meinem Mittelfinger, erbarmungslos grob, so fest es ging. Nina versuchte mir auszuweichen, begann hilflos quiekend auf meiner Hand zu zappeln, wie ein Lachs bei der Wanderung. Woraufhin ich meinen Daumen tief in sie hineindrückte, mit dem Rest der Hand fest zupackte und sie noch kräftiger bearbeitete. Verzweifelt rüttelte Nina an den Heizungsrohren, wand sich, schnaufte, grunzte, heulte vollkommen aufgelöst mit ihren zugeklebten Lippen und mein linker Arm wurde taub von der Anstrengung.
Zur Belohnung fing es nun aber zu schmatzen an aus ihrem Schritt bei jeder Bewegung meiner Hand. Immer glitschiger wurde es dort unten und fast zum Platzen prall. Ich nahm Zeige- und Ringfinger zu Hilfe, um Halt zu finden, machte noch mehr Druck. Kreischen durch das Panzerband, beinahe ohne Unterbrechung. Wie rasend warf Nina ihren Kopf hin und her, vor Lust wie von Sinnen.
Als es an der Zimmertür klopfte.
Vor Schreck rutschte ich ab und aus ihr heraus. Rauschen in meinem Kopf, verschwommen und weit weg Ninas verheulte Smaragdaugen, hilflos und mit vor Geilheit riesigen Pupillen. «Wassn...? Hallo? », entfuhr mir ein hormonbedröhntes Nuscheln Richtung Tür.
Verdammte Hacke! Noch nie, wirklich noch nie hatte ich mich so peinlich ertappt gefühlt.
Und mich genau dafür gleichzeitig so sehr geschämt.
Weil doch eigentlich nichts dabei war! Weil zwei volljährige Menschen nachts um Halbeins in einem abgeschlossenen Zimmer doch miteinander tun konnten, was sie wollten, solange es einvernehmlich geschah! Und weil es mir doch völlig egal sein konnte, ob sieben kontaktgehemmte, in mannigfaltigster Weise therapiebedürftige Vollnerds Nina und mich ab jetzt fälschlicherweise für gestörter hielten, als sich selbst.
Es war mir aber nicht egal.
Wie zum Beweis ließ die böse Tante Angst mein Herz pochen, dass es wehtat und schnürte mir die staubtrockene Kehle zu. Nein, da gab es nichts zu leugnen – ich, Ivo-Alexander Jäger, war nicht nur ein Aufschneider und Lügner, ich war auch ein verdammter Feigling!
Erneutes Klopfen, lauter und nachdrücklicher.
«Was deeenn?», immerhin klang ich jetzt ebenfalls etwas lauter und nachdrücklicher.
«Da kommen komische Geräusche aus der Heizung!», beschwerte sich ein ebenso betonungslos, wie vorwurfsvoll quakendes Organ. Ragrund, der Obergestörte höchstselbst! Ich hätte es mir denken können. Sicher hatte er noch gar nicht geschlafen, sondern bis jetzt programmiert.
«So ein... Schubbern. Und irgendwas grunzt und quietscht.»
«Wir... m...machn nur... bisschen Sport!»
Super, Ivo! Da hatten die Hormone also nicht nur deine Zunge, sondern auch gleich dein Gehirn teilweise gelähmt und Nina fing an zu kichern hinter ihrem Panzerband. Wie beschissen konnte das alles eigentlich noch werden?!
«Seid ihr sicher?», hakte Ragrund nach, «was, wenn der Heizkessel kaputt ist? So Dinger explodieren schon mal und dann sind alle tot! Alle im ganzen Haus!»
«Es ist nix! Geh zurück in dein Zimmer!»
«Darf... darf ich reinkommen? Nur... ganz kurz?»
«Nein, Mann!», knurrte ich Richtung Tür. Erstaunlich genervt und abweisend. Und gleich darauf mit grässlich schlechtem Gewissen. Denn so sehr Ragrund allen auf den Geist ging und dringend eine Therapie brauchte, er war mein Freund. Und ich musste ihm dankbar sein! So was von dankbar!
«Is... nichts gegen dich! Das passt einfach... gerade nicht so!», lenkte ich deshalb ein.
«O.K.! Dann warte ich hier bis es passt. Passt es so in fünf Minuten?»
Ausgelassenes Glucksen hinter dem Panzerband; als würden dort dicke Gasblasen in Sumpfwasser zerplatzen.
Tief atmete ich gegen das in mir aufkommende Verlangen an, jetzt sofort die Tür zu öffnen und Ragrunds käsig-schlaffen Grottenolmkörper in seinen hässlichen Trekkinghosen und überteuerten Comicladen- Hoodies über mein Knie zu legen. Um ihm dann, mithilfe meiner an der Heizung geparkten Reitgerte, beizubringen, was die Nichtbeachtung des Sachverhalts «Du störst!», im ungünstigsten Fall für Konsequenzen haben konnte!
Doch Nina hatte momentan keinen anderen Ort. Und wir beide zusammen auch nicht. Mal abgesehen von dem winzigen Kinderzimmer bei meinen Großeltern zwei Stockwerke weiter oben, das ich nach der Trennung von Rosie wieder bezogen hatte. Dort gab es dieselben Heizungsrohre, und Oma brachte unangemeldet Kakao und Kekse.
Dann lieber die Nerds.
Weshalb ich mich nun schweren Herzens bemühte, alle Wut auf Ragrund in einem Meer süßer Dankesgedanken zu ertränken. Wer sich ein Vierteljahr lang keine neue Bleibe sucht, hat nichts anders verdient, Ivo! Schluss für heute, Setzen, Sechs! Morgen war auch noch eine Nacht.
Der Klebestreifenschmuck über Ninas Mund hatte aber anscheinend andere Pläne. Als ich ihn nämlich aufforderte, der zarten Haut meiner Angebeteten Lebewohl zu sagen, weigerte er sich hartnäckig und nahm beim Dranziehen Ninas Oberlippe mit.
Derartig unsanft, dass die Saphirmurmeln nun ziemlich erschrocken aussahen. Und dass mir, der ich vorhin vollmundig versichert hatte, das Zeug ginge völlig problemlos wieder ab, einmal aufs Neue die hochnotpeinliche Knallröte ins Gesicht schoss. «T...tut mir leid! Das... klebt sonst nie so doll», stammelte ich, hassenswert unsicher, knibbelte nacheinander an allen vier Ecken herum, bekam Haut und Klebstoff aber nirgendwo voneinander los. Und jetzt?
Das hast du nun davon, Ivo, du verfluchter Schwindler!
Noch vor zwei Wochen hast du dich nicht einmal zum Psychologen getraut, so peinlich waren Dir deine abartige Sehnsüchte. Vor Deinen Kollegen hast du die schlimmsten aller vorpubertären 50 Shades of Grey- Witze gerissen und jetzt, keine zehn Tage später, gibst du hier im Zuge deiner BDSM- technischen Überraschungsentjungferung plötzlich den abgeklärten Superdom? Glaubst du echt, dass du damit durchkommst, du naiver Volltrottel? Ohne das geringste Bisschen Erfahrung? Du verdammter Stümper, du Hochstapler, du dreckiger Betrüger?
Aber welcher Mann hätte denn nicht seine Chance genutzt an meiner Stelle?
Genau fünf Tage war das Ganze jetzt her und noch immer konnte ich es kaum fassen:
Nina Witte, ewig unerreichbare Tochter meiner Chefin Regina Witte und seit Jahren funkelndes Zentrum aller meiner ebenso verzweifelten, wie hoffnungslosen Wunschträume, hatte ausgerechnet mir plötzlich ihre intimsten sexuellen Sehnsüchte offenbart. Ausgerechnet mir!
In einem ausgewachsenen MDMA- Laberflash zwar, dessen Dauer mich kräftemäßig etwas überfordert hatte.
Aber was waren sechs Stunden Herumstehen auf einer Verkehrsinsel gegen diesen Einblick ins Seelenleben meiner Traumfrau? Zumal mir mit jedem Wort aus Ninas umwerfend schönem Mund immer wärmer geworden war. Weil ihre Fantasien von Schmerz und Unterwerfung wie ein Schlüssel ins Schloss zu den meinen gepasst hatten – mit der einzigen Einschränkung, dass sie um Längen schärfer gewesen waren als alles, was ich mir selbst je hätte ausdenken können.
Mal ehrlich, welcher Mann wäre denn da nicht zumindest ein bisschen kreativ mit der Wahrheit umgegangen? Wer hätte nicht angeboten, dem Mädchen aller Mädchen bei der Erfüllung ihrer Sehnsüchte behilflich zu sein – wo man doch, ganz zufällig, über jede Menge entsprechende Erfahrung verfügte...?
Die ich – ich gebe es ja zu – bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich durch Konsum von BDSM-Internetpornos erworben hatte.
Durch jahrelangen Konsum unzähliger BDSM- Internetpornos, immerhin! Und schon lange vor «50 Shades of Grey», damit das mal klar war!
Zu meiner Verteidigung möchte ich außerdem anführen, dass ich mir bei jeder, wirklich bei jeder der in süßem Schmerz von Orgasmen geschüttelten Darstellerinnen vorgestellt hatte, es wäre in Wahrheit Nina gewesen! Bei jeder! Ich schwöre, Alter!