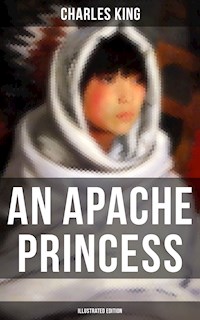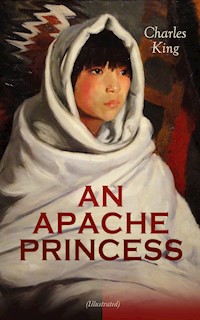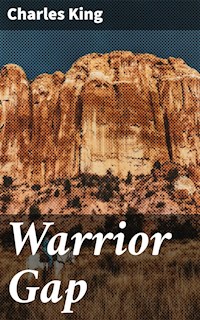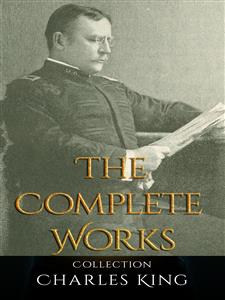Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Race, Sex, Gender: Die erstaunlichen Hintergründe für die Diskussion unserer Gegenwart und der Beginn der modernen Anthropologie um Franz Boas, Margaret Mead und Claud Lévi-Strauss
Race, Sex, Gender: Mit diesen Begriffen wird heute gegen Diskriminierung gekämpft. Dass die Biologie den Menschen nicht auf eine bestimmte Rolle festlegt und keine Kultur anderen überlegen ist, erkannte freilich schon eine rebellische Gruppe junger Wissenschaftler um den Ethnologen Franz Boas (1858–1942). Ihre Forschungen widerlegten die Lehren der Rassekundler. Boas selbst unternahm schon früh eine Expedition in die Arktis, erforschte Eskimos und Indianer. Als Professor in New York begründete er die moderne Anthropologie: Margaret Mead und Claude Lévi-Strauss verehrten ihn als Lehrer, die Nationalsozialisten verbrannten seine Bücher. Boas und sein Kreis begründeten ein Menschenbild, für das wir noch heute kämpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Race, Sex und Gender: Mit diesen Begriffen wird heute gegen Diskriminierung aller Art gekämpft. Dass die Biologie den Menschen nicht auf eine bestimmte Rolle festlegt und keine Kultur anderen überlegen ist, erkannte freilich schon eine rebellische Gruppe junger Wissenschaftler um den Ethnologen Franz Boas (1858–1942). Ihre Forschungen widerlegten die Lehren der Rassekundler. In Minden geboren, organisierte Franz Boas gleich nach dem Studium eine Expedition in die Arktis, später erforschte er die Ureinwohner der kanadischen Küste und Amerikas. Als Professor in New York begründete er die moderne Anthropologie: Margaret Mead und Claude Lévi-Strauss verehrten ihn als Lehrer, die Nationalsozialisten verbrannten seine Bücher. Franz Boas und sein Kreis begründeten ein universales Menschenbild, für das wir noch heute kämpfen müssen.
Charles King
Schule der Rebellen
Wie ein Kreis verwegener Anthropologen Race, Sex und Gender erfand
Aus dem Englischen von Nikolaus de Palézieux
Carl Hanser Verlag
Für Maggie, wen sonst?
Ich will nicht behaupten, daß meine Gedankengänge zu irgendeinem Thema universelle Gültigkeit besitzen, aber ich habe sehr vielfältige Erfahrungen gemacht, schöne und bittere, und für mich sind sie in Ordnung … Mit einer Wolkenkrone um den Kopf und zuckenden Blitzen zwischen den Fingern bin ich durch Stürme gegangen. Die Götter der oberen Lüfte haben meinen Augen ihr Antlitz gezeigt.
Zora Neale Hurston, Anthropologin, 1942
Eine neue wissenschaftlicheWahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.
Max Planck, Physiker, 1948
Inhalt
1 Weit weg
2 Baffin Island
3 »Alles dreht sich um Individualität«
4 Wissenschaft und Zirkus
5 Headhunter
6 Ein amerikanisches Imperium
7 »Ein Mädchen so zerbrechlich wie Margaret«
8 Kindheit und Jugend auf Samoa
9 Massen und Berggipfel
10 Indianerland
11 Lebendige Theorie
12 Im Reich der Geister
13 Krieg und Unsinn
14 Zu Hause
ANHANG
Dank
Abkürzungen
Anmerkungen
Bibliografie
Bildnachweis
Register
1 Weit weg
Ende August 1925 erreichte das Dampfschiff Sonoma, ein Dreidecker auf Fahrt von San Francisco nach Sydney, einen Hafen, der durch einen erloschenen Vulkan entstanden war. Die Insel Tutuila war von Dürre versengt, ihre Berghänge aber noch immer voller Avocado-Bäume und blühendem Ingwer. Schwarze Klippen ragten über einem weißen Sandstrand empor. Hinter einer Reihe dürrer Palmen standen offene strohgedeckte Häuser, der Baustil in diesem Teil der pazifischen Inseln, den man Amerikanisch-Samoa nennt.
An Bord der Sonoma befand sich eine 23-jährige Frau aus Pennsylvania. Sie war klein und kräftig gebaut, konnte nicht schwimmen, hatte eine Bindehautentzündung, einen gebrochenen Knöchel und ein chronisches Leiden, das ihren rechten Arm manchmal nutzlos werden ließ. Sie hatte in New York einen Ehemann zurückgelassen und in Chicago ihren Freund und die Zugfahrt quer durch die USA in den Armen einer Frau verbracht. In ihrem Schiffskoffer führte sie Notizbücher wie für Reporter mit sich, eine Schreibmaschine, Abendkleidung und das Foto eines alternden Mannes mit wildem Haar, den sie Papa Franz nannte. Sein Gesicht war von Säbelhieben zerschnitten und durch eine Nervenschädigung entstellt, die durch eine verpfuschte Operation entstanden war.1 Er war es, wegen dem Margaret Mead zu ihrer Reise aufgebrochen war.
Mead hatte ihre Doktorarbeit erst kürzlich unter seiner Leitung abgeschlossen. Sie war eine der ersten Frauen, die den anspruchsvollen Studiengang am Fachbereich für Anthropologie der New Yorker Columbia University durchlaufen hatten. Bis jetzt war ihr Schreiben mehr von Bücherstapeln als vom wahren Leben inspiriert gewesen. Doch Papa Franz – wie Professor Franz Boas, seines Zeichens Leiter des Fachbereichs, von seinen Studenten genannt wurde – hatte sie gedrängt, zu eigener Feldforschung aufzubrechen und nach einem Ort zu suchen, von dem aus sie sich als Anthropologin profilieren konnte. Mit der richtigen Planung und etwas Glück würde ihre Forschung »der erste ernsthafte Versuch werden, in die Geisteshaltungen einer Gruppe innerhalb einer primitiven* Gesellschaft« einzutauchen, sollte er ihr ein paar Monate später schreiben.2 »Ich glaube, dass Ihr Erfolg den Anfang einer neuen Ära in der methodischen Untersuchung von Ureinwohner-Stämmen markieren könnte.«
Jetzt, beim Blick über das Schiffsgeländer, verließ sie der Mut.
Graue Kreuzer, Zerstörer und Versorgungsschiffe blockierten den Hafen. Die Wasseroberfläche glänzte wie ein öliger Regenbogen. Amerikanisch-Samoa und sein Hafen auf Tutuila – Pago Pago – wurden schon seit den 1890er-Jahren von den Vereinigten Staaten kontrolliert. Nur drei Jahre vor Meads Ankunft hatte die Marine die meisten ihrer Schiffe vom Atlantik in den Pazifik verlegt; eine strategische Neuausrichtung, die dem wachsenden Interesse Amerikas an Asien Rechnung trug. Schnell wurden die Inseln zur Station für die Aufnahme von Kohle und zum Reparaturzentrum der reorganisierten Flotte – die zufällig an genau demselben Tag wie Mead in Pago Pago einfuhr. Es war der größte See-Einsatz, seit Theodore Roosevelt noch vor dem Ersten Weltkrieg die Great White Fleet als Demonstration der amerikanischen Seemacht einmal rund um die Erde geschickt hatte.
Flugzeuge dröhnten in der Luft. An Land stotterte ein Dutzend Ford-Militärwagen eine schmale Betonstraße entlang. Im Malae, dem öffentlichen Platz im Zentrum Pago Pagos, hatten die Samoaner einen rasch improvisierten Basar mit Holzschalen, Perlenketten, gewebten Körben, Grasröcken und spielzeuggroßen Kanus aufgebaut. Familien saßen rund um die Wiese und genossen ihr frühes Mittagessen. »Ständig spielt die Band irgendeines Schiffs Ragtime«, würde Mead klagen.3 Unter solchen Umständen konnte man keine primitiven Stämme studieren. Sie nahm sich vor, so schnell wie möglich von Pago Pago wegzukommen.
Ihren Forschungsgegenstand hatte ihr Papa Franz vorgeschlagen. War der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter, dieser Ausbruch der Pubertät, bei dem junge Frauen und Männer gegen ihre Eltern aufbegehrten, das Ergebnis einer rein biologischen Veränderung? Oder war Jugend etwas so Besonderes, weil bestimmte Gesellschaften beschlossen, sie so zu behandeln? Um darüber mehr herauszufinden, durchstreifte Mead während der nächsten Monate die Gebirge und wanderte zu den abgelegenen Dörfern der Inseln. Sie schrieb die Lebensgeschichten von Kindern und Jugendlichen auf und befragte die Erwachsenen nach ihren intimsten Erfahrungen mit Liebe und Sex.
Schon bald kam sie zu dem Schluss, dass in der samoanischen Gesellschaft nur wenige rebellische Jugendliche zu finden waren. Was auch daran liegen musste, dass es nur wenig gab, gegen das diese Jugendlichen hätten rebellieren können. Die sexuellen Normen waren hier fließend. Jungfräulichkeit wurde in der Theorie hochgehalten, galt jedoch in der Praxis wenig. Strikte Treue war unbekannt. Die Lebensweise der Samoaner, schien Mead, war nicht primitiv und rückwärtsgewandt, sondern absolut modern. Es war, als hätten sich die Samoaner bereits mit vielen Werten von Meads Generation angefreundet: der Jugend Amerikas in den 1920er-Jahren, die Partys mit viel Anfassen feierte, schwarzgebrannten Gin trank und Charleston tanzte. Mead würde herauszufinden versuchen, wie die Samoaner es schafften, bei solchem freizügigen Erwachsenwerden alle aggressiv zugeknallten Türen und alle Jugendkriminalität zu vermeiden und ebenso keine Angst vor jenem vermeintlichen Zusammenbruch der Zivilisation zu haben, von dem die Kommentatoren in Amerika regelrecht besessen waren. Wie hatten die Samoaner Teenager ohne die typisch amerikanischen Ängste hervorgebracht?
Aber stimmte das überhaupt? »Wie leid ich es bin, von Sex, Sex, Sex zu reden«, schrieb Mead ihrer engsten Freundin Ruth Benedict nach einigen Monaten bei den Samoanern.4 Sie hatte ganze Notizbücher vollgeschrieben, Karteikarten angelegt und Unmengen ihrer Feldnotizen abgetippt, um sie mit dem Kanu durch die Wellen und über das Riff zum Postboot zu schicken. Sie beobachtete das Kanu voller Furcht vor seinem Kentern, davor, dass mit ihm alles untergehen könnte, das ihre Anwesenheit auf der anderen Seite des Globus rechtfertigte – und auch den einzigen Beweis dafür, dass sie an etwas wie einer Karriere arbeitete. »Ich habe eine Menge schön wichtige Fakten gesammelt«, schrieb sie; und der Sarkasmus troff nur so vom Blatt, denn sie bezweifelte, dass ihre Fakten viel ergeben würden.5 »Es macht mich richtig krank, an meine Zeit und meine Ideen zu denken … Wenn ich nach Hause komme, werde ich mir einen Job bei der U-Bahn suchen und Wechselgeld herausgeben.«6
Sie konnte es damals nicht wissen, doch bei all den Willkommensfesten und beim Fischen im Riff, an schwülen Nachmittagen und im peitschenden Wind von Tropenstürmen befand sich Mead inmitten einer Revolution. Einer Revolution, die mit kritischen Fragen von Philosophie, Religion und Geisteswissenschaften begonnen hatte: Was sind die natürlichen Trennlinien menschlicher Gesellschaften? Ist Moral allgemeingültig? Wie sollen wir mit Menschen umgehen, deren Überzeugungen und Angewohnheiten anders sind als unsere eigenen? Führen würden diese Fragen zu einer radikalen Neubewertung dessen, was es bedeutet, ein soziales Wesen zu sein, und ebenso zu der Erschütterung des Vertrauens in die Überlegenheit unserer eigenen Zivilisation. Auf dem Spiel standen die Konsequenzen einer erstaunlichen Entdeckung: dass unsere entfernten Vorfahren irgendwann in ihrer Entwicklung etwas erfunden hatten, das wir Kultur nennen.
Dieses Buch erzählt von Frauen und Männern, die sich an vorderster Front des größten moralischen Kampfes unserer Zeit sahen: dem Kampf zu beweisen, dass – allen Differenzen von Hautfarbe, Geschlecht, Fähigkeiten oder Gebräuchen zum Trotz – die Menschheit etwas Unteilbares ist. Es erzählt die Geschichte von Weltbürgern in einer Zeit des Nationalismus und der gesellschaftlichen Teilung, aber auch von den Ursprüngen einer Auffassung, die wir heute als modern und aufgeschlossen empfinden. Es erzählt die Vorgeschichte der umwälzenden gesellschaftlichen Bewegungen der letzten hundert Jahre, vom Frauenwahlrecht und den Bürgerrechtsbewegungen bis hin zur sexuellen Revolution und den Kampagnen für die gleichgeschlechtliche Ehe, aber ebenso der Gegenkräfte des Chauvinismus und der Bigotterie.
Aber dieses Buch handelt nicht von Politik, Ethik oder Theologie. Es bietet keine Lektion in Toleranz. Es ist vielmehr eine Geschichte von Wissenschaft und Wissenschaftlern.
Vor etwas mehr als einem Jahrhundert wusste jeder gebildete Mensch, dass die Welt auf eine bestimmte, offensichtliche Weise funktionierte. Die Menschen waren Individuen, aber zugleich Repräsentanten eines bestimmten Typs und damit die Summen je unterschiedlicher Anordnungen von ethnischen, nationalen und sexuellen Merkmalen. Jeder Typus war dazu bestimmt, etwa mehr oder weniger intelligent, faul, regelgebunden oder kriegslüstern zu sein. Politik war dementsprechend eine Männerdomäne, während Frauen, sofern sie überhaupt am öffentlichen Leben teilnehmen durften, als dann am produktivsten galten, wenn sie in Wohlfahrtsorganisationen, bei der Missionsarbeit oder der Kinderpädagogik tätig waren. Einwanderer verwässerten die nationale Lebenskraft und brachten politischen Extremismus hervor. Tiere verdienten Freundlichkeit, und die nur knapp über den Tieren rangierenden scheinbar primitiven Völker zwar Hilfe, aber keinen Respekt. Verbrecher wurden zu einem Leben außerhalb des Gesetzes geboren, konnten aber gebessert werden. Homosexuelle wählten ihre Verderbnis selbst und waren vermutlich nicht zu retten. Diese Zeit war zugleich aber auch eine Zeit der Fortschritts: eine Ära, die die Rechtfertigung von Sklaverei hinter sich gelassen hatte, in der begonnen wurde, Klassenbegrenzungen abzuschütteln, und die schließlich auch politische Imperien abschaffen sollte. Während wiederum zugleich die lebenden Erinnerungen an die Unvollkommenheit der Menschheit – Personen, die man als blind, taub und stumm bezeichnete, als Krüppel, Idioten, Schwachköpfe, Geistesgestörte und Mongoloide – in den besten Fällen ein stilles Leben hinter Mauern führten.
Sämtliche dieser so empfundenen natürlichen Wahrheiten schienen durch eine Vielzahl praktischer Erfahrungen bestätigt. Kein Staat gestattete Frauen zu wählen oder ein politisches Amt zu bekleiden. In den Vereinigten Staaten teilten Volkszählungen die Gesellschaft eindeutig und abgrenzend in rassische Typen ein, in Übersetzung der damaligen Begriffe in: Weiße, Neger, Chinesen, Indianer. Die US-Zählung von 1890 verfeinerte sogar noch um die Begriffe Mulatte, Quadroon und Octoroon, um Mischverhältnisse zu unterscheiden. Die Bedeutung der zutreffenden Kategorie schien so offenkundig, dass es nicht darum ging, was man selbst definieren wollte, sondern was ein anderer einteilte, nämlich der Beamte bei der Volkszählung – für gewöhnlich ein weißer Mann.
Suchte man eine größere Bücherei auf, ob in Paris oder London oder Washington, D. C., stieß man auf gelehrte Bücher, die allen diesen Punkten zustimmten. Die erste Ausgabe der Encyclopaedia Britannica im 20. Jahrhundert von 1911 definierte »Rasse« als eine Gruppe von Menschen, die »von einem gemeinsamen Vorfahr abstammen« – was implizierte, dass beispielsweise weiße und schwarze Menschen vollkommen getrennte Abstammungen hatten, die durch die Zeiten der Evolution zurückreichten. Zivilisation wurde definiert als die Periode, seit der »die am höchsten entwickelten Menschenrassen Schreibsysteme benutzten«. Die erste Ausgabe des Oxford English Dictionary im 20. Jahrhundert, das Handwörterbuch von 1914, enthielt keine Einträge für racism, colonialism oder homosexual.
Generell wurde über die menschliche Gesellschaft angenommen, dass Unterschiede im Glauben und Handeln der Menschen ihre Gründe in der Entwicklung oder aber Abweichung von dieser Entwicklung hätten. Von primitiven Gesellschaften zu fortgeschrittenen verliefe eine mehr oder weniger gerade Linie. In New York City konnte man diesen natürlichen Entwicklungspfad nachvollziehen, indem man einfach nur von einer Seite des Central Parks zur anderen spazierte: Ausstellungen über Afrikaner, Bewohner der pazifischen Inseln oder die amerikanischen Ureinwohner wurden (und werden bis heute) unter demselben Dach wie Elche und Grizzlys in nachgestellten Szenen präsentiert; auf der anderen Seite des Parks, im Metropolitan Museum of Art, waren dagegen die echten Errungenschaften zu finden. Die zeitgenössische Gesellschaft hatte zwar immer noch ihre Schwachstellen: Arme, sexuell Abweichende, Schwachsinnige, übertrieben ehrgeizige Frauen. Doch waren sie einfach nur Hinweise auf die Arbeit, die noch getan werden musste, um eine bereits weit fortgeschrittene Zivilisation zu vervollkommnen.
Die Vorstellung der natürlichen Rangfolge menschlicher Typen bestimmte alles: Schul- und Universitäts-Lehrpläne, Gerichtsentscheidungen und Polizeistrategien, die Arbeit des mit den Nachkommen der amerikanischen Ureinwohner befassten Bureau of Indian Affaires und der US-Kolonialverwalter etwa auf den Philippinen wie auch deren Entsprechungen in England, Frankreich, Deutschland und so vielen weiteren Ländern und Gegenden. Die Armen waren arm aufgrund ihrer eigenen Unzulänglichkeiten. Die Natur begünstigte die starken Kolonialisten zuungunsten der unbedarften Eingeborenen. Unterschiede in der körperlichen Erscheinung, in Tradition und Sprache spiegelten einfach stets tiefe und angeborene Andersartigkeit wider. Selbst politisch progressiv Denkende akzeptierten diese Vorstellungen und fügten höchstens hinzu, dass es durchaus möglich sei, mit genügend Missionaren, Lehrern und Ärzten sämtliche primitiven und unnatürlichen Praktiken auszumerzen und durch aufgeklärte Lebensweisen zu ersetzen. Es gab Gründe, aus denen Amerikas führendes Magazin zu Weltpolitik und internationalen Beziehungen, das seit 1910 erschien und heute das einflussreiche Foreign-Affairs-Magazin ist, anfangs Journal of Race Development hieß, Journal für Rassenentwicklung. Primitive Rassen, das waren einfach alle Ethnien, die noch die Wohltaten des triumphierenden Christentums, von Wasserklosetts bis zur Ford Motor Company, vor sich hatten.
Über alle diese Dinge haben wir inzwischen unsere Meinung geändert.
Konzepte wie Rasse, Ethnizität, Nationalität, Geschlecht, Sexualität und Behinderung gehören zu den grundlegenden Kategorien, mit denen wir die soziale Welt zu begreifen versuchen. Wir fragen einige dieser Kategorien bei Stellenbewerbungen ab. Wir bemessen andere auf Formularen für Behörden. Wir reden über alle von ihnen – und das in den Vereinigten Staaten des 21. Jahrhunderts sogar unaufhörlich – in den Hörsälen der Geisteswissenschaften ebenso wie in den sozialen Medien. Was wir aber damit meinen, ist nicht mehr dasselbe wie früher.
Bei der Volkszählung im Jahr 2000 durften die Amerikaner zum ersten Mal überhaupt mehrfache Antworten auf Fragen zu ihrer ethnischen Identität geben. Die Common Application, das Anmeldungsformular, das von mehr als sechshundert amerikanischen Colleges und Universitäten benutzt wird, verlangt zwar, dass das einzutragende Geschlecht der gesetzlichen Angabe auf dem Geburtsschein entspricht, erlaubt heute aber weitere Erklärungen dazu, wie dieser Umstand wahrgenommen und dargestellt werden soll. 2015 entschied eine Mehrheit am Obersten Gerichtshof der USA, dass der Schutz der Institution der Ehe nicht bedeute, dass ein Paar aus Mann und Frau zu bestehen habe. An Schulen, Universitäten, öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstellen werden heute Dinge, die vor noch nicht langer Zeit als Defekte galten – von Taubheit über den Bedarf eines Rollstuhls bis zu bestimmtem Lernverhalten –, als Unterschiede begriffen, denen man Rechnung tragen sollte, um dafür zu sorgen, dass keine Idee, keine Fähigkeit und kein Talent etwa nur der Schallwellen oder eines Treppenhauses wegen unbeachtet bleibt.
Für gewöhnlich schildern wir diese Veränderungen als Erweiterung oder aber Verengung unseres moralischen Universums. In den Vereinigten Staaten tendiert die politische Linke dazu, einen langen Bogen vom Abbau des rassistischen Autoritarismus in der Ära von Rassentrennung und Rassendiskriminierung über die Stonewall-Unruhen der späten 1960er-Jahre für die Gleichberechtigung von Homo- und Transsexuellen und den Americans with Disability Act von 1990 für die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen bis hin zur ersten weiblichen Kandidatin für das Amt des US-Präsidenten zu schlagen. Das ist ein Narrativ des Fortschritts. Es erzählt von der immer weitgehenderen Verwirklichung der Rechte, die in den Gründungsurkunden der Nation niedergelegt sind. Die politische Rechte setzt dagegen, manche Veränderungen würden die Möglichkeiten einer Gemeinschaft beschränken, die gesellschaftlichen Sitten frei selbst zu bestimmen. Eine neue Form der staatlich sanktionierten Intoleranz, geschützt in Safe Spaces und gefördert durch eine Sprachpolizei an staatlichen Schulen ebenso wie in Büros, bestehe darauf, dass wir alle gleicher Meinung zu sein hätten, was eine Ehe ausmacht, einen guten Witz oder eine funktionierende Gesellschaft. Dieses Narrativ ist indes übertrieben und unvernünftig, es handelt von einem anmaßenden Staat, der in die individuellen Sprechweisen, das Denken und die ureigenen Werte einzudringen versucht. Ähnliche Fronten gibt es auch in anderen Ländern – auf der einen Seite das Feiern bestimmter Differenzen, auf der anderen Seite das Bewahren der Werte vergangener Generationen.
Doch ging all diesen einzelnen Debatten eine ungleich fundamentalere Veränderung voraus. Sie war das Ergebnis einer ganzen Reihe von Entdeckungen durch eine kleine, unangepasste Forschergemeinschaft, die Franz Boas bescheiden »unsere kleine Gruppe« nannte.7 Empirisch durch Beweise gestützte Analysen, glaubten diese Forscher, würden einen der elementarsten Grundsätze der Moderne zum Einsturz bringen: dass die Wissenschaft angeblich sagen konnte, welche Individuen und Gruppen von Natur aus schlauer, begabter, aufrechter und zur Herrschaft geeigneter seien. Die Antwort der Forschergemeinschaft darauf lautete: Wissenschaftliches Denken weist genau in die entgegengesetzte Richtung, nämlich hin zu einer Theorie des Menschseins, die sämtliche verschiedenen möglichen Lebenswege umfasst, die wir Menschen uns ausdenken können. Die sozialen Kategorien, nach denen wir uns gewöhnlich selbst einteilen und zu denen auch Merkmale wie Ethnie und Geschlecht gehören, sind von Grund auf künstlich – sie sind das Ergebnis menschlicher Vorstellungen und in den Mentalitäten und unbewussten Gewohnheiten der jeweiligen Gesellschaften zu verorten. Wir sind kulturelle Wesen, behaupteten die Forscher, und also durch Regeln gebunden, die wir selbst aufgestellt haben, selbst wenn diese Regeln oft unsichtbar sind oder innerhalb einer Gesellschaft als gegeben gelten.
Die Geschichte des Boas-Kreises muss man nicht kennen, weil sie die einzigen Menschen gewesen wären, die einen alten Irrglauben herausforderten. Die Einheit der Menschheit ist eine Vorstellung, die sich durch die Religionen, ethischen Systeme, die Kunst und Literatur der ganzen Welt zieht. Doch Boas und seine Studenten vermochten es auf besondere Weise, die Diskrepanz zwischen dem zu spüren, was wirklich real ist, und dem, was der allgemeinen Behauptung nach real sein soll. Das vermochten sie, weil sie selbst wie in einer Fallstudie zu diesem Thema lebten. Denn die USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beriefen sich zwar auf die Ideen der Aufklärung, perfektionierten zugleich aber ein riesiges System ethnischer Entrechtung. Die US-Amerikaner hielten sich für eine einzigartige Nation und bestanden dennoch zugleich auf der universellen Gültigkeit ihrer Vorstellungen von einer guten Gesellschaft. Ihre Regierung kämpfte darum, bestimmte Arten von Ausländern fernzuhalten, überschüttete aber deren Herkunftsländer mit nie da gewesenem Wohlstand und ebensolcher Militärkraft, wodurch sie die Länder umgestaltete, die diese Menschen geschickt hatten. Die Konzepte des Boas-Kreises entstanden in einer Zeit und an einem Ort, die sie dringend nötig zu haben schienen.
Sie nannten sich Kulturanthropologen, ein Ausdruck, den sie selbst prägten. Ihre neue Theorie tauften sie kulturelle Relativität, heute oft als kultureller Relativismus oder Kulturrelativismus bezeichnet. Beinahe ein Jahrhundert lang würden ihre Kritiker sie mit unzähligen Vorwürfen überziehen, von angeblicher Rechtfertigung der Sittenlosigkeit bis zur Zerstörung der Grundlagen der Zivilisation. Heute wird der kulturelle Relativismus oft als eine Gegenkraft zu Tradition und gutem Benehmen gehandelt, Seite an Seite mit Begriffen wie Postmoderne und Multikulturalismus. Die Arbeit des Boas-Kreises erscheint in konservativen Medien und auf rechtsextremen Websites als Schreckgespenst, wird von Streitern wider Diversität und politische Korrektheit verspottet und steht auf Listen namens »Zehn Bücher, die die Welt verpfuscht haben«. Wie können wir überhaupt irgendetwas als definitiv richtig oder falsch beurteilen, fragen Kritiker, wenn alles lediglich relativ zu seiner Zeit, seinem Ort und seinem Kontext sein soll?
Die Überzeugung, dass unsere jeweilige Ansicht die einzige vernünftige und moralisch richtige ist, hat große Anziehungskraft, vor allem, wenn sie in der Sprache von Wissenschaft, Rationalität, Religion oder Tradition ausgedrückt wird. Alle Gesellschaften neigen dazu, ihre eigenen Merkmale als positive Errungenschaften anzusehen, diejenigen anderer Gesellschaften aber als Mängel. Die zentrale Botschaft des Boas-Kreises setzte dem entgegen, dass wir für ein gutes Leben auf der Erde das Leben der anderen durch die Brille der Empathie sehen sollten. Wir sollten unser Urteil über andere Umgangsweisen mit der sozialen Realität so lange aufschieben, bis wir diese Umgangsweisen wirklich verstehen, und demgemäß sollten wir unsere eigene Gesellschaft mit der gleichen Sachlichkeit und Skepsis betrachten, mit der wir entlegene Völker studieren.
Boas und seine Studenten begriffen Kultur als die ultimative Quelle all dessen, was landläufiger Meinung nach üblicherweise den gesunden Menschenverstand ausmacht. Unsere jeweilige Kultur sagt uns, wie man ein Kind aufzieht, wie man eine Führungsperson wählt, wie man gute Sachen zum Essen findet oder gut heiratet. Im Lauf der Zeit verändern sich diese Überzeugungen, manchmal langsam, manchmal schnell. Es gibt keine andere fundamentale Wirklichkeit in der sozialen Welt als diejenige, die die Menschen gewissermaßen selbst erschaffen.
Die Implikationen der Idee, dass wir unsere soziale Welt selbst erschaffen, waren tiefgehend. Dieses Konzept unterhöhlte den Glauben, die gesellschaftliche Entwicklung verliefe linear, von angeblich primitiven Gesellschaften hin zu den sogenannten zivilisierten. Sie stellte ganze Bausteine der politischen und gesellschaftlichen Ordnung infrage, angefangen beim Glauben an die Existenz verschiedener Rassen bis hin zur Überzeugung, dass das biologische und das soziale Geschlecht – Gender – dasselbe seien. Das Konzept verschiedener Rassen musste, meinte Boas, als gesellschaftliche Realität gesehen werden, nicht als biologische – genau wie alle anderen von den Menschen tief empfundenen und dennoch von ihnen selbst gemachten Trennungslinien von der Kaste über den Stamm bis zur Sekte, die sich durch alle Gesellschaften der Welt hindurchziehen. Und ebenso konnten auch im Falle des biologischen Geschlechts Frauen und Männer nicht durch eine starr festzulegende Auffassung von Sexualität geformt sein, sondern durch flexible Vorstellungen von sozial definiertem Geschlecht und von Anziehung und Erotik, die sich von Ort zu Ort unterschieden. Die Wertschätzung von Reinheit – eine unbefleckte Rasse, ein züchtiger Körper, eine Nation, die ihrem angestammten Boden vollständig entwickelt entspross – sollte der durch Beobachtung bestätigten Ansicht weichen, dass Vermischung und nicht Trennung der natürliche Zustand der Welt ist.
Im Laufe der Zeit würden diese grundlegenden Veränderungen umformen, wie Soziologen die Integration oder Exklusion von Immigranten betrachten; wie Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens mit Krankheiten von Diabetes bis zu Drogenabhängigkeit umgehen; wie Polizisten und Kriminologen die Hauptursachen für Verbrechen herausfanden; wie Ökonomen die nur scheinbar irrationalen Handlungen von Käufern und Verkäufern analysieren. Der Glaube an die Normalität von »gemischt-ethnischer« Identität, an fluide Genderidentitäten, die jenseits von Entweder-oder-Entscheidungen liegen; an die schiere Vielfalt der menschlichen Sexualität; an die Tatsache, dass gesellschaftliche Normen unsere Gefühle für richtig und falsch bestimmen – all diese Dinge mussten erst imaginiert und dann gewissermaßen bewiesen werden, ehe sie Gesetze, Regierungen und die gesamte Politik prägen konnten. Besucht man ein Museum, füllt ein Behördenformular aus oder lässt sein Kind den Unterricht zur Gesundheitserziehung im achten Schuljahr besuchen – dann ist das alles Mal für Mal ohne die Auswirkungen der hier beschriebenen intellektuellen Revolution undenkbar. Heute fällt es nicht weiter auf, wenn sich ein schwules Paar auf dem Bahnsteig zum Abschied küsst, wenn ein College-Student in seinem Kurs über Weltliteratur die Bhagavad Gita liest; wenn Rassismus als moralisch bankrott und offensichtlich dumm zurückgewiesen wird; und wenn alle, ganz gleich, wie sie ihr eigenes Geschlecht definieren, mit großer Selbstverständlichkeit Arbeitsplätze und Vorstandsetagen für sich in Anspruch nehmen – wenn all diese Dinge keine radikalen Neuerungen oder bloße Wünsche mehr sind, sondern zum normalen und selbstverständlichen Funktionieren der Gesellschaft gehören, dann verdanken wir das den Ideen, für die der Boas-Kreis kämpfte.
Mit seinen wilden Haaren und dem heftigen deutschen Akzent lieferte Papa Franz das perfekte Bild eines verrückten Wissenschaftlers. In den 1930ern erfuhr er die Auszeichnung, auf dem Titelbild der Zeitschrift Time zu erscheinen, wie üblich von rechts fotografiert, um die herabhängende linke Seite seines Gesichts zu verbergen, und Geburtstagsgrüße erreichten ihn von Berühmtheiten wie Franklin Roosevelt oder Orson Welles. Nachdem Adolf Hitler in Boas’ Heimatland Deutschland an die Macht gekommen war, gehörten Boas’ Bücher zu den ersten, die die Nationalsozialisten zusammen mit denen von Einstein, Freud und Lenin ins Feuer warfen. Als Boas 1942 starb, versah die New York Times ihren Nachruf mit einer Aufforderung: Es sei nun an seinen ehemaligen Studenten, »jenes Werk der Aufklärung« fortzuführen, in dem er »ein wagemutiger Pionier war«.8
Diese setzten es in der Tat fort. Und wurden teils zu intellektuellen Stars des Jahrhunderts, teils wäre das ohne Weiteres möglich gewesen: Margaret Mead, die Feldforscherin, die kein Blatt vor den Mund nahm und eine der bedeutendsten und bekanntesten Wissenschaftlerinnen Amerikas werden sollte; Ruth Benedict, Boas’ wichtigste Assistentin und Meads große Liebe, deren Forschung für die US-Regierung dazu beitrug, die Zukunft Japans nach dem Zweiten Weltkrieg mitzuprägen; Ella Cara Deloria, die die kulturellen Überlieferungen der Prärie-Indianer bewahrte, dennoch den größten Teil ihres Lebens in Armut verbrachte und in Vergessenheit geriet; Zora Neale Hurston, die herausragende Querdenkerin der Harlem-Renaissance-Bewegung afroamerikanischer Künstler, deren ethnografische Studien unter Boas direkt in ihren heute als Klassiker geltenden Roman Vor ihren Augen sahen sie Gott einflossen; sowie eine Handvoll weiterer Akademiker und Forscher, die einige der weltweit führenden Fachbereiche für Ethnologie von Yale über Chicago bis nach Berkeley ins Leben riefen.
Sie waren Wissenschaftler und Denker; die Herausforderung, andere Menschen zu verstehen, war ihre Leidenschaft. Eine wahrhaft am Menschen interessierte Wissenschaft, glaubten sie, proklamiere nicht, was in der Natur des Menschen fest verankert und unveränderlich sei. Vielmehr offenbare sie die große Vielfalt von menschlichen Gesellschaften – die gewaltigen und diversen Dimensionen von Anstands- und Aufrichtigkeitsvorstellungen, Bräuchen und Moral. Unsere meistgeschätzten Traditionen seien, so ihre Überzeugung, nur ein winziger Bruchteil der vielen Möglichkeiten, die die Menschen zur Lösung grundsätzlicher Probleme entwickelt hätten, von der Frage, wie Gesellschaften überhaupt strukturiert sein sollen, bis zu der, wie sie den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenleben markieren. So wie eine noch unentdeckte Pflanze in einem weit entfernten Dschungel zur Heilung von einer tödlichen Krankheit verhelfen kann, könne auch die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch Orientierung daran gelingen, wie andere Menschen an anderen Orten mit den Herausforderungen der Menschheit umgegangen seien. Ein Gedanke von großer Dringlichkeit: In einer immer vernetzteren Welt wird notwendigerweise der Katalog verschiedenartiger menschlicher Lösungsmöglichkeiten immer kleiner.
Wenn man fortgeht, erfährt man außerdem Grundlegendes über den eigenen Hintergrund – nämlich, dass er immer ganz anders sein könnte. Ruth Benedict nannte dies die »Erleuchtung, die dann kommt, wenn man sehr unterschiedliche Wege zum Umgang mit unveränderlichen Problemen ins Auge fasst«.9 Genau darauf zielte die Arbeit, zu der Boas seine Studenten antrieb – all die Auslandsreisen, Museumsausstellungen und fachwissenschaftlichen Artikel über Ureinwohnersprachen und sexuelle Gewohnheiten. Sie alle sollten zeigen, dass wir nicht die erste Gesellschaft sind, die heiratet, ein Kind aufzieht, den Verlust eines Elternteils beklagt oder auch entscheidet, wer die Regeln aufstellt.
Boas und seine Studentinnen und Studenten waren recht optimistisch, was die Möglichkeit betraf, die Wahrheit zu erfassen; wir seien in der Tat dazu fähig, die Wirklichkeit zu erkennen. Sie glaubten, dass die wissenschaftliche Methode – die Grundannahme, dass unsere Schlussfolgerungen nur provisorisch und jederzeit möglichen Widerlegungen anhand neuer Daten unterworfen sind – einer der größten Fortschritte in der Geschichte der Menschheit war. Sie hatte unser Verständnis der Natur verändert und konnte ihrer Ansicht nach unsere Vorstellungen von Gesellschaft gleichfalls revolutionieren.
Eine Gesellschaftswissenschaft stellte in ihren Augen eine Art Rettungsaktion dar. Denn wer wir heute sind, sind wir durch einen gewaltigen Akt des Vergessens, von der Frage an, wie man einen Baum nennt, wann man bestimmte Samen aussät oder wie die Götter gerne angesprochen werden wollen. Wir mögen unsere Vorfahren zwar ehren, doch niemand von uns versteht sie wirklich. Die menschliche Gesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart zu kennen ist ein Wettlauf gegen das Vergessen. Der unermessliche Schatz der menschlichen Kulturen musste gesammelt und bewahrt werden, ehe die Menschen die Details dessen vergaßen – oder noch schlimmer, sich falsch daran erinnerten –, wie sie einst gewesen waren.
Althergebrachte Wege, bestimmte Dinge zu tun, sind verschwunden. Auch unseren heutigen Routinen wird dasselbe widerfahren. Unsere Urenkel werden sich fragen, wie wir jemals so glauben und uns so verhalten konnten, wie wir es taten. Sie werden sich über unsere Ignoranz wundern und unsere moralischen Urteile kritisieren. Schon allein aus dieser Perspektive heraus ist das Wort Kultur nur im Plural sinnvoll – ein Sprachgebrauch, den Boas popularisierte. Van Gogh und Dostojewski sind Bestandteile einer Kultur, aber das gilt eben auch für Gesichts-Tattoos oder das Kanu-Bauen oder das, was jeweils als Familie zählt.
»Höflichkeit, Bescheidenheit, gute Manieren und Übereinstimmung mit den festgelegten ethischen Normen sind universal«, schrieb Boas einst lapidar, »aber ihr Inhalt ist es nicht.«10 Er und seine Studenten wussten, dass der Glaube an eine zeitlose Natur des Menschen manche Verhaltensweisen rechtfertigt und andere sanktioniert. Selbst im Zeitalter der Wissenschaft kann man bis heute oft nur schwerlich die Meinung abschütteln, Gott und Tradition stünden aufseiten eines bestimmten Familientyps oder einer bestimmten Art zu lieben – nämlich jener, die einem selbst zufälligerweise am vertrautesten ist. Die Antwort des Boas-Kreises darauf lautete, dass wir alle, jede und jeder auf seine Weise, nichts anderes als Museumsstücke sind. Wir haben unsere eigenen Totems und Tabus, unsere eigenen Götter und Dämonen – da sie aber größtenteils unsere eigenen Schöpfungen sind, bleibt uns die Wahl, sie zu verehren oder jedoch sie zu verwerfen.
Stärker als zu seiner Zeit jeder andere begriff Boas, dass die tiefsten Vorurteile der ihn umgebenden Gesellschaft nicht auf moralischen Argumenten beruhten, sondern auf angeblich wissenschaftlichen. Entrechtete Afroamerikaner waren vorgeblich intellektuell tiefer stehend, weil die neueste Forschung dies besagte. Frauen konnten keine einflussreichen Positionen bekleiden, weil ihre Schwächen und Eigenheiten klar bewiesen schienen. Menschen mit geistigen Behinderungen sollten unter sich bleiben, die Reduktion ihres Anteils an der Bevölkerung gesellschaftlichen Fortschritt bedeuten. Einwanderer brachten die Nöte ihrer gottverlassenen Heimatländer mit sich, von Krankheiten über Kriminalität bis zu sozialen Unruhen.
Schien die Wissenschaft bis zu diesem Zeitpunkt zu beweisen, dass die Menschheit unüberbrückbar gespalten war, musste dies nun von einer anderen Wissenschaft widerlegt werden. Indem Boas vor allem die Amerikaner dazu brachte, sich selbst in ihren Merkwürdigkeiten wahrzunehmen – in ihrem hartnäckigen Glauben an etwas, das sie Race, »Rasse«, nennen; in ihrer Blindheit gegenüber alltäglicher Gewalt; in ihrer schwankenden Einstellung zu Sexualität; in ihrer selbst vergleichsweise großen Rückständigkeit, was Frauenbeteiligung angeht –, taten Boas und sein Kreis einen Riesenschritt, der ihnen den Rest der Welt etwas vertrauter machte. Er ist das Verdienst der Denker, die in diesem Buch beschrieben werden. Erst sie brachten uns bei, dass keine Gesellschaft, auch nicht die jeweils eigene, einen Endpunkt gesellschaftlicher Entwicklung darstellt. Wir befinden uns nicht einmal auf einer wichtigen Stufe der menschlichen Entwicklung. Die Geschichte bewegt sich in Sprüngen und Kreisen, nicht in geraden Linien, und führt zu keinem besonderen Ende hin. Unsere Problemstellungen und blinden Flecken sind genauso offensichtlich wie die jeder anderen Gesellschaft.
Die Mitglieder des Boas-Kreises kämpften und stritten, schrieben Tausende von Briefseiten, verbrachten zahllose Nächte unter Moskitonetzen und in regendurchnässten Hütten, verliebten und entliebten sich untereinander. Für jede und jeden von ihnen war Ruhm, sofern er überhaupt eintrat, gleichbedeutend mit öffentlichen Schmähungen – ihre Karrieren wurden als Ausbünde von Zügellosigkeit und Geschmacklosigkeit gesehen, und als Inbegriff der abwegigen Vorstellung, dass Amerikaner nicht das großartigste Land geschaffen hätten, das jemals existierte. Die Forscherinnen und Forscher wurden aus ihren Jobs entlassen, vom FBI überwacht und von der Presse gejagt – und das alles nur, weil sie öffentlich den einfachen Vorschlag gemacht hatten, dass man menschliche Gesellschaften auf wissenschaftlich angemessene Weise nur studieren könne, indem man diese Gesellschaften allesamt als Teile einer gemeinsamen Menschheit auffasse.
Vor einem Jahrhundert begann diese Gruppe von Außenseitern in Dschungelwäldern und auf Eisschollen, in Pueblos und auf Vorstadt-Terrassen eine atemberaubende Wahrheit zu entdecken, die noch heute unser öffentliches und privates Leben formt.
Sie entdeckten, dass unsere Verhaltensweisen uns nicht formen.
Es verhält sich genau andersherum.
* Zur Verwendung heute nicht mehr üblicher Begriffe wie zum Beispiel »primitiv«, »Neger«, »Indianer« im Text siehe Dank, Seite 414.
2 Baffin Island
Ein halbes Jahrhundert vor Margaret Meads Aufbruch nach Samoa träumte Franz Boas in seiner Heimat von Abenteuern – in den Hügeln und Moorgebieten jener Landstriche, die wir heute Norddeutschland nennen. Zu Hause zu sein war für ihn stets das Schlimmste.1 Sein Lieblingsbuch war Robinson Crusoe, notierte er als Schüler in seinem Tagebuch; es brachte ihn dazu, sich auf eine spätere Expedition in das »dunkelste Afrika« oder »jedenfalls in die Tropen« vorzubereiten.2 Er übte sich in Entbehrungen, indem er große Mengen von Essen vertilgte, das er hasste. Als ein Klassenkamerad in einem nahe gelegenen Fluss ertrank, verbrachte Boas Tage in einem Ruderboot und suchte nach der Leiche – ohne Erfolg.3
Geboren wurde er am 9. Juli 1858 in eine assimilierte jüdische Familie in Minden, einer kleinen Stadt in Westfalen, das damals zum Königreich Preußen gehörte. Jedes Schulkind in Europa kannte diese Heimatprovinz Boas’. Sie hatte einem der wichtigsten Friedensverträge der Geschichte, dem Westfälischen Frieden von 1648, den Namen gegeben. Dieser Vertrag hatte den Dreißigjährigen Krieg beendet und die Grundlagen für die moderne Diplomatie gelegt. Er bildete das Fundament internationaler Rechtsprechung und strukturierte die Welt als ein System souveräner Nationalstaaten. Ordnung, die Begrenzung jeglicher Macht, Rationalität wurden von ihm an als Grundlage des Weltgeschehens angesehen, so wie Philosophen die gleichen Werte als Kern zivilisierten Lebens im Allgemeinen verkündeten.
Selbst in einem relativ rückständigen Ort wie Minden spürten die Menschen der Generation von Boas noch immer das Nachglühen der Aufklärung. Schiller und Goethe waren nur wenige Jahrzehnte zuvor gestorben. Der preußische Naturforscher, Reisende und Philosoph Alexander von Humboldt – »der größte Mann seit der Sintflut«, wie ein Beobachter meinte – bildete, obwohl durch einen Schlaganfall beeinträchtigt, ein lebendes Bindeglied zu den Philosophes des 18. Jahrhunderts.4 Die Ideen, die diese Männer verfochten hatten – vernünftig aufgebaute Debatten, verantwortungsvolle Regierungen, Lebensweisen, die von unvoreingenommenen Standpunkten geleitet wurden –, hatten die größte Welle freiheitlicher Revolutionen inspiriert, die Europa je gesehen hatte.
1848, zehn Jahre vor Boas’ Geburt, waren bewaffnete Aufstände über ganz Europa hinweggerast und hatten vom Atlantik bis zum Balkan autokratische Herrscher bedroht. Studenten, Arbeiter, Intellektuelle und Kleinbauern forderten Gerechtigkeit und Reformen. In den deutschen Königreichen und Fürstentümern kam es zu Demonstrationen und Protesten für Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und die nationale Einigung. In Paris wurden Barrikaden errichtet; sie beendeten die konstitutionelle Monarchie von König Louis-Philippe. Ungarische und kroatische Patrioten bekämpften ihren Regenten, den Habsburger-Kaiser. Diese Monate der Unordnung, Gewalt und Hoffnung sollten schon bald als »Völkerfrühling« bezeichnet werden. Doch kam bald darauf der Winter. Land für Land erneuerten die Monarchen ihre Macht. Diejenigen, die die »Achtundvierziger« unterstützt hatten, sowohl auf dem Straßenpflaster als auch im Geiste, zogen sich in die Universitäten und freien Berufe zurück oder wurden ins ausländische Exil gezwungen. Die Politik wurde Männern wie Otto von Bismarck überlassen, Preußens Ministerpräsidenten mit dem eisernen Willen.
Ein Rückzug auf das Land war vor allem dann üblich, wenn man zufällig jüdisch war. Preußen war damals ein »Königreich der Flicken«, wie ein zeitgenössischer Reisender meinte, ein Staat mit einem undurchschaubaren Gewirr an Gesetzesnormen, religiösen Beschränkungen, Zunft-Privilegien sowie städtischer und provinzieller Rechtsprechung.5 Mindens jüdische Bevölkerung war wie in vielen anderen Städten Norddeutschlands winzig im Vergleich zur Anzahl der Protestanten. Wie fast überall in Europa war Antisemitismus Alltag. Doch selbst in dieser Zeit der erneuerten Autokratie konnten gut situierte Juden ihrer Stellung in der Gesellschaft einigermaßen sicher sein. Für die Familie von Meier und Sophie Boas, Franz’ Eltern, war ihre Zugehörigkeit zum Bürgertum – und also einer städtischen, gebildeten, freigeistigen Existenzform – ebenso lebensbestimmend wie ihre Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit.
Juden lebten wortwörtlich und symbolisch im Herzen städtischer Betriebsamkeit, hatten ihre Stadthäuser im Zentrum und ihre Geschäfte an den Hauptstraßen. Sie waren Mindens Einzelhändler, Bankiers, Handwerker und Freiberufler, und sie organisierten sich bereits lange als eigene Gemeinschaft, ehe Preußen ihnen 1869 endlich volle Rechte als Stadt- und Staatsbürger gewährte. Um die Synagogen in Betrieb zu halten, zahlten sie Steuern und beachteten die jüdischen Feiertage, feierten zugleich aber auch – wie die Familie Boas – Weihnachten.6 Sie waren Teil eines Netzwerks über Staatengrenzen hinweg, das von Handel, Reisen und einem über lange Zeit hinweg erworbenen Kosmopolitismus geprägt war. Meier, anfangs nur ein kleiner Kornhändler, hatte reich genug geheiratet, um in diese Welt hineinzugelangen. Er verlegte seine Karriere auf das Familiengeschäft, das Sophie, geborene Meyer, als Mitgift in die Ehe mitgebracht hatte: den Export von feinem Leinen, Tischwäsche und Möbeln für die Firma Jacob Meyer in New York.7
Als einziger Sohn in einem Haushalt mit vielen Schwestern war der junge Franz ein Grund zur Verzweiflung für seinen zupackenden Vater und ein Sorgenkind für seine in ihn vernarrte Mutter. Er neigte dazu, in seinen eigenen Gedanken zu leben. Er konnte depressiv sein und hatte oft Kopfschmerzen, war aber auch abenteuerlustig und mutig, wenn ihm etwas wirklich wichtig war.8 Als Angehöriger einer halbwegs wohlhabenden Familie kam er auf das Gymnasium mit den Schwerpunkten klassische Sprachen und Philosophie. In Latein, Französisch und Mathematik hatte er gute Noten, in Geografie sogar sehr gute.9 Er war ein Kind, das die Lehrer vielleicht als aufgeweckten, aber nicht als fleißigen Schüler bezeichneten; ein Junge, der voller Begeisterung von einer Sache zur nächsten stürzte und sich selten für längere Zeit auf eine einzige einließ.
Habe er eine Haupttendenz gehabt, meinte er später als Resümee seiner Schulkarriere, dann sei es die gewesen, systematische Vergleiche zwischen den Naturerscheinungen anzustellen, die er beobachtete.10 Als die Familie aus den Sommerferien auf Helgoland zurückkehrte, das damals britische Kronkolonie war, versuchte Franz am deutschen Zollbeamten vorbei eine ganze Wagenladung von Steinen einzuführen, die er zu geologischen Forschungszwecken gesammelt hatte.11 Er trug die Kadaver kleiner Tiere nach Hause, die er im Wald fand.12 Seine Mutter gab ihm einen Topf, sodass er sie abkochen und die Knochen für weitere Studien benutzen konnte.
Als die Zeit kam, an die Universität zu denken – man erwartete von Jungen aus seiner Gesellschaftsschicht, dass sie studierten, wenn sie nicht dazu überredet werden konnten, in das Familiengeschäft einzusteigen –, schwankte er und machte Ausflüchte. Er lehnte den Vorschlag seines Vaters ab, Arzt zu werden. Stattdessen entschied er sich, Mathematik oder Physik zu studieren, auch wenn er wenig Ahnung hatte, welche Arbeit am Ende daraus resultieren konnte. Er verhielt sich wie viele talentierte Jugendliche und wollte die Dinge einfach nur so arrangieren, dass er nicht »unbekannt und unbeachtet« bliebe, wie er einer seiner Schwestern schrieb.13 1877 immatrikulierte er sich an der Universität Heidelberg, dem Oxford der deutschen Universitäten mit seinen verträumten Turmspitzen über der alten Stadt. Seinen ersten Abend beging er extravagant: Er mietete eine Kutsche, die ihn vom Bahnhof abholte; danach bestellte er sich ein vollständiges Diner in ein Hotel.14
Deutschland war inzwischen zu einem geeinten Reich geworden, vereinigt nur wenige Jahre zuvor infolge des Deutsch-Französischen Krieges. Als Junge hatte Boas mit angesehen, wie eine Militärkapelle uniformierte Soldaten bei deren Aufbruch zur weit entfernten Front in Frankreich begleitete.15 Nun konzentrierten junge Männer wie er, die so viele Geschichten von Kampfesruhm gehört hatten, ihre Universitätsjahre auf ganz andere Felder der Ehre. Die Studenten wurden oft vom Anfang ihrer Universitätszeit an Mitglieder in den studentischen Verbindungen, deren einzige wirkliche Aufgabe darin bestand, die konfliktreichen Beziehungen zu den vielen anderen derartigen Verbindungen zu bewältigen. Gut geölt durch Alkohol, auf dem Kopf eine flotte Studentenmütze und zuweilen mit scharfen Säbeln bewaffnet, lebten sie in einer Gesellschaft, in der jede persönliche Kränkung nur durch einen inszenierten Kampf bereinigt werden konnte.
Als einmal einige Nachbarn sich laut über das Klavierspiel eines Freundes beklagten, ließ Boas den Streit eskalieren und nahm die Aufforderung zum Duell an. Er schlitzte die Wange seines Gegners auf – ein glücklicher Hieb, da seine einzige Unterweisung in das Fechten einige improvisierte Lehrstunden mit zwei Freunden gewesen waren –, kam aber selbst auch nur mit einem kleinen Stück fehlender Kopfhaut davon. Dennoch wurde davon ausgegangen, dass er gewonnen habe.16 Beide Duellanten zogen mit dem davon, um dessentwillen junge Männer damals die Universität besuchten: mit einem Schmiss, so stolz zur Schau getragen wie die Brokat-Uniform eines Husaren. Diese Mensur war die erste von mindestens fünf derartigen Begegnungen, die Boas im Lauf seiner Universitätskarriere haben sollte; Fechtkämpfe, die durch einen unbestimmten Kodex der Ritterlichkeit geadelt waren. In seinem späteren Leben würden ihn die Narben wie ein altes Walross aussehen lassen, mit Schmissen an Stirn, Nase und Wange und einer gezackten Linie, die vom Mund bis zum Ohr verlief.17
Für Studenten war es nicht ungewöhnlich, Deutschlands große Universitäten wie eine Art Wandergeselle zu besuchen; sie saßen hier in Vorlesungen und nahmen dort an Seminaren bei einem berühmten Professor teil, ehe sie schließlich die Examina ablegten. Boas ging von Heidelberg nach Bonn und dann 1879 nach Kiel, einer guten, wenn auch nicht herausragenden Universität. Die Wahl war letztlich zufällig. Eine seiner Schwestern, Toni, erholte sich in Kiel von einer Krankheit und war in ärztlicher Behandlung; Boas zog hin, um sich um sie zu kümmern.18 Er setzte sein Mathematik- und Physikstudium fort und entwickelte allmählich die Hoffnung, dass ein unabhängiges Forschungsprojekt in eine abschließende Promotion münden könnte, und damit in den Zugangsweg zu einer Karriere als Gelehrter und, machte er alles richtig, gewissem Ansehen.
Sämtliche Universitäten, an denen Boas studierte – und sich duellierte –, standen in der Tradition einer Denkweise, die Immanuel KantAufklärung getauft hatte. Französische Denker wie Descartes, Montesquieu und Diderot hatten über die Strukturen der Naturgesetze spekuliert, und über die Macht der Vernunft, Rechte und Regierungsweisen zu gestalten. Sie legten die elegante Logik frei, die dem Chaos der natürlichen Welt zugrunde lag. Ihre englischen und schottischen Kollegen wie John Locke und David Hume wiederum hatten darauf hingewiesen, dass wahres Wissen durch direkte Erfahrung entstehe, nicht durch abstrakte Spekulation. Doch während sie alle sich mit dem Menschen und seiner Fähigkeit befassten, die Welt zu erkennen, dachten ihre deutschen Kollegen zuvorderst an den Menschen und sein Unvermögen, sich diese Welt vorzustellen.
Besonders für Kant waren die Beschränkungen des Menschen angesichts abstrakter Vernunft eines der wichtigsten Probleme für Philosophen, Ethiker und all diejenigen, die die natürliche Welt studierten. Wohl mögen wir in einem von Gesetzen bestimmten Universum leben, glaubte Kant. Die gesamte Schöpfung mag einem göttlichen Plan voll Ordnung und Vollkommenheit entsprechen. Ihre tiefsten Geheimnisse aber werden stets durch die Schwächen unseres Verstandes verdunkelt. Unsere Vorstellungen über die Wirklichkeit gelangen eben nur über unsere Sinne zu uns, die besser als unverlässliche Informanten behandelt werden sollten. Doch statt darum einfach nur allem gegenüber skeptisch zu sein, besteht der sicherste Erkenntnisweg darin, die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmungen selbst zu richten.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, falsche Vorstellungen von etwas zu haben, das wir zu sehen meinen – ein Trugbild zum Beispiel oder jemanden auf der Straße, den wir irrtümlich für einen alten Freund halten –, wenn es aber um unseren Sinn für die Wirklichkeit geht, können wir nicht irren: Per Definition sind wir alle Experten unserer eigenen Erfahrung. Aufgabe der Philosophen sollte daher sein, die Differenz zwischen den Sinneswahrnehmungen, die auf uns einstürzen, und den Vorstellungen zu erforschen, die wir uns von ihnen machen. Erkenntnisse von der Welt konnte man erlangen, indem man einen Weg fand zwischen dem Glauben an die universelle Macht der Vernunft und dem starken Zweifel an der Fähigkeit, überhaupt etwas zu wissen. Einer von Kants Studenten, Johann Gottfried Herder, behauptete sogar, dass ganze Völker ihre jeweils eigenen Modelle der Sinnstiftung hätten – einen »Geist«, der jeder einzelnen Kultur eigen sei und sie überhaupt erst entstehen lasse. Die menschliche Zivilisation sei ein Puzzlespiel dieser verschiedenen Wege des Seins; ein jeder von ihnen trage sein eigenes Puzzlestück – manche konturierter als andere – zum großen Gesamtbild menschlicher Errungenschaften bei.
Kein deutscher Universitätsstudent konnte sich diesen berauschenden und befreienden Ideen entziehen. Boas las Kant, erwarb Herders sämtliche Werke in vierzig Bänden und brütete über den Schriften Alexander von Humboldts, der angeregt hatte, die gesamte Natur als ein einziges miteinander verbundenes System zu sehen.19 Gerade in Kiel lag besondere Betonung auf der praktischen Anwendung dieser Konzepte. Die Universitätsfakultät legte Wert auf wissenschaftliche Genauigkeit, empirische Beobachtung und das Interesse an den wechselnden Erscheinungen der Dinge der Welt. Einige der jüngeren Professoren schlugen bereits Experimente vor, die die Beziehungen zwischen physikalischer Realität und menschlicher Wahrnehmung untersuchten. Boas folgte ihrem Beispiel und reichte ein Dissertationsthema zu den photometrischen Eigenschaften von Flüssigkeiten ein. Er schlug vor, zu erforschen, wie Licht durch Wasser polarisiert und in seinen augenscheinlichen Eigenschaften verändert wird, wenn es sich durch etwas anderes hindurchbewegt. Dieses Thema würde ihm die Möglichkeit bieten, handgreiflich Beobachtungen anzustellen und die Laborausstattung in Kiel zu benutzen, um eigenständige Forschung zu betreiben – eine Erfordernis für einen höheren universitären Grad.
Bald schon schickte er fleißig Licht durch Teströhren, die verschiedene Arten von Wasser enthielten, und studierte die Eigenschaften des Lichts am anderen Ende der Röhren. Von einem gemieteten Boot aus ließ er in Kiels geschäftigem Hafen Porzellanteller und Spiegel in das trübe Wasser sinken, um den Punkt festzustellen, an dem sich in der Tiefe die Lichtreflexionen veränderten.20 All das war wenig fachmännisch und improvisiert, aber ausreichend, um von den Prüfern das Bestehen attestiert zu bekommen. Im Juli 1881 erhielt Boas den Titel eines Doktors der Philosophie in Physik.
An diesem Punkt aber entschloss er sich zu einer Richtungsänderung. Seine Forschung hatte ihn gelangweilt, so wie es den meisten, die an einer Doktorarbeit sitzen, am Ende geht, und die mittelmäßigen Ergebnisse seiner Wasserexperimente – die ihm die Auszeichnung magna cum laude, nicht aber summa einbrachten – würden weder irgendein Komitee für ein Forschungsstipendium noch einen Arbeitgeber überzeugen.21 Außerdem brauchte er, wollte er an einer deutschen Universität lehren, eine Habilitation, was ohnehin ein weiteres selbstständiges Forschungsprojekt bedeutete. Und dann dämmerte ihm allmählich, dass es nicht seinen wahren Interessen entsprach, die ewigen Gesetze der Physik zu erarbeiten oder präzise mathematische Beweise zu liefern – sondern vielmehr die Differenz zwischen seinen eigenen Augen und den Porzellantellern zu begreifen, die er im Hafen versenkt hatte.
Boas wusste, dass es ein objektives Farbspektrum gibt, das sich aufgrund vorhersehbarer Gesetze verändert, wenn Licht durch ein Medium wie Wasser dringt. Doch ist es etwas ganz anderes, wirklich zu verstehen, wie unser Geist subtile Veränderungen bei den Lichtfrequenzen interpretiert – wie wir uns entscheiden, dass etwas nicht mehr blau, sondern beispielsweise aquamarin ist. Das waren in der Tat vollkommen andere Forschungsfragen, wurde Boas klar. Eine betraf die Welt der konkreten Wirklichkeit, die andere hatte mit Sinneswahrnehmung zu tun – es ging um das »Noumenale« und das »Phänomenale«, wie die deutschen Universitätsstudenten seit Kant gelernt hatten. Boas wollte sich in das Letztere stürzen; nicht, um herauszufinden, was die natürliche Welt tut, sondern um herauszufinden, wie wir für uns festlegen, was sie unserer Meinung nach macht. Ein Weg dazu bestand darin, zu erfahren, wie Menschen, die ganz anders als man selbst waren, die Dinge sahen. Und das wiederum bedeutete, sich so weit wie möglich von bekannten Orten wie Minden oder Kiel zu entfernen.
Wie viele junge Männer seiner Generation war Boas mit Erzählungen über Abenteuer in der Arktis groß geworden. Nach Norden zu ziehen war die Kaltwetter-Version des Dranges der europäischen Staaten nach Afrika. Doch bewirkten die ungastliche Umgebung und die geringe Bevölkerung der Arktis, dass für gewöhnlich keine Soldaten oder Händler, sondern Wissenschaftler und Patrioten am Wettrennen in Richtung Pol teilnahmen. Anstatt das Land und die Arbeit der dort lebenden Menschen auszubeuten, war das Ziel Erkundung im reinsten Sinne. Boas hatte die Pflicht geradezu verinnerlicht, die jedem deutschen Schulkind aus gutem Hause eingetrichtert worden war, zu Deutschlands Größe beizutragen, indem man die Grenzen der Erde erreichte, ehe andere Nationen dorthin gelangten.
Vierzig Jahre zuvor war eine britische Arktis-Expedition Treibeis, Skorbut und Hungertod zum Opfer gefallen. In den folgenden Jahrzehnten befuhren weitere englische und amerikanische Expeditionen das Eismeer, sammelten Informationen über dort lebende Völker und testeten die Grenzen menschlichen Überlebens in extremem Klima. In den späten 1860ern und frühen 1870ern schlossen sich ihnen auch deutsche Abenteurer und Akademiker an. Zwei deutsche Polar-Expeditionen kämpften sich durch das Packeis, kartierten die Küste Grönlands und sammelten botanische Untersuchungsproben für die weitere Forschung an deutschen Universitäten. Den Nordpol erreichten sie nie, doch ihr Scheitern vergrößerte nur die Begeisterung für neue Versuche. Das geeinte Deutsche Reich konnte sich nun selbst auf das große Spiel der Welteroberung und -erforschung einlassen.
Bereits kurz nach Verteidigung seiner Dissertation verfasste Boas einen Plan für eine eigene wissenschaftliche Expedition: Er plante das Studium der Bewegungsmuster der einheimischen Völker, die auf Baffin Island lebten, der fünftgrößten Insel der Welt.22 Dieser Ort war deutschen Wissenschaftlern bereits halbwegs bekannt; und ebenso auch den schottischen und amerikanischen Walfängern, die dort die Küste anliefen. Boas verbrachte Monate damit, die wissenschaftliche Literatur zum Thema durchzugehen, ein wenig von der Sprache der indigenen Inuit, Inuktitut, zu lernen und Kontakte zu Geografen und Forschern herzustellen, die einem jungen Wissenschaftler wie ihm dabei helfen konnten, in dem neuen Forschungsfeld Fuß zu fassen.23 Er überredete das Berliner Tageblatt, ihm die Möglichkeit zu geben, eine Reihe von Artikeln über seine Abenteuer zu schreiben. Er erzählte seinem Redakteur, dass er sehr wohl die deutsche Version von Henry Morton Stanley werden könnte, dem Journalisten, der auf so legendäre Weise den Forscher David Livingstone in Afrika gefunden hatte. Stanleys Artikel für den New York Herald waren eine Sensation gewesen, und Boas meinte, das könnte auch für seine Berichte zutreffen – vor allem, wenn es ihm gelänge, wie Stanley »in dicken Farben auf[zu]tragen«.24
Boas erledigte einen großen Teil dieser frühen Planungen ohne Wissen seiner Familie.25 Als er schließlich seinem Vater die Neuigkeiten überbrachte, trug er auch gleich seine bescheidene Bitte vor – dass nämlich dieser und Boas’ Onkel Jacobi einen Großteil der Rechnung begleichen sollten. Wieder so eine Verrücktheit, muss Meier Boas gedacht haben; eine weitere plötzliche Schwärmerei seines einzigen Sohnes. Trotzdem konnte diese ja zumindest zur Habilitation führen, und von da zu einem wirklichen Beruf. Widerstrebend stimmte Meier also zu, jedoch nur unter einer Bedingung: Boas sollte den langjährigen Diener der Familie Wilhelm Weike als Assistenten und Begleiter mitnehmen.
Zurück in Minden, sammelte Boas dann auch Weike ein und verabschiedete sich von seiner Familie. Den Umgang mit Gefahren übte er, indem er Nahschüsse mit einem Revolver abgab, was ihm »Ohrensausen« bescherte.26 Mitte Juni 1883 kamen Boas und Weike in Hamburg an, einem der geschäftigsten Handelszentren des Deutschen Reiches, wo Dampfschiffe und Lastkähne aus Südamerika, Indien oder Ostasien die Elbe herauffuhren. An den Kais suchten die beiden Männer die Germania, einen alten Segler, der von der Deutschen Polar-Kommission ausgestattet worden war, der wichtigsten Koordinierungsstelle des Reichs für Arktis-Expeditionen. Das Schiff sollte eine Gruppe von Forschern abholen, die ein Jahr auf Baffin Island bleiben wollte. Die Kommission hatte zugestimmt, zwei unabhängige Reisende kostenlos mitreisen zu lassen.
Die beiden Männer schleppten ihre Sachen an Bord: wissenschaftliche Instrumente, Winterkleidung, Landkarten, Medizin, Zelte und so viel Nahrung, wie sie nur mitführen konnten, dazu noch Tabak, Messer, Nadeln und weitere Dinge zum Tauschen: Ergebnisse einer Schenkung seitens der Polar-Kommission und der Nachgiebigkeit des Vaters. Danach machten sie sich auf die langsame Reise Richtung Nordsee. »Nun ade, Du mein lieb Heimathland! Lieb Heimathland, ade!«, notierte Boas dramatisch in sein Tagebuch.27 Der Zweimaster Germania, durch ein Kabel mit einem Schlepper verbunden, lichtete die Anker und drehte seinen Bug in Richtung des offenen Meeres. Viele Leute jubelten, als das Schiff an ihnen vorbeifuhr.28 Im Zeitalter der Dampfmaschinen war es noch immer aufregend, ein altmodisches Schiff ablegen zu sehen, selbst wenn die Segel eingerollt waren. Meier sah vom Kai aus zu, wie die Germania elbabwärts verschwand.29
Boas hatte bereits im letzten Frühling begonnen, die Menschen auf Baffin Island als »meine Eskimos« zu bezeichnen.30 Schon im vergangenen Jahrhundert waren die Inuit-Gruppen der Region in engeren Kontakt mit europäischen und amerikanischen Walfängern gekommen. Nun waren sie zu unverzichtbaren Mitspielern bei der aufkommenden Welle der Polar-Erforschung geworden. Boas wusste, dass es keine Reise in die Arktis ohne ihre Unterstützung gab, auch wenn sie selten in den Berichten auftauchten, die die Europäer verfassten, sobald sie wieder zu Hause waren. Man konnte nur wenige Entdeckungen machen, die die Inuit nicht schon vorher gemacht hatten. »Ich werde auch ein paar Eskimos engagieren, die mir bei meinen Unternehmungen helfen sollen«, hatte er seinem zweiseitigen Plan zuversichtlich anvertraut.31
Franz Boas an Bord der Germania auf dem Weg nach Baffin Island, Sommer 1883. Als Schuljunge hatte Boas notiert, sein Leben wäre von dem Verlangen bestimmt, Dinge zu vergleichen, die er in der Natur beobachtete. In der Arktis wollte er das mit den Menschen umsetzen, die er bereits als »meine Eskimos« bezeichnete.
In Europa waren die Inuit mindestens seit dem 16. Jahrhundert bekannt, als der englische Seefahrer Martin Frobisher sich aufgemacht hatte, die sagenhafte Nordwestpassage zwischen Atlantik und Pazifik zu entdecken. Einige der frühesten Berichte beschrieben die Inuit als wild und verschlagen und behaupteten, sie lebten mit Rudeln wolfsähnlicher Hunde zusammen. »Sie essen ihr Fleisch ganz roh, sowohl Fleisch, Fisch und Verdorbenes, oder etwas, das mit Blut und etwas Wasser gekocht wurde, was sie trinken. Aus Mangel an Wasser essen sie Eis, das hart gefroren ist, mit solchem Vergnügen, wie wir Naschwerk oder sogar Zucker essen«, berichtete einer der Männer Frobishers namens Dionyse Settle 1577.32 Die Mannschaft hatte Beweise gesammelt, die ihre Entdeckungen belegen sollten: »Wir nahmen zwei Frauen, die nicht so schnell wie die Männer waren, dass sie fliehen konnten; die eine recht alt, die andere mit einem kleinen Kind«, schrieb Settle.33 Vier Inuit – ein Mann, Kalicho, eine Frau, Arnaq, und ihr Kind, Nutaaq, sowie ein ungenannter Mann – wurden schließlich per Schiff nach England gebracht. Sie wurden zu Sensationsobjekten für gaffende Menschen des Elisabethanischen Zeitalters, ehe sie an den Krankheiten und Verletzungen starben, die sie sich während ihrer Gefangenschaft zugezogen hatten. Sie waren die ersten nordamerikanischen Ureinwohner in Gefangenschaft, die jemals in europäischen Quellen namentlich aufgeführt wurden, anstatt bloß als »Eskimo« oder »Indianer« bezeichnet zu werden.34
Im 19. Jahrhundert fanden europäische Reisende die Inuit weniger interessant als die Umgebung, in der sie lebten. Die Wissenschaftler, die die Germania einsammeln sollte – Mitglieder einer großen, aus elf Ländern stammenden Expedition zur Polarerforschung, die 1882 gestartet war –, waren damit beschäftigt, meteorologische Muster zu bestimmen und die Magnetfelder der Erde zu untersuchen. Doch Boas war von den Inuit selbst fasziniert – ihrer Bewegung über große Distanzen; ihrer Fähigkeit, in einem schwierigen Umfeld zu überleben; ihrer Fähigkeit, eine Landschaft zu lesen, die Außenstehenden öde und gestaltlos erschien.
Boas hatte einige anfängliche Hypothesen über die Beziehungen zwischen verfügbarer Nahrung, Bewegungsmuster und Umwelt formuliert. Doch diese Hypothesen waren schwammig, einzig der Lektüre der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur und dem Besuch einiger gelehrter Seminare entsprungen. Eigene Forschung zu betreiben und Notizbücher mit eigenen Ergebnissen durch Quellen vor Ort zu füllen würde, glaubte Boas, ihn weit über die laienhaften Experimente hinausführen, die er für seinen Doktortitel angestellt hatte. »[Ich würde] gleich in die Zahl der Geographen aufgenommen sein«, schrieb er seinem Onkel, dem ins Exil gegangenen Achtundvierziger und als Arzt bekannt gewordenen New Yorker Abraham Jacobi, mehrere Monate vor seinem Aufbruch.35
Nun, da Boas und Weike sich zu ihrer langen Reise aufgemacht hatten, pfiffen die Nordseewinde, als die Germania vor der Elbmündung Richtung Helgoland lossegelte. Kaum zwei Tage auf Reisen, war Boas bereits seekrank.36 Der Kapitän und seine Crew segelten nun in einem langen Bogen hinter den Shetland-Inseln und den Färöern, dann an Island und Grönland vorbei und schließlich zur Baffin Bay, dem Tor zur kanadischen Arktis.
Jeden Tag wurde es kälter, und das Meer schien vom Morgen bis zum Nachmittag die Farbe zu wechseln; ein Phänomen, das Boas in seinem Tagebuch gewissenhaft vermerkte. Er verbrachte die Zeit damit, Weike etwas Englisch beizubringen – aber »er hat doch einen furchtbaren harten Kopf« – und den Zustand seiner eigenen Seefestigkeit zu notieren: »wieder seekrank … unruhige See«.37 Wochen vergingen auf der nahezu dreitausend Meilen weiten Reise, mit nichts auf beiden Seiten des Schiffes als kalbenden Eisbergen, die wie Donnerschläge dröhnten.38 Trugbilder ragten aus der eiskalten See empor, täuschten das Auge und ließen die beiden Passagiere denken, dass man mitten im Ozean eine schöne Kirche errichtet hätte.39 Man konnte kaum wissen, was davon echt war.
Mitte Juli kam endlich Baffin Island in Sicht, doch an das Ufer zu gelangen war unmöglich. Weitere sechs Wochen vergingen, bis der Kapitän und seine Seeleute eine Möglichkeit fanden, sowohl mit den wechselnden Winden als auch dem Treiben der tödlichen Eisberge fertigzuwerden. Endlich fuhr die Germania am 26. August 1883 in den Cumberland Sound ein, direkt südlich des nördlichen Polarkreises, vor sich eine kleine Siedlung auf Kekerten Island.
Die Hunde des Dorfes heulten, als das Schiff in Sicht kam. Inuit-Frauen, in Seehundsfelljacken mit Baumwoll-Unterröcken gekleidet, nahmen ihre Barkassen und brachten ein Seil zur Germania, um sie zum Ankerplatz zu schleppen.40 Die Männer der Walstation hissten englische und amerikanische Flaggen zur Begrüßung. Nachdem sie an Land gegangen waren, tranken Boas und Weike einen ihnen zur Begrüßung gereichten Krug mit Rum und sahen zu, wie die Hunde ein totes Walross zwischen den wenigen Zelten herumschleiften, aus denen die Inuit-Siedlung bestand. »Sie sind nicht so schmutzig, wie ich dachte«, schrieb Boas über diese Zelte, nachdem man ihn in das Innere eingeladen hatte.41 »Auf dem Lande sah ich wieder die ersten Blumen; wie froh ich war.« Er pflückte wilde Gräser, presste sie sorgfältig in seinem Notizbuch und bewahrte viele Proben auf, wie er es schon in seiner Kindheit getan hatte.42 »Nach ein paar Tagen verließ uns das Schiff«, erinnerte Boas sich später, »und ich war mit meinem Diener allein unter den Eskimos.«43
Ursprünglich hatte er geplant, den Bewegungsradius der Inuit auf der riesigen Insel zu dokumentieren und dazu die Eisschollen, die Schneeverwehungen und die Verhaltensweisen der Seehundgruppen zu kartografieren. Schnell merkte er, wie schwierig das in der Praxis sein würde. Das unwegsame Eis und das Wetter zwangen ihn und Weike, mehrere Monate am Cumberland Sound zu bleiben, hauptsächlich in Kekerten. Doch es war keine vergeudete Zeit. Boas war mit einem ganzen Vorrat an Notizbüchern gekommen, in Leder gebunden und mit marmorierten Kanten; in seiner Vorstellung die Arbeitsutensilien eines professionellen Forschungsreisenden. Auf der Reise hierher hatte er die Seiten mit Zahlen gefüllt, hatte ordnungsgemäß Windrichtungen, Breiten- und Längengrade eingetragen. Nun, da er sein zweites Notizbuch zur Hälfte vollgeschrieben hatte, begann er, auch Inuit-Worte hineinzukritzeln, eine selbst erstellte Vokabelliste, die er in langen Gesprächen in den Zelten und Häusern der Einheimischen entwickelte.
Er war umgeben von diesen Menschen. Zahlenmäßig waren sie der kleinen Walfänger-Gruppe und den beiden Amateur-Abenteurern weit überlegen, und Boas begriff, als die Wochen verstrichen, dass er ohnehin vollständig auf ihre Hilfe angewiesen war. Lange Winternächte verbrachte er im Gespräch mit Signa, einem Inuit-Mann aus dem Ort, in einer Mischung verschiedenster Sprachen, während er mehr und mehr von Signas Sprache lernte.44 Boas war durchaus überrascht, als sich zeigte, dass Signa eine individuelle Geschichte hatte. Er war an einem anderen Ort geboren, an der Küste der Davisstraße, und erst als Junge nach Kekerten gekommen. Als er älter wurde, jagte er Rotwild an den großen Seen westlich des Sounds. Seine Frau, die die Walfänger als Betty kannten, war im Allgemeinen vergnügt und entgegenkommend, verlangte aber, dass Signa Robbenfleisch und Tran nach Hause mitbrachte, wenn er mit den deutschen Besuchern auf Forschungsfahrt ging; so wie eine Hausfrau aus Minden ihrem Mann gesagt hätte, er solle vom Fleischer etwas mitbringen.45 Signa war kein aus der Zeit gefallener Ureinwohner, der an einer unerbittlichen Küste ums bloße Überleben kämpfte. Er hatte eine Vergangenheit voller Wanderungen und Bewegung, einen Familienstammbaum und erinnerte sich an Momente des Elends wie der Freude.
Von Signa und den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft hörte Boas Inuit-Geschichten und begann, sie niederzuschreiben, so wie er während der Überfahrt Windgeschwindigkeiten und die Farbe des Meerwassers notiert hatte. Seine Sprachfähigkeiten waren rudimentär, doch kam er gut durch mit einer Kombination aus Inuktitut und Pidgin-English, der lingua franca der Walfangstationen. Er machte sich Aufzeichnungen über die Spiele, die die Inuit in ihren Zelten spielten, über die Bauweise ihrer Hundeschlitten, darüber, wie man Kleidung aus Rentierfell richtig trägt, wie man einen Iglu baut und wie man mit den unerwarteten Frustrationen umgeht, die aufkommen, wenn man in einer Welt ohne Grenzen lebt. Bald schon verwandelten sich seine Vokabellisten zu längeren Texten auf Inuktitut. Er arbeitete an einem Stammbaum, versuchte herauszufinden, wer mit wem verwandt war, und strich viele frühere Versuche mit dem Bleistift aus. Er benutzte Musiknoten, Ergebnis seiner Klavierstunden als Kind in Minden, um die Lieder der Inuit aufzuschreiben, wobei er die Melodien Note für Note in C oder G notierte.46