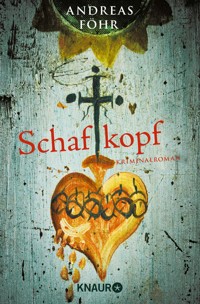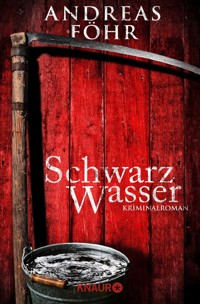
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
"Im Hype-Reigen der deutschen Regional-Krimis ist 'Schwarzwasser' herrlich unprovinziell und vielschichtig - und bringt den Leser trotzdem mit Dialekt und Schrulligkeit zum Lachen." Stern Der Tegernsee als Krimi-Kulisse: Spiegel-Bestsellerautor Andreas Föhr mit dem 7. Kriminalfall für sein ungleiches Tegernseer Ermittler-Duo, Kommissar Clemens Wallner und Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner, liebevoll "Leichen-Leo" genannt! Krimi-Fans und ganz besonders Bayern-Krimi-Fans dürfen sich wieder auf Hochspannung vom Feinsten, einen intelligenten Plot und Föhrs trockenen Humor freuen - auf eine Spurensuche jenseits der Komfortzone im idyllischen Oberbayern, denn Wallner und Kreuthner bekommen es mit einem Toten zu tun, der gar nicht gelebt hat. Als Kommissar Wallner, Chef der Kripo Miesbach, die Nachricht erhält, man habe die Leiche eines alten Mannes gefunden, bleibt ihm beinahe das Herz stehen: Seit Stunden ist sein Großvater Manfred abgängig und auf dem Handy nicht zu erreichen ... Am Tatort angekommen, stellt Wallner erleichtert fest, dass Manfred wohlauf ist – er und Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner haben den Toten - Klaus Wartberg - entdeckt. Am Tatort findet sich auch eine verstörte junge Frau, die die Tatwaffe in der Hand hält. Hat sie Klaus Wartberg ermordet? Schon bald stellt sich heraus, dass der Ermordete gar nicht tot sein dürfte. Ihn hat es nämlich nie gegeben. Seine Papiere sind gut gemachte Fälschungen, der Lebenslauf ist frei erfunden, Freunde oder Familie gibt es nicht. Wer also war der Tote wirklich? Was verbindet ihn mit der jungen Frau? Und warum musste er eine andere Identität annehmen? Andreas Föhr und sein Tegernseer Ermittler-Duo Wallner & Kreuthner in Bestform! "Ausgezeichnete und spannende Unterhaltung - zum Genießen und Mitlachen." Krimi-couch.de (Andreas Kuth) Alle Bände der Wallner & Kreuthner-Krimis auf einen Blick: Band 1 - Prinzessinnenmörder Band 2 - Schafkopf Band 3 - Karwoche Band 4 - Schwarze Piste Band 5 - Totensonntag Band 6 - Wolfsschlucht Band 7 - Schwarzwasser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andreas Föhr
Schwarzwasser
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einer Winternacht wird Klaus Wartberg erschossen. Der Sechzigjährige lebte in einem abgelegenen Haus und galt als unzugänglich und menschenscheu.
Am Tatort verhaften Kommissar Wallner und seine Leute eine verstörte junge Frau. Hat sie Wartberg ermordet? Auch der Tote selbst gibt den Ermittlern Rätsel auf: Denn einen Klaus Wartberg hat es nie gegeben – seine Papiere sind gut gemachte Fälschungen, der Lebenslauf ist frei erfunden, Freunde oder Familie gibt es nicht. Wer also ist der Tote? Und warum musste er eine andere Identität annehmen?
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Danksagung
Rezept: Teufelsravioli »Leonardo«
FdLmL Damaris
Prolog
Berlin, Herbst 1996
Die Frau war dreiundzwanzig Jahre alt und wohnte im dritten Hinterhof eines Altbaus in Kreuzberg. Als sie um 06:44 Uhr das Haus verließ, trug sie Jeans, Strickpullover und Ohrenwärmer auf kurzen schwarzen Haaren mit blauer Strähne. Es war ein kalter Oktobermorgen, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, die Straßenlaternen erhellten die neblige Dämmerung, das erste Laub lag auf dem Trottoir. Am Ende der Straße bog die Frau in den Mehringdamm ein und erreichte nach dreihundert Metern den Zugang zur U-Bahn.
Axel Baum hatte den Wagen an der Ecke geparkt, so dass er das Mädchen von der Haustür bis zur U-Bahn im Blick hatte. Sie würde zum Savignyplatz fahren, um in einem Café ihre Arbeit als Bedienung anzutreten. Das hatte er schon vor zwei Tagen herausgefunden, als er ihr dorthin gefolgt war. Konnte er sich heute sparen. Er würde eine Currywurst frühstücken und sich dann in ihrer Wohnung umsehen. Möglicherweise besaß sie Rauschgift oder andere Dinge, mit denen man ihr das Leben schwermachen konnte. Danach würde er ein paar Stunden schlafen, Kräfte sammeln. Abends wollte Baum herausfinden, mit wem sich die junge Frau in ihrer Freizeit traf. Es war Freitag.
Zu zweit waren sie gekommen, um zu hören, was Baum herausgefunden hatte. Vielleicht aus Neugierde, vielleicht weil sie einander nicht über den Weg trauten. Marc und Regina Augustin, er dreißig, sie vier Jahre älter. Ein hübsch gepflegtes, gut gekleidetes Geschwisterpaar. Baum fühlte sich immer etwas beklommen in Gegenwart von Menschen, die von Geburt an Geld hatten. Die Haltung, mit der sie anderen begegneten, und wie sie es schafften, durch Dinge, die Baum noch nicht entschlüsselt hatte, einen Abstand zwischen sich und den einfachen Leuten herzustellen, verursachte ihm Unbehagen. Bis vor sechs Jahren war Baum so jemandem noch nie begegnet. Tja – einiges blieb rätselhaft. Ansonsten war er gut angekommen in der freien Marktwirtschaft. Denn er arbeitete in einer Branche, in der die DDR nicht nur auf Weltniveau, sondern Spitzenreiter gewesen war: Informationsbeschaffung. Natürlich konnte man nicht offen damit werben. Aber wenn Baum mit einer subtilen Andeutung seinen früheren Arbeitgeber durchschimmern ließ, schlug ihm eine Ehrfurcht und ein Vertrauen in seine berufliche Kompetenz entgegen, wie es vielleicht nur noch Sporttrainer aus den neuen Ländern genossen.
Sie hatten ihn in Regina Augustins Stadtapartment am Ku’damm gebeten. Das war unauffälliger als das Haus in Grunewald. Die Wohnung hatte jemand mit Geschmack, aber etwas kalt eingerichtet. Hier wohnte auch keiner. Sie war für Gäste gedacht. Das edle Paar saß auf der Couch, er die Hände hinter dem Kopf verschränkt, sie die Beine übereinandergeschlagen. Es war schon dunkel draußen. Trotzdem stand nur Wasser auf dem Tisch. Baum hätte gerne ein Bier gehabt. Aber er machte beim Wasser mit. Profis trinken angeblich nicht. Wenn die wüssten, was sie bei der Stasi weggeschluckt hatten. Na gut. Wenigstens rauchten die beiden. Baum zündete sich auch eine an und schlug sein Notizbüchlein auf.
»Miriam Cordes, geboren 3. März 1973, wohnhaft Bergmannstraße 92, arbeitet seit ein paar Wochen als Küchenhilfe im Café Blehnicke in der Bleibtreustraße. Kommt ursprünglich aus Braunschweig, hat daselbst das Gymnasium besucht, in der zwölften Klasse abgebrochen, danach ein Jahr in Köln, unregelmäßige Jobs beim Fernsehen, 1990 dann nach Berlin und so weiter. Ich will Sie nicht langweilen. Steht alles im schriftlichen Bericht. Bis vor kurzem hat Frau Cordes anscheinend ein ziemlich unstetes Leben geführt und einiges an Drogen konsumiert. Zweimal mit Koks erwischt worden. Vor ein paar Monaten noch eine Verurteilung auf Bewährung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Im Augenblick lässt sie offenbar die Finger vom Kokain.«
»Woher wissen Sie so was?« Regina Augustins Miene verriet interessiertes Schaudern. Diese Dinge kamen in ihrer Welt nicht vor.
»Weil sie keins kaufen wollte. Und der Preis war wirklich günstig.«
»Sie haben der Frau …?«
»Das wollen Sie nicht so genau wissen.«
Regina schwieg dazu.
»Und was hat jetzt unser Onkel mit diesem Junkie zu tun?« Marc Augustin hatte die Hände hinter seinem Kopf hervorgeholt und sich nach vorne gelehnt.
»Wie es aussieht …«, Baum blätterte ein wenig in seinen Aufzeichnungen, obwohl er genau wusste, was er sagen würde, »… hat Frau Cordes sich als Begleitung für ältere Herren angeboten.«
»Gott, nein! Das ist ja abgeschmackt.« Regina Augustin sprang der Ekel förmlich aus dem Gesicht, und sie blickte, seelischen Beistand fordernd, zu ihrem Bruder.
»Mein Gott, er ist seit fünf Jahren Witwer. Wenn er da Bedürfnisse hat – warum nicht.«
»Ach so, das ist normal. Entschuldige. Ich dachte, so was machen nur Menschen, die wir nicht kennen.«
»Wie du siehst, machen das auch andere Menschen.« Marc wandte sich wieder Baum zu. »Das heißt, sie hat als eine Art … Callgirl gearbeitet.«
»Nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie hat Ihren Onkel jedenfalls mehrfach auf Wochenendfahrten an die Ostsee begleitet und dafür eine Gegenleistung erhalten.«
»Ja, das kann man allerdings sagen!« Regina schleuderte ein fassungslos-verächtliches Lachen von sich.
»Da muss doch mehr zwischen den beiden gewesen sein. Ich meine, mal ein Wochenende oder auch zwei oder drei. Na gut, was zahlt man da?«
»Scheinst es ja zu wissen«, zischelte Regina.
»Ich denke, ein paar hundert Mark und, sagen wir, ein hübsches Kleid samt Handtasche sind angemessen.« Baum versuchte durch einen dezidiert sachlichen Ton, die Wogen zwischen seinen Auftraggebern zu glätten. »Ihr sein ganzes Vermögen zu vererben ist allerdings schon … ungewöhnlich.«
»Das ist so grausam.« Regina schüttelte verzweifelt den Kopf und schien den Tränen nahe. »Sie müssen wissen, dass die Schwarzwasser GmbH sich seit vielen Jahren in Familienbesitz befindet. Und unser Onkel hat – ohne ihm zu nahe zu treten – leider nichts für die Firma getan. Er hat immer nur Geld ausgegeben. Unser Großvater hat das damals schon kommen sehen und wollte eigentlich meinen Bruder und mich als Erben einsetzen. Aber irgendwie hat er es nicht mehr rechtzeitig geschafft.«
Baum machte ein verständnisvolles Gesicht, auch wenn ihm die Sorgen der Kapitalistenkinder am Arsch vorbeigingen. Eigentlich könnte er mal die nächste Rechnung stellen, fiel ihm dabei ein. Und bei der Gelegenheit: Der Stundensatz von zweiundvierzig Mark war viel zu niedrig. Beim nächsten Auftrag musste er mehr nehmen.
»Gut«, sagte Marc und reichte seiner Schwester gelangweilt ein weißes Stofftaschentuch. Baum meinte die eingestickten Initialen M. A. zu erkennen. »Was schlagen Sie also vor?«
»Nun – der Rechtsweg scheint wenig erfolgversprechend.«
»Unser Onkel hat sich von zwei Psychologieprofessoren seine Testierfähigkeit bescheinigen lassen«, jammerte Regina Augustin. »Das muss man sich mal vorstellen: Was er für einen Aufwand getrieben hat, nur um seine einzigen Verwandten von ihrem Erbe auszuschließen.«
Regina musste erneut zum Taschentuch greifen. Baum hatte viel Verständnis – für den Onkel.
»Es gibt zwei Ansatzpunkte: Miriam Cordes als Erbin. Und diesen Anwalt, Dieter Sitting. In der Schwarzwasser GmbH hat Sitting jetzt das Sagen, wenn ich das Testament richtig verstehe.«
»Das verstehen Sie absolut richtig.«
»Dann sollten wir uns auf ihn konzentrieren.«
Im September war es endlich so weit gewesen. Es war das passiert, was so sicher war wie der nächste Morgen, so unabwendbar, dass sie im Landkreis nur noch auf den genauen Zeitpunkt wetteten.
Schon vor ein paar Monaten hatten sie die Jagd auf ihn eröffnet, Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthners jüngerer Kollege Greiner und ein paar andere. Tempora mutantur! Früher hätte kein Uniformierter einen nicht im Dienst befindlichen Kollegen zur Alkoholkontrolle herausgewunken oder ihn gar blasen lassen. Da hat man vielleicht mal geschaut, ob einer noch geradeaus fahren konnte. Und wenn es Probleme gab, dann haben sie dem Kollegen aus dem Auto geholfen und ihn im Streifenwagen ein, zwei Stunden ausnüchtern lassen, bis er wieder fahrtüchtig war. Damals – aber das war eben eine andere Zeit. Zusammenhelfen – das Wort kannten sie heute gar nicht mehr. Die Ärzte hingegen, hatte Kreuthner gehört, die behandelten andere Ärzte kostenlos. Das war noch ein Standesethos! Und in diesem Sinne hatte man früher auch unter Polizisten gesagt: »Mit dem Rausch im G’sicht, des kostet dich eigentlich an Führerschein. Aber für an Kollegen – da is es halt kostenlos.« Heute: Da sind sie sogar noch stolz, wenn sie einen anderen Polizisten erwischen.
Aufgrund dieses ethischen Verfalls war Kreuthner bei Alkoholfahrten ausgesprochen vorsichtig geworden. Zwar wusste er im Groben, wo und wann kontrolliert wurde, auch wenn er keinen Dienst hatte. Aber er wusste bei weitem nicht mehr alles. Dass freilich während der Wiesenzeit mit einigem zu rechnen war, verstand sich von selbst. Kreuthner sah es daher als Wink des Schicksals, dass der Kater vom Vortagesrausch noch nicht verklungen war und ihm das Bier in der Mangfallmühle irgendwie nicht schmecken wollte. Daher ließ sich Kreuthner einen Masskrug voll Kamillentee an den Wirtshaustisch bringen, den er im Lauf des Abends vollständig leerte. Auf der Heimfahrt überkam ihn ein Anflug von Euphorie. Der Tee hatte seinen Magen wieder in Ordnung gebracht, und die ungewohnte Unverschwommenheit, mit der er den Mittelstreifen sehen konnte, sowie das Gefühl, dass sie ihm bei einer Kontrolle nichts anhaben konnten, versetzten Kreuthner in Ekstase. Lustvoll flog er durch die Nacht, nüchtern wie ein Säugling und unantastbar. Einen ersten Knacks bekam dieses Hochgefühl, als am Straßenrand etwas rot aufblitzte.
»Da hammas aber eilig g’habt, Herr Kollege.« Es war natürlich Greiner, der ihn kontrollierte. »Was schätz ma denn, hamma draufg’habt?«
»Keine Ahnung. Schau net ständig aufn Tacho. Achtzge?«
»So! 142 han’s gwen. Minus drei Prozent, han’s 137. Macht dann – wart grad …«, Greiner blätterte in einem Büchlein, obwohl Kreuthner sicher war, dass er den Bußgeldkatalog auswendig konnte, »… 240 Euro, zwoa Punkte, und der Lappen is aa weg.«
»He, Greiner – ich bin a Kollege …«
»Und?«
»Des macht ma net unter Kollegen.«
»Du, mir san fei net in der Bananenrepublik. Hier in Deutschland gelten die Gesetze für alle. Sogar für dich.«
»Herrschaftszeiten – ich fahr Streife. Ich brauch den Führerschein!«
»Jetzt beruhigen mir uns erst amal wieder. Und dann blast amal da eina.« Greiners Kollege war dazugetreten und hielt Kreuthner ein Alkoholmessgerät hin. »Is freiwillig. Aber das weißt ja selber.«
Kreuthner nahm das Gerät, setzte an, blies nach Kräften hinein und gab es mit trotziger Geste an Greiner weiter. Der schaute auf die Anzeige und runzelte die Stirn.
»Sappralot! Ja gibt’s des aa? Der Kreuthner fahrt nüchtern Auto.« Er gab das Messgerät mit einem Lachen an den Kollegen zurück, der ebenfalls fassungslos den Kopf schüttelte. »Ja gratuliere. Bist schwanger?« Dem folgenden Heiterkeitsausbruch der im Dienst befindlichen Kollegen mochte Kreuthner sich nicht so recht anschließen. »Ja dann bleibt’s beim Speeding. Kriegst bald a Brieferl«, sagte Greiner und händigte Kreuthner seine Papiere wieder aus.
»Jetzt wart halt amal. Des kann man doch auch irgendwie anders regeln.«
Greiner sah Kreuthner irgendwie nachdenklich-amüsiert an, trat schließlich etwas näher und sagte mit gesenkter Stimme: »Zum Beispiel – dass ma uns deine 240 Euro brüderlich teilen?«
»Greiner, jetzt redst des erste Mal koan Schmarrn.« Auch Kreuthner hatte seine Stimme gesenkt, obwohl außer dem anderen Kollegen niemand zuhören konnte. »An was hättst so denkt?«
»Ja brüderlich halt – achtzge, achtzge, achtzge.«
»Sangma an Fuchzger für jeden und a Flasch’n Obstler obendrauf.«
Kreuthner war jetzt in seinem Element und wartete auf das nächste Angebot von Greiner. Aber der sah Kreuthner nur stumm an. Schließlich sagte er: »Des war a Witz. Und jetzt schleich di, sonst gibt’s noch a Anzeige wegen Beamtenbestechung.«
Das Böse hatte für Kreuthner von dieser Stunde an einen Namen: Greiner. Und Kreuthner würde von jetzt an wachsam und geduldig sein und warten, bis sie kommen würde: die Gelegenheit zur Rache. Den einen Monat Fahrverbot schob Kreuthner vor sich her, bis es nicht mehr länger ging. Und so kam es, dass er ausgerechnet im Fasching seinen Führerschein abliefern musste.
1
Miesbach, 31. Januar 2016, 23:02 Uhr
Die Nacht war eisig. Eine Atemwolke hüllte Clemens Wallner ein, als er aus dem Taxi stieg. Entgegen seiner Gewohnheit war Wallner aufgewühlt. Er hatte Stefanie Lauberhalm besucht, eine aus zwei Gründen bemerkenswerte Frau: Zum einen übte sie den Beruf der Hexe aus. Sie bot über ihre Website Kurse zum Thema Grundwissen Magie, Kräuterkunde, Heilen mit Steinen und Zaubersprüche für jeden Anlass an. Außerdem konnte man Stefanies magische Fähigkeiten buchen, um gegen Krankheiten, Depressionen oder böse Geister im Garten vorzugehen. Zum Zweiten war Stefanie die Erziehungsberechtigte von Olivia, einem Mädchen von zwölf Jahren – Wallners Stiefschwester, von der er lange Jahre nichts gewusst hatte. Eine seltsam gewundene Fügung des Schicksals hatte die beiden Stiefgeschwister vor zwei Jahren zusammengeführt.
Wallner stand in der kalten Nacht und blickte zu dem Zimmer im ersten Stock, in dem sein Großvater Manfred schlief. Es war dunkel. Auch sonst brannte kein Licht im Haus. Wallner wunderte sich. Manfred ging selten vor Mitternacht ins Bett. Aber Wallner musste reden. Was er erfahren hatte, war so außerordentlich, dass es keinen Aufschub duldete.
Das Haus war still. Wallner hängte die Daunenjacke an die Garderobe und lauschte. Der Kühlschrank sprang an. Sonst war nichts zu hören.
Die Tür zu Manfreds Zimmer stand offen. Vor der Zimmertür blieb Wallner stehen und starrte in die Dunkelheit. Das Flurlicht fiel als dünner Streifen auf die Schleiflackkommode. Stille. Kein Atmen, kein Schnarchen. Wallner spürte ein drückendes Gefühl im Hals. War jetzt der Moment gekommen, vor dem er sich seit Jahren fürchtete? Wallner hatte immer gehofft, dass sein Großvater friedlich in seinem Bett sterben würde. Aber jetzt wäre wirklich ein ganz beschissener Zeitpunkt.
»Manfred?« Wallners Stimme war leise und belegt. Keine Antwort. Er klopfte. »Bist du im Bett?«
Wallner schob die Tür auf. Der Lichtstreifen wurde breiter und fiel auf das Bett. Es war leer.
Beunruhigt rumpelte Wallner die Treppe nach unten, ging in die Küche, suchte nach einem Zettel auf dem Küchentisch. »Bin kurz weg, um zwölf wieder zurück.« Aber das wäre absurd. Nie im Leben würde Manfred einfach nachts das Haus verlassen, noch dazu, ohne Wallner etwas zu sagen.
Wallner riss die Wohnzimmertür auf. Der Raum war leer, wie das ganze Haus. Wallner durchkämmte es vom Dachboden bis in den Keller. Als alles durchsucht war, setzte er sich an den Küchentisch, atmete langsam ein und aus und zwang sich, vernünftig nachzudenken. Eigentlich gab es nur eine Erklärung: Manfred war in einen Zustand der Orientierungslosigkeit geraten. Durch einen Schlaganfall, eine Gehirnblutung oder erste Symptome von Demenz. Er hatte das Haus verlassen und irrte jetzt durch die Nacht. Wallner hastete zur Garderobe. Die Daunenjacke seines Großvaters hing dort. Er war ohne Jacke in die Kälte hinausgegangen.
Wallner beschloss, Manfred zu suchen. Doch die Autoschlüssel waren weg. Sie lagen immer in dem Murano-Aschenbecher vor dem Garderobenspiegel. Immer. Warum jetzt nicht? Herrgott … Um keine Zeit zu verlieren, nahm er den Reserveschlüssel aus der Schublade, verließ das Haus, ohne abzuschließen, und öffnete das Garagentor. Leer. Wie um alles in der Welt … Die Garage war tatsächlich leer.
Wallner rief bei der Polizei an und schilderte die Lage. Der Polizist in der Telefonzentrale versprach, nach Wallners Wagen und Manfred suchen zu lassen.
Wallner hatte das Bedürfnis, einen Schnaps zu trinken, beließ es aber bei Mineralwasser. Beklemmung legte sich auf seine Brust. Um wenigstens irgendetwas zu tun, setzte sich Wallner an seinen Laptop und verfasste eine Liste von Orten im Landkreis, an denen Manfred früher öfter gewesen war, vor allem in seiner Kindheit, denn das war die Zeit, an die sich demente Menschen am besten erinnerten. Aber wieso sollte Manfred mit einem Mal dement geworden sein? Wallner schob den Gedanken zu den vielen anderen ungelösten Fragen dieses Abends und mailte die Liste an die Polizei.
»Schaust du mal bitte in deine Mail«, sagte er zu dem Kollegen in der Telefonzentrale. »Ich hab dir da eine Liste geschickt.«
»Hab’s schon aufgemacht. Alles klar.«
»Das sind Orte, wo Manfred vielleicht hinwill.«
»Ja. Steht drauf.«
»Vielleicht wenn ihr da schwerpunktmäßig …«
»Alles klar. Ich schick die Liste raus.« Der Kollege klang ein wenig ungeduldig.
»Tausend Dank. Und bitte in jedem Fall anrufen. Ich bin auf.«
»Wart mal kurz«, sagte der Kollege. »Da kommt grad was rein.« Er drückte Wallner in die Warteschleife. Wallner behielt den Hörer am Ohr. Als sich der Beamte nach über einer Minute noch immer nicht gemeldet hatte, wuchs die Panik. Wallner wippte mit dem Oberkörper und kaute an der Nagelhaut. Nach endlosen zwei Minuten ein leises Knacken in der Leitung.
»So, da bin ich wieder.« Der genervte Unterton war verschwunden, und das beunruhigte Wallner. Die Stimme des Kollegen kam Wallner belegt und gehemmt vor.
»Was war jetzt?«
»Es is alles a bissl unübersichtlich. Der Schartauer is zu einem Haus gerufen worden und … also da is er jetzt …« Der Beamte zögerte.
»Was ist denn passiert? Warum ist er gerufen worden?«
»Nun … es is wohl eine Leiche gefunden worden.« Er kam nicht weiter. Dem Kollegen in der Telefonzentrale schien die Luft ausgegangen zu sein.
»Was für eine Leiche? Mann, jetzt sag halt endlich!« Wallner war aufgestanden und lief um den Küchentisch herum.
»Sie haben den Toten noch nicht identifiziert. Aber es ist anscheinend ein … älterer Mann und … dein Wagen steht vor dem Haus.«
2
Wirtshaus Mangfallmühle, 22:40 Uhr
Atemlos durch die Nacht …« Der Mann auf der Bühne sang mit Leidenschaft und geschlossenen Augen, schwarze Korkenzieherlocken reichten ihm bis über die Schultern. Auf dem Tanzboden wogten Leiber und Gesichter, ekstatisch, schweißnass, Münder öffneten sich und krächzten den Refrain ins Stroboskopfeuer. Die Hellsbells waren eigentlich eine AC/DC-Coverband, zeigten sich aber flexibel, wenn es der Anlass erforderte. Und der hier erforderte unzweifelhaft Helene Fischer. Einen Faschingsball ohne Atemlos konnte man auch gleich bleibenlassen.
Leonhardt Kreuthner tanzte wie ein Derwisch, die Wilderer-Lodenkotze wirbelte durch die Luft, den breitkrempigen Hut hatte er keck ins Genick geschoben, seine Hände flatterten auf Kopfhöhe, und er sandte schelmisch schmachtende Blicke zu der Frau, die ihm schräg gegenüber tanzte. Sie, in Zwanziger-Jahre-Paillettenkleid und Bubikopf-Perücke wie aus Cabaret entsprungen, lachte händeflatternd zurück, zog die Brauen hoch und schloss für einen Moment die Lider, wiegte sich im Rausch der Melodie, und als sie die Augen wieder öffnete, war ihr Blick umso tiefer. »Atemlos, schwindelfrei …«, ganz dicht tanzten sie aneinander vorbei, ihre feuchten, heißen Hände berührten sich kurz, »… großes Kino für uns zwei«, er roch ihr Parfum, es war blumig und schwer und nicht teuer.
Seit Jahren schon hatte Kreuthner ein Auge auf Michaela Hundsgeiger geworfen, Friseurin in Rottach-Egern. Vor zehn Jahren war sie überaus begehrt gewesen im Tal, und die smarten Anwalts- und Chefarztsöhne hatten sich um sie gerissen. Keine Chance für einen einfachen Polizisten ohne 325i Cabrio. Inzwischen ging die Hundsgeigerin auf die vierzig zu, und keiner der Anwalts- und Chefarztsöhne hatte sie geheiratet. Nein, ihr Freund war Mechatroniker mit schmutzigen Fingernägeln. Genauer gesagt war er bis vor vier Wochen ihr Freund gewesen. Da hatte sie ihn in die Wüste geschickt. Was wiederum bedeutete, dass jetzt, endlich, nach all den Jahren Kreuthners Chance gekommen war. Heute Nacht musste es passieren!
»Was tätst du machen, wennst morgen, sagen wir, eine Million gewinnen tätst?« Kreuthner stand mit Michaela an der Bar, und sie tranken jeder einen Cocktail mit kleiner Glitzerpalme drauf.
»Eine Million!« Michaela umschloss nachdenklich den Strohhalm mit ihren vollen, tomatenroten Lippen. Die letzten Cocktailreste gurgelten zwischen zerstoßenem Eis.
Kreuthner wurde heiß bei diesem Anblick, aber er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Also? Was tätst machen mit dem Geld?«
Michaelas Blick wurde ernst. »A eigenes Haus tät ich kaufen. Und a Bibliothek müsst drin sein wie in am englischen Schloss.« Sie presste die Lippen zusammen und nickte heftig und entschlossen. »Was tätst du denn mit der Million machen?«
»Jedenfalls kein Haus kaufen. Ich hab ja schon eins.« Kreuthner ließ kurz die Bilder des Anwesens zwischen Gmund und Hausham Revue passieren, das er vor einigen Jahren von seinem Onkel Simon geerbt hatte. Haus war ein dehnbarer Begriff, aber solange das Dach noch drauf war, sagte sich Kreuthner, war’s ein Haus und keine Ruine. Kreuthner bewohnte im Wesentlichen die Wohnküche, der Rest war heruntergekommen, und die Tapeten aus den sechziger Jahren blätterten von den Wänden. Überdies hatte er letzte Woche beim Destillieren von Apfelschnaps einen Brand im ehemaligen Stall ausgelöst und die Männer der Haushamer Feuerwehr mit einer Flasche Obstler für jeden davon überzeugen müssen, dass sie Kabelbrand in den Bericht schrieben. Abgesehen von dem unschönen Anblick, den die rußgeschwärzten Mauern boten, hatte sich ein beißender Geruch in allen Räumen des Hauses festgesetzt.
»Der Sennleitner hat g’sagt, es wär recht derhaut«, sagte Michaela.
»Wie? Mein Haus? Des kennt der doch gar net.«
»Doch. Irgendwo zwischen Gmund und Hausham, hat er g’sagt.« Sie beugte sich vor, und ihr Ton wurde verschwörerisch. »Und hinten wär a Schwarzbrennerei drin.«
»Ach des!« Kreuthner lachte und schüttelte amüsiert den Kopf. »Des, hat er gedacht, is mein Haus? So ein Depp.«
»Des g’hört gar net dir?«
»Doch. Das hab ich mal geerbt. Aber da plan ich grad die Renovierung. So als Sommerhaus.«
Michaela nickte beeindruckt. »Und dein richtiges Haus?«
»Äh … is net weit von hier.« Konkreter konnte Kreuthner nicht werden, da er gerade fieberhaft überlegte, wo sein angeblich richtiges Haus stehen und wie es aussehen sollte.
»Mit Bibliothek?«
»Ja was glaubst denn du? A Haus ohne Bibliothek is … a Kuhstall. Da brauchst gar net ’s Bauen anfangen.«
»Tät ich mir gern mal anschauen.«
Kreuthner schluckte. Die Frau wollte zu ihm nach Hause kommen! Die Sache nahm Formen an. »Ja gern. Äh … wann denn?«
Michaela zuckte mit den Schultern und lächelte. »Jetzt?«
Kreuthner schoss das Adrenalin bis in die Ohren. »Okay …« Er lachte erfreut. Doch das überraschende Angebot warf Fragen auf. Vor allem die: Wo auf die Schnelle ein Haus mit Bibliothek hernehmen? Einen Freund bitten, ihm seins zur Verfügung zu stellen? Von Kreuthners Spezln hatte keiner in seinem Leben je freiwillig ein Buch gelesen, geschweige denn dass er eine Bibliothek besaß.
»So«, lächelte Kreuthner etwas verunsichert, »da willst du also mein Haus anschauen.«
»Ja. Wieso? Hast net aufg’räumt?« Michaela klimperte schelmisch mit ihren dunklen Wimpern. Dann sah sie ihn mit halb geschlossenen Augen an, und Kreuthner wurde es ganz anders.
»Muss nur noch was klären. Dann kann’s losgehen.« Er winkte Harry Lintinger, dem Wirt der Mangfallmühle, der mit Fliege, Weste und einem Bowler auf dem Kopf hinter dem Tresen stand und sich heute Abend ganz dem Mixen von teuren Drinks aus preiswerten Zutaten widmete. »Machst der Michi noch an Sex on the Beach?« Harry nickte. Kreuthner legte seine Hand auf Michaelas Unterarm und sagte: »Bin gleich wieder da.«
Auf der Toilette wählte Kreuthner eine Nummer mit dem Handy an. Der Anrufbeantworter meldete sich, und ein Mann namens Klaus Wartberg bat darum, eine Nachricht zu hinterlassen. Kreuthner beendete die Verbindung und schien zufrieden.
Zurück im Gastraum, frönten die Hellsbells ihrer wahren Berufung und rockten den Saal mit You Shook Me All Night Long von AC/DC. Auch Michaela war wieder auf der Tanzfläche, hatte die Hände über den Kopf gehoben und bewegte die Hüften im stampfenden Rhythmus. Kreuthner winkte ihr zu und versuchte zu signalisieren, dass sie demnächst aufbrechen könnten. Harry Lintinger hatte Michaelas Drink mittlerweile aus viel Tetrapack-Orangensaft, Eis, Obstler und einem undefinierbaren Fruchtsirup zusammengegossen. Zum Schluss kam die Glitzerpalme drauf.
»Du, Harry …«, Kreuthner kam hinter den Tresen und stellte sich dicht neben den Wirt, um nicht schreien zu müssen, »… ich bräucht mal den Schlüssel vom Wartberg.«
»Wozu?« Lintinger stellte den Cocktail auf den Tresen.
»Kriegst die nächste Lieferung umsonst.« Kreuthner meinte den schwarzgebrannten Obstler, den er Lintinger gelegentlich verkaufte und der heute geballt zum Einsatz kam.
»Was willst denn mit dem Schlüssel?«
Kreuthner deutete in Richtung Tanzfläche, wo Michaela weiter die Hüften kreisen ließ und Kreuthner eine Kusshand zuwarf. Kreuthner erwiderte die Zärtlichkeit.
»Du tickst ja net richtig«, raunte Lintinger. »Der Wartberg ist doch da.«
»Na. Is er net. Die Lara hat g’sagt, er wollte wegfahren. Und er geht net ans Telefon.«
Lintinger sah Kreuthner skeptisch an. Klaus Wartberg war ein Mann in den Sechzigern, der in einem einsam gelegenen Haus wohnte, ein paar Kilometer von der Mangfallmühle entfernt. Lara Evers, eine junge Frau, die ab und zu in der Mangfallmühle bediente, kannte Wartberg. Wie gut sie ihn kannte und was die beiden miteinander hatten, wusste keiner genau. Aber Lara hatte einen Schlüssel zum Haus. Für zweihundert Euro hatte Lintinger ihre Erlaubnis bekommen, einen Nachschlüssel anzufertigen. Nicht dass Lintinger in das Haus einbrechen wollte. Aber sollte Wartberg, der anscheinend weder Freunde noch Familie hatte, eines Tages plötzlich verschwinden oder sterben, könnte man mit etwas Glück ein paar wertvolle Dinge aus dem Haus holen, ohne dass es einer mitkriegte.
»Bist sicher, dass er net da is?« Lintinger befüllte ein Cocktailglas mit Wermut sowie einem Schuss von Kreuthners Eigenbrand-Obstler und gab anschließend eine Kompottkirsche aus der Dose dazu.
»Um die Uhrzeit geht der doch noch ans Telefon, wenn er da ist.«
Lintinger stellte das Cocktailglas vor einer Indianersquaw auf den Tresen. »Einen Manhattan, die Dame!« Er überlegte kurz. Dass Wartberg weggegangen war, etwa zu einem Faschingsball, konnte man ausschließen. Wartberg ging abends nie weg.
»Zwei Kisten. Vierundzwanzig Flaschen.« Lintinger hielt Kreuthner den Hausschlüssel hin.
»Zwanzig.«
»Vierundzwanzig.«
Kreuthner sah zur Tanzfläche. Dort wurde Michaela gerade von Spiderman angetanzt. Kreuthner gab auf und ließ sich den Schlüssel aushändigen.
Jetzt musste er nur noch hinkommen zu Wartbergs Haus. Das war ohne Führerschein leider nicht so einfach. Aber es gab Lösungen: Kreuthners Blick fiel auf eine Gestalt, die am anderen Ende des Saales an einem Tisch saß: schwarzer Schlapphut, kreidebleiches Gesicht mit schwarz umrandeten Augen. Das geisterhafte Männlein saß vor einem Glas Bier mit Bierwärmer, hinter ihm an der Wand lehnte eine Sense …
3
Schal-ten!« Der Zeiger des Tourenzählers näherte sich der Marke sechstausend, und Kreuthners Stimme klang ungeduldig.
»Mach ich ja!« Am Steuer des alten Audi A4 Avant saß Manfred Wallner, 86, mit Schlapphut und schwarzem Umhang. Die Oberkörper der Wageninsassen ruckten nach vorn und wieder zurück.
»Des is die Bremse, Herrschaftszeiten!« Kreuthner dirigierte Manfred vom Beifahrersitz aus.
»Das hab ich auch g’merkt. Bin ja net blöd. Die is jetzt weiter links wie früher.«
»Nein, die is da, wo sie immer war. Drückst jetzt endlich mal auf die Kupplung?«
Manfred musste seinen linken Fuß ziemlich strecken, um an das Pedal zu kommen. Deswegen und weil er dabei nach unten sah, stieß die Krempe seines Schlapphutes ans Lenkrad und schob sich über die Augen.
»Verflucht – i siech nix mehr!«
Kreuthner schob den Hut wieder nach hinten und griff ins Lenkrad, denn der Wagen hatte Richtung Straßengraben abgedreht. »Bleib auf der Kupplung. Ich schalt jetzt.«
Kreuthner legte die linke Hand an den Gangknüppel, nahm sie aber sofort wieder weg und drehte Manfreds Kopf in Richtung Windschutzscheibe.
»Du musst net auf meine Hand schauen, wenn ich schalte. Schau auf die Straß.« Kreuthner schaltete. »Gang is drin!«
Der Motor heulte auf.
»Lass die Kupplung los, aber lang …«
Kreuthners Satz wurde abgewürgt, der Wagen machte einen Satz nach vorn.
»Langsam!«
»Ja, ja.«
Kreuthner sah nach hinten. Michaela Hundsgeiger hielt den oberen Teil einer Sense umklammert und sah Kreuthner mit ängstlichen Augen an.
»Das wird schon«, sagte Kreuthner. »Er is nur a bissl aus der Übung.«
Kreuthner hatte Manfred am frühen Abend gebeten, ihn zur Mangfallmühle zu fahren. Dort fand der Striezelball statt, der berüchtigt war für seine Ausschweifungen vor allem erotischer Natur. Es hatte daher nicht viel Mühe gekostet, Manfred zu überreden. Schlapphut, schwarzer Umhang und die alte Sense aus dem Schuppen – schnell war das Boandlkramerkostüm improvisiert, und los ging die wilde Sause. Früher hätte Kreuthner keine Skrupel gehabt, auch ohne Führerschein zu fahren. Aber viel konnte er sich nicht mehr leisten im Polizeidienst. Da Manfred streng genommen nicht mehr in der Lage war, einen Pkw zu steuern, übernahm Kreuthner das Schalten und gelegentlich auch das Lenken, und so erreichten sie im Schneckentempo, aber lebend die Mangfallmühle. Jetzt steuerte Manfred den Wagen in Richtung des Wartbergschen Anwesens. Kreuthner hatte Manfred gefragt, ob er nicht Lust auf einen netten Abend zu dritt mit der Michaela hätte. Der genauere Ablauf dieser Veranstaltung blieb etwas nebulös. Aber Manfred hatte offenbar hochfliegende Erwartungen. Jedenfalls war Michaela sehr nach seinem Geschmack.
Der Audi näherte sich auf der verschneiten Nebenstraße einem einsam gelegenen ländlichen Anwesen.
»Ja Wahnsinn!«, sagte Michaela Hundsgeiger, als das Haus im Scheinwerferlicht auftauchte.
»Des is der derhaute Bauernhof von dir?« Manfred blickte mit starrem Blick nach vorn.
»Des is mein Haupthaus«, erklärte Kreuthner vom Beifahrersitz aus.
»Sein Haupthaus!« Manfred entließ ein hohes, heiseres Greisenlachen aus seinem bleich geschminkten Gesicht und drehte sich zu Michaela. »Is mir ja wurscht, wem des Haus g’hört. Hauptsach, mir drei ham an schönen Abend.«
»Schau auf die Straß, zefix!« Kreuthner griff zum wiederholten Mal ins Lenkrad und verhinderte, dass sich der Wagen in den Schneewall am Straßenrand bohrte.
Die Grundstückseinfahrt war offen. Das kam Kreuthner einerseits gelegen, denn er wusste nicht, ob der Hausschlüssel auch für das Tor passte. Andererseits irritierte es ihn. Wenn jemand für einige Zeit wegfuhr, wie Lara das von Wartberg behauptet hatte, machte er ja wohl das Tor zu. War Wartberg doch zu Hause? Und war das sein Motorroller, der neben der Haustür stand? Kreuthner klingelte, bevor er die Haustür aufschloss.
»Was klingelst denn? Is doch dein Haus«, fragte Manfred, der mit der Sense in der Hand hinter Kreuthner stand.
»Vorsichtsmaßnahme. Wenn Einbrecher im Haus sind.«
Manfred und Michaela sahen Kreuthner fragend an.
»Wenn ich einfach neigeh, san die überrascht, und dann geraten s’ in Panik und alles Mögliche kann passieren. Verstehts?«
Michaela nickte ein wenig besorgt. Manfred sah sich nervös um und murmelte, Kreuthner könne seiner Großmutter erzählen, dass das sein Haus sei. Kreuthner trat einen Schritt von der Eingangstür zurück und betrachtete die Fassade. Aber weder ging hinter einem der Fenster Licht an, noch hörte man etwas.
»Alles sauber.« Kreuthner steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn. Abermals musste er sich wundern. Die Tür war nur zugezogen, nicht abgesperrt.
»Hast gar net abg’sperrt?«, krächzte Manfred.
»Typisch Polizist«, scherzte Kreuthner in Richtung Michaela. »Ich vergess es immer wieder.« Dann betrat die seltsame Combo aus Wilderer, Sensenmann und Charleston-Girl in falschem Pelzmantel das Haus.
Kreuthner fingerte eine Weile an der Wand herum, bis er nach dem Öffnen der Tür den Lichtschalter gefunden hatte. »Dann mal rein in die gute Stube!«
Sie standen in einem langen Flur mit Garderobe, von dem mehrere Türen abgingen. Eine Tür führte in die Küche, eine andere ins Bad, was unverkennbar war, denn die Türen standen offen. Bei den anderen war weniger klar, wo sie hinführten. Kreuthner nahm Michaelas Kunstpelzmantel und hängte ihn an die Garderobe, wo bereits ein hellbrauner Herrenmantel hing. Manfred wollte seine Sachen lieber anbehalten.
»Dann mach ma’s uns mal gemütlich.« Kreuthner öffnete Michaela beherzt die mittlere Tür. Doch befand sich dahinter weder das Wohnzimmer noch eine Bibliothek, sondern die Besenkammer.
Michaela sah Kreuthner verwirrt an.
Kreuthner knallte lachend die Tür zu. »War a Spaß.« Die nächste Tür traf es besser. Sie führte ins Wohnzimmer.
Nicht nur ein offener Kamin zierte den Raum. An den Wänden prangten überdies Bücherwände bis zur Decke. Michaela war entzückt. Auf dem Couchtisch waren allerdings zwei gebrauchte Whiskygläser und mehrere angebrochene Flaschen mit Spirituosen.
»Hab wieder net aufg’räumt. Sorry.«
Manfred, die Sense mit knochiger Hand umklammernd, äugte unter seinem Schlapphut im Raum umher und warf Kreuthner einen besorgten Blick zu. Ihm schwante, dass hier etwas nicht in Ordnung war. Michaela hatte sich inzwischen vor einem der Bücherregale aufgestellt.
»Mei is des schee! Hast die alle g’lesen?«
»Fast alle. A paar sogar zweimal.« Manfred prustete in die rechte Hand, die er sich vor den Mund hielt. »Ja! Is gut!«, fauchte ihn Kreuthner an und wandte sich wieder an Michaela. »Magst was trinken?«
»Gern. An Sex on the Beach«, sagte sie und verabschiedete sich zum Frischmachen ins Bad.
»Für mich a Bier«, sagte Manfred und ließ sich ächzend auf einen Sessel niedersinken.
Kreuthner sah Michaela hinterher, wie sie in ihrem Glitterkostüm im Flur verschwand. »Okay. Jetzt pass amal auf.« Kreuthner setzte sich zu Manfred auf die Sessellehne und senkte die Stimme. »Des hast ja bestimmt schon g’merkt, dass die Michaela scharf is auf mich.« Er wurde noch leiser und eindringlicher: »Da geht was heut Nacht!« Gevatter Tod schwieg und schien nachzudenken. »Und äh … deswegen wär des super von dir, wenn du … na ja, dich a bissl zurückziehen tätst. Da hättst echt was gut bei mir.«
»Du hast was von am Abend zu dritt g’sagt!« Manfred legte anscheinend wenig Wert darauf, bei Kreuthner was gutzuhaben.
»Was hast dir denn da vorg’stellt? Glaubst, die will dir was?«
Manfred machte eine vage Geste.
»Jetzt komm! Irgendwo muss man auch realistisch bleiben.«
Auf dem Weg zur Toilette kam Michaela an einer offenen Tür vorbei. Ein flüchtiger Blick genügte, um ein Bett zu erkennen. Sie hielt an, zögerte kurz und betrat das Zimmer. Es war dunkel, nur das Licht vom Gang fiel herein. Michaela betätigte den Schalter neben der Tür und staunte: Auch in diesem Zimmer gab es Bücherregale bis zur Decke. Oben an den Regalen waren längliche Lampen angebracht, um die Bücher zu beleuchten. Neben dem Bett drei Lamellentüren aus dunklem Holz. Eine Deckenlampe gab es nicht. Doch die Bücherleuchten und eine Nachttischlampe sorgten für angenehmes, einem Schlafzimmer angemessenes Licht.
Das Bett lag, bis auf den Teil, auf den das Licht der Nachttischlampe fiel, im Halbschatten. Michaela musste daher zweimal hinsehen, bis sie begriff, was sie sah: Die Bettdecke wölbte sich ungleichmäßig. Da lag etwas. Sie trat einen Schritt näher und sah graue Haare, die unter der Decke hervorschauten. Michaela entfuhr ein leiser, aber spitzer Schrei, mehr ein hochfrequenter Pfiff. Sie schlug die Hand vor den Mund.
»Dann musst mich wenigstens ihrer Mutter vorstellen.« Die Verhandlungen zwischen Manfred und Kreuthner waren noch im Gang. Kreuthner schüttete währenddessen verschiedene Alkoholika in ein großes Glas in der Hoffnung, einen akzeptablen Drink zu produzieren. Aber Whisky und Curaçao ergaben einen irgendwie ungesunden Farbton, und der Geschmack der Mischung stand dem Aussehen in nichts nach. Gerade überlegte Kreuthner, ob ein Schuss Angostura die Sache reparieren konnte, als er Schritte hörte.
»Pscht!«, sagte er zu Manfred. In der Tür glitzerte es. Michaela starrte Kreuthner an. Der Schrecken war ihr wie ins Gesicht gestanzt.
»Da … ist einer in deinem Bett.« Sie atmete flach, und ihr Kinn zitterte.
»Ah ja!?« Auch Kreuthner fuhr es gehörig in die Glieder, und sein erster Gedanke war, das Haus fluchtartig zu verlassen. Aber das hätte einen ziemlich uncoolen Eindruck auf Michaela gemacht.
»Wer is’n des?« Michaelas Stimme klang brüchig.
»Ich … ich überlege gerade, ob jemand zu Besuch kommen wollte.«
»Ich hab’s ja g’wusst«, lamentierte Manfred leise und schob den Schlapphut noch tiefer in die Stirn.
Michaela stand ratlos in der Tür, sah Kreuthner an und erwartete offenbar eine Antwort auf die Frage, was jetzt passieren sollte.
»Is er aufg’wacht?«
»Glaub net. Wieso?«
»Jetzt fällt’s mir wieder ein! Des ist der Onkel Willy. Der hat an Schlüssel.«
»Der schläft in deinem Bett?«
»Der is sehr … krank. Am Herz. Wir müssen a bissl leise sein und nach oben gehen.« Kreuthner hoffte, dass sich im ersten Stock irgendein Gästezimmer oder wenigstens eins mit Couch befand. Die Vernunft hätte geboten, möglichst schnell das Feld zu räumen, bevor der Hausherr sie entdeckte. Aber Kreuthner wollte auf keinen Fall die gute Chance vertun, Michaela ins Bett zu bekommen. Immerhin war Wartberg nicht aufgewacht, als sie das Schlafzimmer betreten hatte. Das gab Kreuthner Hoffnung, dass der Mann entweder einen gesunden Schlaf hatte oder betrunken war.
»Oh, verdammt!« Michaela hatte eine Hand unter ihrer Zwanziger-Jahre-Perücke am rechten Ohr.
»Was is?«
»Mein Ohrring. Ich glaub, der is mir im Schlafzimmer runtergefallen.«
»Ich hol ihn dir. Kein Problem.« Kreuthner drängte sich an Michaela vorbei hinaus in den langen Flur. Er ging auf Zehenspitzen, so gut ihm das mit den Wilderer-Bergstiefeln möglich war. Vor der offenen Schlafzimmertür blieb Kreuthner stehen und checkte die Lage. Es war ruhig dadrin. Kein Rascheln, Atmen, Husten oder Schnarchen. Der Raum war mit hochflorigem Teppichboden ausgelegt, was leises Betreten erleichterte. Kreuthner machte zwei Schritte über die Schwelle und verschwand in dem dunklen, nicht vom Flurlicht beschienenen Teil des Zimmers. Dort hielt er inne und gab seinen Augen Zeit, sich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Michaelas Ohrring lag auf der Bettdecke. Und unter der Bettdecke lag ganz offensichtlich jemand. Kreuthner konnte aber kein Gesicht sehen. Am oberen Ende der Decke schauten lediglich einige graue Haupthaare hervor.
Vorsichtig trat Kreuthner neben das Bett und hob den glitzernden Ohrring von der Decke, sehr langsam und darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen. Dann ging er noch einen halben Schritt weiter. Er war neugierig und wollte sehen, wer da unter der Decke lag. Es war ein älterer Mann. Vermutlich der Hausbesitzer Wartberg. Ein Zucken ging durch Kreuthner: Der Mann … sah ihn an. Die Augen standen offen und auch der Mund. Vorsichtig hielt Kreuthner den Handrücken vor die Nase des Mannes. Nichts, kein Hauch. Er war offensichtlich tot. In der Bettdecke entdeckte Kreuthner jetzt mehrere Löcher, auch lagen Federn im Raum herum.
»Hast ihn?«, flüsterte es mit einem Mal von hinten. Michaela stand in der Tür.
Kreuthner bedeutete ihr mit einer wedelnden Handbewegung wegzugehen und beeilte sich ebenfalls, das Schlafzimmer zu verlassen. Einen Augenblick später war er draußen auf dem Flur und zog die Schlafzimmertür hinter sich zu.
»Hier, der Ohrring.« Kreuthner reichte ihn Michaela, die ihn gleich anlegte.
»Ist das jetzt dein Onkel Willy dadrin?«
Kreuthner nickte, dachte aber nach. Der Mann im Bett war tot. Das erklärte auch, warum er bei ihrem Eindringen nicht aufgewacht war. War der Mann eines natürlichen Todes gestorben? Oder war hier ein Mord geschehen? Was waren das für Löcher in der Bettdecke? Wie auch immer – er müsste eigentlich die Polizei rufen. Aber dann konnte er sich die Nacht mit der Hundsgeigerin in die Haare schmieren. Wut und Verzweiflung wühlten Kreuthner auf. Er hätte heulen können. Einmal im Leben hatte er Glück. Die Frau, hinter der er so lange her war, wollte nachts zu ihm nach Hause! Und dann ging alles schief. Alles. Absolut alles! Konnte man die Polizei nicht erst in einer Stunde rufen? Nachdem man mit Michaela in den ersten Stock gegangen war? Dem Toten konnte es egal sein. Und überhaupt: Polizei rufen? Das hier war nicht sein Haus. Sie würden Fragen stellen, und Michaela würde erfahren, dass er sie angelogen hatte. Auch das sprach nach reiflicher Abwägung dafür … nun ja, das Beste aus der Sache zu machen.
»Ja, dann gemma nach oben, oder?« Kreuthner lächelte Michaela aufmunternd zu. Doch die stand unter Schock, und ihre Augen wurden jetzt so riesengroß, dass Kreuthner alles Weiß um die Iris sehen konnte.
»Und wer ist das?«, fragte Michaela.
Sie starrte auf einen Punkt in Kreuthners Rücken. Er drehte sich um.
Sie stand da wie ein Geist. Eine junge Frau in Jeans und Lederjacke, wirre Haare, orientierungsloser Blick aus verquollenen Augen. Kreuthner kannte sie. Es war Lara Evers. Die, die gesagt hatte, Wartberg sei weggefahren. In der Hand hielt sie eine Pistole.
»Lara«, sagte Kreuthner und ließ eine Pause, um ihre Reaktion abzuwarten. Es kam keine. Die junge Frau atmete heftig und in kurzen Stößen. »Bleib einfach ruhig.« Kreuthner bedeutete Michaela mit einer Handbewegung, dass sie weggehen sollte. »Lara – hörst mich?« Lara Evers starrte ihn an, aber es war nicht zu erkennen, ob sie Kreuthner tatsächlich wahrnahm. Dann, mit einem Mal, kam Leben in ihre Mimik. Sie riss die Augen auf, entließ einen markerschütternden Schrei, hob die Pistole – und schoss …
4
Der Streifenwagen, der Wallner abgeholt hatte, fuhr durch verschneite Wiesen und Waldstücke. Schon von weitem sah man die Blaulichter durch die Nacht zucken. Mehrere Einsatzfahrzeuge standen vor einem alten ehemaligen Bauernhaus, im Erdgeschoss weißer, an einigen Stellen abblätternder Putz, im ersten Stock dunkles Holz. Zwischen den Einsatzfahrzeugen Wallners eigener Audi A4 Avant.
Eiskalte Luft schlug Wallner entgegen, als er aus dem Wagen sprang. Er zog den Reißverschluss seiner Daunenjacke zu und ging mit schnellen, abgehackten Schritten zum Haus. In einiger Entfernung sah er seine Kollegin Janette Bode mit zwei Männern reden. Sie standen neben einem Wagen mit Rosenheimer Kennzeichen. Wallner schloss daraus, dass es die Kollegen vom Kriminaldauerdienst waren, die routinemäßig bei nächtlichen Gewaltverbrechen gerufen wurden. In dem Moment trat Schartauer aus der Tür und rief Wallner zu, er solle aufpassen und nicht außerhalb des von der Spurensicherung angelegten Trampelpfads herumlaufen. Wallner blieb vor Schartauer stehen.
»Ist es … Manfred?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Manfred ist auf der anderen Seite.« Schartauer deutete um das Gebäude herum. »Wir haben ihn hinters Haus gebracht.«
Wallner wurde schwarz vor Augen. Gleichzeitig spürte er, dass etwas nicht stimmig war. In Schartauers Ton lag Verwunderung, eine Art akustisches Kopfschütteln: Als wenn’s hier nicht schon genug Ärger gäbe, ist auch noch Manfred da. Das passte nicht zur Tragik der Umstände. Zum anderen konnte Wallner kaum glauben, dass sie Manfreds Leiche wegbrachten, noch bevor überhaupt eine vernünftige Untersuchung der Todesumstände begonnen hatte.
»Ihr habt … die Leiche bewegt?«
Verwunderung belebte Schartauers Mienenspiel. »Die Leiche?«
»Du hast gesagt, ihr habt Manfred hinters Haus gebracht.«
»Der Manfred ist doch net tot. Wie kommst denn da drauf?«
»Man hat doch einen alten Mann gefunden?«
»Ja. Aber des is wer anders.«
»Ah so? Gut.« Kurze Pause, Wallner musste seine Gedanken sortieren, durchatmen, Erleichterung rieselte durch seinen Körper. »Oder natürlich schlimm. Aber …« Wallner nahm die Brille ab und massierte seine Nasenwurzel. »Scheiße, ich bin völlig durch den Wind. Wieso ist mein Großvater hier?«
»Keine Ahnung. Frag ihn.«
Hinter dem Haupthaus lag ein kleines Wirtschaftsgebäude aus Holz mit Bundwerk im Obergeschoss. Die einstige Scheune des Hofes war zur Garage umgebaut worden. Vor dem Garagentor stand ein Rettungswagen. Darin saß eine junge Frau, die von einem Notarzt versorgt wurde. Zwei Polizisten standen anscheinend zur Bewachung daneben. Wallner sah sich um, konnte Manfred aber nicht entdecken. Fragend blickte er noch einmal zu Schartauer.
»Hinter dem Sanka! In der Garage!«
Wallner dankte und ging um den Notarztwagen herum. Mit einem Mal tauchten drei Gestalten wie aus einem Theaterstück vor ihm auf: ein Mann in Lederhose und Lodenkotze, Gamsbart am Hut; unter dem Hut schaute ein Kopfverband heraus. Neben ihm eine Frau mit Pelzmantel-Imitat, unter dem sie ein glitzerndes Paillettenkleid trug, an den Füßen Uggs, über der Schulter eine kleine Handtasche, in der zwei glitzernde Pumps steckten. Und schließlich – der Tod mit Sense in der Hand. Alle drei sahen Wallner an und schwiegen.
»Ich hab mir Sorgen gemacht«, sagte Wallner zum Sensenmann.
»Tut mir leid. Ich hab dir an Zettel hing’legt.« Manfred nestelte im Inneren seines schwarzen Umhangs. »Oder …?«
»Ich hab keinen Zettel gefunden. Wo hast ihn denn hingelegt?«
»Na, am Küchentisch …« Die knochigen Finger beförderten jetzt ein kleines quadratisches Stück Papier aus dem Umhang. »Also, ich wollt ihn hinlegen. Tut mir leid. In der Aufregung hab ich’s vergessen.« Er hielt Wallner den Zettel hin. »Das wär draufgestanden.«
BIN AUF DEM FASCHING stand auf dem Papier. Und weiter: KANN LÄNGER DAUERN, WARTE NICHT AUF MICH. Wallner gab den Zettel zurück, Unglauben im Blick. »Du warst auf dem Fasching!??«
»Mir waren zusammen«, sagte Kreuthner. »A bissl die tollen Tage genießen.« Kreuthner lachte.
»Mir is kalt. Kann ich endlich gehen?«, wandte sich die Frau an Wallner. Offenbar vermutete sie, dass er bei der Polizei was zu sagen hatte.
»Hat man Sie schon befragt?«
»Ich hab mit der Dame von der Kripo gesprochen.«
Wallner versicherte sich, dass man ihre Adresse hatte, und ließ Michaela Hundsgeiger gehen. Dann wandte er sich an die beiden Männer. »Wir müssen reden.«
5
Berlin, Frühjahr 1996
Amtsgericht Moabit, Schöffengericht. Die Angeklagte Miriam Cordes war hübsch anzusehen. Sie hatte Sommersprossen und grüne Augen. Die Kurzhaarfrisur und das geblümte Kleid der jungen Frau waren eine Spur zu brav für das, was man ihr vorwarf: Besitz von vierhundert Gramm Kokain in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Der Blick der jungen Frau: ängstlich.
Im Zeugenstand ein Beamter der Drogenfahndung. Die Richterin befragte ihn zu einer Razzia, in deren Verlauf auch Miriam Cordes kontrolliert worden war. In ihrer Lederjacke waren vier Päckchen mit jeweils einhundert Gramm Kokain gefunden worden. Als man Cordes Handschellen anlegen wollte, leistete sie Widerstand und schlug mit der Faust auf einen Beamten ein. Er erlitt eine Schnittwunde im Gesicht, weil die Angeklagte einen großen Totenkopfring am Finger trug – weswegen die Staatsanwaltschaft sie wegen gefährlicher statt einfacher Körperverletzung angeklagt hatte.
Die Vorsitzende hatte ihre Befragung jetzt beendet. Die Staatsanwältin war mit dem Ergebnis im Wesentlichen zufrieden, hakte bei zwei, drei Details nach und ließ es dabei bewenden.
»Herr Verteidiger?«, sagte die Vorsitzende.
Dieter Sitting, ein Meter fünfundachtzig, volles Haar, ergrauende Schläfen, schwarze Anwaltsrobe, nickte und sah den Zeugen einige Augenblicke an wie ein Bildhauer einen Steinblock vor der Entscheidung, wo er den Meißel ansetzen soll.
»Sie sagten, die Angeklagte hatte das Kokain in ihrer Lederjacke?«, begann er seine Befragung.
Der Polizist nickte.
»Hatte sie die Jacke an?«
»Nein. Sie hing über der Lehne ihres Stuhls.«
»Woher wussten Sie, dass es ihr Stuhl war?«
Der Beamte machte ein Gesicht, als habe man ihn etwas vollkommen Absurdes gefragt, riss sich aber zusammen. »Da war ein Tisch mit einer Sitzbank und drei oder vier Stühlen. Wir haben nur die Angeklagte in dieser Sitzgruppe angetroffen, und da hing auch nur eine Jacke. Wessen Jacke sollte das sonst gewesen sein?«
»Vielleicht waren vorher andere Leute da gesessen.«
»Das ist in der Tat zu vermuten. Es waren etliche Gläser auf dem Tisch. Aber die anderen sind verschwunden, als die Razzia begann.«
»Es ging vermutlich ziemlich chaotisch zu.«
»Die Leute werden logischerweise nervös, wenn wir kommen.«
»Gut. Aber dann könnte die Jacke ja einer dieser anderen Personen gehört haben.«
»Also erstens: Wenn ich abhaue, nehme ich ja wohl meine Jacke mit.«
»Wenn da vierhundert Gramm Kokain drin sind, und die Polizei ist im Raum? Dann würden Sie die mitnehmen?«
Gelächter aus dem Publikum. Der Beamte wartete, bis es stiller wurde, und überging die Frage.
»Und zweitens: Als wir die Jacke untersucht haben, war die Angeklagte äußerst nervös. Wir haben ihr das Kokain vorgehalten und gefragt, woher sie es hat. Daraufhin hat sie weggesehen und geschwiegen.«
»Also hat sie nicht zugegeben, dass es ihres war.«
»Jeder in so einer Situation sagt doch sofort, wenn ihm das Koks nicht gehört. Jeder.«
»Gibt es diese Statistik irgendwo schriftlich?«
»Ich bitte Sie. Was würden Sie denn machen, wenn ich Ihnen Koks unter die Nase halte und es gehört Ihnen nicht?«
»Na ja, ich bin Strafverteidiger. Vermutlich würde ich gar nichts sagen.«
»Aber jeder, der nicht Strafverteidiger ist, schreit Zeter und Mordio, wenn man ihn falsch beschuldigt. Fragen Sie irgendeinen anderen Polizisten, fragen Sie Psychologen.«
»Danke für den Tipp. Aber das ist im Augenblick nicht geplant. Ich darf kurz zusammenfassen …« Er wandte sich dem Gerichtstisch zu. »Die Polizei trifft die Angeklagte in dem Lokal alleine an einem Tisch mit mehreren Stühlen an. Sie ist im Übrigen nicht wie viele andere geflohen, was nach meiner Erfahrung eher dafür spricht, dass sie nichts verbrochen hat …«
»Sie war einfach zu stoned, um wegzulaufen«, warf der Kripobeamte ein.
»Darf ich den Gedanken kurz zu Ende führen? Danke. An einem der Stühle hängt eine Lederjacke, in der sich vier Beutel mit Kokain befinden. Die Polizei fragt die Angeklagte, ob ihr das Kokain gehört. Und sie macht was? Sie macht von ihrem Recht Gebrauch, sich nicht zu äußern. Es ist allgemein anerkannt, dass Schweigen in diesem Fall weder als Geständnis noch in sonstiger Weise negativ für die Angeklagte gewertet werden darf.«
Fassungsloses Kopfschütteln auf Seiten des Polizisten.
»Gibt es andere Hinweise, dass das Kokain im Besitz der Angeklagten war? Vermutlich nicht, sonst hätten Sie die sicher vorgetragen. Ich frage trotzdem: Fingerabdrücke etwa?«
»Die Plastikbeutel haben sich offenbar länger in der Innentasche der Jacke befunden. Durch das Stofffutter hatten sich die Fingerabdrücke so stark verwischt, dass sie nicht mehr verwertbar waren.«
»Fanden sich an der Jacke Fingerabdrücke der Angeklagten oder Haare?«
»Die … die Jacke konnte nicht sichergestellt werden.«
»Oh – wie das?«
»Die Lage war sehr chaotisch. Während wir die Angeklagte befragten, brach am anderen Ende des Lokals eine Schlägerei aus. Wir mussten den Kollegen zu Hilfe kommen.«
»Keiner ist bei der Angeklagten geblieben?«
»Doch. Eine Kollegin. Aber die hatte genug damit zu tun, die Angeklagte zu bewachen. Was genau passiert ist, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls war am Ende die Jacke nicht mehr da.«
Sitting ließ ein paar Sekunden verstreichen, um dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. Aber der Mann war erfahren und wusste, dass jedes weitere Wort die Sache verschlimmern würde. Schließlich sagte Sitting: »Gut. Dann halten wir das mal so fest: Es gibt keinen Beweis, dass die Jacke und damit das Kokain der Angeklagten gehörten. Und sie hat das auch nie zugegeben. Ich frage mich offen gesagt, auf welcher Grundlage die Anklage in dem Punkt fußt.«
Die Vorsitzende blickte zur Staatsanwältin, als würde sie eine ganz ähnliche Frage beschäftigen.
»Nun, ich bin durchaus der Meinung …«, die Staatsanwältin würgte an ihrer Argumentation, der es jetzt ein wenig an Durchschlagskraft gebrach, »… dass die … die Bewertung der … gesamten Umstände den Schluss erlaubt, nein, sogar erzwingt, dass sich das Kokain im Besitz der Angeklagten befunden hat.« Sie nahm mit den Schöffen Blickkontakt auf in der Hoffnung, dass deren von keinem Jurastudium verdorbenes Urteilsvermögen ihr recht geben würde.
»Wenn Sie das so sehen«, sagte die Vorsitzende. Mehr nicht. Damit war quasi amtlich, dass die Anklage in ihrem wichtigsten Punkt verloren hatte.