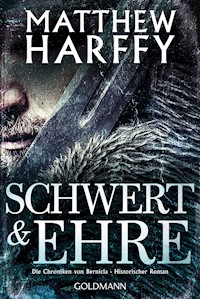
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Chroniken von Bernicia
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Große Schlachten, klirrende Schwerter, mutige Krieger – der Kampf um England hat begonnen.
Nordengland im Jahre 633: Nach dem Tod seiner Eltern folgt der junge Beobrand dem Vorbild seines Bruders Octa und zieht los, um sich dem Hof von König Edwin als Krieger anzuschließen. Auf dem gefährlichen Weg wird er überall mit Tod und Krieg konfrontiert. Die Menschen versuchen verzweifelt, die Kontrolle über ihr Schicksal zu erlangen, während die Kriegsherren im Land blutige Kämpfe um die Herrschaft austragen. Als Beobrand am Hof Edwards ankommt, ist er zutiefst erschüttert. Sein geliebter Bruder Octa ist tot, angeblich hat er Selbstmord begangen. Beobrand ist jedoch überzeugt, dass Octa ermordet wurde, und schwört bittere Rache ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Ähnliche
Buch
Nordengland im Jahre 633: Nach dem Tod seiner Eltern folgt der junge Beobrand dem Vorbild seines Bruders Octa und zieht los, um sich dem Hof von König Edwin als Krieger anzuschließen. Auf dem gefährlichen Weg wird er überall mit Tod und Krieg konfrontiert. Die Menschen versuchen verzweifelt, die Kontrolle über ihr Schicksal zu erlangen, während die Kriegsherren im Land blutige Kämpfe um die Herrschaft austragen. Als Beobrand am Hof Edwards ankommt, ist er zutiefst erschüttert. Sein geliebter Bruder Octa ist tot, angeblich hat er Selbstmord begangen. Beobrand ist jedoch überzeugt, dass Octa ermordet wurde, und schwört bittere Rache …
Autor
Matthew Harffy wuchs in Northumberland auf, wo ihn die zerklüftete Landschaft, die Burgruinen und die felsige Küste zu seinen historischen Romanen inspirierten. Heute lebt der Autor mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Wiltshire, England. »Schwert und Ehre« ist der Beginn einer Reihe um den jungen Krieger Beobrand.
Weitere historische Romane von Matthew Harffy sind bei Goldmann in Vorbereitung.
Weitere Informationen zum Autor unter
matthewharffy.com
und unter facebook.com/MatthewHarffyAuthor.
Matthew Harffy
Schwert und Ehre
Die Chroniken von Bernicia
Historischer Roman
Aus dem Englischen
von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Serpent Sword« bei Aria, an imprint of Head of Zeus, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2022
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Matthew Harffy
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
BH · Herstellung: ik
Satz: KCFG-Medienagentur, Neuss
ISBN: 978-3-641-29595-0V001
www.goldmann-verlag.de
Für Maite, Elora und Iona
ORTSNAMEN
Die Ortsbezeichnungen im Britannien des frühen Mittelalters fallen je nach Zeit, Sprache, Dialekt und jeweiligem Schreiber zum Teil recht unterschiedlich aus. Ich habe mich bei der Wahl der Ortsnamen nicht an eine bestimmte Konvention gehalten, sondern in der Regel die Bezeichnung gewählt, die meines Erachtens am ehesten der im siebten Jahrhundert gebräuchlichen entspricht. Doch genau wie die Schreiber der damaligen Zeit habe auch ich mir gelegentlich die künstlerische Freiheit genommen und mich für den Namen entschieden, der mir am besten gefällt.
Albion
Großbritannien
Bebbanburg
Bamburgh
Bernicia
Königreich im nördlichen Teil von Northumbria, das sich vom River Tyne im Süden bis zum Firth of Forth im Norden erstreckt und in etwa dem Gebiet der heutigen Grafschaften Northumberland und Durham entspricht
Cantware
Kent
Cantwareburh
Canterbury
Dál Riata
Kleinkönigreich, das Gebiete an der schottischen Westküste sowie die Grafschaft Antrim im Nordosten Irlands umfasst und Heimat der keltischen Skoten ist
Deira
Königreich im südlichen Teil von Northumbria, das sich ungefähr vom Humber im Süden bis zum River Tyne im Norden erstreckt
Elmet
unabhängiges britisches Königreich, dessen Gebiet in etwa dem westlichen Verwaltungsbezirk der heutigen Grafschaft Yorkshire entspricht
Engelmynster
fiktiver Ort in Deira
Eoferwic
York
Frankia
Frankreich
Gefrin
Yeavering, ein kleiner Ort in Northumberland, etwa 15 Kilometer von Bebbanburg entfernt
Gwynedd
Gwynedd in Nordwales
Hibernia
Irland
Hii
Iona
Hithe
Hythe in Kent
Northumbria
angelsächsisches Kleinkönigreich, das die Gebiete der heutigen Grafschaften Yorkshire und Northumberland sowie den Südosten Schottlands umfasst
Pocel’s Hall
Pocklington in Yorkshire
Anno Domini Nostri Iesu Christi
Im Jahre unseres Herrn Jesus Christus
633
»Infaustus ille annus et omnibus bonis exosus usque hodie permanet.«
Historia ecclesiastica gentis Anglorum
Beda Venerabilis
»Dieses Jahr gilt allen rechtschaffenen Männern als abscheulich und schändlich.«
Kirchengeschichte des englischen Volkes
Beda der Ehrwürdige
PROLOG
Der Mann stand im Schatten und bereitete sich auf den Mord vor. Er zog den Mantel fester um seine Schultern und dehnte seine vom langen regungslosen Stehen steif gewordenen Muskeln. In der kalten Luft der Herbstnacht bildeten sich dichte Atemwolken vor seinen Lippen. Es war nicht gerade angenehm, hier zu warten, aber er würde durchhalten. Sein Entschluss stand fest.
Schon längere Zeit hatte er einen Verdacht gehegt, doch jetzt kannte er die ganze Wahrheit. Er war ihnen bis hierher gefolgt und hatte beobachtet, wie sie gemeinsam im Stall verschwunden waren.
Leises Frauenlachen wehte aus dem Stall zu ihm herüber. Er biss die Zähne zusammen. Seine Hand umschloss den Griff seines Sachsmessers, der aus einem Geweih gefertigt war. Die Berührung der Waffe verlieh ihm Ruhe und Gewissheit, auch wenn er das Messer am heutigen Abend nicht benutzen würde. Nein. Es würde keinen Kampf geben, kein Klirren der Klingen. Keine ehrenvolle Schlacht. Keine Heldentaten, von denen die Sänger später künden könnten und die im flackernden Licht der Feuer in den Metsälen von den Barden verbreitet würden. Hier gab es kein Licht. Der Tod würde heimlich kommen, von Finsternis umhüllt.
Was er zu tun hatte, war klar. Dennoch durfte niemand je erfahren, was in dieser Nacht hier geschehen würde. Sollte er entdeckt werden, dann hatte er sein Leben verwirkt.
Irgendwo auf der westlichen, dem Festland zugewandten Seite der Festung bellte ein Hund, dann war es wieder still. Vom Osten her war das ferne Rauschen der Brandung zu hören, die tief unter ihm gegen die Klippen schlug.
Auf dem Palisadengang in einiger Entfernung war gerade eben noch die Silhouette eines Wachsoldaten zu sehen gewesen, jetzt schob sich eine Wolke vor den Mond. Das alles sehende Auge Wodens, des Vaters sämtlicher Götter, war geschlossen. In einer solchen Nacht schliefen die Götter und gaben den Menschen so die Gelegenheit, das eigene Schicksal zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Ein bedeutender Mann wie er konnte sich dann nehmen, was ihm von Rechts wegen zustand. Schon seine Mutter hatte ihm einst prophezeit, dass er ein Mann werden würde, der Könige entthronen und Königreiche zum Einsturz bringen würde, und für bedeutende Männer galten die Gesetze der gewöhnlichen nicht.
An diesem Gedanken hielt er sich fest, während er sich bereit machte, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Als er schauderte, redete er sich ein, dass das nur an der Kälte lag, bevor er sich noch ein wenig tiefer in den Schatten zurückzog.
Aus dem Gebäude drang nun ein anderes Geräusch zu ihm, das rhythmische Keuchen und Stöhnen zweier Liebender. In den kehligen Lauten erkannte er Eldas Stimme wieder.
Wie konnte sie nur so wankelmütig sein? Er hatte ihr doch alles geboten. Bei Woden, er hätte sie zu seiner Frau gemacht! Allein der Gedanke, dass sie ihn verschmäht hatte, nur um diesem jungen Emporkömmling die Beine zu öffnen … Die Wut angesichts ihrer Zurückweisung stieg bitter wie Galle in ihm auf.
Ausgerechnet er! Octa! Der Mann, mit dem Elda es dort im Stall trieb. Octa hatte alles, was ein Krieger sich nur wünschen konnte. Einen großzügigen Lehnsherrn, der sich ihm gegenüber wohlwollend gab. Octa besaß Land und ein kleines Vermögen. Und natürlich das Schwert. Das Schwert, das ihm niemals hätte gehören dürfen. Es trug den Namen Hrunting und war ein Geschenk ihres gemeinsamen Herrn, König Edwin. Dieser hatte es dem Mann überreicht, der ihm, so glaubte er, in der Schlacht das Leben gerettet hatte. Doch er hatte es dem Falschen geschenkt. Die Schlacht war chaotisch gewesen. Der Schildwall war auseinandergebrochen und der König von Feinden umzingelt worden. Lange wirkte es so, als wäre alles verloren, bis einer der Krieger des Königs, einer seiner Recken, die Männer um sich geschart und damit der Schlacht die entscheidende Wendung gegeben hatte.
Im Anschluss hatte Octa aus Edwins Händen die Waffe erhalten. Hrunting. Ein Schwert, das eines Königs würdig war. Die Klinge geschmiedet aus ineinander verschlungenen Eisenstäben. Das Metall glänzte wie kabbeliges Wasser oder die schlüpfrige Haut einer Schlange. Das Heft war mit wunderschönen Knochenintarsien und aufwendigen Schnitzereien verziert. Jeder, der dieses Schwert einmal gesehen hatte, begehrte es.
Doch der Mann, der im Schatten lauerte, wusste, dass es eigentlich ihm gehören sollte. Er hatte den Anführer der Feinde niedergestreckt. Er war es gewesen, der bei dem Angriff, der ihnen den Sieg gebracht hatte, die Männer angeführt hatte.
Er war es, den das Schicksal zu Großem berufen hatte.
Ungläubig hatte er mit angesehen, wie das sagenumwobene Schwert seinem Rivalen übergeben worden war. Es war, als wäre der König verhext. Seit Octa in Bernicia aufgetaucht war, schien es, als würde ihm einfach alles gelingen, als könnte er nicht den geringsten Fehler machen.
Seine Empörung über Eldas Verhalten war nichts im Vergleich zu dem Zorn, den er empfand, wenn er an den Aufstieg seines Feindes dachte.
Er berührte den Hammer Thunors, der als Amulett an einem Lederband um seinen Hals hing. Der Priester des sanften neuen Gottes, dieses Christus, predigte Vergebung, doch die alten Götter verlangten keine Vergebung. Stattdessen forderten sie Vergeltung. Schnell und grausam. Und nun würde es nicht mehr lange dauern, bis sie ihren blutigen Tribut erhalten würden.
Langsam öffnete sich die Stalltür, und das Objekt seines Hasses trat heraus. Der Beobachter hielt den Atem an. Das Licht der Sterne ließ Octas goldenes Haar schimmern wie poliertes Eisen. Breitschultrig und groß war er, seine Bewegungen mühelos elegant. Er wirkte wie die Heldengestalt aus einer Legende. Der Mann, der in der Dunkelheit lauerte, wurde von Hass und Eifersucht überwältigt.
Als der blonde Riese zwischen zwei Lagerhäusern verschwand, wo vollkommene Dunkelheit herrschte, schlich ihm die schemenhafte Gestalt hinterher. Unter seinem Mantel trug der Verfolger nichts weiter als einen Kittel und eine Kniehose, um sich möglichst lautlos zu bewegen. In der Hand hielt er einen dicken Eichenknüppel.
Er näherte sich Octa von hinten. Hier konnten sie weder vom Palisadengang noch vom Weg zwischen den Gebäuden aus gesehen werden. Er hob den Knüppel und machte den letzten Schritt. Sein Opfer wurde zwar von seinem Instinkt gewarnt, verharrte plötzlich und drehte sich um, doch seine Ahnung kam zu spät.
Eigentlich hatte Octa hier nicht das Geringste zu befürchten. Die dicken Mauern der Festung garantierten Sicherheit. Noch trug er Eldas wärmende Leidenschaft im Leib und im Herzen, und die Erinnerung an die gerade erlebten Wonnen machte ihn träge. Alles zusammen war der Grund, weshalb Octas Drehung zu langsam geriet. Er nahm die dunkle Gestalt, die sich aus der Dunkelheit auf ihn stürzte, kaum wahr. Mit einem widerwärtigen dumpfen Aufprall kollidierte der Knüppel mit seiner Schläfe. Octa schlug wild um sich und taumelte rückwärts. Er wollte Hrunting aus der Scheide ziehen, war aber zu benommen, und seine Hand verweigerte ihm den Dienst.
Der dunkle Schatten landete den nächsten schmerzhaften Kopftreffer. Octa wehrte sich tapfer, doch er konnte nur noch verschwommen sehen. Er wusste immer noch nicht, was hier eigentlich geschah, aber ihm war klar, dass er in Gefahr schwebte und sein Körper ihm nicht gehorchen wollte. Als der nächste Schlag seinen Schädel erschütterte, blitzten Lichter vor seinem inneren Auge auf. Er stöhnte laut und sank auf ein Knie.
Octa machte Anstalten, wieder aufzustehen, um seinem Gegner aufrecht gegenüberzutreten. Er mühte sich sehr, doch dann prasselte eine ganze Serie von Schlägen auf sein Gesicht und seine Schultern ein, und er brach zusammen, war nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen.
Bald schon lag er regungslos da, sein Gesicht nur noch eine einzige feucht glänzende dunkle Masse.
Sein Angreifer keuchte angestrengt mit offenem Mund und lauschte. Sollte jemand etwas von diesem Kampf mitbekommen haben, wäre er so gut wie tot. Er wartete, bis sich sein Atem wieder beruhigte. Doch niemand kam herbeigerannt. Niemand schlug Alarm.
Hastig zog er Hrunting aus der mit Wolle gefütterten Scheide. Einen Augenblick lang drehte er das Schwert in diese und jene Richtung, bewunderte seine Ausgewogenheit, spürte voller Freude sein Gewicht. Es war wahrhaftig ein Meisterwerk. Eine bedeutende Waffe für einen bedeutenden Mann. Er hätte die Klinge gerne noch länger betrachtet, musste sich aber beeilen und sich seine bewundernden Blicke für später aufheben. Zwischen allerhand Unrat und dem Unkraut, das am Fuß eines Schuppens wucherte, entdeckte er ein Versteck.
Nachdem er Hrunting zu seiner Zufriedenheit dort vor neugierigen Blicken verborgen hatte, wandte er sich seinem leblosen Gegenspieler zu. Octa war von stattlicher Gestalt und alles andere als ein Leichtgewicht, genau wie er. Es würde nicht einfach werden, aber irgendwie würde er ihn schon hochheben. Er bückte sich und packte Octas Handgelenk. Die Hand baumelte kraftlos hin und her, als wollte sie ihm zuwinken. Er schauderte und versuchte, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass der Geist des Mannes längst das Weite gesucht haben musste. Zunächst hievte er den Leichnam in eine sitzende Position, um ihn sich dann, mithilfe seines eigenen Körpergewichts und schierer Kraft, auf die Schultern zu wuchten. Schließlich stemmte er sich in die Senkrechte. Bei allen Göttern, der Hurensohn war schwer!
Er hatte den Weg, den er jetzt nehmen musste, genau geplant. Vorausgesetzt, die Schwestern des Schicksals, die die Fäden seines Lebens spannen, waren ihm gnädig gestimmt, konnte er ungesehen bis zum südlichsten Punkt des östlichen Schutzwalls gelangen.
So rasch es die Vorsicht gestattete, huschte er zwischen Ställen und Lagerhäusern hindurch, vorbei an den Küchen und dem Brauhaus, wo die Luft stets mit Hopfengeruch geschwängert war. Sein Weg führte ihn im weiten Bogen an Wächtern und Fackeln vorbei, aber dennoch … Falls jetzt jemand aus einem Haus hervortreten würde, um sich nach dem Genuss von Met oder Bier zu erleichtern, wäre er verloren.
Er erreichte die Leiter am Fuß der Palisaden, warf einen letzten Blick den Schutzwall entlang und bemerkte den Wachsoldaten am hinteren Ende. Der Mann stand direkt neben einer Feuerschale, sodass er Schwierigkeiten haben dürfte, etwas in der ihn umgebenden Dunkelheit zu erkennen.
Octas Mörder packte die Streben der Leiter und machte sich auf den Weg nach oben, immer einen schweren Schritt vor den anderen setzend. Trotz der nächtlichen Kühle war er schweißgebadet. Sein Rücken und seine Arme schmerzten unter der schauerlichen Last, er spürte seine Kräfte allmählich erlahmen. Er musste den Toten bald loswerden, andernfalls würde er ihn fallen lassen. Bei dem Gedanken huschte ein grimmiges Lächeln über seine Lippen.
Endlich hatte er den Palisadengang erreicht. Tief unter ihm schlugen die Wellen gegen die Felsen. Gischt schimmerte gespenstisch weiß in der Dunkelheit. Ohne innezuhalten, getrieben von dem Wunsch, sich der Last und des Beweises seines Verbrechens endlich zu entledigen, ließ er den Leichnam von seiner Schulter und über den Schutzwall ins Meer gleiten. Er beobachtete Octas Sturz, sah ihn als dunklen Umriss vor wütenden Wellen in die Tiefe fallen. Anschließend lehnte er sich gegen die Palisaden und holte tief Luft. Sein Herzschlag beruhigte sich allmählich, der Schweiß wurde kalt. Der Wächter am anderen Ende der Palisaden stand immer noch neben seinem kleinen Feuer.
Der Tote würde morgen früh gefunden werden, vorausgesetzt, die See zerrte ihn nicht in ihre undurchsichtigen Tiefen. Die Leute würden sich fragen, weshalb ein Krieger, der alles besaß, sich auf diese Art und Weise das Leben genommen hatte, denn eine andere Erklärung für seinen Tod würde es nicht geben.
Die Wolkendecke riss auf, und der Mond tauchte die Festung wieder in sein Licht. Woden blickte erneut auf die Erde hinab. Suchte er Octa? Oder saß der bereits im Saal des Allvaters und wurde von ihm ebenso gehätschelt und geliebt wie zuvor von König Edwin?
Octas Mörder schauderte. Dies war die Nacht, in der er sein Schicksal selbst in die Hand genommen hatte, dennoch wollte er auf keinen Fall von den Göttern gerichtet werden. Er wandte seinen Blick vom Himmel ab.
Edwin hätte wissen müssen, welcher seiner Recken der würdigste war. Doch stattdessen hatte er Octa belohnt. Seine Blindheit würde zu seinem Untergang führen; seine Vernichtung war nur noch eine Frage der Zeit. Edwin würde entthront werden, sein Königreich zerfallen.
Der Mörder lächelte in der Dunkelheit. Bevor er die Prophezeiung seiner Mutter erfüllen würde, hatte er noch etwas anderes zu erledigen. Er stieg die Leiter hinab und machte sich auf den Weg zurück zum Stall.
Hoffentlich war Elda noch dort. Sie würde ihren Verrat an ihm schon bald bitter bereuen.
ERSTERTEIL
DAS SCHMIEDEN
KAPITEL 1
Beobrand wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das große Schiff auf den Strand zu schieben war anstrengend. Seine Beine fühlten sich schwach an, dazu kam das mulmige Gefühl in seinem Magen. Sein Körper verlangte nach dem gleichmäßigen Auf und Ab des Meeres, obwohl das beständige Wogen der Wellen ihm noch vor wenigen Tagen gänzlich fremd gewesen war. Er hob den Blick zu der Festung auf dem Felsen vor ihm. Zur mächtigen Festung Bebbanburg, Wohnsitz der königlichen Familie von Bernicia.
Lummen und Möwen zischten über den windigen grauen Himmel, Schemen vor den dräuenden Sturmwolken, die noch schlechteres Wetter ankündigten.
»Sobald wir das Schiff sicher unter der Böschung vertäut haben, hast du genügend Zeit, dich umzublicken, Junge.« Hrothgars Stimme war heiser, seine Kehle wund nach all den Befehlen, die er den Männern auf See zugebrüllt hatte. »Und jetzt mach weiter, wie wir alle!«
Einmal mehr stemmte Beobrand sich gegen die Seitenwand des Schiffes. Es fehlte nicht mehr viel, dann würde es parallel zu den beiden anderen hinter der Flutlinie auf dem Strand liegen.
Da erkannte er das erste der beiden Schiffe. Es gehörte Swidhelm. Beobrand hatte es in der Vergangenheit schon zweimal gesehen und sich an den elegant geformten Bug mit dem Schlangenkopf ganz vorn erinnert. Swidhelm musste dem Sturm entkommen sein, der ihnen gestern zu schaffen gemacht hatte, sodass er vor ihnen eingetroffen war. Hrothgar hatte oft erwähnt, dass Swidhelm nicht nur ein sehr guter Seemann war, sondern auch das Glück der Götter auf seiner Seite hatte. Ein großes Lob des ansonsten eher schweigsamen Seefahrers.
Das zweite Schiff kannte Beobrand nicht. Er wusste nicht viel über die Seefahrt, aber dieses war größer als alle, die er je gesehen hatte, fast ein Drittel länger als ihres und Swidhelms. Über wie viel Macht musste der Eigner eines solchen Schiffes verfügen? Ob er dem König dieses nördlichen Reiches gehörte? Und wie viele Männer mochte seine Kriegerschar wohl zählen? Die Galionsfigur des Schiffes war ein seltsames Ungeheuer, dessen lange Zunge aus einem Schlund mit spitzen Zähnen hervorragte. Der Mund war rot gefärbt, wie mit frischem Blut getränkt.
»Gut so, ihr Weiber!«, brüllte Hrothgar. »Das reicht!«
Die erschöpften Männer murmelten einen kurzen Dank, bevor sie innehielten und sich streckten.
Beobrands Körper war vom vielen Rudern völlig verspannt, seine Hände waren durch die rauen Taue wund und rissig geworden. Er war kein Seemann und hatte sich auf dem Schiff zunächst schwergetan, doch Hrothgar und die älteren Männer hatten ihm geholfen, sich einzugewöhnen. Er lernte schnell und war jederzeit bereit zuzupacken, doch abgesehen von seiner Körperkraft hatte er als Gegenleistung für die Fahrt auch nichts anzubieten gehabt. Gut möglich, dass Hrothgar gar keinen zusätzlichen Deckshelfer benötigt hatte, doch viele der Männer kannten seine Geschichte. Höchstwahrscheinlich hatte ihn der verschlossene Kapitän nur aus Mitleid an Bord gehen lassen.
Mitleidige Mienen hatte Beobrand in den letzten Wochen jedenfalls viele zu Gesicht bekommen. Seine Familie war nicht die einzige, die die Pest heimgesucht hatte, aber nur wenige waren durch die Seuche härter getroffen worden. Als Erste war Edita ihr erlegen. Über Nacht war aus dem fröhlichen, aufgeweckten Mädchen ein bleiches, zitterndes Gespenst geworden. Der Tod war in Windeseile über sie gekommen, so schnell, wie die Dunkelheit vor einem Gewitter hereinbricht. Und danach …
»Fangen wir an, die Ladung zu löschen, oder wollt ihr etwa immer noch hier draußen stehen, wenn der Regen wieder einsetzt?«, ließ Hrothgar sich vernehmen.
Beobrand und etliche andere, jüngere Besatzungsmitglieder stöhnten vernehmlich, doch die erfahreneren Matrosen begannen bereits, die ersten Ballen und Fässer an Land zu wuchten und sich für den steilen Weg zur Festung bereit zu machen.
Einige Zeit später erreichte die Gruppe mit den letzten Vorräten aus dem Bauch des Schiffes das Felsplateau. Der Himmel war dunkel, es hatte zu regnen begonnen. Der kalte Herbstwind ließ ihre Mäntel flattern und blies ihnen die Tropfen ins Gesicht. Beobrand folgte den anderen durch den Torbogen am Ende einer Treppe und gelangte in einen von großen Gebäuden umgebenen Innenhof. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hofs empfing ihn der lang ersehnte erleuchtete Eingang zum Großen Saal. Als der Wind für einen kurzen Moment nachließ, drangen Stimmengewirr und Gelächter an seine Ohren.
Ein groß gewachsener, dünner Mann mit langem Schnurrbart wies Beobrand den Weg zu einem anderen Gebäude. »Los jetzt. Den Sack kannst du da rechts zu den anderen stellen.« Er wirkte ungeduldig. Wahrscheinlich zog es ihn wieder zurück in den warmen Saal zu einem Horn voll Met. Er schlang sich seinen schönen Wollmantel enger um die Schultern und warf einen Blick durch den Torbogen, wie um nachzusehen, ob Beobrand noch mehr Männer folgten.
»Bist du der Letzte?«, fragte er ihn. Er sprach langsam, mit schwerfälligem Akzent, den Beobrand jedoch gut verstehen konnte.
»Aye. Die anderen bleiben unten, um die Schiffe zu bewachen.« Beobrand betrat den Lagerraum und sah sich nach den anderen Säcken um, von denen der Mann gesprochen hatte. Im Dämmerlicht konnte er erkennen, dass die große Scheune mit Vorräten prall gefüllt war.
Als er wieder nach draußen kam, schloss der Mann die Tür, bevor er zum Saal ging. Beobrand folgte ihm.
Er betrat das rauchgeschwängerte Gebäude, und die Gespräche verstummten ebenso wie die Essgeräusche. Einen Augenblick lang kam Beobrand sich beobachtet vor, fehl am Platz, so als wären alle Blicke auf ihn gerichtet. Als wäre aus irgendeinem Grund er die Ursache für die plötzliche Stille. Doch dann wurde ihm klar, dass die Männer und Frauen an den Tischen einen großen Mann am Kopfende des Saales anstarrten. Seine Haltung war die eines Befehlshabers, ein meisterhaft geschmiedetes Schwert lag in seiner Hand. Der lange braune Schnurrbart war mit weißen Sprenkeln durchsetzt, die wie Salzkristalle nach einer langen Seefahrt wirkten. Sein kahler Schädel schien im Schein des lodernden Kaminfeuers zu leuchten.
»Es geht das Wort, dass Penda von Mercia, möge Gott seine Knochen zerschmettern, sich mit dem walisischen König Cadwallon von Gwynedd zusammengetan hat. Es ist genau so, wie wir es befürchtet haben. Im Augenblick lagern beide mit ihrer Kriegerschar im Lande Elmet.« Deutlich schallte seine Stimme durch den Saal. »Diese Allianz muss ein Ende finden. Wenn Penda glaubt, ungestraft in das Land Edwins, Sohn des Aella, eindringen zu können, werden wir ihn eines Besseren belehren. In zwei Tagen marschieren wir südwärts. Ich habe bereits Reiter ausgesandt, um die Truppen zu sammeln. Die Männer des Landes werden ihrer Pflicht nachkommen und mit mir zu den Waffen greifen. Gemeinsam wird unser Zorn unsere Feinde im Felde vernichten, denn dort werden wir auf sie treffen. Ich habe genug von Diplomatie. Penda ist nichts weiter als Ungeziefer, und so muss er auch sterben. Er hat mein Land geschändet und die Hand gegen mein Volk erhoben. Seht her, ich habe mein Schwert gezogen …« Er reckte das schön gearbeitete Breitschwert hoch über seinen Kopf, sodass die gewellte Klinge im Licht des Feuers funkelte. »Es soll nicht eher wieder in die Scheide fahren, bis sein Durst mit dem Blut unserer Feinde gestillt ist!« Bei dem letzten Ausruf stieß er das Schwert mit voller Wucht in den vor ihm stehenden Eichentisch. Ein hölzerner Becher kippte um und fiel von der Tischplatte. Sein Inhalt spritzte in alle Richtungen.
Niemand im Saal hörte, wie der Becher auf dem Holzboden aufschlug, weil die versammelte Kriegerschar schon zu jubeln begann, bevor Edwins Stimme endgültig verhallt war. Die Männer sprangen auf, leerten ihre Hörner und Krüge, priesen ihren König und überschütteten ihre Feinde mit Flüchen.
Der Lärm und die Wärme des Saales hüllten Beobrand ein. So sprach ein wahrer König. Mit einem Mal hatte er das Gefühl, diesen Ort und diesen König in sein Herz schließen zu können, so wie es schon sein Bruder getan hatte. Beobrand ließ den Blick über die Tische schweifen und suchte Octas vertraute blonde Mähne. Octa hatte sich vor drei Jahren Edwins Kriegerschar angeschlossen, und aus den wenigen Nachrichten, die Beobrand zu Hause in Hithe in Cantware erreicht hatten, war hervorgegangen, dass er sich im Dienst seines neuen Herrn bewährt hatte.
Dennoch konnte er seinen Bruder in der Menge der versammelten Recken nicht entdecken. Wahrscheinlich musste er Wache stehen oder sich um sein eigenes Land kümmern, falls der König so gnädig gewesen war, ihn damit zu betrauen Nun, Octa konnte warten. Der Tag war anstrengend und sehr ermüdend gewesen, und der Duft des Wildschweins, das auf einem Spieß über dem Feuer gebraten wurde, machte Beobrand bewusst, wie viel Zeit vergangen war, seit er das letzte Mal etwas gegessen hatte.
Der Saal war prächtiger als der seines Herrn Folca in Hithe, aber die Einrichtung mit den der Länge nach aufgebauten Bänken und Tischen und dem großen Kaminfeuer in der Mitte war ihm vertraut. Er war nicht oft im Saal seines Herrn gewesen, doch die festliche Atmosphäre hier erinnerte ihn an die Feiern im Drei-Milch-Monat, zu denen alle Freien eingeladen wurden, um die Früchte des Bodens zu ehren. Bei diesen Gelegenheiten waren immer große Mengen Getränke und Berge der verschiedensten Speisen aufgetischt worden. Allerdings hatten sich bei den Feiern in Folcas Saal deutlich weniger Recken versammelt gehabt als hier. Und ihre Schwerter waren bei Weitem nicht von dieser Qualität gewesen. Beobrand betrachtete die Klinge, die immer noch zitternd im Holz des Tisches steckte. Octa und er hatten lange davon geträumt, ein solches Schwert zu besitzen. Vielleicht hatte sich für Octa ja mittlerweile dieser Traum erfüllt, genau wie der, ein Recke zu sein.
Beobrand blickte sich nach einem Platz auf einer der Bänke um. Alle anderen, die mit ihm zusammen eingetroffen waren, hatten sich bereits gesetzt und wurden mit Met, Bier und Essen versorgt. Auch der dünne Mann aus dem Lagerraum hatte sich in der Nähe des Königs niedergelassen, nur Beobrand stand immer noch ein wenig ratlos in der Tür. Im Saal herrschte eine fröhliche Atmosphäre. Die Männer waren damit beschäftigt, sich satt zu essen und auf ihre Heldentaten anzustoßen, auf die vergangenen ebenso wie auf die zukünftigen. Bald schon würden sie in die Schlacht ziehen, und Schlachten waren genau das, wofür diese Krieger lebten.
Beobrand beneidete sie.
Solange er denken konnte, hatte er den Wunsch gehegt, ein Krieger zu werden. Der Bruder ihres Vaters, Selwyn, war Teil einer Kriegerschar gewesen. In seiner Jugend war er weit gereist, bevor er nach Hithe zurückkehrte und seinen Neffen mit Geschichten von Schlachten und Abenteuern Flausen in den Kopf setzte. Octa verließ daraufhin später die Heimat, um der Bestimmung nachzukommen, die er für die seine hielt; um in die Fußstapfen seines Onkels zu treten und sich im Dienst eines mächtigen Fürsten oder Königs Ruhm und Ehre zu erwerben.
Damals ließ er Beobrand in der Heimat zurück. Dieser war noch zu jung gewesen, um ihn zu begleiten, darum war er geblieben und hatte sich um das Land ihrer Väter, um ihre Schwestern und ihre Mutter gekümmert.
Aber jetzt gab es nichts mehr, was ihn in Cantware hätte halten können.
Als ein junger Mann mit struppigem Bart Beobrand alleine neben der Tür stehen sah, deutete er auffordernd auf einen freien Platz neben sich. Beobrand nahm die Einladung an und ließ sich nach dem langen Anstieg vom Strand dankbar auf die Bank sinken.
»Ich heiße Tondbert«, sagte der junge Mann. Er musste die Stimme erheben, um gegen den Lärm im Saal anzukommen. »Du bist von einem der Schiffe aus Cantware, nicht wahr?«
Beobrand nickte. Seine Gefühle mussten ihm deutlich anzusehen sein, denn Tondbert folgte seinen Blicken und reichte ihm dann ein Horn mit Met. »Du bist bestimmt müde nach der langen Reise.«
»Ja«, antwortete Beobrand, nachdem er einen tiefen Schluck des süßen Getränks genommen hatte. »Und hungrig«, fügte er hinzu. »Das ist die erste Reise, die mich aus dem Land meines Herrn, König Eadbald, weggeführt hat.«
Tondbert winkte einer wohlgeratenen Sklavin, die gerade Fleischstücke aus dem Wildschwein schnitt. Sie brachte ihnen einen Holzteller mit ausgewählten Stücken, schenkte den beiden jungen Männern ein Lächeln und kehrte wieder zur Feuerstelle zurück. Beobrand griff nach einem Fleischbrocken und nahm einen Bissen, obwohl ihm das heiße Fett fast die Finger verbrannte.
Tondbert goss ihm aus einem großen irdenen Krug Met nach. Die Unterhaltung mit einem Wildfremden schien ihm leichtzufallen, und Beobrand hörte ihm gerne zu, während er aß.
»Übermorgen ziehe ich zum allerersten Mal mit den Kriegern in die Schlacht. Mein Vater hat mir im letzten Sommer einen neuen Speer und einen Schild geschenkt. Jetzt bekomme ich endlich Gelegenheit, beides auszuprobieren.« Seine Augen funkelten im Licht des Feuers. Beobrand konnte seine Aufregung gut verstehen.
Während Tondbert über seine neuen Waffen und darüber sprach, wie er sie in der Schlacht einsetzen würde, schweifte Beobrands Blick über die Krieger im Saal. Mindestens fünfzig kraftstrotzende Recken saßen an den Tischen. Eine durchaus beeindruckende Anzahl. Falls Edwin noch mehr Männer von den umliegenden Höfen und Dörfern versammeln konnte, verfügte er über eine Streitmacht, die nicht zu unterschätzen war. Und wie viele waren wohl – so wie Octa – bei diesem Fest nicht zugegen?
Er schluckte ein Stück Brot hinunter, das er zuvor im Fleischsaft eingeweicht hatte, und spülte mit Met nach. Die Wärme und der Alkohol entspannten ihn, und er spürte, wie die Anstrengungen der Reise allmählich aus seinen Muskeln wichen.
Wie von selbst wanderte sein Geist immer wieder zu den Ereignissen der letzten Monate. Ein ums andere Mal sah er Edita vor sich sterben. Dann die Bestattungen Rhedas und ihrer Mutter, beide am selben Tag. Alle drei waren innerhalb einer Woche gestorben. Nur sein Vater war währenddessen gesund geblieben. Beobrand hatte sich lange gefragt, ob womöglich ein Fluch auf ihm lastete.
Mit gerunzelter Stirn starrte er ins Feuer und versuchte, die Erinnerungen zu vertreiben. Er wollte nicht an die Vergangenheit denken. An das, was geschehen war.
Was er getan hatte.
Er war in den Norden gekommen, um hier eine Zukunft zu finden.
Er wandte sich an Tondbert, der gerade eine Geschichte über Osfrid erzählte, einen Sohn des Königs. Allem Anschein nach war Osfrid ein ausgezeichneter Jäger und hatte in diesem Sommer ganz allein einen Bären zur Strecke gebracht. Tondberts unentwegtes Geplapper langweilte Beobrand allmählich, sodass er ihm mit einer Frage ins Wort fiel.
»Weißt du, wo ich meinen Bruder finden kann?«
Tondbert blickte ihn verwirrt an, während er vergeblich versuchte, einen Zusammenhang zwischen der Frage und seiner Geschichte herzustellen. »Das hängt vermutlich davon ab, wer dein Bruder ist«, erwiderte er schließlich lächelnd. Anscheinend nahm er keinen Anstoß an der Unterbrechung.
»Octa. Er ist ein wenig größer als ich. Seine Haare sind sehr blond, fast schon weiß.«
Tondbert öffnete den Mund, als wollte er etwas erwidern, bevor er sich eines Besseren besann und ihn wieder schloss. Er blickte auf seine Hände, dann nahm er einen Schluck Met aus seinem Horn.
Beobrand beschlich die Ahnung, dass nur etwas wahrhaft Schreckliches den redseligen Tondbert sprachlos machen konnte. »Was ist geschehen?«, hakte er nach.
Tondbert schien zunächst nicht antworten zu wollen, doch nach wenigen Augenblicken platzte es aus ihm heraus: »Er ist tot!«
Die Worte ergaben für Beobrand keinen Sinn. »Was? Aber das ist unmöglich … Ich …«, stammelte er.
Doch Tondberts Miene sagte ihm, dass er die Wahrheit gesprochen hatte. Sein Gesicht war aschfahl, das Entsetzen über das Gesagte war ihm deutlich anzusehen.
»Es tut mir leid«, sagte Tondbert und nahm noch einen Schluck Met. Offensichtlich fühlte er sich mehr als unwohl in seiner Haut.
»Wie?« Es kostete Beobrand Mühe, dieses Wort trotz des dicken Kloßes in seiner Kehle hervorzustoßen.
Tondbert senkte den Blick.
»Wie ist er gestorben?« Mit erhobener Stimme wiederholte Beobrand seine Frage.
Tondbert starrte in seine blauen Augen. Für einen kurzen Moment dachte Beobrand, er würde lieber die Flucht ergreifen, als seinem durchdringenden Blick standzuhalten. Doch dann holte der junge Mann tief Luft und sagte mit leiser Stimme: »Er hat sich das Leben genommen.«
Die Worte waren im Lärm des Saals nicht zu verstehen. Um sie herum überall nur Feiernde. In all dem Getümmel waren Tondbert und Beobrand eine Insel der Stille, wie ein Wolkenschatten, der an einem windigen Sommertag über ein Gerstenfeld zieht.
»Was?«
Tondbert schluckte. »Er hat sich das Leben genommen«, wiederholte er lauter als zuvor.
»Wie? Warum?«
Tondbert schluckte erneut, bevor er sich räusperte.
Beobrand starrte ihn an und wartete. Er wollte wissen, warum sein Bruder, den zu sehen er die weite Reise in den Norden Albions angetreten hatte, tot war.
Schließlich schien Tondbert sich mit seiner Rolle als Überbringer schlechter Nachrichten abgefunden zu haben und antwortete: »Er hat sich vom Schutzwall gestürzt. Auf die Felsen.«
Beobrands Gedanken wirbelten im Kreis. Er konnte keinen einzigen davon festhalten. Sie waren wie Blätter im Sturm. Das ergab doch keinen Sinn. Edita, Rheda und seine Mutter waren von der Pest dahingerafft worden. Auch sein Vater war nicht mehr am Leben. Und nun Octa. »Warum?«, stieß er erneut hervor, ohne zu wissen, ob er Tondbert oder den Göttern die Frage stellte.
»Man hat seine Geliebte erstochen aufgefunden. Anscheinend hat er …« Tondberts Stimme versagte.
Beobrand wollte nichts mehr hören. Ruckartig stand er auf. Ihm war speiübel, er drohte an dem halb zerkauten Fleischstück in seinem Mund zu ersticken. Unsagbarer Schmerz wallte in seinem tiefsten Inneren auf. Tränen brannten in seinen Augen, aber diese Fremdlinge sollten ihn nicht weinen sehen.
Tondbert hatte sich ebenfalls erhoben, sagte jedoch nichts.
Auch Beobrand brachte kein Wort hervor. Seine Kehle wurde eng. Sein Atem ging nur noch stoßweise. Der Saal verschwamm vor seinen Augen, in denen sich immer mehr Tränen sammelten. Er musste weg von hier. Abrupt drehte er sich um, wäre dabei beinahe über die Bank gestolpert und taumelte ins Freie.
Während er in die Dunkelheit floh, spürte er den kalten Wind und den Regen im Gesicht.
Tot! Alle tot!
Je weiter er sich vom Saal entfernte, desto dichter wurde die Finsternis, die ihn umschloss. Noch konnte er die flackernden Fackeln bei den Wachen auf den Palisaden sehen, aber er wollte sich keinen neugierigen Blicken aussetzen, wollte allein sein mit seiner Trauer. Er steuerte ein großes Gebäude an, das in vollkommener Dunkelheit lag, wie das Innere eines Grabhügels. Die Ställe. Er stieß das Tor auf und trat ein.
Während er sich an der Wand entlangtastete, roch und hörte er die Pferde mehr, als dass er sie sah. Er stieß gegen einen Heuballen und ließ sich darauf fallen. Als seine Schwestern und seine Mutter gestorben waren, hatte er sich keine Trauer gestattet. Zuerst hatte er sich mit allem, was er hatte, ihrer Pflege gewidmet und später dann all seinen Schmerz tief in seinem Inneren verschlossen. Dort hatte er sich in jenen stählernen Hass verwandelt, mit dem er schließlich auf seinen Vater losgegangen war. Auf den Vater, der nie wieder die Hand gegen ihn oder sonst jemanden erheben würde.
Nachdem sie alle tot gewesen waren, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, Octa die traurige Nachricht zu überbringen. Und jetzt war auch Octa nicht mehr am Leben.
Octa. Sein geistreicher, fröhlicher, leidenschaftlicher Bruder Octa. In Beobrands Erinnerung sah er noch genau so aus wie bei seinem Abschied vor drei Jahren: ein großer, kräftiger, zwanzigjähriger Mann, der lachend an Deck des Schiffes gestanden hatte, das ihn in den Norden bringen sollte. Beobrand hatte das Schiff auf den Klippen begleitet, seinem Bruder mit den wehenden blonden Haaren zugewinkt und seine Abschiedsgrüße zugerufen. Er konnte sich noch gut an das Gefühl des Verlassenwerdens erinnern.
Sie waren enge Verbündete gewesen, hatten gemeinsam auf den Feldern gearbeitet und unter Onkel Selwyns Anleitung den Gebrauch von Waffen geübt. Und Octa hatte sie alle immer vor den Gewaltausbrüchen des Vaters beschützt.
Beobrand hatte Octa niemals vollständig verziehen, dass er weggegangen war.
Und jetzt würde er nie wieder sein lachendes Gesicht sehen, würde nie wieder seine warme, melodiöse Stimme hören. Er hatte nichts anderes vorgehabt, als seinen Bruder zu finden, und mit einem Mal keine Ahnung mehr, was er tun sollte. Zum ersten Mal in seinem Leben war er wirklich allein.
Mit dieser Erkenntnis ließ er endlich seinen Tränen freien Lauf. Sie kamen wie eine Flut, die er lange zurückgehalten hatte, um gemeinsam mit Octa den Verlust ihrer Familie zu betrauern. Beobrands Körper bebte unter seinem Schluchzen. Hohe, tierische Laute drangen aus seiner Kehle. Trauer und Selbstmitleid überwältigten ihn.
Lange Zeit lag er da, das Gesicht im Heu vergraben, bis seine Tränen endlich getrocknet waren. Er versuchte, sich zu sammeln. Wie hätte wohl sein Vater darauf reagiert, dass er als erwachsener Mann hier greinte wie ein Säugling? Er hätte ihm ein paar Backpfeifen versetzt und ihm klargemacht, dass Weinen etwas für Frauen und Kinder war. Mit Weinen wurde nichts erreicht, darum war es sinnlos. »Du solltest etwas tun, mein Sohn, nicht jammern und rumheulen.« Wie oft hatte er diese Worte aus dem Mund seines Vaters gehört? Hunderte Male? Tausende?
Zu guter Letzt hatte er sich den Rat seines Vaters zu Herzen genommen.
»Warum hast du geweint?«
Er erstarrte, als er die zarte Stimme hörte.
»Vater sagt, Männer sollen nicht weinen«, fuhr die Stimme fort. Ihre Besitzerin war dicht neben ihm.
Beobrand setzte sich auf und wischte sich mit dem Ärmel seines Kittels übers Gesicht. »Wer bist du?«, fragte er mit pochendem Herzen.
»Eanflæd. Und du?«
Die Stimme gehörte einem kleinen Mädchen. Was hatte sie hier im dunklen Stall zu suchen?
»Beobrand«, erwiderte er.
»Bist du aus Cantware?«, fragte Eanflæd weiter. »Du sprichst so seltsam.«
»Du hast recht. Aber was meinst du damit, dass ich so seltsam spreche?«
»Du klingst anders als wir«, lautete ihre Antwort, und dann wiederholte sie ihre erste Frage: »Warum hast du geweint?«
Beobrand wollte nicht über den Verlust seiner Familie, seine übermächtige Trauer sprechen, schon gar nicht mit einem naseweisen kleinen Mädchen. Also antwortete er mit einer Gegenfrage: »Was machst du hier? Wissen deine Eltern, dass du hier bist?«
Eanflæds Stimme war plötzlich schwermütig. »Ich sitze gerne bei den Pferden. Niemand weiß, dass ich hier bin. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt zu feiern. Edwin ist mein Vater.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Er ist der König«, als wäre Beobrand ein begriffsstutziges Kind.
Hastig rappelte er sich auf und stieß dabei gegen eine der Pferdeboxen in seinem Rücken. Falls er hier entdeckt wurde, allein mit der jungen Prinzessin in der Dunkelheit, würde es mehr als schwierig werden, dies zu erklären. Ein Pferd wieherte und stampfte angesichts der Störung mit dem Huf auf.
»Pschscht, Großer, alles in Ordnung. Ganz ruhig«, besänftigte er das Tier in genau dem Tonfall, in dem er zu Hause auf dem Hof nervösen Tieren begegnet war, und das Pferd beruhigte sich. »Eanflæd, ich glaube nicht, dass du hier sein solltest. Am besten gehst du wieder in dein Bett.«
Er hörte sie aufstehen. Hoffentlich tat sie, was er ihr geraten hatte, und hoffentlich wurde sie beim Verlassen der Ställe nicht gesehen. Er hatte kein Interesse daran, diese Situation jemandem erklären zu müssen.
»Also gut«, erwiderte sie fast demütig. »Ich nehme an, es ist schon spät. Dann gute Nacht, Beobrand aus Cantware.«
»Gute Nacht, Eanflæd, Edwins Tochter«, murmelte er.
Er hörte sie mit schnellen, selbstsicheren Schritten zum Stalltor gehen, sah, wie es sich unter leisem Knarren einen Spalt weit öffnete und Mondlicht, Wind und Regen hereindrangen. Dann war er wieder allein mit den Pferden in der Dunkelheit.
Er saß da und lauschte dem Sturm, der an den Wänden rüttelte. Die Begegnung mit der Prinzessin hatte ihm geholfen, sich zu sammeln, aber im Inneren fühlte er sich immer noch hohl und leer. Als hätten die Tränen all seine Empfindungen aus ihm herausgespült. Was sollte er jetzt tun? Mit Hrothgar nach Süden zurückfahren konnte er nicht. Dort warteten zu viele Gespenster auf ihn. Vielleicht konnte er ja hier im Norden bleiben. Aber wie? Er hatte einem potenziellen Herrn nicht das Geringste anzubieten.
Doch wozu sollte er sich jetzt noch über seine eigene Zukunft Gedanken machen? Alles erschien ihm bedeutungslos. Was immer das Schicksal für ihn bereithielt, er würde sich den Herausforderungen stellen.
Nach einer Weile wurde ihm klar, dass er in den Saal zurückkehren und noch etwas essen sollte, bevor das Fest vorüber war. Vielleicht würde ihm das helfen, die Leere in seinem Inneren wieder zu füllen. Er erhob sich und schob sich durch das Tor vorsichtig ins Freie. Der Wind hatte sich gelegt und der Regen nachgelassen. Behutsam zog er die Stalltür hinter sich ins Schloss und ging langsam zurück zum Saal. Niemand sprach ihn an, und von dem Mädchen war weit und breit nichts zu sehen.
Wieder in der Wärme und umgeben vom Lärm des lang gestreckten Saales blickte er sich nach einem Sitzplatz um. Er wollte nicht schon wieder das Geplapper von Tondbert ertragen müssen, aber alle Bänke waren dicht besetzt. Während Beobrand noch darüber nachdachte, ob er sich neben einigen jüngeren Männern auf dem Boden neben dem Feuer niederlassen sollte, fiel ihm auf, dass es in den letzten Sekunden um ihn herum seltsam still geworden war, so wie vorhin, als er zum ersten Mal den Saal betreten hatte. Er nahm an, dass der König erneut das Wort ergreifen wollte, und wandte sich zum Kopfende der Tafel, wo immer noch das wunderschöne Schwert im Eichentisch steckte. König Edwin sah ihm direkt in die Augen. Beobrands Herzschlag setzte aus. Zu den Füßen des Königs kauerte ein Mädchen und streichelte einen grauen Wolfshund. Obwohl er Eanflæd in der Dunkelheit des Pferdestalls nicht gesehen hatte, war er sich sicher, dass dieses zierliche strohblonde Kind Edwins Tochter war. Umgekehrt konnte auch sie sein Gesicht nicht erblickt haben. War das seine Rettung? Doch seine Hoffnung wurde schnell zunichtegemacht, als der König zu sprechen begann. Mit lauter Stimme, sodass alle im Saal ihn hören konnten.
»Du da! Wirst du Beobrand genannt?«
Beobrand brachte keinen Ton heraus, konnte nur nicken.
»Komm näher, sodass ich dich sehen kann.«
Beobrand ging bedächtig durch den lang gestreckten Saal. Er spürte jeden einzelnen der zahlreichen Blicke, die ihm folgten, hörte das vielstimmige Getuschel klar und deutlich. Die Anwesenden wunderten sich, was hier gerade passierte. Als er an seinen Landsleuten vorbeikam, raunte Hrothgar ihm mit heiserer Stimme zu: »Was hast du nur angestellt, Junge?«
Beobrand gab ihm keine Antwort. Der durchdringende Blick des Königs hielt ihn gefangen wie ein Opferlamm, das in die Augen des Priesters starrt.
Wenige Schritte vor Edwin blieb er stehen. Da er nicht wusste, was er tun sollte, kniete er sich nieder und senkte den Kopf.
»Nun denn, Beobrand, von Eanflæd höre ich, dass du dich in den Ställen herumgetrieben hast. Was wolltest du dort?«
Beobrand dachte nicht einmal daran zu lügen. »Ich habe um meinen verstorbenen Bruder, meine Schwestern und Eltern getrauert, Sire«, erwiderte er mit brechender Stimme. »Ich wollte nicht hier vor den Augen aller weinen.«
Bis auf das Knistern des Feuers und das Krachen der Knochen im Maul der Hunde war es jetzt vollkommen still im Saal. Niemand wollte ein Wort verpassen.
»Wer war dein Vater und wer dein Bruder?«, erkundigte sich Edwin. Seine Stimme hatte einen weichen Klang angenommen.
»Ich bin ein Sohn des Grimgundi und Bruder des Octa, mein Herr.«
Ein Raunen ging durch den Saal. Der Name seines Bruders schien bekannt zu sein.
»Deines Bruders Tod war eine Tragödie. Er war bei jedem beliebt und ein wackerer Recke, dessen Taten noch viele Jahre an unserer Tafel besungen werden.« Ein Schatten huschte über Edwins Gesicht. »Den Verlust geliebter Menschen zu betrauern schmälert dein Ansehen nicht, junger Krieger.«
»Ich bin kein Krieger, Herr.«
»Oh, aber ich erkenne Eisen in deinem Blick und Feuerstein in deinem Herzen, Beobrand. Mag sein, dass du es noch nicht weißt, aber du bist ein Kämpfer. Ich sehe vieles von Octa in dir. Eines Tages wird man auch von deinen Taten künden, dessen bin ich mir sicher.«
Beobrand war wie vor den Kopf gestoßen. Er hatte vom König einen Tadel erwartet, wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber seiner Tochter. Stattdessen prophezeite er ihm, dass er in Octas Fußstapfen treten würde. Aus dem Mund eines großen Königs im Beisein seiner Kämpferschar war dies in der Tat ein großes Kompliment. Bislang hatte Beobrand lediglich im Geheimen davon geträumt, ein Krieger zu sein. Die Vorstellung war wie eine Art glitzernder Schmuckstein, den er betrachtete, wenn das Leben nur wenig Erquickliches zu bieten hatte. Dann stellte er sich vor, wie es wohl wäre, ein Kettenhemd zu tragen und im Schildwall zu stehen, Schulter an Schulter mit echten Helden. Der Ruhm der Schlacht. Die Siegesgesänge. Die Ringe, anschließend von einem Herrn als Zeichen der Anerkennung verliehen.
Er blickte Edwin in die Augen und erkannte dort keinerlei Belustigung, nur Traurigkeit und Wohlwollen.
Und mit einem Mal, während er vor dem König kniete und die Augen aller im Saal auf ihn gerichtet waren, wusste er, was er zu tun hatte. Er hatte keine Ahnung, was danach geschehen würde, aber in diesem Moment hatte er völlige Klarheit und war sich sicher, dass alle Ereignisse der vergangenen Monate ihn zu diesem Augenblick geführt hatten. Das Schicksal hatte ihn durch Tod und Verzweiflung hindurch hierhergespült, an einen Ort, an dem eine Umkehr unmöglich war. Es war, als wäre ein Leuchtfeuer in seinem Geist entzündet worden, das selbst die dunklen Ecken erhellte, in die er nie zuvor einen Blick geworfen hatte. Ohne über die Konsequenzen seines Handelns nachzudenken und bevor das Licht in seinem Geist wieder erlöschen und erneut den Schatten Platz machen konnte, ergriff Beobrand das Wort.
»Falls Ihr glaubt, ich könnte ein Krieger werden, Edwin, mein Herr«, sagte er mit kräftiger, ruhiger Stimme, die alle – auch ihn – überraschte, »dann lasst mich mit Eurem Schild in die Schlacht ziehen. Lasst mich Waffen tragen gegen Eure Feinde, auf dass jede meiner Taten Euch zu Ruhm und Ehre gereichen möge. Lasst mich Euch dienen, so wie mein Bruder Euch gedient hat. Was sagt Ihr, Herr? Wollt Ihr mich zu Eurem Krieger machen?«
Selbst das Feuer schien zu verstummen, und nicht einmal die Hunde nagten noch länger an ihren Knochen.
Onkel Selwyn hatte Beobrand den Schwur der königlichen Krieger beigebracht, aber was den genauen Wortlaut betraf, war Beobrand sich nicht mehr sicher. Er fuhr fort, so gut er es vermochte, und sprach in die Stille hinein: »Ich werde Euch treu und ergeben sein. Ich werde lieben, was Ihr liebt, und meiden, was Ihr meidet, und niemals Euer Missfallen hervorrufen, weder in Taten noch in Worten.«
Mit einem Mal wurde ihm die Kühnheit dessen bewusst, was er da gerade getan hatte. Ein siebzehnjähriger Bauernjunge stellte sich nicht vor den König und bat, als Schwertträger in seine Kriegerschar aufgenommen zu werden. Der Zorn des Königs angesichts eines solchen Affronts würde schrecklich sein. Er schloss die Augen und schimpfte sich einen Narren.
Nach einer kurzen Weile riskierte er einen schnellen Blick zum König. Edwin hatte den Kopf in den Nacken gelegt und die Fäuste in die Luft gereckt. Gleich würde er ihn mit diesen Fäusten zerschmettern. Beobrand spannte seine Muskeln an und machte sich auf den ersten Schlag gefasst.
Aber dann beugte sich Edwin weit nach hinten und ließ schallendes Gelächter hören. Auch etliche Männer im Saal begannen jetzt, da sie die Reaktion ihres Königs sahen, zu lachen.
»Bei den Knochen des Christus, ganz gewiss wirst du eines Tages ein großer Krieger sein!« Edwin versuchte, seinen Lachanfall zu stoppen. »Du besitzt die Tapferkeit eines Keilers, Beobrand, Sohn des Grimgundi. Du machst deinen Vater stolz und bist eindeutig von Octas Stamm. Aye, ich nehme dich auf in meine Kriegerschar, denn ich kann jedes tapfere Herz gebrauchen! Und jetzt iss und trink. Bald schon wirst du deine gesamte Kraft brauchen.«
Jubelschreie und Gelächter brandeten durch den Saal. Der König setzte sich und legte seiner Tochter die Hand auf den Kopf. Eanflæd lächelte Beobrand an.
Unsicher kam er auf die Beine und ging zurück zu Hrothgar und den anderen Männern aus Cantware. Er bekam kaum etwas davon mit, dass Krieger, die er noch nie zuvor gesehen hatte, ihm auf die Schulter klopften und seinen Mut priesen. Sein Körper fühlte sich viel zu leicht an. Als er bei seinen Landsleuten angelangt war, machten sie ihm bereitwillig Platz, und er ließ sich schwer auf die Bank plumpsen. Angesichts dieser plötzlichen Wendung seines Schicksals war ihm immer noch ein wenig schwindlig.
»Wohlan, Männer!«, brüllte Hrothgar über den Lärm im Saal hinweg. »Sieht ganz so aus, als würde der junge Beobrand hier ein großer Krieger werden!«
Beobrands Landsleute johlten und prosteten ihm zu. Er war in den Rang eines Helden aufgestiegen, und sie würden diese Geschichte mit großem Gefallen weitererzählen, sobald sie wieder in Cantware waren.
Beobrand selbst hatte nicht die geringste Ahnung, was er jetzt tun sollte, also griff er nach einem Horn voll Met und verleibte sich dessen Inhalt mit drei langen Zügen ein. Dann blickte er seine Freunde an und zwang sich zu einem schmalen Lächeln.
Statt der Leere in seinem Inneren fühlte er nun das kalte Kribbeln reiner Angst, und ihm war erneut zum Heulen zumute.
KAPITEL 2
Als Beobrand am nächsten Morgen erwachte, schmerzte sein Schädel fast genauso wie sein Herz. Der vergangene Abend lag wie im Nebel. Er konnte sich noch erinnern, wie ein Krieger nach dem anderen zu ihm gekommen war, ihm zu seinem Mut gratuliert und anschließend sein Beileid zum Verlust seiner Angehörigen ausgesprochen hatte. Und jeder hatte ihm Met oder Bier angeboten, sodass Beobrand mehr getrunken hatte, als viele Männer, die doppelt so alt waren wie er, hätten verkraften können. Am Schluss bekam er nur noch wenig von den Dingen mit, die sich um ihn herum abspielten. Irgendwann kauerte er sich in eine Ecke, wo ein Hund sich an ihn schmiegte, und ließ sich von der Geräuschkulisse und der Wärme einlullen.
Der Alkohol milderte zwar sein Gespür für die Außenwelt, änderte jedoch ansonsten kaum etwas an der grässlichen Einsamkeit und Verzweiflung, die ihn fest im Griff hatten. Je weiter die Nacht fortschritt, desto mehr zogen sich die anderen Feiernden zurück. Er wollte zwar nicht schon wieder weinen, aber ein nahezu unerträglicher Schmerz quälte seine Seele. Und er hatte nichts weiter dagegen tun können, als noch mehr zu trinken und zu hoffen, dass er irgendwann vergessen würde, wo er war. Oder vielleicht sogar, wer er war.
Undeutlich erinnerte er sich an einen Barden und an dessen Gesang von einem mächtigen Mann, der einen Dämon getötet hatte. Um sich von seiner eigenen Niedergeschlagenheit abzulenken, hatte Beobrand versucht, der Geschichte zu folgen. Doch in seinem angetrunkenen Zustand gelang es ihm nicht, sich zu konzentrieren. Die verschlungenen Melodien, die der Mann mit seiner Harfe und seiner wunderschönen Stimme wob, vereinten sich zu einem trällernden Klangteppich ohne verständliche Worte. Beobrand hatte nie erfahren, was aus dem Krieger in dem Lied geworden war, weil er in einen unruhigen Schlaf gefallen war.
Vorsichtig setzte er sich auf und sah sich um. Die Saaltür stand offen, damit etwas Licht und frische Luft eindringen konnten. Die Sonne stand bereits am Himmel, und mehrere Sklavinnen wischten den Boden des Großen Saals und bereiteten die Tische für das Morgenmahl vor. In verschiedenen Ecken lagen noch andere Männer in Felle, Tücher oder Mäntel gewickelt und schliefen, aber die meisten mussten schon wach sein.
Beobrand erhob sich und stellte jetzt erst fest, dass eine freundliche Seele ihn mit einer Decke zugedeckt hatte. Er rollte sie zusammen und legte sie auf eine Bank, bevor er beschloss, den Saal möglichst schnell zu verlassen. Die Frauen wären sicherlich wenig begeistert, müssten sie sein Abendessen vom Fußboden aufwischen.
Während er nach draußen eilte, spürte er bereits, wie sich seine Speiseröhre füllte. In seinem Kopf drehte sich alles. Er huschte um die Ecke des Gebäudes, lehnte sich gegen die Wand und wurde von heftigen Krämpfen geschüttelt.
»Sieht ganz so aus, als hättest du ein wenig zu viel vom Met unseres Herrn Edwin genossen, Bursche«, ließ sich plötzlich eine joviale Stimme in seinem Rücken vernehmen. »Ein kräftiger Löffel Haferbrei wird dir guttun. Bist du fertig? Man hat ja den Eindruck, als wolltest du dir die Eingeweide rauskotzen.«
Als Beobrand wieder einigermaßen gerade stehen konnte, drehte er sich um und musterte den Mann, der ihn angesprochen hatte. Er war riesenhaft, hatte einen braunen Vollbart, aber bereits lichtes Haar. Über seinem linken Auge war eine lang gezogene Narbe zu erkennen.
»Du erinnerst dich nicht mehr an mich, was, Bursche?«, fuhr der Riese fort. »Ich habe gestern Abend schon mit dir gesprochen, aber ich nehme an, du warst nicht mehr in der Lage, wirklich zuzuhören. Mein Name ist Bassus. Ich war ein Freund deines Bruders.«
Die frische Luft und sein leerer Magen sorgten dafür, dass Beobrand sich ein wenig besser fühlte. Sein Schädel pochte immer noch heftig, aber er traute sich zu, langsam zu gehen, ohne sich noch einmal übergeben zu müssen oder in Ohnmacht zu fallen.
»Anscheinend bist du einer von der schweigsamen Sorte«, fuhr Bassus fort. »Na los, sehen wir zu, dass du etwas Warmes in den Magen bekommst. Du bist ja bleich wie Lammwolle. Aber wenn ich bis Sonnenuntergang einen Kämpfer aus dir machen soll, musst du jetzt langsam zu Kräften kommen.«
Mit dieser beunruhigenden letzten Bemerkung legte Bassus seine riesige Pranke auf Beobrands Schulter und lenkte ihn zurück in den Saal, wo die Männer sich zur ersten Mahlzeit des Tages versammelten.
Der Sturm der vergangenen Nacht hatte den Strand makellos sauber gewaschen. Ein kräftiger Wind blies vom Meer her, und die weißen Wolkenbänke am Horizont sahen nicht so aus, als würden sie noch mehr Regen bringen.
Beobrand und Bassus gingen die steinernen Stufen hinab, die von der Festung zum Strand führten, und zu den auf dem Sand liegenden Schiffen. Auf beiden herrschte ein Gewusel wie in einem Bienenstock. Hrothgar und Swidhelm hatten bei dem guten Wetter beschlossen, noch am Morgen in See zu stechen. Der Befehl hatte den Männern aus Cantware zahlreiche Flüche entlockt, selbst jetzt noch, während sie Vorräte und Taue schleppten und die Schiffe reisefertig machten, beschwerten sie sich immer wieder. Trotz des Missmuts etlicher Besatzungsmitglieder, die gerne noch ein paar Tage an Land verbracht hätten, schienen die Vorbereitungen in ordentlichem Tempo voranzuschreiten.
Während Beobrand schweigend neben dem hünenhaften Krieger herging, dachte er über seine Zukunft und die Entscheidung nach, die er gefällt hatte. Sein Leben hatte sich gestern auf eine Art und Weise verändert, wie er es sich noch vor wenigen Tagen nicht hatte vorstellen können. Inzwischen war sein Geist wieder klarer geworden. Er hatte eine kleine Portion vom heißen Haferbrei gegessen, sodass ihm sein Leben jetzt im Schein der Sonne und mit einer kühlen Brise im Gesicht nicht mehr ganz so grauenhaft erschien wie noch am gestrigen Abend. Zwar spürte er immer noch einen tief sitzenden Schmerz, der jederzeit an die Oberfläche brechen konnte, aber er versuchte, ihn zu ignorieren und sich auf die unmittelbaren Probleme zu konzentrieren. Sein Vater wäre stolz auf ihn gewesen.
Währenddessen musterte Bassus Beobrand genau. Bei allen Göttern, er sah seinem Bruder wirklich ähnlich. Beobrand war nicht ganz so hellblond, nicht ganz so groß und auch nicht ganz so muskulös wie Octa. Aber schon wenige Monate mit regelmäßigem Training würden einen kräftigen Kämpfer aus ihm machen, so wie sein älterer Bruder einer gewesen war. Er besaß denselben schwingenden Gang, denselben durchdringenden Blick. Bassus konnte erkennen, warum Edwin glaubte, dass aus ihm eines Tages ein großer Krieger werden würde. Das geschulte Auge eines Recken musste sehen, dass dieser Bauernjunge alle Anlagen eines Killers in sich trug. Bassus hoffte nur, dass er Beobrand in kurzer Zeit so viel beibringen konnte, dass er die nächste Schlacht überlebte, die schon in wenigen Tagen stattfinden würde.
Er konnte immer noch nicht glauben, dass Octa nicht mehr am Leben war. Ihre erste Begegnung war der Beginn einer engen Freundschaft gewesen, auch wenn Bassus ungefähr zehn Jahre älter als Octa gewesen war. Sie waren wie Brüder gewesen, hatten oft darüber gewitzelt, wie ähnlich ihre Geschmäcker waren, und regelmäßig die Sätze des anderen beendet. Und jetzt, da Octa tot war, fühlte sich Bassus, als hätte er tatsächlich einen Bruder verloren.
Beim Morgenmahl hatte Beobrand sich bei ihm nach den genauen Umständen von Octas Tod erkundigt.
»Es war so, wie du es gehört hast«, hatte er mit feierlicher Miene erwidert. »Fischer haben ihn auf den Felsen unterhalb der Palisade entdeckt.«
Octas Tod war ein schwerer Schock gewesen. Bassus hatte immer noch das Bild von seinem Leichnam vor Augen, die Knochen vielfach gebrochen, der Körper entstellt nach dem Sturz vom hohen Felsen, auf dem die Festung thronte.
»Aber warum hat er das getan?«, wollte Beobrand wissen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Bruder so verzweifelt gewesen war. Andererseits … was wusste er schon von ihm und seinem Leben hier? Drei Jahre waren eine lange Zeit.
»Er war in ein Mädchen namens Elda verliebt.« Bassus starrte gedankenverloren in das gerade entfachte Feuer. »Nach Octas hat man auch ihren Leichnam gefunden. Sie wurde ermordet. Brutal ermordet.«
Er sagte dem Jungen nicht, dass von ihr nicht mehr als ein Klumpen blutiges rohes Fleisch übrig geblieben war. Es war ein grausames Gemetzel gewesen, wie es zuvor noch niemand gesehen hatte.
»Er hat sie getötet?«, fragte Beobrand nach.
»Das glauben die Leute. Dass er zuerst sie und dann sich selbst umgebracht hat.«
»Aber du nicht?«
Bassus schwieg lange. Alle hatten gewusst, dass Elda und Octa ein Liebespaar gewesen waren. Deshalb hatten auch alle – da es keine Hinweise gab, die in eine andere Richtung deuteten – den naheliegenden Schluss gezogen, dass Octa Elda getötet hatte und anschließend in den Tod gesprungen war.
Allerdings hörte sich das alles in seinen Ohren durch und durch unglaubwürdig an. Octa hatte Elda leidenschaftlich geliebt. Sie hatten einander seit Monaten den Hof gemacht. Sie waren glücklich gewesen und hatten von Heirat gesprochen. Selbst wenn Elda ihm untreu gewesen wäre, hätte Octa sie niemals getötet, dessen war sich Bassus sicher. In der Schlacht war Octa ein Ausnahmekämpfer gewesen, aber gegen eine Frau hätte er niemals die Hand erhoben.
Edwin dachte genauso, aber ohne Zeugen und ohne einen Beweis des Gegenteils war das Offensichtliche die einzige Erklärung. Bassus fragte sich, ob das, was in jener Nacht wirklich vorgefallen war, jemals ans Tageslicht kommen würde. Aber wenn das Schicksal ihnen Antworten auf ihre Fragen geben würde, dann, so hoffte er, wäre er bereit, den Tod seines Freundes zu rächen.
»Nein. Ich glaube das nicht«, hatte er schließlich erwidert. »Ich glaube, er wurde ermordet, und zwar von dem Mann, der auch Elda umgebracht hat. Aber ich habe keine Ahnung, wer es gewesen sein und aus welchem Grund er das getan haben könnte.«
Beobrand klammerte sich an diese Worte wie ein Ertrinkender an ein Stück Treibholz. Er konnte nicht glauben, dass sein Bruder ein Mörder war, der sich selbst das Leben genommen hatte. Da war es noch besser zu glauben, dass er einem Mord zum Opfer gefallen war.
Wer mochte das getan haben? Beobrand blickte über die Schulter hinauf zur Festung. War der Mörder hier? Auf Bebbanburg? War er gestern Abend auch im Saal gewesen? Hatte er vielleicht sogar mit ihm geredet? Er hatte nicht den geringsten Hinweis darauf, wer Octa das Leben genommen hatte. Niemand hatte den Blutzoll für seinen Tod entrichtet. Aber falls Beobrand den Mörder seines Bruders entdeckte, dann würde er nur eine Währung akzeptieren.
Sie näherten sich den Schiffen. Bassus ließ die beiden Schilde fallen, die er sich auf den Rücken geworfen hatte, und stieß die zwei mitgebrachten Speere in den Sand. Beobrand wandte sich dem hünenhaften Krieger zu und sprach zum ersten Mal seit ihrem Verlassen des Saales.
»Es wird nicht lang dauern. Ich möchte mich nur verabschieden.«
Bassus nickte, setzte sich in den Sand und blickte auf die graublaue See hinaus.
Beobrand ging die letzten Schritte bis zu den Schiffen allein. Noch bevor er den Männern aus Cantware einen Gruß zurufen konnte, begannen etliche, ihm zu winken. Einige wenige unterbrachen ihre Arbeit und kamen zu ihm, um ihm persönlich Lebewohl zu sagen. Die meisten von ihnen waren älter als er und pflegten im besten Fall einen rauen Umgangston, aber jetzt strahlten sie eine Zartheit aus, die Beobrand berührte. Er war einer von ihnen, und jetzt ließen sie ihn hier zurück, lieferten ihn einem ungewissen Schicksal aus und sorgten sich um ihn. Sie wussten um die Tragödien seines Lebens und hofften, er möge in diesem nördlichen Königreich sein Glück finden. Ein paar Männer schenkten ihm sogar Erinnerungsstücke – er bekam einen kleinen Lederbeutel, ein Messer mit Knochengriff von Immin und einen aus einem Walzahn geschnitzten Hammer Thunors von Hrothgar, der ihn immer um den Hals getragen hatte.
»Möge er dir Glück bringen, junger Krieger«, stieß er unwirsch hervor, bevor er sich rasch umdrehte. Es war unübersehbar, dass er nicht zu viele Gefühle zeigen wollte, und so brüllte er im nächsten Moment schon seine Männer an, die kurz die Arbeit eingestellt hatten: »Nun macht schon, ihr Faulpelze! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die Flut wartet nicht.«





























