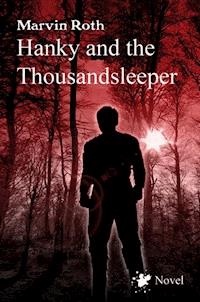Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seelen Schlachter - (Hank Bersons erster Fall) Hank Berson erwacht aus einer geistigen Umnachtung. Ausgelöst wurde dies durch den Kontakt zu einem Wesen, dass seit unendlichen Zeiten Menschen dazu missbraucht, und ihre Lebensenergie raubt. Dabei ist es dem Wesen egal, ob seine Opfer dabei sterben. Im Gegenteil. Im Lauf der Jahrhunderte ergötzt sich der Räuber daran zu Morden. Er ist ein unheimlicher Jäger, der nicht zu fassen ist. Hank Berson erkennt die Gefahr, und macht sich auf, den Jäger zu jagen. Seelenschlachter ist der erste Band einer Reihe von Geschichten, die sich mit dem Roman "Lebens Spender" fortsetzt. Herzlichst Ihr Marvin Roth
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C&M
Art House
Der Autor
Marvin Roth lebte von 2001 bis 2011 in den USA. Durch berufliche und private Reisen, die ihn und seine Frau quer durch die USA führten, abseits der touristischen Routen lernten sie Land und Leute kennen und lieben. Marvin Roth veröffentlichte bereits früh Kurzgeschichten und beschäftigt sich seit 2004 mit verschiedenen Romanideen. Die Idee zuSeelenschlachterkam ihm im Jahr 2005. Bis zum fertigen Buch dauerte es weitere drei Jahre, da der Autor nicht durchgehend an dem Roman arbeiten konnte. Zurzeit sind weitere Romane in Vorbereitung, darunter eine weitere Hank Berson Story.
Seelenschlachter
Marvin Roth
Seelen
Schlachter
Titelbild: Marvin Roth
Lektorat: Jürgen Stürmer
Satz und Layout: Ralf Berszuck
Umschlaggestaltung: Marvin Roth
Copyright © 2009 by Marvin Roth
Besuchen Sie unsere Website
http://www.cm-art-house.de
Original Titel: Hanky und der Tausendschläfer
Vom Autor überarbeitete Version.
Alle Rechte vorbehalten.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Verarbeitung
und die Verbreitung des Werkes in jedweder Form, insbesondere zu Zwecken der Vervielfältigung auf fotomechanischem, digitalem oder sonstigem Weg
sowie die Nutzung im Internet dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen.
Danksagung
Meinen Dank an meine liebe Frau Conny für die unverzichtbare Mitarbeit, die Geduld, meine Texte mehr als einmal zu lesen, und ihre wichtigen Kommentare!
Den schönsten der Kommentare brachte sie ziemlich am Anfang des Buches, als ich zu der Szene kam, wo die Bestie in dem Hasen saß und der Hund den Hasen sah.
Sie sagte sehr bestimmt:»Tu ja dem Hund nichts!«
Oder noch besser von unserer Freundin Patti kommentiert,
als wir ihr diese kleine Episode schilderten:»Don‘t kill the dog!«
Widmung!
An alle meine Leser einen herzlichen Dank für ihre Bereitschaft, auch einmal das Undenkbare zu denken!
Vorwort
Wir alle haben schon von Geistern, Poltergeistern, Kobolden und Dämonen gehört.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum das so ist?
Schon seit Menschengedenken befassen wir uns mit diesen unheimlichen Wesen. Gibt es sie wirklich, oder ist das alles nur Phantasie? Wer will das schon genau sagen? Fakt ist jedenfalls, dass Vorstellungen der Völker Afrikas, Indonesiens, Ozeaniens, des Amazonasgebiets, aber auch der Römer, Germanen, Chinesen, Japaner sowie die katholische Kirche und der Islam von diesen Geschöpfen geprägt wurden.
Es gibt sogar einen Forschungszweig, der sich mit dem sogenannten Animismus beschäftigt — das ist lateinisch und bezeichnet den Glauben, dass alle Dinge und Naturerscheinungen eine Seele besitzen, die nach dem Tod den Körper verlässt und woanders weiterlebt.
Noch heute werden Kultfeiern veranstaltet, bei denen Geister vertrieben werden sollen. Auch Sie haben schon an solchen Feiern teilgenommen! Ganz bestimmt! Oder waren Sie noch nie auf einem Polterabend? Na also!
Der Polterabend hat seinen Ursprung im 16. Jahrhundert und heißt genau genommen Poltergeistabend. Durch das Zerschlagen von Porzellan wird den Poltergeistern gezeigt, dass diese Arbeit schon getan ist und sie nicht weiteres Geschirr zu zerschlagen brauchen. Damit soll dem jungen Ehepaar eine ruhige Nacht gesichert werden.
Dies ist nur ein Beispiel aus unserem »modernen« Leben, das erkennen lässt, dass Geisterwesen noch immer eine Rolle spielen.
Begleiten Sie nun Hank Berson bei seinem aufregenden Abenteuer.
Ich wünsche Ihnen spannende Stunden!
Ihr
Marvin Roth
Kapitel 1
Der Morgen kroch mit müden, kalten Nebelschwaden über die Waldwiese.Tautropfen hingen an den Zweigen der Buchen, Eichen und Eiben. Das Gras zeigte die ungesunde, ins Blaugraue tendierende Farbe des voranschreitenden Herbstes. Der Tag erwachte langsam und mühselig. Fahles Licht der hinter grauen Wolken versteckten Sonne vertrieb nur schwerfällig die Nachtkälte.
Eine kleine Gruppe Rehe stand am Waldrand und äste. Sie kamen fast jeden Morgen zu dieser frühen Stunde auf die einsame Lichtung, ehe der Wald mit all seinen Geräuschen ihre gesamte Aufmerksamkeit forderte. Hier war es sicher, und noch nie war ein Räuber hier erschienen. Trotzdem waren die Tiere, ihrer Art entsprechend, vorsichtig. Abwechselnd schauten sie auf und überprüften den nahen Waldrand, auf eine verdächtige Bewegung, das Rascheln eines Strauches oder das Knacken eines Astes achtend.
Doch alles war wie immer. Der Wald lag ruhig da, und nur eine leichte Böe bewegte die Spitzen der Gräser.
Von einer Sekunde zur anderen veränderte sich das friedliche Bild schlagartig. Die gesamte Gruppe stellte wie auf einen geheimen Befehl das Äsen ein und schaute gebannt in die gleiche Richtung. Optisch hatte sich nichts geändert, auch war kein ungewöhnliches Geräusch zu hören, aber dort draußen war etwas. Dort war ein Jäger, der gefährlicher und grausamer war als alle anderen. Er war lautlos, unsichtbar und doch voller Mordlust. Die Rehe spürten, wie er erwachte. Sie spürten das Grauenvolle und Unfassbare. Sie spürten, wie das Böse nach ihnen tastete.
Mit vor Panik aufgerissenen Augen und Schaum vor dem Maul, durch das hastige, überschnelle Atmen in großer Angst verursacht, stampften die Tiere das feuchte Gras nieder, ehe sie, nicht ohne andere Rehe anzurempeln, in entgegengesetzte Richtung in den Wald flohen.
Momente später zeugten nur die niedergetrampelte Wiese und das immer leiser werdende Geräusch brechender Äste von der Anwesenheit des Rudels.
Einige Kilometer entfernt knatterte der Farmer Ben Jo-hanson mit seinem altersschwachen, aus den Fünfzigern stammenden Fordtraktor über die holprigen Feldwege von Prisco. Er war heute früh dran, denn er wollte am Nachmittag mit seiner Frau Julie noch in die Stadt fahren, wenn man New Bismark so nennen konnte. Dort gab es nur das Kaufhaus des alten Josh Biller. Zusätzlich konnte man noch in einigen kleinen Läden die Sachen des normalen Lebens kaufen. Die Geschäfte lagen an der Mainstreet von New Bismark. Insgesamt gab es da aber nicht mehr als vielleicht fünfundzwanzig Straßen mit etwa dreitausend Einwohnern. Er freute sich schon auf den Ausflug, obwohl Einkaufen nicht so seine Sache war. Aber während Julie bei Josh Biller die Regale durchstöberte, würde er bei Betty Sue, deren kleines, ländliches Restaurant direkt neben dem Frisörladen von Hose de
Villa lag, die Neuigkeiten der Gegend hören und einige gesellige Stunden mit seinen Freunden verbringen. So war der Einkaufstag schon immer gelaufen, jedenfalls seit der Zeit, als er die Farm von seinem Vater geerbt hatte, und das war schon zweiunddreißig Jahre her.
Am Abend zuvor hatte das Verhängnis begonnen. Ein Fuchs hatte eine Elster gefangen. Er hatte lange auf der Lauer gelegen, und sein Magen knurrte vor Hunger. Dann war direkt vor ihm die Elster gelandet. Der Vogel war unaufmerksam und stocherte mit seinem Schnabel in der Erde herum, auf der Suche nach einem Wurm oder einer schmackhaften Made. Der Fuchs sprang aus einem kleinen Gebüsch hervor, und beinahe wäre es dem Vogel noch gelungen, die Flucht zu ergreifen. Er flatterte auf, und der Fuchs sprang dem Vogel hinterher. Im letzten Moment erwischte er ihn gerade noch an den Schwanzfedern und riss ihn zu Boden. Schnell stellte er seine Pfote auf den Leib der Elster und biss dieser hastig das Genick durch. Sofort erschlaffte die Elster, und ein paar Tropfen Blut fielen auf den Waldboden. Dort versickerten sie im weichen Humus. Der Fuchs packte seine Beute und lief von plötzlicher Panik befallen mit ihr davon. Nach wenigen Sekunden war er im dichten Unterholz verschwunden. Das Blut aber weckte tief unter dem Humus etwas, das nie mehr hätte erweckt werden sollen.
Ben Johanson hatte gerade mit dem Pflügen angefangen, als er drüben am Waldrand eine Bewegung wahrnahm. Ben schaute genauer hin und sah einen Mann in blauer Latzhose, kariertem Hemd und einer schwarzgrauen
Baseballmütze dort stehen. Der Mann winkte ihm zu. Ben winkte zurück und erkannte Hank Berson, den alle aber immer nur Hanky nannten, obwohl er an die zwei Meter groß war. Hanky hatte strohblondes Haar und das Gemüt eines siebenjährigen Jungen.
Seine Eltern, Ellie und Daniel, hatten damals geheiratet, obwohl sie Cousin und Cousine ersten Grades waren. Aber hier auf dem Land machte sich zu dieser Zeit keiner große Sorgen darum. Wenn die Kinder sich liebten, sagten alle, dann sollten sie ruhig heiraten. Sie waren doch so ein schönes Paar.
Schon von kleinauf waren Ellie und Daniel immer zusammen gewesen. Daniels Vater, Ray, war Waldarbeiter, und ab und zu brachte er abends ein Stück Wild mit nach Hause, was in den armen, harten Tagen Fleisch für eine Woche bedeutete. Gleich neben den Bersons lebte in einer kleinen Hütte seine Schwester Willma, die den Bergarbeiter Ed Leuten geheiratet hatte. Er brachte nie genügend Geld mit nach Hause, um seine kleine Familie ordentlich zu versorgen. Oft kam er betrunken nach Hause und hatte nicht mehr viel Geld in der Tasche. So kam es, dass Willma und ihre kleine Ellie regelmäßig bei der Familie ihres Bruders zu essen bekamen. Eines Tages kam Ed nicht mehr nach Hause. Anfangs glaubte seine Frau, Ed wäre wieder auf einer Sauftour, doch als er nach drei Tagen noch nicht wieder aufgetaucht war, machte sich Ray auf die Suche. Er schulterte sein Gewehr, packte etwas Brot und getrocknetes Rehfleisch in einen Beutel und ging los. Tagelang durchstreifte er die Wälder und die nahegelegenen Gemeinden. Keiner der Leute, die er nach seinem Schwager fragte, hatte Ed gesehen. Am fünften Tag fand er ihn schließlich ... oder vielmehr das, was von ihm übrig geblieben war. Ed lag an einem Abhang, etwa fünf Meilen von seinem Zuhause entfernt. Er war schrecklich zugerichtet. Kaum ein Körperteil war noch an seinem natürlichen Platz. Er war so verstümmelt, dass Ray sich übergeben musste. Nach einer Weile schaufelte er mit bloßen Händen ein Grab für seinen Schwager und beerdigte ihn. Gewissenhaft hatte er alle Spuren des grauenhaften Geschehens beseitigt und sogar Laub und Zweige über den aufgewühlten Boden verteilt. Der Wald sah nun wieder völlig unberührt aus. An einem nahen Bach wusch er sich gründlich und ging dann zurück zu seiner Familie. Dort angekommen sagte er, dass er nichts gefunden habe und Ed bestimmt weggelaufen sei. Seine Schwester und ihre kleine Tochter zogen nun ganz zu Rays Familie. Von diesem Tag an waren Ellie und Daniel immer zusammen. Für jeden im Tal war es ein gewohntes Bild, dass die beiden überall gemeinsam auftauchten, und so war es fast natürlich, dass sie schließlich heirateten.
Ein gutes Jahr nach der Heirat wurde Hank geboren. Schon bald merkten die Eltern, dass ihr Sohn anders war als die anderen Kinder. Sie gaben dem Kleinen all ihre Liebe. Er wuchs prächtig heran, aber mit seinem Kopf war etwas nicht in Ordnung, wie die Leute sagten.
Jeder im Tal kannte Hanky. Oft fuhr er mit seinem alten Fahrrad herum und sang Kinderlieder, und das tat er immer noch, obwohl er schon fast dreißig Jahre alt war. Hanky liebte sein Fahrrad, und er liebte den Wald. Die Leute sagten, das habe er von seinem Großvater geerbt. So manchen Tag streifte er durch die Wälder und kam erst bei Einbruch der Dunkelheit nach Hause.
So machte sich Ben Johanson auch keine Gedanken, als er Hanky am Waldrand stehen sah.
Hankysah den Traktor von Ben Johanson über das Feld fahren. Er mochte Ben gern, denn Ben war immer freundlich zu ihm. Manchmal schenkte er ihm ein Stück Schokolade oder ein Zitronenbonbon. Er stellte sich also gut sichtbar am Waldrand auf und winkte dem Farmer zu. Vielleicht hatte Ben Schokolade bei sich, und wenn er schön winkte, bekam er ein Stück. Der Farmer aber winkte nur kurz zurück und wendete sein Gefährt, um die nächste Reihe zu pflügen.
»Dann hat er nix dabei«,murmelte Hanky vor sich hin.
Ein Eichhörnchen rannte keine zwei Meter an ihm vorbei, und Hanky hatte Ben Johanson schon vergessen. Mit großen Kinderaugen schaute er dem Tier zu, wie es flink und gewandt den Baum erklomm. Nach einer Weile hatte er genug vom Zuschauen und tappte in seiner unbeholfenen Art in den Wald hinein.
Etwa zur gleichen Zeit schaute Rita Miller, die Grundschullehrerin von Prisco, ob alle Kinder der dritten Klasse ihre Jacken und Mützen ordentlich angezogen hatten. Sie war eine sehr verantwortungsbewusste und engagierte Lehrerin, und die Kinder liebten sie. Rita hatte keine eigenen Kinder und konnte, so sagten die Ärzte zumindest, auch keine bekommen.
So hatte sie sich nach einiger Zeit damit abgefunden und konzentrierte sich mit Freude auf ihren Beruf. Ihr Mann Richard arbeitete bei der örtlichen Redaktion der
New Bismark News. So war er immer bestens informiert, was in der Gegend passierte. Das war ganz nach seinem Geschmack, denn er klatschte gerne und wäre bestimmt ein gern gesehener Gast bei so manchen Kaffeekränzchen gewesen. Er fuhr aber lieber durch die Gegend, sprach mit Farmern und den Angestellten kleiner Firmen über deren Probleme.
Nur einmal pro Woche musste er in die Redaktion nach New Bismark fahren, um dort seine Berichte abzugeben und auch manchmal einen Auftrag für ein spezielles Thema zu bekommen.
Rita Miller stellte die Kinder in zwei Reihen auf. Für heute hatte sie einen Ausflug in den Wald geplant. Die Kinder freuten sich schon darauf, mussten sie doch nicht den ganzen Tag ruhig auf den Schulbänken verbringen. So marschierte die kleine Gruppe los. Nachdem sie die Mainstreet überquert hatten, bogen sie in eine kleine Seitenstraße ein, die sie über einen Feldweg direkt zum Wald bringen würde.
Kapitel 2
Unter dem Humus war es warm und feucht. Hier war noch nichts vom Herbst und dem nahenden Winter zu bemerken. Es wäre ihm auch egal gewesen. Er spürte nichts davon. Er verspürte nur zwei Gefühle: Hunger und Rachsucht. Das war bei ihm gleichzusetzen mit purer Mordlust. Aber er musste warten. Das wenige Blut, das vermischt mit der Feuchtigkeit des Bodens zu ihm heruntergedrungen war, reichte gerade aus, um ihn zu wecken. Nun musste er warten. Warten auf einen Transportkörper. Warten auf ein ausreichend großes Tier, auf das er überwechseln konnte. Obwohl er ungeduldig war, wusste er, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis er aus seiner Gefangenschaft befreit war. Der Ärger kehrte langsam zurück. Der Ärger, damals überrumpelt worden zu sein. Sein Gastkörper war erschossen worden und gestorben, bevor er in einen anderen Körper schlüpfen konnte. Das hatte ihn betäubt, und bevor er sichs versah, war er im Waldboden verscharrt worden. Das Sterben des Wirtskörpers hatte ihn so geschwächt, dass er ausruhen musste. Schließlich war er so schwach geworden, dass er eingeschlafen war. Er hatte lange geschlafen, wie schon so oft. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wie oft. Immer wieder hatte sich das Schicksal gegen ihn gewandt. Aber immer wieder hatte er es geschafft, zurückzukommen. Und jedes Mal hatte er sich gerächt. Grausam gerächt. Die Menschen begannen ihn als Dämon zu betrachten und erzählten sich Geschichten über seine Taten. Manchmal hatte er sich unbemerkt unter sie gemischt und hatte zugehört. Er fühlte sich den Menschen weit überlegen und betrachtete sie voller Verachtung. Doch er war etwas völlig anderes als ein Dämon.
Hankywar schon ein ganzes Stück durch den Wald gelaufen. Manchmal hatte er gesungen. Seine Lieder. Kinderlieder. Er liebte es, alleine herumzuwandern und zu singen. Die anderen schauten immer so komisch, wenn er sang. Aber hier waren keine anderen, und so konnte er aus vollem Halse und manchmal auch ganz leise singen, je nachdem, wie er sich gerade fühlte. Oft redete er auch mit sich selbst oder mit allem, was er so bei seinen Wanderungen sah. Er redete mit den Bäumen, den Vögeln, die scheinbar immer aufmerksam und interessiert auf ihn herabblickten. Ab und zu redete er auch mal mit einem Igel, die waren aber recht grimmige Burschen und schauten ihn nicht mal an, wenn er mit ihnen sprach. Der Wald war gut zu ihm und hatte ihm noch nie wehgetan. Die Tiere blieben in seiner Nähe, da er irgendetwas ausstrahlte, das man vielleicht als Gutmütigkeit und Sanftmut beschreiben konnte. Hanky hatte gerade einem Ameisenvolk zugeschaut, das in langer Kolonne über die kleine Lichtung marschierte, an deren Rand er stand.
»So viele Meisies«,murmelte er, »drei, fünf, dreizehn, acht, einundvierzig, sechs, zwei.«
Hankyhatte es nie geschafft, das Zählen zu lernen. Ihm gefiel es aber sehr, Zahlen aufzusagen. Er kannte alle Zahlen bis Hundert, aber ihm fehlte das Verständnis, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das machte Hanky aber nichts aus, er dachte nicht einmal darüber nach. Er richtete sich wieder auf und wollte gerade weitergehen, als er eine Stimme zu hören glaubte. Etwas rief ihn. Nicht eigentlich mit Worten, sondern irgendwie in seinem Kopf, was Hanky sehr verwirrte. Unruhig schaute er sich um und trappelte nervös mit den Füßen, was er immer tat, wenn er nicht wusste, was er machen sollte. Er kratzte sich nervös am Nacken, dann hielt er sich die Ohren zu, doch das Rufen war immer noch da. Hanky tappte ein Stück auf die Lichtung hinaus, und das Rufen in seinem Kopf wurde etwas lauter.
Rita Miller war mit ihren Kindern am Waldrand angekommen und stand nun fast an der Stelle, an der Hanky einige Zeit zuvor das Eichhörnchen beobachtet und Ben Johanson zugewinkt hatte. Ben war fast mit dem Pflügen fertig und machte eine Pause, um sich seine Pfeife anzustecken. Er rauchte meistens im Freien, da seine Frau Julie es nicht ausstehen konnte, wenn es im Haus nach Pfeifentabak roch. So stopfte sich Ben seine Pfeife und sah der kleinen Gruppe am Waldrand zu.
Die Kinder hüpften aufgeregt hin und her, und Rita Miller zupfte den Kleinen erneut die Jacken zurecht. Danach zählte sie die paarweise aufgestellten Kinder noch einmal durch. Dann setzte sich die Gruppe in Bewegung und wollte gerade in den Wald hineingehen, als von dort ein wüstes Geschrei zu hören war. Ben setzte sich aufrecht hin, um besser sehen zu können, was da vor sich ging. Die Kinder und ihre Lehrerin blieben verdutzt stehen und horchten ebenfalls in den Wald hinein. Das Geschrei wurde immer lauter, und mit einem Male brach Hanky durch die Büsche, rannte noch ein Stück weiter und blieb dann schwer atmend in den frisch gepflügten Furchen des Feldes stehen. Er schüttelte wie benommen den schweren Kopf, als wolle er etwas aus seinem Haar verscheuchen. Dann erst sah er Rita Miller mit den Kindern. Diese scharten sich um ihre Lehrerin und schauten auf den mit Blättern und Erde verdreckten Hanky. Aus einer Schürfwunde an seinem Kopf sickerte Blut und zog eine dunkle Spur durch sein verschwitztes Gesicht.
»Nich da reingehn«,stammelte Hanky. »Böses Ding is da, nichreingehn.«
Rita Miller machte sich von den Kindern los und bedeutete ihnen, stehen zu bleiben. Danach ging sie zu Hanky, der am ganzen Leib zu zittern begonnen hatte.
»Hanky, armer Hanky«,sagte sie, »was hat dich denn nur so erschreckt?«
»Nichreingehn, nichreingehn«,stammelte er.
Inzwischen war Ben Johanson über das Feld gekommen und fragte: »Was ist denn hier los? Hanky, was ist denn mit dir? Du bist ja ganz verdreckt. Bist du hingefallen?«
»Nich da reingehn«,wiederholte Hanky mit nun stumpfem Blick. »Böses Ding is da.«
»Der ist ja völlig aus dem Häuschen«,sagte Ben zu Rita Miller.
»Es ist bestimmt besser, wir bringen ihn ins Dorf zu Doktor Ness«,antwortete die Lehrerin.
Sie ging zu Hanky und nahm ihn an die Hand wie einen kleinen Jungen, was in einer anderen Situation bestimmt lustig ausgesehen hätte, da Hanky fast zwei Köpfe größer war als sie. Doch selbst die Kinder hatten den Ernst der Situation bemerkt, verhielten sich ruhig und sprachen nicht. Keiner machte Witze oder hüpfte herum. Einige schauten ängstlich zum Wald, als würden auch sie spüren, das da etwas Unheimliches vor sich ging. Ben ging ein kleines Stück mit der Gruppe mit und stieg dann schließlich auf den Traktor.
»Ich werde nach Prisco vorfahren und den Doktor unterrichten«,rief er der Lehrerin zu. Danach startete er den Motor und fuhr los.
»Da kann ich den Jungs in New Bismark was erzählen«,dachte er, »und Julie auch.« Kurz darauf bog er in den Feldweg ein, der nach Prisco führte.
Kapitel 3
Er brüllte, für menschliche Ohren unhörbar, und raste vor Zorn in seinem dunklen Gefängnis. Erst hatte er geglaubt, er hätte Glück, als er fühlte, das sich da ein vermeintliches Opfer näherte. Er hatte gerufen und gelockt. Noch nie war ein Opfer seinem Rufen entkommen. Noch nie hatte sich einer widersetzt. Doch dieser da hatte sich gewehrt. Er wollte in das Gehirn des Opfers eindringen, fand darin aber eine totale Unordnung und kein verwertbares Muster. Mit einem Male spürte er eine bekannte, verhasste Präsenz in den Schwingungen des Opfers. Er spürte die Präsenz seines letzten Gegners. Dieser hatte ihn damals überrumpelt. Doch irgendetwas stimmte nicht mit diesem Schwingungsmuster. Es konnte nicht derselbe sein. Andere Schwingungen waren zu hören, unbekannte. Das verwirrte ihn für einen Augenblick. In diesem Moment hatte er seinen geistigen Griff gelockert, und sein Opfer war davongestürmt. Nun war es weg, unerreichbar, und es würde bestimmt nicht mehr zurückkommen. Das hieß: weiter warten. Bestimmt würde er eines dieser stupiden Tiere übernehmen müssen. Das war zwar nicht besonders angenehm, aber manchmal, wenn er auf der Jagd war, bediente er sich dieser Kreaturen.
So wie damals, als er in der Gestalt eines Berglöwen diesen dummen Menschen getötet hatte. Der Kerl war durch den Wald gestapft, um eine Abkürzung zu seiner Wohnung zu nehmen. Das Ding hatte die Gedanken des Mannes gelesen. Der Mann war leicht zu töten gewesen. Doch nachdem das Ding im Körper des Pumas seine Wut und Mordgier ausgetobt hatte, kam ein anderer Mann durch den Wald und direkt auf ihn zu.
Das Pumading duckte sich, um den Mann anzuspringen, doch der richtete plötzlich ein Gewehr auf ihn und schoss, ehe das Ding flüchten konnte. Der halbe Kopf des Pumas flog auseinander, und das Tier blieb mit seinem unsichtbaren Gast unbeweglich liegen. Was dann weiter geschehen war, wusste das Ding nicht, und es war so geschwächt, dass es bald darauf einschlief. Eins hatte es sich aber gemerkt: die geistige Präsenz, die mentalen Schwingungen des Mannes.
Der alte Mann saß an seinem Lieblingsplatz auf der Holzveranda seines ebenfalls in die Jahre gekommenen Hauses. Er hatte auf die Bank, die an der Hauswand stand, ein Kissen gelegt, da ihm das Sitzen in letzter Zeit immer wieder Rückenschmerzen bereitete. Aber er war gerne hier draußen. Er genoss die frische Luft und den Blick über die Wiesen bis hin zum nahen Wald. Er lauschte mit Vergnügen den Vögeln und dem Rascheln der Blätter im Herbst.
Fast jeden Tag verbrachte er im Freien, wenn es das Wetter erlaubte. Es wurde ihm hier nie langweilig, da er ungestört seinen Gedanken nachhängen konnte. In den letzten Jahren kamen immer mehr Erinnerungen aus seinen Kinder- und Jugendjahren wie alte Freunde zu ihm zurück. Er mochte das, und es erstaunte ihn manchmal sehr, an welche Kleinigkeiten er sich da erinnern konnte.
Er konnte fast den Kuchen riechen, den seine Mutter immer sonntags auf den Tisch gebracht hatte. An seine Schulzeit mochte er sich nicht erinnern, da er damals sehr ungern in die Schule gegangen war. An seine Kinderfreunde aber dachte er sehr oft. Was hatten sie zusammen doch für verrückte Streiche ausgeheckt, und wenn er daran dachte, musste er manchmal richtig lachen. Wenn ihn dabei jemand beobachtet hätte, wie er da saß, ganz alleine, und sich ausschüttete vor Lachen, dann würde dieser heimliche Beobachter bestimmt am Verstand des Alten gezweifelt haben.
Oft, sehr oft, dachte er an seine Frau und das Leben mit ihr. Wie oft hatte er ihr aus falschem Stolz oder dummer Rechthaberei wehgetan, statt sie in die Arme zu nehmen und jede Stunde mit ihr zu genießen. Vor sechs Jahren war sie gestorben, oder, wie der Pastor damals sagte: von ihm gegangen. Die Welt war für ihn seit diesem Tag dunkler geworden. Er hatte mit Gott und der Welt gehadert. Er hatte sein Schicksal verflucht. Er hatte sich verflucht, noch zu leben.
Seine Kinder heirateten und waren nach Prisco in ein hübsches kleines Haus gezogen. Sie sagten damals, er solle doch mit in den Ort ziehen. Aber er wollte in seiner gewohnten Umgebung bleiben, in seinen eigenen vier Wänden. Hier war er zu Hause und nirgendwo sonst. Als die Kinder selbst ein Baby, einen Jungen bekamen, freute er sich, damals noch zusammen mit seiner Frau, sehr. Das war nun schon fast dreißig Jahre her, und das Baby von damals war nun ein Mann.
Ja, wenn es doch nur so wäre. Wäre es doch nur ein Mann geworden. Sein Enkel war noch immer ein Kind. Er hatte sich nur körperlich entwickelt, sein Geist war nicht mitgewachsen. Trotzdem hatte der alte Mann in seinem Enkel immer etwas Besonderes gesehen.
Er sagte immer: »Der liebe Gott hat sich etwas dabei gedacht, ihn so zu machen. Ihr werdet eines Tages schon sehen ... «
Damit brach er immer diesen Satz ab und ließ den Rest offen. Er war nicht immer gläubig gewesen. Selten war er in die Kirche gegangen, eigentlich nur, wenn seine Frau es von ihm verlangte. Das hatte sich aber mit dem Tag geändert, als er seinen Schwager im Wald beerdigte. Über dieses Drama hatte er zum Glauben gefunden. Er ging zwar immer noch nicht sehr oft zur Kirche, aber er sprach mit Gott. Er redete mit ihm, erzählte ihm Geschichten, wie einem alten Freund, und das jeden Tag. Das brachte ihm innere Ruhe und Zufriedenheit.
So saß er also auch an diesem Tag wieder draußen und schaute über die Wiesen und den Wald, wie jeden Tag. Doch heute war es anders als sonst. Etwas ließ ihn frösteln, obwohl die Herbstsonne warme Strahlen auf die Veranda warf. Er hatte ein unbehagliches Gefühl, wie schon seit Tagen. Er wachte immer ermattet auf und konnte sich an keinen Traum erinnern. Normalerweise schlief er sehr gut und wachte erfrischt auf. Irgendwas lag in der Luft, irgendwas war falsch. Angestrengt spähte er zum Waldrand hinüber, doch da war nichts zu erkennen. Alles sah normal aus.
Das Ding streckte unsichtbar seine mentalen Fühler aus. Es suchte wie ein Blinder, tastete umher und horchte. Weiter und weiter suchte das Wesen. Etwa zweihundert Meter entfernt nagte ein Kaninchen an einem Grasbüschel. Seine Ohren stellten sich mit einem Mal senkrecht auf und lauschten. Das Tier hörte erst ein feines Wispern, dann einen lauten, summenden Ton, wie ihn ein Bienenschwarm erzeugte. Noch ehe das Kaninchen sich zur Flucht wenden konnte, wurde sein Geist brutal zur Seite gedrängt, und ein kaltes Glitzern war plötzlich in seinen Augen. Das Ding hatte blitzartig die Kontrolle über das Tier. Das Kaninchen bewegte sich anfangs unsicher hin und her, als wäre es betrunken. Sein Herz schlug wie wild. Einige Zeit später drehte es sich Richtung Waldrand und jagte los.
Rita Miller war inzwischen mit Hanky bei Doktor Ness angekommen. Der Doktor wartete vor der Tür, da Ben Johanson ihn schon informiert hatte. Schnell lief er die kleine Treppe vor seinem Haus hinunter und auf die kleine Gruppe zu. Rita hatte noch immer die Kinder bei sich, da Hankys Zustand es nicht erlaubte, die Kleinen erst in die Schule zu bringen. Hanky, noch immer an Ritas Hand, zitterte wie bei einem Fieberanfall.
Kapitel 4
»Der Junge muss einen Schock haben«, murmelte der Doktor in sich hinein.
Er bedankte sich bei Rita für ihre schnelle Hilfe und versprach ihr, sich um alles weitere zu kümmern. Behutsam löste er Hankys Hand von Ritas und führte ihn ins Haus. Dabei sprach er beruhigend auf den armen Kerl ein. Rita schaute noch so lange den beiden hinterher, bis sie im Haus verschwunden waren. Danach ging sie mit den Kindern zurück zur Schule.
Kaum waren der Doktor und Hanky im Sprechzimmer angekommen, begann Hanky aus Leibeskräften zu brüllen. »Es kommt, böses Ding kommt. Hanky hat Angst. Dodor, wir müssen weg. Schnell, das böses Ding kommt«
Er rannte wie wild im Zimmer hin und her, und Speichel rann ihm aus dem Mund. Als ihn der Doktor am Arm festhalten wollte, stieß ihn Hanky wie eine Puppe beiseite. Doktor Ness rannte zu einem Medizinschrank und nahm nach kurzem Suchen eine Spritze und ein kleines Fläschchen mit einem starken Beruhigungsmittel heraus. Er zog die Spritze auf und versteckte sie dann mit der rechten Hand hinter seinem Rücken. Hanky brüllte noch immer und schien in seiner Panik die Tür nicht zu finden. Er rannte wild mit den Armen fuchtelnd durch das Behandlungszimmer und stieß dabei einige Sachen zu Boden. Als eine Aluminiumschale scheppernd herunterfiel, war er kurz abgelenkt und schaute auf das silberne Ding. In diesem Moment stieß der Doktor ihm die Spritze in den Arm. Hanky war darüber so verblüfft, dass er für einen Moment sogar zu schreien vergaß. Das Medikament zeigte schnell Wirkung, und Hanky sackte weg. Er schlug hart auf den Boden und blieb dort mit zuckenden Gliedern liegen. Doktor Ness wischte sich den Schweiß von der Stirn und ging dann hinaus, um die Schwester zu holen. Einige Minuten später lag Hanky, mit Lederbändern festgebunden, in einem Nebenraum der Praxis. Seine Lippen bewegten sich trotz der Betäubung, als wollten sie noch immer die Warnung hinausrufen: »Böses Ding kommt ...«
Kapitel 5
Das Kaninchen hatte den Waldrand erreicht. Es schaute sich suchend um. Nach kurzer Zeit hoppelte es Richtung Prisco davon.
Etwas oberhalb von Prisco lag die Farm von Jerry Prado. Jerrys Farm war ein kleiner Betrieb. Mit zwei Arbeitern bewältigte er die Feldarbeit, und seine Frau Lynn versorgte die Tiere. Heute war es ruhig auf der Farm. Die Männer waren auf dem Feld, und Lynn traf sich an diesem Nachmittag mit Freundinnen. Nur der Hund Max lag in der Herbstsonne. Er war ein freundlicher Kerl und freute sich über jeden Besuch. Fliegen schwirrten durch die Luft, und ein stetes Gegacker kam vom Hühnervolk drüben, neben dem Schuppen. Max erhob sich etwas schwerfällig, schüttelte sich kurz und lief über den Hof zu seinem Wassernapf. Als er das Wasser schlabberte, bemerkte er eine Bewegung auf der angrenzenden Wiese. Sofort hörte er mit dem Trinken auf und schaute genauer hin. Da hockte doch tatsächlich ein Kaninchen und blickte ihn unvermittelt an. Es hatte überhaupt keine Angst. Max sträubte das Fell und begann leise, kehlig zu knurren. Das musste das Kaninchen gehört haben, aber zu seiner Verwunderung saß es immer noch am gleichen Platz. Das hatte er noch nie erlebt. Selbst die aufdringlichen
Katzen der Farm flüchteten bei seinem Knurren. Er lief mit gesenktem Kopf langsam über den Hof.
In diesem Moment rumpelte der Ford des Farmers auf den Hof, dicht gefolgt von einem neuen John-Deer-Traktor mit einem vollbeladenen Hänger. Jerry stieg aus dem Wagen und dirigierte den Traktor, auf dem seine beiden Arbeiter saßen, Jack Binder und Walt Kessler.
»Bringt den Hänger in die Scheune, Jungs. Für heute ist es genug. Wir laden dann morgen ab.«
Mit diesen Worten verschwand er im Haus. Er hatte heute keine Zeit mehr für die Arbeit auf dem Hof. Er würde sich schnell waschen und dann rüber nach New Bismark fahren. Dort wollte er sich mit seinen Freunden in Betty Sues Restaurant treffen. Viele Farmer nahmen diesen Termin gerne wahr, da sie dann immer den neuesten Klatsch aus den umliegenden Gemeinden hören konnten. Lynn wollte heute nicht mit, jedenfalls noch nicht. Gegen Abend würde sie dann direkt von ihren Freundinnen aus nach New Bismark kommen. Als er gerade fertig mit dem Waschen war, blickte er rein zufällig aus dem Badezimmerfenster im ersten Stock. Dort sah er eine erstaunliche Szene.
Sein Hund Max stand zitternd und mit aufgestelltem Fell mitten im Hof und schaute zur benachbarten Wiese. Was er dort sah, konnte Jerry nicht erkennen. Von der Scheune her kam Walt Kessler mit seiner Flinte. Die hatte er immer im Kofferraum seines Wagens liegen, in der Hoffnung, ab und zu etwas Wild zu schießen. Soweit Jerry wusste, hatte Walt bisher noch nie Jagdglück gehabt. Der Hund stand immer noch am gleichen Platz und starrte Richtung Wiese. Wie ein Soldat schlich sich
Walt von hinten an. Als er neben Max angekommen war, blieb er stehen, hob die Flinte und zielte. Jetzt sah Jerry, auf was Walt da anlegte. Keine zwanzig Meter entfernt kauerte ein Kaninchen völlig ruhig im Gras und schaute in Richtung des Jägers.
»Was für ein dummes Tier«,dachte Jerry, »läuft nicht mal weg.«