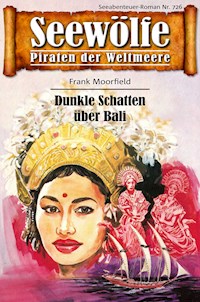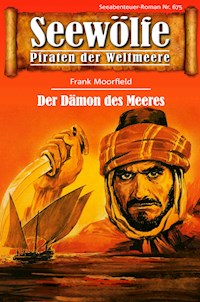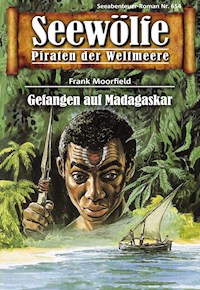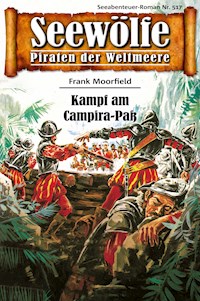Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Obwohl die Piraten zu wissen schienen, daß sie kaum eine Chance hatten, das sich anbahnende Gefecht unbeschadet zu überstehen, wollten sie doch nichts unversucht lassen. Deshalb brach augenblicklich die Hölle los. Ein wildes Brüllen und Fauchen erfüllte die stille, malerische Bucht. Die Piraten hatten je eine Culverine auf dem Achterdeck und der Back abgefeuert. Die siebzehn Pfund schwere Kugel, die das achtere Geschütz ausgespien hatte, galt der "Isabella", die andere der Karavelle. Die Kugel die der "Isabella" zugedacht war, klatschte zwar wirkungslos ins Wasser, dafür flogen auf der Karavelle aber die Fetzen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2016 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-573-6Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
„Du mußt jetzt gehen, Liebster“, flüsterte Dorina. „Es kann nicht mehr lange dauern, und sie werden kommen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas zustoßen würde.“ Ihre großen dunklen Augen, die so gut in das rassige, von langem, schwarzem Haar eingerahmte Gesicht paßten, blickten den jungen Mann ängstlich an.
„Ich liebe dich, Dorina“, sagte Sebastiano, und seine Stimme klang plötzlich heiser. „Es fällt mir schwer, von dir wegzugehen.“
Dorinas Gesicht sah traurig aus, aber dennoch kämpfte sie tapfer gegen die Tränen an. Nein, sie durfte nicht weinen, auch wenn der Abschied sie innerlich noch so sehr aufwühlte. Sie durfte Sebastiano das Gehen nicht durch Tränen erschweren. Es war schon schlimm genug für beide, sich für Monate oder Jahre, ja, vielleicht sogar für immer trennen zu müssen.
Ihr Gesicht schmiegte sich eng an die Brust Sebastianos. Und zum letzten Male atmete er den Duft ihres Haares, zum letzten Male spürte er ihre vollen, weichen Lippen, die ihn das Leben bisher als etwas Schönes und Wertvolles hatten empfinden lassen.
„Es wird nicht für immer sein, Dorina. Ich fühle es, ja, ich weiß es. Der Tag wird kommen, an dem wir wieder beisammen sein werden, denn wir gehören zusammen, so, wie hier in unserer Heimat die Berge und das Meer zusammengehören.“
Dorina nickte stumm. Sie hoffte nur zu sehr, daß diese Worte in Erfüllung gehen würden.
Für einen Augenblick schwiegen beide. Die Stille wurde nur vom Blöken der Schafe unterbrochen, die in ihrer Nähe weideten, und vereinzelt auch vom Geschrei der Wildenten, die zu dieser Jahreszeit in großen Schwärmen über Korsika, der „Insel der Schönheit“, hinwegflogen.
Sebastiano Tursi wußte, daß er sich jetzt aus den Armen der schönen Dorina losreißen mußte, bei der er sich in den vergangenen fünf Tagen versteckt gehalten hatte. Jetzt mußte es sein, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Verfolger ihn hier aufspürten, und dann würde das nicht nur schlimme Folgen für ihn haben, sondern auch für das Mädchen, das er liebte. Außerdem sollte ihm dieser Tag heute die Sicherheit bringen, die er schon so lange herbeisehnte.
Nach einem letzten Kuß trennten sich die beiden.
Sebastiano, ein junger Mann von höchstens fünfundzwanzig Jahren, mittelgroß und schlank, mit lockigem, schwarzem Haar und einem markanten Gesicht, ließ ein letztes Mal den Blick hinunter auf die silbrig schimmernde Wasserfläche des Golfes von Valinco, an der Westküste der Insel, wandern.
Die Sonne stand bereits wie ein glutroter Ball am Horizont – es konnte nicht mehr lange dauern, und die Dämmerung würde ihre zarten, grauen Schleier über die kontrastreiche Landschaft senken.
Für Sebastiano war Eile geboten, wenn er die einsame Berglandschaft mit den wenigen Hütten und Häusern noch vor Einbruch der Dunkelheit hinter sich bringen wollte. Er mußte so rasch wie möglich den Strand von Porto Bollo, einem kleinen Dorf, das da unten an der Mündung des Flusses Taravo lag, erreichen.
Denn heute war es soweit. Wenn es das Schicksal gut mit ihm meinte, müßte an diesem Abend dort hinter der Kimm das Schiff auftauchen, das ihn in Sicherheit bringen sollte.
Sebastiano Tursi spürte, wie ihm das Herz schwer wurde bei dem Gedanken, nicht nur Dorina, sondern auch diese herrliche Insel verlassen zu müssen, diese großartige Bergwelt, mit ihren dichten, aromatisch duftenden Buschwäldern, mit ihren prachtvollen Beständen an Edelkastanien, Kiefern und Weiden. Es war ihm, als müsse er sich von jedem einzelnen der majestätischen Gipfel verabschieden, die bis in den Frühling hinein mit Schnee bedeckt waren. Aber auch die Trennung von den malerischen Stränden und den kleinen, versteckten Dörfern fiel ihm schwer.
Das Gurren einer Wildtaube riß ihn aus seinen schwermütigen Gedanken. Ein allerletztes Mal wandte er sich zu Dorina um.
„Leb wohl!“ sagte er und nahm, als er ging, ihr letztes Lächeln mit auf die Reise ins Ungewisse.
Die Dämmerung begann bereits hereinzubrechen, er konnte sein Gehen nicht mehr länger hinausschieben. Als er zwischen den zerklüfteten Felsen verschwand, um den Weg hinunter zur Bucht einzuschlagen, konnte er nicht mehr sehen, wie Tränen in Dorinas Augen schossen. Allein der Selbsterhaltungstrieb sagte ihm, daß er sich jetzt auf das konzentrieren mußte, was vor ihm lag. Er war jung und kräftig und würde die Schwierigkeiten, die das Leben mit sich brachte, schon meistern.
Während Sebastiano Tursi den Berg hinuntereilte, hoffte er inbrünstig, daß kein Unglück und keine schlechten Windverhältnisse die Ankunft des Segelschiffes verzögern würden.
Niccolò Borgo, der Kapitän der „Santa Maria Figaniella“, war ein alter Freund seiner Familie, und ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Er war Korse und befehligte im Auftrag eines genuesischen Handelshauses die stattliche Galeone. Seine Handelsfahrten führten ihn, außer zu den Ländern des Mittelmeeres, bis an die Küste Afrikas und der Neuen Welt. Wenn er, Sebastiano, sich erst an Bord dieser Galeone befand, war er zumindest vorerst in Sicherheit vor seinen blutrünstigen Verfolgern. Niemand würde dort das grausame Gesetz der Vendetta, der Blutrache, an ihm vollstrecken.
Sebastiano Tursi war beileibe kein Feigling. Er hatte sich bisher allen Problemen und Schwierigkeiten, allen Höhen und Tiefen, die das Leben an ihn herangetragen hatte, mutig gestellt. Doch die Vendetta, die in seiner Heimat bereits seit vielen Jahrhunderten praktiziert wurde, hatte seine Familie bereits stark dezimiert. Er war das einzige, noch lebende männliche Familienmitglied. Und deshalb wollte er fliehen. Er fühlte sich verpflichtet, die Familie Tursi vor dem Aussterben zu bewahren.
Schon seit Jahren forderte das ungeschriebene Gesetz der Blutrache seine Opfer auf beiden Seiten. In der Familie Tursi hatten bereits der Vater Sebastianos und drei seiner Brüder ihr Leben gelassen.
Begonnen hatte alles mit einer falschen Zeugenaussage. Das Familienoberhaupt Giovanni Tursi hatte einem jungen Fischer die Hand seiner Tochter Angela verweigert. Er hatte dafür seine Gründe gehabt. Aus Wut darüber hatte der junge Fischer damals bezeugt, Giovanni Tursi habe Benozzo Ducale, seinen Partner, mit einem Schlag betäubt und über Bord gestoßen, um den Fang für sich allein behalten zu können. In Wirklichkeit war Benozzo Ducale, der mit seiner großen Familie in San Micheli, einem winzigen Bergnest in der Nähe von Porto Bollo gelebt hatte, bei stürmischer See über Bord gespült worden. Und damit hatte das Sterben in beiden Familien begonnen.
Die Familie Tursi, die in Porto Bollo lebte, war der Sippe Benozzo Ducales zahlenmäßig weit unterlegen. So war es geschehen, daß Sebastiano Tursi sich zur Flucht entschlossen hatte. Der Vertreter der feindlichen Sippe, die ihm nach dem Leben trachtete, waren Fulvio und Cosimo, die beiden ältesten Söhne der Familie Ducale. Sie waren harte, rauhe Burschen, die ihren Lebensunterhalt mit dunklen Geschäften verdienten. Wegen ihrer Verschlagenheit und Gewalttätigkeit hatten sie in der ganzen Umgebung der Bucht von Valinco einen schlechten Ruf.
Sebastiano Tursi stoppte seine Schritte und legte die Hand über die Augen. Er wußte nicht, wie oft er das an diesem Tag bereits getan hatte. Immer und immer wieder tasteten seine Augen die Kimm nach einer Mastspitze ab. Er wußte, daß er verloren war, wenn die „Santa Maria Figaniella“ nicht erschien. Er konnte sich nicht mehr länger verstecken. Die Brüder Ducale hatten geschworen, ihn umzubringen. Sie würden nicht nachlassen, ihn überall mit fanatischem Eifer zu suchen.
Schon konnte er weiter unten in der Bucht, wo sich das silbrige Band des Taravo in den Golf ergoß, die Mauern von Porto Bollo erkennen. Dort lebte seine Familie und ernährte sich mühsam von der kargen Landwirtschaft. An einen lohnenden Fischfang war nicht mehr zu denken, denn außer ihm gab es keine Männer mehr in der Familie, die auf das Meer hinausfuhren.
Sebastiano war gedrückter Stimmung. Er konnte sich nicht einmal von seiner Mutter und seinen Schwestern verabschieden, denn er mußte wie ein Geächteter das kleine Dorf umgehen, um ungefährdet den Strand zu erreichen.
Seine Familie war verarmt. Außer der Liebe Dorinas, die oben auf dem Berg in einem winzigen Gehöft bei ihren Eltern lebte, besaß er nichts, was er mit in die Ferne nehmen konnte. Sein ganzer Besitz war das, was er am Leibe trug.
Sebastiano hastete über Steine und Geröll, vorbei an Mastixsträuchern, duftendem Lavendel und hochwucherndem Farnkraut. Er durchquerte ein Felsenlabyrinth und erreichte dann die Macchia, den dichten, immergrünen Buschwald, der sich über einen Teil des Berghanges hinunterzog.
Die Luft roch frisch und salzig, der Abend brachte eine milde Brise vom Meer herüber. Die Sonne hatte sich fast bis zum Horizont gesenkt und tauchte die Wasserfläche des Golfes von Valinco in einen rötlichen Schimmer.
Aber Sebastiano Tursi hatte nicht die Zeit, diesen herrlichen Ausblick zu genießen. Er verhielt gerade neben einer Gruppe von Mandelbäumen, um seine Augen über die endlosen Wassermassen gleiten zu lassen – da sah er das Schiff.
Zuerst waren es die Mastspitzen und die großen Rahsegel, die an der Kimm auftauchten, und Sebastiano hoffte sehr, daß sie zur „Santa Maria Figaniella“ gehörten. Wieder und wieder ließ er seine Augen in die Ferne schweifen, doch er täuschte sich nicht. Das Schiff war näher gerückt und hielt unverkennbar auf die riesige Bucht zu.
Der junge Korse beschleunigte seine Schritte. Sein Herz begann plötzlich wie wild zu pochen. Aber so erleichtert er einerseits war, daß Niccolò Borgo sein Wort gehalten hatte, so sehr bedrückte ihn doch die Tatsache, daß er seine Heimat verlassen mußte. Still und heimlich, wie ein Dieb oder Ehrloser, mußte er sich davonschleichen, wenn er am Leben bleiben wollte.
Aus der Ferne hörte Sebastiano die Schiffsglocken glasen. Längst ging er nicht mehr, sondern rannte. Seine nackten Füße eilten über Steine und Geröll. Rasch wechselte er die Richtung, um Porto Bollo zu umgehen. Die Konturen des Segelschiffes waren inzwischen größer und deutlicher geworden. Ruhig und majestätisch lief es in die Bucht ein.
Der Weg zum Strand war nicht mehr weit. In wenigen Augenblicken mußte er den unteren Rand des Buschwaldes erreichen. Ein Stück weiter unten konnte er sich bereits in der Deckung der Felsen ans Wasser heranarbeiten, ohne gesehen zu werden. Er hatte jedoch längst die Erfahrung gesammelt, daß die Familie Ducale überall ihre Spitzel hatte. Nirgendwo konnte man sich deshalb in Sicherheit wiegen, zumindest nicht über einen größeren Zeitraum hinweg.
Das plötzliche Poltern von Steinen und Geröll ließ Sebastiano herumfahren. Seine Augen weiteten sich, über seinen Rücken fegte ein eiskalter Schauer.
Sie waren da. Sie hatten ihn gefunden. Dort oben am Steilhang verschwanden sie blitzschnell hinter einigen Felsblöcken, aber er hatte sie gesehen. Es waren Fulvio und Cosimo Ducale. Ihre wilden, bärtigen Gesichter waren unverwechselbar. Sebastiano zweifelte keinen Augenblick daran, daß sie versuchen würden, ihn zu töten, sobald sie näher an ihn herangelangt waren.
Er brauchte wahrhaftig kein Rechenkünstler zu sein, um sich seine Chancen auszurechnen. Sie waren zu zweit und wahrscheinlich bis an die Zähne bewaffnet. Er war nicht nur allein, sondern er hatte auch keine Waffen, wenn man von dem einfachen Buschmesser absah, das er am Gürtel trug.
Also kombinierte Sebastiano Tursi blitzschnell, daß er in erster Linie auf seine Beine angewiesen war. Er dachte nicht im geringsten daran, aufzugeben. Gerade jetzt nicht, als die „Santa Maria Figaniella“ mit vollem Zeug in die Bucht segelte.
Der junge Korse wußte sehr wohl, daß ihm der Tod dicht im Nacken saß, aber er wußte auch, daß er schnell und geschmeidig sein konnte wie eine Raubkatze, wenn es um sein Leben ging.
Rasch wirbelte Sebastiano herum und lief weiter, lief um sein Leben. Er achtete nicht auf spitze Steine und Dornen, die ihm bald blutige Spuren in die Haut rissen und sein Hemd zerfetzten. Er hatte nur ein Ziel vor Augen: den Strand. Er mußte ihn erreichen und notfalls schwimmend versuchen, zum Schiff zu gelangen.
An den Geräuschen hinter sich erkannte er, daß ihm die Verfolger auf den Fersen waren. Er nahm sich nicht die Zeit, einen Blick nach hinten zu werfen, denn der Weg war steinig und gefährlich. Er mußte sich voll auf sein Ziel konzentrieren. Einmal stolperte er und stürzte. Aber er raffte sich sofort wieder auf und lief weiter. Daß seine Hose über dem rechten Knie in Fetzen hing, registrierte er nur am Rande. Um die Hose ging es nicht, sondern um ihn – um sein Leben.
Die Geräusche hinter ihm wurden lauter. Die Verfolger schienen aufzuholen. Doch plötzlich verstummten sie, und Sebastiano hörte eine rauhe Männerstimme rufen: „Bleib stehen, Tursi, gib auf! Es hat keinen Zweck mehr, wir kriegen dich doch!“ Wie zur Bekräftigung dieser Worte krachte ein Pistolenschuß durch das Gestrüpp.
Aber Sebastiano stürmte weiter. Er dachte nicht ans Aufgeben.
Auch die Laute hinter ihm, die von raschen Fußtritten auf dem Geröll verursacht wurden, setzten wieder ein. Offenbar waren auch Fulvio und Cosimo Ducale fest entschlossen, ihr Ziel zu erreichen.
Als die Verfolger wieder ein Stück aufgeholt hatten, stoppten sie ihre Schritte abermals. Unmittelbar darauf flog am Kopf Sebastianos etwas vorbei, und er hörte einen dumpfen Aufprall. Noch im Laufen sah er, was es war – ein Messer, das sich wenige Schritte vor ihm in den Stamm einer Laricio-Kiefer gebohrt hatte.
Doch dieser Mordversuch der Brüder Ducale verschaffte ihm nur einen weiteren Vorsprung. Während er von einem mächtigen Felsblock aus hinuntersprang in den weichen Sand des Strandes, sah er, daß die „Santa Maria Figaniella“ ein Stück draußen bereits vor Anker gegangen war. Die Segel waren aufgegeit worden, und einige Männer waren damit beschäftigt, ein Beiboot abzufieren.
Sebastiano Tursi sah sein Ziel zum Greifen nahe. Aber er fühlte instinktiv, daß er noch lange nicht gewonnen hatte. Der Tod saß ihm noch immer im Nacken, deshalb jagte er mit Riesenschritten über den breiten Strand, direkt auf das Wasser zu, das den Sand leicht umspülte. Es gab keinen anderen Weg für ihn, er konnte sich nicht wie eine Maus in einem Loch verkriechen. Und hätte er es tun können, dann würden die Brüder Ducale mit Sicherheit vor dem Loch warten, bis er wieder auftauchen mußte. Ihr Haß und das Gesetz der Vendetta trieb sie weiter, rücksichtslos und unaufhaltsam.
Das Wasser spritzte auf, als sich Sebastiano mit fliegendem Atem hineinstürzte. Er war, wie die meisten Korsen, die in Küstennähe aufgewachsen waren, ein schneller und geübter Schwimmer. Aber auch Wasser konnte nicht unbedingt vor tödlichen Pistolenkugeln retten.
Während der junge Bursche, der um sein Leben schwamm, sah, wie die Männer im Beiboot der „Santa Maria Figaniella“ eilig auf ihn zupullten, erreichten auch Fulvio und Cosimo Ducale den Strand. Während sich Fulvio, der seine Pistole bereits abgefeuert hatte, ein Messer zwischen die Zähne klemmte und sich ins Wasser warf, verhielt Cosimo einen Moment und hob seine Schußwaffe. Die Kugel fuhr dicht neben Sebastiano ins Wasser und riß eine kleine Fontäne hoch. Dann tauchte auch der braunhäutige Cosimo in die Fluten.