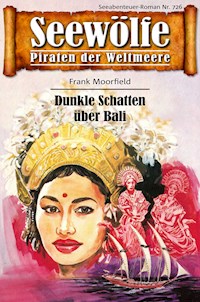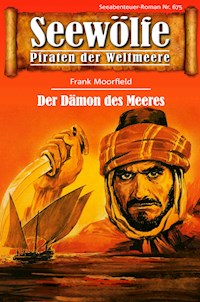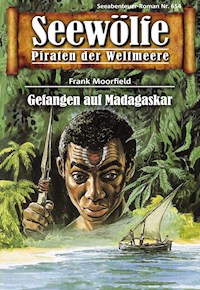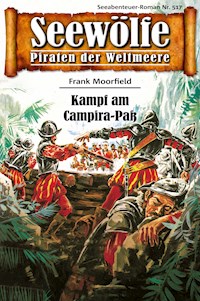Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Urplötzlich brach die Hölle los. Die sechs Drehbrassen des "Roten Drachen" Siri-Tongs entluden sich donnernd und fast gleichzeitig. Dabei ging man nach einer Taktik vor, die sich schon oft bewährt hatte. Da von jetzt an auch mit dem Einatz der feindlichen Drehbrassen gerechnet werden mußte, nahmen sich die Männer, die an den schwenkbaren Geschützen der Back auf Station waren, die Spanier vor, die man auf der "San Mateo" an gleicher Stelle postiert hatte. Die Männer an den Heckdrehbrassen konzentrierten sich dagegen auf die feindlichen Segel und die Takelage. Aus diesem Grunde hatten sie ihre Drehbrassen mit Kettenkugeln geladen. Und schon jetzt war ihre Wirkung zu sehen. Sie wirbelten durch das Rigg und schlugen riesige Löcher in die Segel...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2017 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-95439-730-3Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Frank Moorfield
Die Überlebendender „San Mateo“
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
„O heilige Madonna!“ schrie der spanische Generalkapitän und deutete entsetzt auf das Vorschiff der „Vencedor“.
Obwohl das Fauchen und Brüllen des Sturms seine Stimme übertönte, erregte seine heftige Gebärde die Aufmerksamkeit einiger Decksleute, die sich an den schlampig gespannten Manntauen über die Back hangelten.
Trotzdem war das Unglück nicht mehr abzuwenden.
Während starke Brecher das Schiff überfluteten, neigte sich der Fockmast plötzlich mit einem häßlichen Splittern und Krachen nach Backbord und kippte dann samt Rahen, Stengen und zerfetzten Wanten der schäumenden und kochenden See entgegen.
Zwei Männer konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein dritter Decksmann hatte weder den Entsetzensschrei des Capitáns gehört noch seine warnende Geste wahrgenommen. Er starrte mit schreckgeweiteten Augen nach oben und versuchte in letzter Verzweiflung, sich mittels der Manntaue aus der Gefahrenzone zu bringen, aber zu spät.
Die Taue, die bereits gestern im Auftrag des Generalkapitäns gespannt worden waren, reichten bei weitem nicht aus. Ein letzter gellender Schrei, und der gebrochene Fockmast sowie Berge von Spieren und Tauwerk begruben den Mann unter sich und rissen ihn mit über Bord. Der untere Teil des Mastes hinterließ dabei eine Schneise der Verwüstung im Schanzkleid der Back.
Der 24. Juni im Jahre des Herrn 1593 war ein Tag des Grauens. Bleigraue Wolken schoben sich wie gigantische Berge über den Atlantik. Die Elemente tobten, als wolle die Welt zusammenstürzen. Regen und Hagel peitschten vom Himmel, und eine Sturmbö nach der anderen fegte mit jäher Wildheit durch das Rigg der prunkvollen 450-Tonnen-Galeone.
Von Nordwesten her baute sich eine bedrohlich hohe Dünung auf, ihre riesigen Gischtfahnen leckten gierig über die Decks. Die „Vencedor“ kletterte schwarze, wogende Berge hinauf und verschwand gleich darauf in tiefen Wellentälern. In der Tat schienen sich die Schlünde der Hölle geöffnet zu haben.
Die Verbände des Schiffes ächzten und stöhnten wie eine gepeinigte Kreatur, und das Jaulen des Windes klang wie das Heulen verdammter Seelen. Der Sturm, der schon am Vortag westlich der Azoren mit Urgewalt aufgebrochen war, schien alles, was sich auf dem Wasser bewegte, für immer verschlingen zu wollen.
Die „Vencedor“ wurde von einer weiteren Woge erfaßt und krängte hart nach Backbord über.
Ramón Firuso de Fernández, der sich auf dem Achterdeck seines Flaggschiffes aufhielt, geriet ins Taumeln, doch er hielt sich geistesgegenwärtig an den Strecktauen fest, die in ausreichender Zahl und in voller Breite über das Achterdeck gespannt worden waren. Der Wind trieb ihm den Regen ins Gesicht, seine Augen brannten, und aus seiner durchnäßten Uniform tropfte das Wasser.
Der Generalkapitän schnitt ein grimmiges Gesicht und brüllte einige wilde Flüche in den Sturm hinaus. Daß er noch kurz zuvor, in einem Augenblick höchster Gefahr, die Madonna angerufen hatte, tat dabei nichts zur Sache. Schließlich hatte sie die zahlreichen Sturmschäden an der „Vencedor“ nicht verhindert und sogar zugelassen, daß der Fockmast über Bord ging.
Wer Ramón Firuso de Fernández kannte, wußte nur zu gut, daß seine Mißstimmung in erster Linie auf den Sturm und seine Folgeschäden zurückzuführen war, und nicht etwa auf den Verlust jenes armen Teufels, den der umgeknickte Mast erschlagen und über Bord gerissen hatte.
Auch der Decksmann, der schön einige Stunden vorher wegen der ungenügenden Zahl von Manntauen in den brodelnden Wassermassen verschwunden war, bereitete dem Generalkapitän kein Kopfzerbrechen, o nein. Der Verlust zweier Kerle des gemeinen Schiffsvolks war seiner Meinung nach allemal zu verkraften. Viel wichtiger waren ihm seine persönlichen Pläne und sein Schiff.
Ursprünglich hatte der kleine, etwas dickliche Mann mit dem bartlosen Gesicht und den glatten, schwarzen Haaren mit drei Kriegsgaleonen sowie vier wendigen und schnellen Karavellen den Geleitschutz für einen spanischen Verband, bestehend aus fünf dickbauchigen Handelsgaleonen, übernommen. Bei den Kriegsschiffen handelte es sich um die „Confianza“, die „San Mateo“ und das Flaggschiff „Vencedor“.
Die „Confianza“, die unter dem Kommando von Adriano de Mendoza y Castillo gesegelt war, hatte es allerdings während einer direkten Auseinandersetzung mit einer englischen Galeone namens „Isabella IX.“ erwischt. Sie war mit Mann und Maus in den Fluten des Atlantiks verschwunden.
Und gerade über diesem Geschehen lastete noch immer der Hauch des Geheimnisvollen und Merkwürdigen. Wie es aussah, war auf der „Vencedor“ zur Zeit der Generalkapitän der einzige, der wirklich genau wußte, was während dieses harten Gefechts tatsächlich mit der „Confianza“ geschehen war.
De Fernández gab seinem Ersten Offizier, Jorge Aurelio Gozálbez, einen Wink, dann zog er sich mühsam an den Strecktauen entlang, bis er das Schott, das ins Achterkastell führte, erreicht hatte.
In der Kapitänskammer angelangt, klopfte er sich, so gut es ging, die Nässe aus der Kleidung, holte eine kleine, dickbauchige Flasche aus dem Schapp und nahm einen kräftigen Schluck Rum zu sich.
Schließlich wurde das Schott abermals geöffnet, und Gozálbez zwängte sich mit wehenden Haaren in den Gang, der zur Kapitänskammer führte. Der Wind pfiff scharf durch die schmale Öffnung und peitschte einen Schwall Wasser hinterher. Der Erste verschloß den Eingang sofort wieder und schüttelte sich zunächst einmal wie ein nasser Hund. Dann stapfte er breitbeinig in die komfortabel eingerichtete Kammer des Generalkapitäns.
Jorge Aurelio Gozálbez war ein mittelgroßer Mann mit breiten Schultern und dunklen Haaren. Wie viele Zeitgenossen trug er einen gepflegten Oberlippenbart.
„Da sind Sie ja endlich!“ herrschte ihn der Generalkapitän an und hielt sich an dem in den Planken verschraubten Tisch fest, um nicht durch die heftigen Bewegungen des Schiffes wegzurutschen.
Gozálbez, dem das Haar wirr und naß im Gesicht hing, vollführte eine bedauernde Geste.
„Es ging leider nicht schneller, Capitán. Um ein Haar wäre auch noch ein dritter Mann über Bord gegangen.“
De Fernández’ Gesicht drückte Unmut aus.
„Ist das Ihre einzige Sorge, Señor Gozálbez?“ fragte er barsch. „Was, zum Beispiel, haben Sie über den Zustand unseres Schiffes zu sagen?“
Der Erste warf seinem Kapitän einen erstaunten Blick zu. Er kannte ihn zwar zur Genüge, ärgerte sich aber immer wieder über seih menschenverachtendes Gebaren.
„Verzeihung, Capitán“, sagte er. „Was geschehen ist, können wir nicht mehr ändern. Die ‚Vencedor‘ hat einige üble Schäden. Sobald der Sturm nachläßt, werden wir sie wieder in Ordnung bringen. Ich finde nur, daß wir künftig mehr auf die Sicherheit der Mannschaft achten sollten. Die zwei Decksleute, die über Bord …“
„Bleiben Sie beim Wesentlichen!“ unterbrach ihn der Generalkapitän unwirsch. „Es geht jetzt nicht um das selbstverschuldete Unglück zweier Kerle, die nicht genug aufgepaßt haben, sondern um die Zukunft meines Schiffes. Niemand kann absehen, wie lange dieser verdammte Sturm noch anhält und welche Überraschungen er uns noch beschert. Es wird deshalb Zeit, daß eine vernünftige Entscheidung getroffen wird.“
Gozálbez nickte verärgert.
„Der Meinung bin ich auch, Capitán“, sagte er. „Ich frage mich zum Beispiel schon lange, warum wir nicht auf Biegen und Brechen versuchen, mit der ‚San Mateo‘ und den anderen Schiffen Kontakt zu halten. Im Verband ist es doch viel einfacher, die Sturmschäden zu beseitigen.“
„So? Meinen Sie?“ fragte de Fernández schnippisch. „Wer garantiert Ihnen denn, daß die ‚Vencedor‘, die ohnehin schon ziemlich angeschlagen ist, dieses Unwetter heil übersteht?“
„Niemand natürlich …“
„Na also!“ fuhr der Generalkapitän fort. „Ich bin ein Mann der Realitäten und lege deshalb keinen Wert darauf, das Glück herauszufordern. Mein Bestreben ist, stets sinnvoll und vernünftig zu handeln und zu entscheiden.“ Er nahm einen weiteren Schluck aus der Rumflasche, ohne jedoch seinem Ersten davon anzubieten.
Gozálbez kniff die Augen zusammen.
„Und wie sieht eine solche vernünftige Entscheidung Ihrer Meinung nach aus, Capitán?“ fragte er kühn.
„Ganz einfach“, erwiderte der Generalkapitän. „Meiner Meinung nach ist es richtig und sinnvoll, wenn wir nach Flores zurückkehren. Genau das werden nämlich auch die anderen Kapitäne unseres Verbandes tun, davon bin ich überzeugt.“
Jorge Aurelio Gozálbez hieb erbost mit der flachen Hand auf den Tisch.
„Aber das ist ein enormer Zeitverlust, Capitán!“
Die Augen des kleinen, rundlichen Generalkapitäns funkelten böse.
„Zügeln Sie Ihr Temperament, Señor Gozálbez! Sie sprechen hier mit einem Generalkapitän der spanischen Kriegsflotte, falls Sie das noch nicht begriffen haben sollten. Und was den Zeitverlust betrifft, so ist es vernünftig, diesen in Kauf zu nehmen, zumal die Reise über den Atlantik gerade erst begonnen hat und die Sturmschäden mit unseren Bordmitteln ohnehin nur unzureichend zu beheben sind.“
Der Erste beherrschte sich nur mühsam.
„Ich will Sie nicht beleidigen, Capitán“, stieß er mit zornrotem Gesicht hervor, „aber ich bin in diesem Punkt nicht Ihrer Meinung. Wir können in diesem Sturm nicht einfach den Verband, für den wir verantwortlich sind, im Stich lassen, nach Flores zurückkehren und einfach darauf hoffen, daß die anderen Kapitäne ebenso handeln.“
„Wollen Sie sich meinen Anweisungen und Entscheidungen widersetzen?“
„Natürlich nicht, Capitán. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, daß es für die Rückkehr der ‚Vencedor‘ nach Flores noch einen ganz anderen Grund gibt.“
De Fernández warf ihm einen tückischen Blick zu.
„Interessant!“ sagte er dann. „Dürfte ich diesen Grund vielleicht auch erfahren?“ Er fügte seiner Frage ein höhnisches Lächeln hinzu.
„Ich bin davon überzeugt, daß Sie diesen Grund kennen“, antwortete Gozálbez. „Nur sollten Sie wissen, daß auch ein Offizier Augen im Kopf hat. Mir jedenfalls ist nicht entgangen, daß beim Untergang der ‚Confianza‘ einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.“
„Was, zum Teufel, wollen Sie damit sagen?“ De Fernández brauste auf. „Los, reden Sie schon! Was ist Ihrer Meinung nach nicht mit rechten Dingen zugegangen?“
„Darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen, Capitán. Aber unser Stückmeister, Señor Rabel, weiß darüber wohl besser Bescheid als ich.“
Gozálbez erinnerte sich sehr genau an das Gefecht mit dem englischen Verband. Er hatte nicht den Eindruck gehabt, daß die Engländer unbedingt auf einen Schlagabtausch ausgewesen waren. Vielmehr war es de Fernández gewesen, der die Konfrontation mit den englischen Schiffen gesucht hatte. „Angriff ist die beste Verteidigung!“ Das war seine Devise gewesen.
Schon deshalb war er mit de Fernández zusammengeraten und hatte natürlich gegen den allmächtigen Generalkapitän den kürzeren gezogen. Wenn die Meinungen auseinandergingen, pflegte de Fernández ganz einfach „kraft seiner Autorität“ zu entscheiden.
Außerdem hatte Gozálbez nicht vergessen, daß kurz vor dem Angriff auf die Engländer Jaime Rabel in die Kapitänskammer gerufen worden war, was den sonstigen Gepflogenheiten an Bord widersprach. Nie zuvor hatte der Generalkapitän vor einem Gefecht Heimlichkeiten mit seinem Stückmeister gehabt.
Noch merkwürdiger waren allerdings die Vorgänge, die während des Kampfes zum Untergang der „Confianza“ geführt hatten. Den Fangschuß, soviel stand für ihn fest, hatte sie jedenfalls nicht aus den Geschützen des englischen Schiffes gekriegt. Irgend etwas stimmte da nicht, und er war nun einmal nicht der Typ, der sich gern für dumm verkaufen ließ, auch wenn er im allgemeinen ein recht phantasieloser Mann war, der nichts anderes als seine Pflicht tat. In dieser Sache jedoch brauchte man keine besondere Phantasie, denn sie stank von sich aus zum Himmel.
Tausend Gedanken wirbelten Gozálbez durch den Kopf, während ihm der Generalkapitän wie ein sprungbereiter Löwe gegenüberstand.
„Ich verbiete Ihnen, so mit mir zu reden!“ brüllte de Fernández außer sich vor Wut. „Was fällt Ihnen ein? Hören Sie neuerdings die Flöhe husten? Was Sie hier vorbringen, sind unverschämte Unterstellungen und Verdächtigungen, die sich letzten Endes auf meine Person beziehen! Obwohl Sie nicht in der Lage sind, klar zu sagen, um was es sich eigentlich handelt, behaupten Sie, irgendwelche geheimnisvollen Vorgänge bemerkt zu haben! Außerdem unterstellen Sie mir, aus eben diesen mysteriösen Gründen den Verband verlassen und nach Flores zurückkehren zu wollen. Dabei wissen Sie so gut wie ich, daß der derzeitige Zustand der ‚Vencedor‘ den Ausschlag für meine Entscheidung gegeben hat.“
„Aber Capitán …“
„Halten Sie den Mund, Gozálbez!“ Die Stimme des Generalkapitäns überschlug sich. Sein rundes Gesicht war krebsrot vor Wut. „Wie können Sie wagen, mich mitten im dicksten Sturm mit leerem Geschwätz aufzuhalten? Wissen Sie, wie ich so etwas nenne? Es gibt nur ein passendes Wort dafür: Meuterei! Wenn Sie sich noch ein einziges Mal erdreisten, sich mit Verleumdungen und Unterstellungen gegen meine Entscheidungen aufzulehnen, dann lasse ich Sie in Ketten legen, jawohl!“
Der Erste sah plötzlich rot. Er vertrug in der Regel eine ganze Menge, aber er konnte auf den Tod nicht ausstehen, wenn man ihn wie einen kleinen Rotzjungen zusammenputzte. Außerdem war er nach wie vor von der Stichhaltigkeit seiner Vermutungen überzeugt. Nur hatte er eben mit seinen offenen und vielleicht auch etwas voreiligen Worten in ein Hornissennest gestochen.
„Ich muß Ihre Worte zurückweisen, Capitán!“ brüllte er los und ballte drohend die Hände. „Sie wissen ganz genau, daß ich kein Meuterer bin …“ Doch weiter gelangte er nicht, denn die Auseinandersetzung, die nahe daran war, auszuufern, wurde plötzlich durch einen gellenden Ruf unterbrochen.
Der Zweite Offizier trat triefendnaß und keuchend durch das Schott.
„Capitán!“ rief er. „Zwei Luken waren nicht richtig verschalkt. Einige Männer müssen an die Pumpen!“
„Verflucht!“ stieß Ramón Firuso de Fernández hervor. „Hat sich denn heute alles gegen mich verschworen?“ Ohne Gozálbez noch eines Blickes zu würdigen, schob er sich an ihm vorbei und folgte dem Zweiten Offizier nach draußen, in die tobende, jaulende und brodelnde Hölle.
2.
Die junge Frau, die sich auf dem Achterdeck des ranken Viermasters mit der einen Hand an den Strecktauen festhielt und mit der anderen ein Spektiv an die Augen führte, zog Männerblicke für gewöhnlich magisch an. Doch jetzt, in diesem heulenden und brüllenden Inferno, hatte niemand die Zeit, ihre langen, schwarzen Haare, ihre mandelförmigen, leicht schräggestellten Augen und ihre samtene Pfirsichhaut zu bewundern. Selbst für die Rundungen ihrer makellosen Figur, die sich unter einer roten Bluse und blauleinenen Schifferhosen verbarg, hatte heute niemand einen Blick.
Siri-Tong, die man auch die Rote Korsarin nannte, hatte bereits seit gestern alle Hände voll zu tun, um ihr Schiff im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser zu halten. Der Sturm, der über dem Atlantik westlich der Azoren tobte, verlangte nicht nur der schlanken Eurasierin, sondern auch ihrer gesamten Crew einiges an seemännischem Können ab. Dennoch hatte sich nicht vermeiden lassen, daß auch der „Rote Drache“ einige kleinere Sturmschäden abkriegte.
Die etwas mehr als 400 Tonnen große Galeone, die früher einmal „Albion“ hieß, hatte die Rote Korsarin einst auf Bora-bora dem größenwahnsinnigen El Supremo abgejagt. Wie sich in England herausgestellt hatte, war der moderne Segler ebenfalls von Hesekiel Ramsgate erbaut worden.