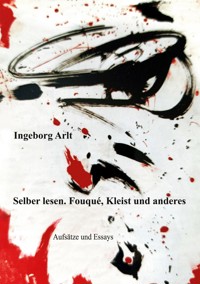
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ingeborg Arlt hat die Gabe, so aufmerksam zu lesen, dass sie in Texten, die man zu kennen glaubt, Überraschendes entdeckt. Wilhelm Müllers "Winterreise" - ein politischer Skandal? Fouqués "Undine" - ein Katalog unsrer Abwehrmechanismen? Goethes "Erlkönig" - die Erinnerung an eine Straftat? Sie weist nach, dass im Libretto der Oper "Norma" anderes steht, als uns auf der Bühne gezeigt wird, blickt nachdenklich auf Urzeichen, kritisiert die in Kirchen gesprochene Sprache, schreckt auch vor Elementargeistern und Dämonen nicht zurück, und ihr "Brief an Kleist" ist auch einer an den heutigen Literaturbetrieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Müllers List. Zu Wilhelm Müllers „Winterreise“
Fouqués „Undine“
Brief an Kleist
Den Erlkönig gibt es
Gestalten. Rainer Maria Rilke und Gertrud Kolmar über Leda und den Schwan. Ein Vergleich
„Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers
Karl Neumann
Namenszauber. Zu Ingeborg Bachmanns Erzählung „Simultan“
Berührung
Norma die Andere
Urzeichen
Begeisterung. Zu den Elementargeistern des Paracelsus
Seltenes Vertrauen. Hommage à Ludwig Leichhardt
Kritik der Kirchensprache
Sodoms zehn Gerechte
Sigrid Noacks Gelddämonen
Sigrid Noack zum Siebzigsten
Tage in Petzow. Erinnerung ans DDR-Schriftstellerheim
Müllers List. Zu Wilhelm Müllers „Winterreise“
Das Wandern ist des Müllers List. Mit dieser List täuschte der Dichter Wilhelm Müller die Zensoren seiner Zeit, die eine Kritik an erstarrten politischen Verhältnissen nicht geduldet haben würden, denen Gedichte über eine Wanderung im Winter aber unbedenklich erschienen. Wanderer kannten sie ja. Wanderer durchzogen die Literatur ja in Scharen. Wanderer, kommst du nach Sparta, so verkündige dorten, du habest von Dantes Wanderung durch die Hölle, Villons auf der Erde und „Wanderers Nachtlied“ von Goethe gehört. Einen „Wanderer in der Sägmühle“ bedichtete zu jener Zeit Justinus Kerner. „Franz Sternbalds Wanderungen“ Ludwig Tieck, und auch Chamisso, Uhland, F. Schlegel, Schmidt von Lübeck, Arnim und Brentano bedichteten Wanderer. „Wer in die Fremde will wandern, / der muss mit der Liebsten gehn. / Es jubeln und lassen die andern / den Fremden alleine stehn“, ließ Joseph von Eichendorff einen Wanderer mahnen. Und nun kam also noch einer dazu. Fremd bin ich eingezogen, / Fremd zieh ich wieder aus. Diesmal von einem Wilhelm Müller aus Dessau. Der Zensor blätterte, las Gedichte von Schnee, Eis, Nacht und Kälte, von Schmerzen, Untreue und leidender Liebe – je nun. Er wandte sich ab. Und das sollte er auch.
Die List wirkte. Sie wirkt immer noch. Damals entzog sie den Dichter, der sich darauf verlassen musste, dass seinesgleichen den Text trotzdem verstand, einer politischen Verfolgung. Heute entzieht sie, wenn wir die politische Verfolgung von seinesgleichen zu jener Zeit nicht berücksichtigen, den Text unserem vollen Verständnis. Wir verstehen nur einen Teil, jenen, den damals auch der Zensor verstand. Wir verstehen nicht mehr das Ganze.
Vierundzwanzig Gedichte über den Schmerz eines Mannes, der von einem Mädchen verlassen, verraten, betrogen wurde, las damals der Zensor. Das Mädchen sprach von Liebe, / die Mutter gar von Eh – Er las davon, dass der Mann sich abwendet, weg geht nachts, während die anderen schlafen.
Was soll ich länger weilen / Bis man mich trieb’ hinaus? Die anderen, weiß dieser Mann, werden nach ihm nicht fragen. Was fragen sie nach meinen Schmerzen? / Ihr Kind ist eine reiche Braut.
Der Zensor las Gedichte über Tränen, die dieser Mann weint, ein Bild, das er im Herzen trägt, einen Lindenbaum, an dem er sich dann doch nicht erhängt. An dem er zwar vorbei muss in tiefer Nacht, aber da hat er sogar noch im Dunkeln die Augen zugemacht, um ihn nicht sehen zu müssen.
Ferner: Gedichte, in denen ein Posthorn vorkommt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, / mein Herz? Das Vorausdenken an die Schneeschmelze, die Eisdecke des Flusses, das Zurückdenken an die Stadt, die Müdigkeit, die eine Lebensmüdigkeit ist: Wie weit noch bis zur Bahre!
Auch: von einer Krähe. Einem einzelnen Blatt im kahlen Geäst. Einem Dorf, das schläft. Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, / Die Menschen schnarchen in ihren Betten. Von einem stürmischen Morgen, nach welchem der Wanderer über den Trost durch Selbstbetrug nachdenkt:
Ach, wer wie ich so elend ist, / gibt gern sich hin der bunten List. Einem Totenacker, der zur ewigen Rast einlädt. Einer Köhlerhütte, in welcher er rastet. Einem Irrlicht, das er nachts sieht und Nebensonnen am Tage. Und vom Träumen des Wanderers: Wann halt ich dich, Liebchen, im Arm? Von seiner Einsamkeit, seinem Mut der Verzweiflung.
Das letzte Gedicht, das damals der Zensor las – und das heute wir lesen oder das letzte Lied, das wir heute hören, falls wir Die Winterreise, vertont von Franz Schubert, im Konzertsaal erleben, heißt „Der Leiermann“ und will zum bisher Erzählten nicht passen.
Weder zum Mädchen und seiner Untreue am Anfang, noch als Ziel einer so beschwerlichen Reise.
Das ist der Schluss? Die Winterreise ging zum Leiermann?
Und was soll das bedeuten?
Wie viel ist über diesen Leiermann schon gerätselt worden! Barfuß auf dem Eise / schwankt er hin und her, / Und sein kleiner Teller / bleibt ihm immer leer …
Was hat denn das mit Liebe und Treue, was mit dieser Reise zu tun! Wunderlicher Alter, / Soll ich mit dir gehen? / Willst zu meinen Liedern / Deine Leier drehn?
So hört es auf? Mit einer Frage?
Wir verstehen nicht.
Wir können auch nicht verstehen, so lange wir nicht anerkennen, dass das Wandern nur eine List ist. Dass wir zum Verständnis des Ganzen einen Kontext heranziehen müssen, den Müllers Zeitgenossen noch im Kopf hatten, ein Bezugssystem aus An- und Beiklängen, jenen noch im Ohr, die damals, wie der 1794 geborene Müller, Kriegsfreiwillige von 1813 waren, denn die Winterreise handelt zwar von Liebe und Treue, aber nur auf den ersten Blick von privater. Auf den zweiten handelt sie von Liebe und Treue in einem politischen Sinn: von der Liebe zum Vaterland und der Untreue, mit der man sie lohnte, von Schmerz und Enttäuschung einer ganzen Generation.
Und das Mädchen in diesen Versen? Das Mädchen ist nur ein Vorwand, erzwungen von den politischen Verhältnissen, um in jener Zeit – Die Winterreise erschien 1823/24 - von politischer Enttäuschung überhaupt öffentlich sprechen zu können! Fällt denn nicht auf, wie merkwürdig abstrakt dieses Mädchen bleibt? Dass wir nichts weiter von ihm erfahren? Keine Haar-, keine Augenfarbe, keinen Namen, keine Herkunft, nichts, dass es uns irgendwie sichtbar macht?
Das Mädchen, übrigens nicht die einzige Braut mit wenig menschlichen Zügen in der damals entstandenen Literatur: Theodor Körner bedichtete ein Schwert als Braut, Max von Schenkendorf sogar „mein heiliges, mein deutsches Reich!“ – das Mädchen bekam vom Dichter nur gerade so viel Kontur, als dem Zensor nötig war, es als Ursache von Schmerz und Enttäuschung akzeptieren zu können und nur gerade so viel, als den Kampfgefährten Müllers, der akademischen Jugend von 1813, nicht hinderlich war, sich beim Lesen der Winterreise ihrer eigenen Probleme zu erinnern.
Denn: „Das unterscheidet den Menschen von den Tieren, dass er bis in den Tod lieben und von seiner Liebe nicht lassen kann“, beginnt der Abschnitt „Von Vaterland und Freiheit“ im „Kurzen Katechismus für teutsche Soldaten“ von Ernst Moritz Arndt. „Wenn alle untreu werden, / so bleiben wir doch treu, / Dass immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sei, / Gefährten unsrer Jugend, ihr Bilder beßrer Zeit ...“, so dichtete, in Anlehnung an Novalis, Max von Schenkendorf über die Ideale dieser Jugend von damals. Bei jemandem, den seine Charaktereigenschaften zum Zensor qualifizierten, durfte Müller davon ausgehen, dass der bei „Liebe“ nicht ans Vaterland und bei „Treue“ nicht an „Bilder beßrer Zeit“ denken würde. Jedenfalls nicht, solange man ihm daneben auch noch irgendein Mädchen vorhielt.
Das heißt: Die Winterreise ist Zeitkritik – unter den Augen des Zensors! Von den furchtbaren politischen Umständen spricht bereits das erste Gedicht. Es heißt Gute Nacht und außer dass da ein Wanderer einem Mädchen gute Nacht wünscht, sagt es auch: Gute Nacht, Deutschland, in dir ist es finster.
Bei Ernst Moritz Arndt in „Geist der Zeit“, hieß es damals „Solltest du wieder in Nacht versinken, glänzende Zeit? Sollten wir Deutschen wieder die traurigen Siebenschläfer werden, die wir Jahrhunderte gewesen …?“ Und nur wenige Jahre war es damals her, dass August Graf von Platen in seinem Gedicht „Nach den Befreiungskriegen“ fragte: „Wo ist dies Volk, beganns aufs neu zu schlafen / Das mächtig sich dem Schlafe kaum entwandt?“
„Nacht“ und „schlafen“ waren zu jener Zeit politische Metaphern. Müllers Zeitgenossen drängten sich beim Lesen dieser vierundzwanzig Gedichte andere Assoziationen auf als uns, für die das Leben von damals zum Inhalt von Schulstunden und zu Zeilen in Büchern geschrumpft ist. Sie wussten noch, was mit „Nacht“ und „schlafen“ gemeint war. Sie, und vor allem jene unter ihnen, die an dem beteiligt waren, was Ernst Moritz Arndt die „glänzende Zeit“ nennt, „Solltest du wieder in Nacht versinken, glänzende Zeit?“, jene Freiwilligen von 1813, die ja mehr gewollt hatten als nur Napoleon schlagen, die auch Freiheit, Gleichheit und ein einiges Deutschland gewollt hatten, – „Es ist in unserer Schar kein Unterschied der Geburt, des Standes, des Landes, wir sind freie Männer“, stand in einem Aufruf Theodor Körners am 12.04.1813 in der „Leipziger Zeitung“; und: „Nicht Bayern und nicht Sachsen mehr / Nicht Östreich und nicht Preußen, / Ein Land, ein Volk, ein Herz, ein Heer, / Wir wollen Deutsche heißen“, dichtete Ernst Moritz Arndt, – sie, die Deutsche heißen wollten, dachten bei Was soll ich länger weilen, / bis man mich trieb’ hinaus? nicht nur wie wir heute, wenn wir die Winterreise lesen, an einen verschmähten Liebhaber. Sie dachten auch an jene, die man damals hinaustrieb, Görres, zum Beispiel, oder später trieb man auch Börne, Gutzkow und Heine hinaus, und Platen wartete nicht erst, bis man ihn hinaustrieb’, sondern ging freiwillig ins Exil.
(Und Müller? Politisch interessiert und freiheitsliebend wie nur einer, ging er etwa nicht? Doch. Er ging. Auf Winterreise.)
Der Wind spielt mit der Wetterfahne. Der politische Wind hatte sich nach den Befreiungskriegen gedreht. Als Napoleon besiegt war, konnten die deutschen Fürsten, auf ihre Territorien bedacht, ein einiges Deutschland nicht brauchen.
Nicht Bayern und nicht Sachsen mehr? Nicht Östreich und nicht Preußen? Da hört sich doch alles auf! Polizei!!!
Plötzlich war die deutsche Polizeistaatlichkeit noch schärfer als die der französischen Besatzer. Plötzlich – von wegen: kein Unterschied der Geburt, des Standes, des Landes – begann die so genannte Demagogenverfolgung, das heißt: national und demokratisch gesinnte Männer wurden von Demagogen Demagogen genannt. Außer der „Wahrung der Sittlichkeit, der guten Ordnung und des äußeren Anstandes“ sah ein neu geschaffenes Universitätsgesetz auch die Überwachung der Professoren bei Lehrveranstaltungen und ein Pressegesetz die Überwachung von Druckerzeugnissen vor.
Ein Untersuchungsgesetz installierte eine „Centralbehörde“ zur Untersuchung all dessen, was den Fürsten nicht passte und am wenigsten passten ihnen Freiheit, Gleichheit, Einheit und die jungen Männer, die keinen Unterschied der Geburt und des Standes gelten lassen wollten, Männer, denen sich 1813 auch der Dichter Wilhelm Müller anschloss.
Es begann, was Hegel „die Herrschaft des Verdachts“ nannte: Man beargwöhnte, denunzierte, bespitzelte, verhörte, entließ, verhaftete und vertrieb.
„Ich kann zu meiner Reisen / Nicht wählen mit der Zeit: / Muß selbst den Weg mir weisen / In dieser Dunkelheit.“
Da ist nicht, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat, vom Reisezeitpunkt die Rede! Nicht davon, dass da einer sich die Reisezeit nicht wählen kann und leider mitten im Winter aufbrechen muss. Da steht nicht „mir die Zeit“, „Ich kann zu meiner Reisen / nicht wählen mir die Zeit“. Da steht „mit“. Und das ist auch kein Druckfehler, sonst folgte kein Dativ.
Schon im ersten Gedicht der Winterreise steht, dass da einer nicht mit der Zeit gehen kann. Dass es ihm nicht freisteht, sich einen der zu seiner Zeit üblichen Wege zu wählen. Sondern: Muß selbst den Weg mir weisen / In dieser Dunkelheit.
Später, nach den Gedichten über Lindenbaum, Posthorn, Krähe, Dorf und dem Grübeln über den Trost durch Selbstbetrug, liest man vom Widerstand gegen Fremdbestimmung noch einmal. Einen Weiser seh ich stehen / Unverrückt vor meinem Blick; / eine Straße muss ich gehen, / die noch keiner ging zurück.
Diese Haltung unterscheidet sich freilich von der jener, die wie eine Wetterfahne sich immer nach der jeweils herrschenden politischen Windrichtung drehen. Sie unterscheidet sich auch von den Sorgen all jener, die nach Idealen und überindividuellen Zielen nicht fragen. Was fragen sie nach meinen Schmerzen? / Ihr Kind ist eine reiche Braut.
Die Sprache wandelt sich. Es sind zweihundert Jahre vergangen. Heutige Publizisten würden von politischer Indolenz sprechen, wo Ernst Moritz Arndt, sich gegen diese Indolenz wendend, damals schrieb: „Keine Träne, Hermann, für dein Volk? / Keine Träne?“ Aber die politische Indolenz selbst bleibt sich gleich: Während der eine weint, „Gefrorene Tropfen fallen / Von meinen Wangen ab: / Und ist’s mir denn entgangen, / dass ich geweinet hab?“, träumen die anderen, was sie nicht haben / Tun sich im Guten und Argen erlaben.
Das hat man auch in unserem Jahrhundert schon erleben können, mehrmals sogar, wie manche Leute vor allem etwas haben wollen, für ihre Habe sorgen im Guten und Argen, egal unter welchem Regime.
Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, / Die Menschen schnarchen in ihren Betten.
Die schlafende Mehrheit – ja kennt man die nicht?
Der Winter in der Winterreise ist eine Metapher. Auch wir haben in politischen Zusammenhängen schon von „Eiszeit“ und „Tauwetter“ sprechen hören. Wenn die Gräser sprossen wollen / Weht daher ein lauer Wind. / Und das Eis zerspringt in Schollen, / Und der weiche Schnee zerrinnt. // Schnee, du weißt von meinem Sehnen. Auch unter uns heute haben sich schon welche nach dem Ende des „Kalten Krieges“ oder nach dem „Prager Frühling“ gesehnt. Im Gedicht Der Lindenbaum wird die Metapher – absichtlich, möchte man meinen – als solche denunziert: Und seine Zweige rauschten, was im wirklichen Winter nicht möglich wäre. Womit denn! Die Linde hat ja im Winter kein Laub!
Natürlich kann man nicht beweisen, dass dieser Vers dieses und jener jenes bedeutet. Dass in dem Gedicht Rückblick sich die Zeile Die runden Lindenbäume blühten auf die Straße Unter den Linden bezieht und mit der Stadt der Unbeständigkeit demnach Berlin gemeint sei. Das wäre ja auch noch schöner für eine „Centralbehörde“ gewesen! Man kann aber beweisen, dass Müller sich 1813 in Berlin zu den Freiwilligen meldete und dass in Berlin 1816 die "Bundesblüten" erschienen, eine Anthologie, zu der auch er Gedichte über die Befreiungskriege beitrug.
Beweisen kann man nicht, dass die Feuerflammen im Gedicht Stürmischer Morgen eine Anspielung auf Körners: „Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen“ seien. Oder das Wort „Sturm“ – Stürmischer Morgen: Das nenn ich einen Morgen / so recht nach meinem Sinn! - ein Jahrzehnt nach dem Landsturm jeden Leser damals auch an anderes denken ließ als an eine meteorologische Erscheinung, etwa an Körners Vers: „Das Volk steht auf, der Sturm bricht los.“ Beweisen kann man aber die Popularität der Körnerschen Texte.
Und die grammatische Genauigkeit!
Nämlich dass Müller schrieb: Auch du, mein Herz, im Kampf und Sturm – nicht „ in Kampf und Sturm“, was irgendwelche Kämpfe, sondern „im“ was einen bestimmten meint.
Auch du, mein Herz, im Kampf und Sturm / So wild und so verwegen…. Beweisen kann man, dass wild und verwegen auch „Lützows wilde verwegene Jagd“ war.
Und den Gleichklang kann man beweisen! Dass in Körners „Schwertlied“ das Schwert „Liebchen“ genannt wird: „Zur Brautnachtsmorgenröte / ruft festlich die Trompete; / Wenn die Kanonen schrein / Hol ich das Liebchen ein“. Und es darin heißt: „Wird euch das Herz nicht warm? / Nehmt’s Liebchen in den Arm!“ Und dass es, fast gleich lautend, in Müllers Frühlingstraum heißt: Noch schlägt das Herz so warm. / … Wann halt ich dich, Liebchen, im Arm?
Der Dichter Wilhelm Müller war Gardejäger. Er kämpfte in den Schlachten von Groß-Görschen, Bautzen, Hainau und Kulm. Auch Fouqué kämpfte als freiwilliger Jäger. Eichendorff, als Lützowscher Jäger, kam zwar nicht zum Einsatz, aber hätte auch gern gekämpft. Und Eichendorff schrieb später „An die Lützowschen Jäger“: „Wunderliche Spießgesellen, / Denkt ihr noch an mich, / wie wir an der Elbe Wellen / Lagen brüderlich? // Wie wir in des Spreewalds Hallen, / Schauer in der Brust, / Hell die Hörner ließen schallen / So zu Schreck und Lust??/ … / Wo wir ruhen, wo wir wohnen: / Jener Waldeshort / Rauscht mit seinen grünen Kronen / Durch mein Leben fort.“





























