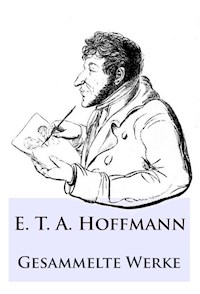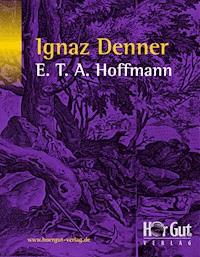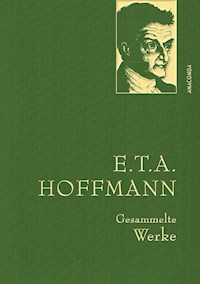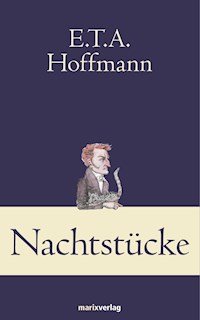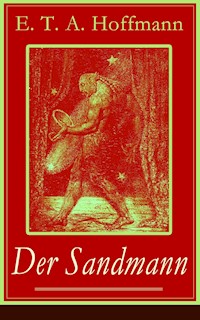Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Schloßhof einer Residenz treffen zwei wunderliche Gäste zusammen, die sich beide als Schauspieldirektoren zu erkennen geben und einander ihre Leiden klagen. Der eine gehört zu den Geduldigen und Raffinierten, der andere zu den zornigen Enthusiasten und Idealisten. Alles, was sie sagen, ist voll Wahrheit und charakterisiert die Verdorbenheit des Theaters vortrefflich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seltsame Leiden eines Theaterdirektors
E. T. A. Hoffmann
Inhalt:
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Vorwort
Seltsame Leiden eines Theaterdirektors
Seltsame Leiden eines Theaterdirektors, E.T.A. Hoffmann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616137
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Vorwort
Vor etwa zwölf Jahren ging es dem Herausgeber dieser Blätter beinahe ebenso, wie dem bekannten Zuschauer, Herrn Grünhelm, in Tiecks »verkehrter Welt«. Das düstre Verhängnis jener ereignisreichen Zeit drängte ihn mit Gewalt heraus aus dem Parterre, wo er seinen bequemen, behaglichen Platz gefunden, und nötigte ihn, einen Sprung zu wagen, der zwar nicht bis aufs Theater, wohl aber bis ins Orchester, bis auf den Platz des Musikdirektors reichte. –
Auf diesem Platz schaute er nun das seltsame Treiben der wunderlichen kleinen Welt, die sich hinter Kuliss' und Gardine regt und bewegt, recht in der Nähe an, und diese Anschauung, vorzüglich aber die Herzensergießungen eines sehr wackern Theaterdirektors, dessen Bekanntschaft er im südlichen Deutschland machte, gaben Stoff zu dem Gespräch zweier Theaterdirektoren, das er schon damals aufschrieb, als er noch nicht ins Parterre zurückgesprungen war, wie er es in der Folge dann wirklich tat.
Ein Teil dieses Gesprächs, das nun im ganzen Umfange erscheint, wurde früher in den hiesigen, vor einiger Zeit selig entschlafenen »dramaturgischen Blättern« abgedruckt. Benannter Herausgeber bittet dich, o günstiger Leser! nun recht von Herzen, daß du in diesem Gespräch nicht etwa tiefe, gelehrt gemeinte Diskussionen über theatralische Darstellung suchen, sondern die flüchtigen Bemerkungen, Andeutungen über das ganze Theaterwesen, wie sie sich eben im Gespräch zu erzeugen pflegen, ja auch wohl manchen zu lockern Scherz, der sich diebischerweise eingeschlichen, freundlich ohne weiteren Anspruch hinnehmen mögest.
Ein ganz vergebliches Mühen würd' es sein, wenn du, o lieber Leser, es unternehmen solltest, zu den Bildern, die einer längst vergangenen Zeit entnommen, die Originale in der neuesten nächsten Umgebung ausspähen zu wollen. Alle Harmlosigkeit, auf die vorzüglich gerechnet, würde über diesem Mühen zugrunde gehen müssen. –
Berlin, im Oktober 1818.
E. T. A. Hoffmann
Seltsame Leiden eines Theaterdirektors
Am Tage des heiligen Dionysius, das heißt, am neunten Oktober, vormittags um eilf Uhr, war es im »Rautenkranz«, dem berühmten Gasthofe in der noch berühmteren freien Reichsstadt R. wie ausgestorben. Denn nur ein einziger Fremder, ein nicht zu großer ältlicher, in einen Oberrock von dem feinsten dunkelbraunen Tuch gekleideter Mann frühstückte einsam in einer Ecke des Gastzimmers. Auf seinem Gesicht lag der Ausdruck innerer Ruhe und Zufriedenheit, und sein ganzer Anstand, jede Bewegung war bequem und wohlbehaglich. Er hatte sich alten Franzwein geben lassen und ein Manuskript aus der Tasche gezogen. Darin las er mit großer Aufmerksamkeit und strich manches mit Rotstift an, indem er aus dem eingeschenkten Glase nippte und etwas Zwieback dazu genoß. Bald spielte ein feines ironisches Lächeln um seinen Mund, bald verzogen sich die Augenbraunen zum finstern Ernst, bald warf er den Blick in die Höhe, wie etwas im Innersten überlegend, bald schüttelte, nickte er mit dem Kopfe, wie den Gedanken verwerfend oder billigend. Wer hätte den Mann nicht für einen Schriftsteller halten sollen, der vielleicht nach R. gekommen war, um irgendeins seiner Geistesprodukte an das Tageslicht zu befördern. – Die Stille, die im Gastzimmer herrschte, wurde auf sonderbare Weise unterbrochen. Die Türe sprang auf, und hinein stürzte ein Mann im modernen grauen Rock, Hut auf dem Kopf, Brill' auf der Nase. – »Champagner, ein Dutzend Austern!« schrie er und warf sich, ohne den Braunen zu bemerken, in einen Stuhl. Er las das Billett, das er in der Hand gehalten, zerriß es und trat es mit Füßen. – Dann lachte er auf wie vor innerer Wut, schlug sich mit geballter Faust vor die Stirn und murmelte: »Unsinnig, unsinnig machen sie mich! – Ein Galeerensklave führt ein köstliches Leben im Vergleich mit meinem Elende!« – Der Kellner hatte den Champagner gebracht, der Graue stürzte jählings einige Gläser hinunter, holte dann eine Menge Briefe hervor, erbrach sie und stieß während des Lesens tausend Flüche und Verwünschungen aus. – Das ganze Ansehen des Grauen mußte das tiefste Mitleid, die innigste Teilnahme erregen. Er war kaum über die spätern Jünglingsjahre hinaus, und sein blasses abgehärmtes Gesicht, der verstörte Blick seiner Augen, die weißen Härchen, die durch die dunklen Locken schimmerten, ließen ihn offenbar älter erscheinen, als er es nach der Art sich zu tragen und zu bewegen sein konnte. Wohl mochte er die Absicht haben, sich zu betäuben und wenigstens für den Augenblick des Elendes oder des ungeheuern Ereignisses zu vergessen, das ihm Vernichtung drohte, denn, Glas auf Glas hinunterstürzend, hatte er schon die Flasche geleert und forderte eine zweite, als der Kellner die Austern herbeitrug! – »Ja, es ist aus,« murmelte er zwischen den Zähnen, »ja, es ist rein aus! Welchem Sterblichen auf Erden ward solche Kraft, solcher Gleichmut, dies zu ertragen!« – Er fing an die Austern zu genießen, kaum hatte er aber die zweite verschluckt und ein Glas Champagner darauf gesetzt, als er mit verschränkten Armen in den Lehnsessel zurück sank, den verklärten Blick aufschlug in die Höhe und mit dem Ton der tiefsten Wehmut sprach: »Aufgeben will ich alles – alles – mich selbst. – Der ew'gen Sonne geb' ich die Atome wieder, die sich zu Lust und Schmerz in mir gefügt. – Ach! und doch so süß, so süß zu träumen – Wenn dieser Traum nicht wäre – das ist die Rücksicht, die Elend läßt zu hohen Jahren kommen!« – Die Tränen traten dem Grauen in die Augen, doch ermannte er sich bald, schlürfte die Austern hinunter, trank dazwischen ein – zwei Gläser Champagner. Dann fuhr er plötzlich auf, schlug sich vor die Stirn, daß es laut klatschte, und rief, wild lachend: »Um Hekuba? – Was ist ihm Hekuba? – Und ich, ein blöder schwachgemuter Schurke, schleiche wie Hans der Träumer, meiner Sache fremd, und kann nichts sagen, nichts für einen Dichter, an dessen Eigentum und teurem Leben verdammter Raub geschah! Bin ich 'ne Memme? Wer nennt mich Schelm? Bricht mir den Kopf entzwei? Rauft mir den Bart und wirft ihn mir ins Antlitz? Zwickt an der Nase mich und straft mich Lügen tief in den Hals hinein? Wer tut mir dies?« – »Ich,« sprach der Braune, der Aug' und Ohr nicht abgewandt hatte von dem Grauen und der endlich aufgestanden und sich ihm genähert, »ich will dieses alles nun gerade nicht tun, aber verzeihen Sie es mir, mein Herr, wenn ich es unmöglich gleichgültig ansehen kann, wie Sie sich immer mehr und mehr einer widerlichen Stimmung hingeben, die nur von dem unglücklichsten Ereignis erzeugt werden konnte. – Aber Trost und Hilfe ist doch wohl möglich. Betrachten Sie mich nicht als einen Fremden, nehmen Sie mich als einen Mann, der der wahrste tätigste Freund jedes mit dem Schicksal oder mit sich selbst Entzweiten ist.« – Der Graue fuhr erschrocken vom Stuhle auf, riß schnell den Hut vom Kopfe und sprach dann, schnell gefaßt, mit leisem Lächeln: »O mein Herr, wie sehr muß ich mich schämen. Nur selten wird dies Zimmer vormittags besucht, ich glaubte mich allein – in der Tat, ganz zerstreut, ja ganz und gar von Sinnen, bemerkte ich Sie nicht, und so wurden Sie Zeuge des Ausbruchs von innerm Ärger und Verdruß, den ich sonst still in mir zu tragen und niederzukämpfen gewohnt bin.« »Und dieser Verdruß, diese auflodernde Verzweiflung?« fiel der Braune ein. »Ist«, fuhr der Graue fort, »die Folge manches in mein Leben nun einmal als notwendig verflochtenen Auftritts und noch niemals bis zur Trostlosigkeit gediehen. Gewiß betrug ich mich auf eine Weise, die Ihnen, mein Herr, albern und abenteuerlich vorkommen muß; ich habe das gut zu machen. Frühstücken Sie mit mir! – Kellner!« – »Lassen Sie das, lassen Sie das,« rief der Braune und winkte den Kellner, der in der Türe erschien, zurück. »Nein bei Gott,« sprach er weiter, »nicht frühstücken will ich mit Ihnen, nein! die Ursache Ihres tiefen Kummers, Ihrer Verzweiflung wissen und tätig sein, rüstig den Feind anpacken und ihn zu Boden schlagen, wie es dem wackern Manne ziemt, und« – »Ach«, unterbrach der Graue den Braunen, »ach, mein werter Herr! mit dem Zu-Bodenschlagen des Feindes, der mich verfolgt, ja der zuweilen recht teuflisch in meinen innersten Eingeweiden wühlt, das ist eine mißliche Sache. Ihm wachsen die Köpfe wie der unbezwinglichen Hydra, er hat wie der Riese Geryon hundert Arme, mit denen er herumhantiert auf schreckliche Weise.« »Sie weichen mir aus,« sprach der Braune, »aber Sie entkommen mir nicht, denn zu tief hat mich Ihr Leiden, das nur zu sehr aus diesem blassen kummervollen Gesichte spricht, bewegt. Sie lasen Briefe. – Ach, jeder enthielt gewiß eine verfehlte Hoffnung. Täusche ich mich nicht, so drückt Sie auch das feindliche Schicksal, das unsere Existenz von Geld und Gut abhängig gemacht hat. Vielleicht drohen Ihnen in diesem Augenblick schlimme Maßregeln eines harten geldgierigen Gläubigers. Meine Umstände sind von der Art, daß ich, ist die Summe nicht zu groß, helfen kann, und ich werde helfen! – Ja gewiß, ich werde helfen, hier ist meine Hand!« Der Graue faßte die ihm dargebotene Hand und drückte sie, indem er dem Braunen ernst und düster ins Auge sah, an seine Brust.
»Nicht wahr, nicht wahr, ich hab' es getroffen? – Sprechen Sie, wer? – wieviel? – wo?« So rief der Braune ganz freudig, aber der Graue, der noch immer des Braunen Hand festhielt, sprach: »Nein, mein Herr! meine Lage ist von der Art, daß ich niemals auf eigentlichen Wohlstand rechnen kann, doch drücken mich durchaus keine Schulden, meine Ehre zum Pfande! Geldverlegenheit ist und kann nicht die Ursache meines Kummers sein. Doch Ihr Anerbieten hat mich auf die Seltsamste Weise überrascht und zugleich im Innersten tief bewegt. Diese Teilnahme an dem Schicksal eines Unbekannten zeugt von einer Gesinnung, die immer mehr und mehr schwindet in der eingeengten vertrockneten Brust unserer Brüder.« »Lassen Sie das,« fiel der Braune dem Grauen ungeduldig ins Wort, »lassen Sie das, mein teuerster Herr, und sagen Sie lieber fein geschwinde, wo das Übel sitzt, wo zu helfen ist. – Wurden Sie von der Frau, von der Geliebten treulos verlassen? Wurde Ihre Ehre von Schmähsüchtigen angegriffen? Ach! – vielleicht Dichter und vom Rezensentenvolk begeifert?« – »Nein, nein,« rief der Graue. »Nun so möchte ich doch in aller Welt wissen«, sprach der Braune kleinlaut, aber da faßte der Graue des Braunen beide Hände und sprach nach kurzem Stillschweigen sehr ernst und feierlich: »So erfahren Sie denn die unglückliche Quelle endloser Quälereien, nicht auszusprechenden, das Leben vergiftenden Verdrusses und Ärgers bei menschliche Kräfte übersteigender Mühe und Arbeit – ich bin Direktor der hiesigen Schaubühne!«
Der Braunesah dem Grauen mit ironischem Lächeln ins Gesicht, als erwarte er einen deutlicheren Kommentar. »Ach, mein Herr!« fuhr der Graue fort, »ach, mein Herr! ich merk' es schon, Ihnen kommt meine Klage närrisch vor, meine Leiden sind Ihnen fremd, Sie vermögen nicht mein Elend zu fassen. Ist es denn nicht auch der böse Dämon des Schauspieldirektors, der schadenfroh jedes Uneingeweihten Auge blendet, daß er nicht vermag in das innere Leben des tausendfach Gequälten, in die düsteren Geheimnisse der Theaterwelt zu schauen? – Nur der Kollege Schauspieldirektor versteht ihn und – lacht ihn aus, wie das nun einmal in der menschlichen Natur liegt. Aber Sie, mein Herr, dem solches Elend fremd ist, Sie dürfen nicht lachen. Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt.« »Sie tun,« unterbrach der Braune den Grauen, »Sie tun mir in der Tat großes Unrecht; denn weit entfernt davon bin ich, deshalb zu lachen, weil ich vielleicht nicht begreife, wie lediglich das Verhältnis, in dem Sie als Direktor einer Bühne stehen, jene Verzweiflung erzeugen kann, die Sie so lebhaft äußerten. Erfahren Sie, daß ich mit Ihnen alles recht tief fühle, da ich manche Jahre hindurch Direktor einer reisenden Schauspielertruppe war und es in gewisser Art noch bin. Konnt' ich vorhin einem leisen Lächeln nicht wehren, das unwillkürlich mein Gesicht überflog, so war es nur, weil ich ohne das nicht vermag, das bunte, groteske, mit allerlei fratzhaften Figuren staffierte Bild meines vergangenen Theaterlebens zu beschauen, das, wie durch einen Zauberschlag geweckt, mir plötzlich vor Augen trat, als Sie sagten: ›Ich bin Direktor der hiesigen Bühne!‹ – Glauben Sie an meine herzliche Teilnahme und schütten Sie Ihren Kummer aus, das erleichtert wenigstens die Brust, und so kann ich doch helfen.«
Mit dem Ausdruck der innigsten Gutmütigkeit hatte der Braune des Grauen Hand gefaßt, dieser zog sie aber voller Unmut zurück und sprach mit finsterem verzogenem Gesicht: »Wie, mein Herr! – Sie sind Direktor einer reisenden Truppe? – Sie wollen hier spielen? – Sie wissen nicht, daß ich ein ausschließendes Privilegium habe? – Sie wollen sich mit mir abfinden? – Deshalb die Freundlichkeit, die Teilnahme! – Ach, nun verstehe ich! Sie kannten mich schon, als ich eintrat. Erlauben Sie mir, Ihnen zu erklären, daß diese Art sich anzubiedern mir sehr mißfallen muß und daß es Ihnen auf keine Weise gelingen wird, hier am Ort wider meinen Willen auch nur eine Kulisse aufzustellen. Überdem würde Ihre Truppe sich auch nur der Gefahr aussetzen, auf die eklatantste Art von der Welt ausgepfiffen zu werden, da meine Bühne, besetzt mit den vortrefflichsten Künstlern, wohl die erste in ganz Deutschland sein dürfte. Ich rate Ihnen sogleich abzureisen. Adieu mein Herr!« –
Der Grauenahm den Hut und wollte schnell fort, aber der Braune schlug voll Erstaunen die Hände zusammen und rief: »Aber ist es möglich! Ist es möglich! – Nein, nein, mein herzlieber Freund und Kollege – Ja ja, mein Herr Kollege,« wiederholte der Braune, da der Graue ihn mit stolzem, beinahe verächtlichem Blick vom Kopfe bis zum Fuße maß, »ich lasse Sie nun einmal nicht so im Zorn und Unmut fort. Bleiben Sie, setzen Sie sich fein nieder.« (Er drückte den Grauen sanft in den Sessel, setzte sich zu ihm und füllte die Gläser.) »Vernehmen Sie, daß es mir auch nicht auf die entfernteste Weise in den Sinn kommt, mit Ihnen zu rivalisieren, oder Ihnen sonst Abbruch zu tun. Ich bin ein bemittelter – ich möchte wohl sagen, reicher Mann.« (Des Grauen Gesicht kelterte sich auf, und er leerte nach einer leichten Verbeugung das vor ihm stehende Glas.) »Wie sollte ich denn töricht genug sein, hier auf ein Unternehmen auszugehen, das mir nur Schaden und Verdruß bereiten könnte. Wie gesagt, ich bin ein Mann von Vermögen, aber was meines Bedenkens noch mehr gilt, ein Mann von Wort, und dieses setze ich zum Pfande, daß unsere Geschäfte sich niemals zum Mißbehagen des einen oder des andern kreuzen können. Stoßen Sie an, teuerster Kollege! und fassen Sie Vertrauen. Klagen Sie, klagen Sie wacker darauf los; klagen Sie über das Publikum, über den Geschmack, über Dichter und Komponisten und auch über die vortrefflichsten Künstler der ersten Bühne in Deutschland, die Ihnen wohl auch ein wenig Kummer und Leid verursachen mögen.«
»Ach, mein Herr!« sprach der Graue mit einem tiefen Seufzer, »mit dem Publikum, mit diesem tausendköpfigen, bizarren, chamäleontischen Ungeheuer, würde man am Ende wohl noch fertig! – Wirft man es auch nach jenes Dichters Rat nicht gerade auf den Rücken, damit das grauliche Ungetüm sich umgestalte zum gemeinen Frosch, so werden doch wohl noch irgendwo Zuckerbrötchen gebacken, die man nur zu rechter Zeit hineinstecken muß in die zum Bellen aufgesperrten Rachen! – Geschmack! Das ist nur eine fabelhafte Idee – ein Gespenst, von dem alle sprechen und das niemand gesehen hat. Riefen die Leute wie im ›Gestiefelten Kater‹: ›Wir wollen guten Geschmack – guten Geschmack‹, so drückt sich darin nur das kranke Gefühl des Übersättigten aus, der nach einer fremden idealen Speise verlangt, die die öde Leere im Innern vertreiben soll. Dichter und Komponisten gelten jetzt bei der Bühne wenig, sie werden meistens nur als Handlanger betrachtet, da sie nur den Anlaß geben zum eigentlichen Schauspiel, das in glänzenden Dekorationen und prächtigen Kleidern besteht.«
Der Graueseufzte nochmals tief aus der Brust, worauf sich das Gespräch in folgender Art weiter fortspann.
Der Braune. Ha ha! ich verstehe Ihre Seufzer! Hinc illae lacrymae – Ja! Welcher Direktor darf sich rühmen, den unaufhörlichen gutgezielten Stößen und Hieben seiner Helden und Heldinnen entgangen zu sein! – Aber erleichtern Sie Ihre Brust, Werter! Klagen Sie, klagen Sie.
Der Graue. Wo anfangen! – wo enden!
Der Braune. Anfangen? – Getrost bei der wahrscheinlich Sie recht schmerzhaft ergreifenden Begebenheit, die sich eben jetzt zugetragen. Sie erhielten einen Brief, dessen Inhalt Sie beinahe bis zur Verzweiflung trieb.
Der Graue