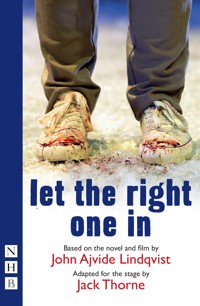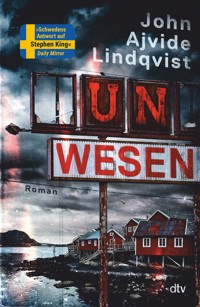14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Mittsommer-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die Reise in die Finsternis geht weiter ... Die Mittsommer-Reihe geht weiter – die Spannungssensation aus Schweden und der zweite Fall für das Ermittlerduo Julia Malmros und Kim Ribbing Wenn das Ende erst der Anfang ist ... Kim Ribbing hat den Schockdoktor Martin Rudbeck gekidnappt und hält ihn im Keller seiner Villa fest. Er will verstehen, was es ist, das einen Menschen dazu bringt, unter dem Vorwand der Wissenschaft junge Menschen zu quälen. Derweil recherchiert die Ex-Polizistin Julia Malmros im Milieu der "Wahren Schweden", einer rechtsextremen Partei mit Kontakten in die kriminelle Szene. Und plötzlich steht Julia vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: Muss sie Kim, der zu einem Teil von ihr geworden ist, verraten? Noch atemberaubender, noch härter: John Ajvide Lindqvist ist der König des modernen Thrillers. Für alle Fans der Millennium-Serie und Skandi-Crime-Leserinnen und Leser Alle Bücher der Mittsommer-Reihe: Band 1: Refugium Band 2: Signum
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Hacker Kim Ribbing hat den berüchtigten Schockdoktor Martin Rudbeck gekidnappt und hält ihn im Keller seiner Stockholmer Villa fest. Vor Jahren wurde Kim von ihm unter folterähnlichen Bedingungen mit Elektroschocks behandelt. Mit einem ausgeklügelten Plan ist es Kim gelungen, die Spuren der Entführung zu verwischen. Doch dann geschieht etwas Unvorhergesehenes, und Kim wird vom Jäger zum Gejagten. Derweil ermittelt Ex-Polizistin Julia Malmros gegen die rechtsextreme Partei Die Wahren Schweden. Ihre Recherchen erweisen sich als keineswegs harmlos. Und plötzlich steht Julia vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: Muss sie Kim, der längst zu einem Teil von ihr geworden ist, verraten?
John Ajvide Lindqvist
Signum
Thriller
Aus dem Schwedischenvon Ricarda Essrich und Thorsten Alms
Für Aaron und Ylva – mit großem Dank für all die Spiele, Filme, kreativen Abendessen und ausufernden Gespräche
Teil 12. bis 9. Juli
Prolog, 2. Juli
Als Kim Ribbing am ersten Morgen auf die Treppe seines gerade erworbenen Hauses trat, sah er ein Reh. Still stand es am Waldrand hinter dem Zaun, der das Grundstück umgab, und beobachtete Kim wachsam. Auch als Kim langsam die Treppe herunterging, den Rasen überquerte und die Latten des Zauns umfasste, regte es sich nicht.
Sie standen fünf Meter voneinander entfernt, der Mensch und das Tier. Wie hypnotisiert sahen sie sich in die Augen. Kim hatte Tieren gegenüber nie eine besondere Zuneigung empfunden, aber hier gab es einen Kontakt, der ihn faszinierte. Fast als würden das Reh und er ein stummes Zwiegespräch über das Leben führen. Einen kurzen, schwindelerregenden Moment lang legte Kim seine Identität ab und betrachtete sich durch die Augen des Rehs.
Dann schob sich plötzlich eine Art dünner Vorhang zwischen sie. Der Kontakt brach ab, und er war einfach wieder Kim, der auf seinem Grundstück stand und ein seltsam zutrauliches Reh beobachtete. Auch das Tier schien die Veränderung zu spüren, schnaubte kurz und entfernte sich dann langsam mit wackelndem weißem Hinterteil.
Diese Begegnung wiederholte sich am nächsten Morgen und am darauffolgenden auch. Wenn Kim mit seinem ersten Kaffee auf die Treppe trat, wartete das Reh bereits auf ihn. Dann stellte er seine Tasse ab und ging zum Zaun. Während das Reh und er in Verbindung traten, war Kim vollständig im Hier und Jetzt und konnte den verborgenen Pulsschlag der Welt spüren. Dann brach der Kontakt ab, und die Welt war wieder die Welt.
Am Morgen des vierten Tages wurde Kim von einem lauten Knall geweckt. Julia Malmros war über Nacht geblieben und schlief ruhig in seinem Bett, aber Kim verspürte eine innere Unruhe. Er stand auf, ging in die Küche und setzte die Kaffeemaschine in Gang. Als der Kaffee fertig war, nahm er seine Tasse mit hinaus auf die Treppe.
Was er befürchtet hatte, wurde zur Gewissheit: Das Reh befand sich hinter dem Zaun, lag aber am Boden. Kim eilte zu ihm und stellte fest, dass eine Kugel den Hals des Tieres zerfetzt hatte. Die schwarzen Augen blickten tot in den Himmel.
Kim sah sich um. Kein Jäger weit und breit. Hatte jemand das Reh womöglich zum Spaß getötet oder aus Zorn, weil es an den falschen Erdbeerpflanzen geknabbert hatte? Kim schloss seine Hände fester um die Zaunlatten, und in seinen Augen brannte es ungewohnt.
Es gab trotz aller Widrigkeiten schöne, unschuldige Dinge auf dieser Welt, zu denen man ohne Furcht, verletzt zu werden, eine Beziehung aufbauen konnte. Und es gab Menschen, die verletzten und töteten, einfach weil sie es konnten und Lust darauf hatten. Weil ihnen gerade danach war.
In diesem Moment, als er in die glänzenden, leblosen Augen des Rehs schaute, beschloss Kim Ribbing, Dr. Martin Rudbeck zu entführen.
8. Juli, tagsüber
Im Keller zog Kim Ribbing die schwere Stahltür hinter sich zu. Krachend fiel sie ins Schloss, ein Geräusch, das von den schallisolierten Betonwänden des Raums verschluckt wurde. Martin Rudbeck lag vor ihm, festgeschnallt auf einer Pritsche; Kim hatte ihn bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Er beugte sich über ihn und sagte: »Ich will verstehen.« Als der Arzt den Mund öffnete, um etwas zu erwidern, hob Kim warnend den Zeigefinger. »Warte, ich formuliere es anders. Ja, ich will verstehen. Aber vor allem will ich, dass du verstehst.«
»Was soll ich verstehen?« Martin Rudbecks Stimme war nach einem Tag ohne Essen oder Trinken dünn und rau. In seiner frühen Jugend war Kim vor den unnötigen Elektroschockbehandlungen unzählige Male genauso von Rudbeck festgeschnallt worden.
»Wer du bist«, sagte Kim und rümpfte die Nase. Der Arzt hatte sich eingenässt, Urin war an der Seite der Pritsche heruntergelaufen und auf den Boden getropft. Seinen Darm hatte er offenbar noch unter Kontrolle. »Musst du auf die Toilette?«
Als Martin Rudbeck nickte, legte Kim ihm einen offenen Metallring um den Hals, der mit einer fünf Meter langen Kette an einem dicken Eisenbügel in der Wand befestigt war. Er sicherte den Ring mit einem Vorhängeschloss, bevor er die Lederriemen löste, mit denen Rudbeck fixiert war. Stöhnend setzte der Arzt sich auf, und Kim zeigte auf eine Tür in der Stirnwand. »Da ist das Klo. Die Kette ist lang genug.«
Dann wies Kim auf den Ring am Hals des Mannes. »Nur zur Information: Ich glaube nicht, dass du eine Chance gegen mich hättest, aber nehmen wir mal an, du würdest den Deckel des Spülkastens abnehmen und mich damit angreifen, und nehmen wir weiter an, dir würde das gelingen …« Er machte eine ausladende Geste und fuhr fort: »Dieser Raum ist schallisoliert. Du hast keine Chance, die Kette loszuwerden, und ich habe den Schlüssel nicht bei mir. Du würdest also hier unten sterben.«
»Das werde ich doch so oder so.«
»Nein. Ich werde dich freilassen. Irgendwann. Es gibt da noch ein paar Details zu klären, aber darüber können wir später sprechen. Jetzt los.«
Rudbeck setzte die Füße auf den Boden, aber seine Beine wollten ihn kaum tragen. Als er ihm den Rücken zuwandte und zur Toilette wankte, sah Kim den braunen Fleck auf der Unterhose.
»Wasser …«, brachte der Arzt heiser hervor, bevor er die Tür öffnete.
»Es gibt ein Handwaschbecken«, antwortete Kim. »Trink daraus. Oder aus dem Klo, wenn dir das lieber ist.«
Während der Arzt sein Geschäft verrichtete, ging Kim hinauf ins Haus. Als er zurückkehrte, hockte Rudbeck auf halber Strecke zwischen Klo und Pritsche zusammengekauert auf dem Boden. Er hielt sich die Hände vors Gesicht, und sein langes ergrautes Attraktiver-Arzt-Haar fiel über seine Finger.
»Hier«, sagte Kim und warf ihm eine seiner alten Unterhosen zu. »Falls du dich umziehen willst.«
Der Arzt wandte Kim den Rücken zu und zog die besudelte Unterhose herunter. Beim Anblick des schlaffen, blassen Körpers, der mit weißem zotteligem Haar bedeckt war, drehte Kim den Kopf zur Seite. Glücklicherweise hielt er ihn nicht aus ästhetischen Gründen gefangen, sondern aus ethischen.
»Jetzt bist du ansehnlich«, sagte Kim, nachdem der Arzt sich umgezogen hatte. Die schwarze Unterhose spannte um seinen Bauch und verlieh ihm das Aussehen eines betagten Chartertouristen. »Leg dich wieder auf die Pritsche.«
»Und wenn ich mich weigere?«
Kim zeigte auf einen Tisch in einer Ecke des Raums, außerhalb der Reichweite der Kette. Darauf lag ein Tablett mit Skalpellen, Zangen und chirurgischen Sägen. »Das Zeug habe ich in einem Lagerraum gefunden. Keine Ahnung, was die hier unten getrieben haben. Einen Elektroschocker habe ich auch, aus Shanghai. Und ein Schweißgerät, falls mir danach ist.«
»Und das würdest du benutzen?«
Kim hob die Augenbrauen. »Sicher. Es würde mir keinen Spaß machen, aber ich würde es tun.«
»Du bist verrückt. Und das meine ich in klinischer Hinsicht.«
»Klar. Das behauptest du ja ständig.«
Der Arzt sah Kim herausfordernd in die Augen, und dieser erwiderte seinen Blick, bis Martin Rudbeck wegsah, seufzte und sich mühsam zurück auf die Pritsche legte. Kim zog die Riemen fest, nahm dann einen Schlüssel aus der Tasche und schloss den Halsring auf, der scheppernd zu Boden fiel.
»Hast du nicht gesagt, du hättest den Schlüssel nicht dabei?«, fragte der Arzt.
»Ich habe gelogen. Aber ab jetzt wird das so sein.«
Kim trat an den Tisch und hängte den Schlüssel an einen Haken an der Wand. Er vermaß den Abstand zwischen Pritsche und Tisch. »Wie viel mag das sein? Die Kette dürfte drei Meter zu kurz sein. Ziemlich frustrierend, falls du hier allein sein solltest.«
Der Arzt betrachtete das Tablett mit den Instrumenten. »Hast du vor, mich zu foltern?«
»Kommt darauf an.«
»Worauf?«
»Wie gut du verstehst.«
»Und wenn ich … verstehe? Dann lässt du mich frei?«
»Richtig. Aber es gibt Bedingungen.«
Kim ging zum Tisch und klappte einen Laptop auf. Mit einem Doppelklick öffnete er eine Videodatei und zeigte Rudbeck den Bildschirm. Dessen Augen weiteten sich. »Aber … was zur Hölle, das ist doch … mein Wohnzimmer! Wie …?«
»Ich habe die Kontrolle über die Kamera in deinem Fernseher übernommen, weil ich mich erstaunlicherweise nicht in deinen Computer hacken konnte. Was für eine Firewall hast du?«
»Rate.«
»Vielleicht TokenSoft. Militärischer Hintergrund. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt habe ich ja den Computer.«
»Der ist geschützt.«
Kim lächelte. »Das kriege ich schon hin, keine Sorge. Da sind sicher viele interessante Dinge drauf. Aber bis auf Weiteres haben wir das hier«, sagte Kim und zeigte auf den Bildschirm. »Vom 3. Juli.«
Rudbecks Augen wanderten nach links, als er überlegte, was er vor fünf Tagen gemacht hatte. Dann zuckte sein Mund. »Du erinnerst dich, nicht wahr?«, sagte Kim.
Er betätigte die Leertaste. Auf dem Bildschirm kam Martin Rudbeck ins Wohnzimmer und setzte sich mit aufgeklapptem Laptop aufs Sofa. Kim spulte eine Minute vor, jetzt tippte der Arzt etwas, balancierte dann den Laptop auf der rechten Handfläche wie ein Kellner sein Tablett und rieb sich mit der anderen Hand über sein Geschlecht. Ein Ruck ging durch seinen Körper, und sein Mund verzog sich zu einem Grinsen, bevor er sich wieder entspannte und weiter sein Geschlecht bearbeitete.
Der Mann auf der Pritsche kniff die Augen zusammen. »Das ist zwar äußerst peinlich, aber als Druckmittel doch ziemlich schwach.«
»Stimmt«, sagte Kim. »Hätte ich nur das hier, könnte ich dich nicht gehen lassen. Oder vielleicht hätte ich dich gar nicht erst hergebracht. Nun gibt es aber ein Programm, das ein gewisser Ali Abbas von der Stockholmer Polizei entwickelt hat und das ich mir … geborgt habe. Gute Sache. Es heißt Clean Sweep und durchsucht das Netz nach heruntergeladenen und gestreamten Videos von Misshandlungen. Na, errätst du es?« Als Kim Rudbeck dieses Mal in die Augen schaute, sah dieser sofort weg, und seine Unterlippe zitterte. »Okay«, sagte Kim, »du kannst es dir denken. Sollen wir uns ein Stück ansehen? Dieser Film war zu dem Zeitpunkt online, als du auf dem Sofa gesessen und es dir gemütlich gemacht hast.«
Kim öffnete eine weitere Videodatei. Das Schreien und Weinen eines Kindes war zu hören. Er klickte den Ton weg und sah zur Wand. Die Aufnahme hatte er bereits gesehen, ein weiteres Mal wollte er sich ersparen. Die Bilder von einem asiatischen, etwa zehnjährigen Mädchen, zwei erwachsenen Männern, verschiedenen Peitschen und einem überdimensionierten Dildo bekam er so schon kaum aus dem Kopf. Es gehörte zum Widerwärtigsten, das Kim je gesehen hatte, und er hatte viel gesehen, als er vor einigen Monaten die Machenschaften eines Pädophilenrings dokumentiert hatte.
Der Arzt schien unter den aktuellen Bedingungen keinen Spaß an dem Film zu haben, und er blickte zur Decke. »Ich verstehe nicht, was du damit beweisen willst.«
»Ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest. Deshalb habe ich eine Splitscreen-Version erstellt.« Kim hustete kurz und strich sich über die Augen. »Leider musste ich mir ziemlich viel davon ansehen, bevor mir die Synchronisation gelungen ist, und das war … nicht besonders angenehm.«
Kim öffnete eine dritte Videodatei. Im oberen Teil des Bildschirms lief das Misshandlungsvideo, im unteren saß Martin Rudbeck auf seinem Sofa. Der Arzt starrte noch immer zur Decke. »Sieh es dir an«, sagte Kim angewidert, »sonst sorge ich dafür, dass deine Augen offen bleiben. Heftklammern im Oberlid, wie klingt das?«
Martin Rudbeck schielte zum Bildschirm, auf dem deutlich sichtbar wurde, dass seine Erregung genau mit den »Höhepunkten« der sexuellen Misshandlungen des Mädchens zusammenfielen. Martin Rudbeck schluckte, und seine Stimme zitterte. »Das beweist gar nichts.«
»Ich denke schon«, widersprach Kim und klickte den Film weg. »Die Dateien sind mit einem Zeitstempel versehen …«
»Der lässt sich manipulieren«, antwortete der Arzt. »Das ist doch genau das, womit du dich sonst beschäftigst, oder?«
»Stimmt. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass er nicht manipuliert wurde. Und ich wage mir kaum vorzustellen, was ich alles finde, wenn ich deinen Rechner knacke.«
»Du wirst Dinge finden, die ich für meine Forschung brauche.«
Kim sah den Arzt lange an. »Ich begreife nicht, wie du das Gericht täuschen und dich aus den Misshandlungen herausreden konntest, denen unter anderem ich ausgesetzt war«, sagte er schließlich. »Aber hier wird dir das kaum gelingen.«
Kim spielte einige Minuten in achtfacher Geschwindigkeit vor, in denen der Arzt wie ein Hampelmann mit abnormem Sexualtrieb aussah. Dann kehrte er zur normalen Geschwindigkeit zurück. Jetzt richtete der Arzt sich im Sofa auf und stellte den Computer neben den Couchtisch, sodass der Bildschirm sichtbar wurde. Kim fror das Bild ein.
»Sieh her. Da ist sie zu erkennen. Siehst du das Mädchen? Das Blut? Willst du hören, wie sie geschrien hat, als sie …?«
»Es reicht«, unterbrach ihn Martin Rudbeck. »Es reicht.«
Kim klappte den Laptop zu. »Offenbar hat es dir nicht gereicht. Du hast nur eine kleine Pause gemacht und dann noch acht Minuten und zwanzig Sekunden weitergeschaut, bis das Mädchen vollkommen am Ende war. Der Begriff Abschaum ist für dich noch zu gut.«
»Das ist mein Beruf«, sagte der Arzt, der zu schwitzen begonnen hatte. »Ich musste mir das ansehen, um …«
»Um zu verstehen«, beendete Kim den Satz für ihn. »Komisch, das habe ich schon mal gehört. Aber inwiefern dient es dem Verständnis, sich einen runterzuholen, während ein Kind gefoltert wird?«
»Ich … ich …«
»Hör auf«, sagte Kim, »hör einfach auf. Du weißt, dass ich dich in der Hand habe. Wenn ich dich irgendwann gehen lasse … solltest du auch nur ein einziges Mal in die Nähe von jungen Menschen kommen, veröffentliche ich diesen Film. Und sollte mir etwas passieren, wird ein Bekannter von mir das erledigen. Verstanden?«
»Du musst …«
»Halt’s Maul. Ob du mich verstanden hast, will ich wissen?«
Martin Rudbeck atmete ein paarmal keuchend ein und aus. »Ja, verstanden«, stieß er dann hervor.
»Gut. Dann können wir ja anfangen.«
8. Juli, tagsüber
Nachdem die Kapelle hinter ihr lag, in der die Trauerfeier für Astrid Helanders Eltern stattgefunden hatte, schlenderte Julia Malmros über den Waldfriedhof. Das Gelände war riesig, und sie wusste, dass dort etwa hunderttausend Menschen beerdigt waren. Unweigerlich dachte sie an die eigene Unbedeutsamkeit in dem großen Ganzen, an die noch verbleibenden Jahre und wie man sie am besten nutzte.
Während Julia auf den Ausgang zusteuerte, wurden diese Gedanken durch einen anderen verdrängt: Trotz allem, was passiert war, wandelte sie noch auf dieser Erde. Der Regen der Nacht war unter der Sonne zwar bereits verdunstet, aber aus dem Gras stieg eine Frische auf, und Julias Glieder fühlten sich ein paar Kilo leichter an als sonst. In diesem Moment genoss sie es, am Leben zu sein.
Beim Gedanken daran, wie Kim heute mit den Fingern getrommelt hatte, während sie ihren Kaffee trank, verzog sie den Mund. Er hatte den starken Drang, die Bedingungen für ihre Treffen und den Zeitplan allein festzulegen, und Julia zog ihn manchmal gern damit auf. An diesem Morgen war er kurz angebunden und kaum zugänglich gewesen. Etwas schien ihn zu beschäftigen, aber Julia wusste, dass es keinen Sinn hatte, nachzufragen. Er erzählte Dinge, wenn er dazu bereit war.
Sie waren direkt nach ihrer Rückkehr aus Norwegen vor einer Woche im Bett gelandet. Julia konnte kaum Kims irrsinnigen Hauskauf kommentieren, als sich ihre Lippen schon in einem Kuss trafen, und so war es im Grunde die ganze Nacht weitergegangen. Dreimal hatten sie Sex, dann war Julia vor Erschöpfung und Glückseligkeit eingeschlafen.
Als sie jetzt über den Rasen lief, während die Sommersonne durch eine hauchdünne Wolkendecke schien, war sie … glücklich. Nicht auf diese tiefe, harmonische Art, sondern eher oberflächlich und intensiv, an Nervosität grenzend. Eine berückende, kurzlebige Freude, die ein Kaninchen aber dennoch zu einem Binky, einem Freudensprung, veranlassen würde.
Rammeln wie die Karnickel.
Ja, ja, das auch. Es fühlte sich gut an, wieder Sex zu haben, und Sex mit Kim sogar noch besser. Nach den Exzessen der ersten Nacht war ihr Zusammenleben in geordneteren Bahnen verlaufen, auch wenn ihre Berührungen an Verliebtheit erinnerten. Ob es bei Kim Verliebtheit war, wagte Julia nicht zu fragen. Im Moment wollte er sie, und damit musste sie sich begnügen.
Obwohl ich das eigentlich nicht will.
Nein, und genau da lag das Problem, das einem stabilen, unerschütterlichen Glück im Weg stand. Kim und sie mochten noch so wild durch die Betten toben und sich aneinanderklammern: Sie wusste trotzdem nicht, woran sie bei ihm war. Selbst wenn er in ihren Armen lag und sie ihm sanft über die vernarbte Haut strich, spürte Julia immer wieder, dass er sich von ihr entfernte, ihr durch die Finger rann wie Wasser oder Sand.
Ach, egal. Noch lag sie nicht unter einem Stein begraben, und solange sie noch einen Fuß vor den anderen setzen konnte, würde sie weitergehen und auf das Beste hoffen. Julia verließ den Friedhof und nahm ein Taxi nach Hammarbyhamnen.
8. Juli, tagsüber
Das große Herbstprojekt bei TV4 war die Fernsehserie um Åsa Fors, acht einstündige Episoden, die auf Julia Malmros’ Büchern basierten. Die Dreharbeiten waren abgeschlossen, und die erste Episode lag im Rohschnitt vor, den Julia sich jetzt ansehen wollte. Sie hatte keine sonderlich hohen Erwartungen, weil sie bereits ein paar Ausschnitte kannte, und fand, dass sie den Polizeiberuf romantisierten. Nun ja, vielleicht war das Endergebnis näher an der Wirklichkeit.
Julia betrat den überdimensionierten Empfangsbereich des Senders und ging zum ebenso großen Tresen, an dem problemlos zehn Personen Platz hatten. Die Besetzung bestand jedoch nur aus zwei. Julia wandte sich an eine Frau in den Dreißigern, die ihre Haare zu einem ordentlichen Knoten hochgesteckt hatte. »Hallo. Ich habe einen Termin.«
Die Frau sah vom Bildschirm auf, und ihre reservierte Miene verwandelte sich in ein Lächeln. »Ah, hallo! Ich habe alle Ihre Bücher gelesen.«
»Soso«, sagte Julia. »Hoffentlich haben sie Ihnen gefallen. Ich bin mit Ylva Strandberg verabredet.«
»Darf ich um Ihren Ausweis bitten?«
Das irritierte Julia noch immer. Seit einigen Jahren war es nahezu unmöglich, Fernseh- und Radiosender wie SVT, SR oder TV4 zu betreten, wenn man sich nicht ausweisen konnte. Die Frau hinter dem Tresen hatte sie erkannt, und trotzdem … was dachte sie? Dass Julia eine Pistole aus der Handtasche zog, das Haus in ihre Gewalt brachte und IS-Propaganda sendete?
Sie ersparte sich die Diskussion, zog das Portemonnaie aus der Schultertasche und legte ihren Führerschein auf den Tresen. Die Frau prüfte ihn, gab etwas in ihren Computer ein, druckte einen Besucherausweis aus und deutete auf einige Sitzgelegenheiten in der Nähe. »Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz. Ylva kommt gleich.«
Julia war versucht, die Frau zu fragen, welches der Bücher ihr am besten gefallen hatte, verzichtete dann aber darauf. Im schlimmsten Fall würde die Frau keinen Titel nennen können, weil sie die Bücher gar nicht gelesen, sondern nur sie als Autorin wiedererkannt hatte. Also setzte sie sich wie angewiesen auf das Sofa, das ziemlich hart war und eine gerade Lehne hatte.
Sie war ein wenig nervös. Seit dem Debakel mit ihrem Millennium-Roman reagierte sie sensibler auf die Meinungen anderer Menschen. Allerdings wurde heute nicht sie beurteilt, sondern sie sollte die Arbeit anderer bewerten. Ärgerlicherweise war sie trotzdem unruhig. Vielleicht weil die Situation denjenigen ähnelte, als sie vor dem Büro des Schuldirektors warten musste. Soso, Fräulein Malmros hat also angefangen zu rauchen? So etwas tun wir hier nicht.
Julia schüttelte den Gedanken ab. Hier würde niemand ihre Eltern anrufen, niemand mit ihr schimpfen, und sie würde auch keinen Hausarrest von ihrem Vater bekommen, der inzwischen bettlägerig war und sich kaum noch an seine Tochter erinnerte.
Schließlich entdeckte Julia Ylva Strandbergs schlanke Gestalt hinter den Glasdrehtüren, die in das Innere des Gebäudes führten. Die Åsa-Fors-Serie wurde durch ein externes Unternehmen namens Bluefish produziert, aber TV4 gehörte zu den Hauptgeldgebern, und Ylva Strandberg war deren Inhouse-Produzentin. So ganz hatte Julia nicht verstanden, wie alles zusammenhing. Während der Produktion waren ihr viele Namen und Gesichter begegnet, aber von der Hälfte der Personen wusste sie nicht, was sie eigentlich taten.
Julia stand auf und ging Ylva entgegen. Sie waren sich bereits mehrmals begegnet und fanden sich durchaus sympathisch, also war wohl eine Umarmung angebracht. Allerdings war Ylva Strandberg sehr dünn und zehn Zentimeter größer als sie, weshalb Julia sich immer fühlte, als würde sie einen Baum umarmen. Ylvas Hals duftete angenehm. Wahrscheinlich Gaultier, dachte Julia. Ein kleines bisschen rebellisch.
»Wie geht es dir?«, fragte Ylva.
»Ganz gut. Ein wenig angespannt.«
»Das musst du nicht sein. Es wird supergut.«
Ylva liebte verstärkende Vorsilben wie super. Im Gespräch mit einem ausländischen Geldgeber hatte sie einmal das in der Filmbranche obligatorische superexited gesagt. Aus ihrem Mund klang es vollkommen natürlich.
Ylvas Absätze klackerten über den Marmorboden, als sie durch die Drehtüren gingen. Julia trug bequeme Sneaker mit dämpfenden Sohlen; sie verspürte keinen Drang, geschäftsmäßig zu wirken, und vielleicht waren die Schuhe auch ein Zugeständnis ans Alter. In Ylvas Pumps bekäme sie nach einer Viertelstunde einen Krampf.
Julia folgte Ylva Treppen hinauf und Flure entlang. Nach einer Weile hatte sie keine Ahnung mehr, wo sie sich befand. Immer wenn sie ein neues Buch veröffentlichte, wurde sie ins Frühstücksfernsehen bei TV4 eingeladen und fand das betreffende Studio inzwischen ohne Weiteres. Aber jetzt hätte sie sich ebenso gut im Labyrinth von Knossos befinden können.
Als sie einen breiteren Gang entlangliefen, verlangsamte Ylva ihre Schritte, damit Julia aufholen konnte. »Das, was du bei Malou gemacht hast, war ein wenig speziell, oder?«, sagte sie.
»So könnte man es auch ausdrücken.«
»Das gesamte Haus hat darüber geredet. Aber die ganze Aufmerksamkeit war supergut für die Serie.«
Nach der Ablehnung ihres Millennium-Romans hatte Julia den Fehler begangen, in der Sendung Malou nach zehn in Tränen auszubrechen. Es folgte ein unvergleichliches Medienspektakel inklusive Klageandrohungen, und Julia war gezwungen, nach Tärnö zu fliehen, um den aufdringlichen Journalisten zu entkommen.
»Stets zu Diensten«, sagte Julia, während Ylva die Tür zu einem Vorführraum öffnete. Er ähnelte einem winzigen Kino mit acht Sesseln, die auf einen 75-Zoll-LED-Fernseher ausgerichtet waren. Ylva tippte etwas in einen Computer, dann erschien auf dem Fernseher der Schriftzug »Åsa Fors – Weicher Stahl«. Ylva zeigte auf den Text und sagte: »Nur ein Entwurf. Wir arbeiten noch an der Titelsequenz. Ich habe schon ein paar andere gesehen; das wird superschön.«
»Okay«, sagte Julia. »Und Weicher Stahl ist auch … ein Entwurf?«
»Jein«, sagte Ylva und zog die Augenbrauen hoch. »Wir mögen den Titel eigentlich ganz gern. Es fehlt noch ein Untertitel. Aber der zeigt supergut, dass sie eine Polizistin und Frau ist. Weich und hart gleichzeitig. Weicher Stahl.«
Julia nickte, fragte sich aber insgeheim, welchen Anwendungsbereich weicher Stahl wohl hätte. Vielleicht denselben wie harte Baumwolle. Sie wollte keine Spielverderberin sein und nicht einfach nur »gefällt mir nicht« sagen, sondern einen Gegenvorschlag machen. Darüber musste sie dringend nachdenken. Sonst bestand das Risiko, dass es bei Weicher Stahl blieb, und das war keine gute Idee.
»Okay«, sagte Ylva und betätigte die Leertaste. »Wir reden nachher weiter. Jetzt lasse ich dich mal mit Åsa allein.«
»Das bin ich gewohnt«, sagte Julia.
Ylva schaltete das Deckenlicht aus, und die Tür schloss sich hinter ihr mit einem saugenden Geräusch. Julia ließ sich in einen der bequemen Sessel sinken und sah auf den Fernseher, auf dem am unteren Rand ein Zählwerk erschienen war. Das war zunächst ein wenig irritierend, aber ihr Gehirn blendete es rasch aus.
Die Episode war fünfzig Minuten lang, und Julia schaute sie mit wachsender Abneigung an. Das lag nicht an Carina Skytte, der Darstellerin von Åsa Fors, auch wenn sie unnötig hübsch war. Die Locations waren sorgfältig ausgewählt, die Aufnahmen gut. Das Problem war, dass es … einfach nicht gut war. Julia brauchte einen Moment, um sich klar zu werden, was genau ihr nicht gefiel. Im Grunde war es das Gleiche wie bei dem Ausschnitt, den sie bereits kannte. Die Geschichte wirkte wie ein Märchen.
Die Åsa Fors aus der Serie sah nicht nur besser aus als ihre literarische Vorlage, ihr Leben war auch viel unkomplizierter. In den Büchern beschrieb Julia Åsas Unzulänglichkeit und Selbstzweifel, ihre Stimmungsschwankungen und Egozentrik. Die Åsa in der Serie hatte viel weniger Ecken und Kanten und bewegte sich immer wohlfrisiert, aufgeweckt und clever durch die verschiedenen Phasen der Ermittlungen. Kurz, sie war eine Superpolizistin, wie sie Julia in der Realität nie kennengelernt hatte. Im Gegensatz zu der Åsa aus der Buchvorlage litt sie nicht einmal unter Tinnitus als Folge eines zu nahe an ihrem Ohr abgefeuerten Schusses.
Als der Bildschirm nach fünfzig Minuten blau wurde, blieb Julia sitzen und fragte sich, was sie bloß zu dem Film sagen sollte. Sie wünschte, Kim wäre da; er hatte keine Hemmungen, auszusprechen, was er dachte. Julia lehnte die TV-Serie nicht rundweg ab, aber sie fand sie mittelmäßig und eindeutig schlechter als ihre Bücher.
Ein paar Minuten später öffnete sich die Tür, und die Deckenbeleuchtung strahlte auf Ylva Strandberg herab. Sie sah Julia erwartungsvoll an, während sie sich in den Sessel neben ihr fallen ließ. »Na, was denkst du?«
Nimm das Geld und lauf war das Erste, was Julia durch den Kopf schoss. Und hätte Ylva tatsächlich eine Tasche mit der knappen Million dabeigehabt, die Julia für die Fernsehrechte bekommen sollte, hätte sie sie wahrscheinlich geschnappt und ihre Beine in die Hände genommen.
»Na ja«, sagte Julia, »es war … nett.«
»Nicht wahr?« Ylvas Augen leuchteten. »Diese Szene draußen auf dem Eis … nur natürliches Licht und trotzdem superschön. Und wie fandest du Carina?«
»Ganz gut. Und hübsch.«
»Meinst du zu hübsch?«
»Ein wenig, ja.«
Ylvas Mundwinkel fielen ein Stück herab. »Na ja, dagegen können wir jetzt natürlich nichts mehr tun. Aber weißt du, gerade so eine Serie muss ja auch etwas fürs Auge sein.«
»Entschuldige, aber was genau meinst du mit gerade so eine Serie?«, fragte Julia.
»Tut mir leid, aber das ist ja nicht The Wire. Versteh mich nicht falsch, ich finde die Bücher super, aber sie haben ja durchaus etwas Märchenhaftes an sich.«
»Das verstehe ich nicht«, entgegnete Julia. »Wenn ich für etwas gelobt werde, dann für meinen Realismus.«
»Natürlich, auf jeden Fall in Bezug auf die Polizeiarbeit. Aber die Intrige, der Plot … nimm zum Beispiel Der Schlüssel zum Paradies. Dieser Schlüssel, mit dem der Geschäftsmann die Kuckucksuhr öffnet, und dann der Kuckuck mit dem USB-Stick im Schnabel … das ist ja nichts, was wirklich passieren würde, das ist … wie nennt man das noch? … überhöhte Realität. Märchenhaft. Und daran ist nichts verkehrt, im Gegenteil.«
Julia spürte, wie sich ihr die Brust zuschnürte. Sie hätte sich umfassend darüber auslassen können, dass die Produktion sogar die mühsame Ermittlungsarbeit in so etwas wie Tischlein deck dich verwandelte. Hinweise materialisierten sich auf einmal durch Åsa Fors’ Einfallsreichtum und nicht mehr durch das Durchackern von Protokollen.
Ihr lagen eine Menge verärgerter oder boshafter Bemerkungen auf der Zunge, aber sie begnügte sich mit: »Nun ja, es lässt sich wohl nicht ändern, nehme ich an.«
»So ist es«, sagte Ylva.
Sie tauschten noch ein paar nichtssagende Floskeln aus, wobei Julia vor unterdrücktem Ärger zitterte. Dann führte Ylva sie durch das Labyrinth zurück, und ihre Wege trennten sich im Empfangsbereich. Keine Umarmung zum Abschied.
Während Julia die Treppe zur Straße hinunterging, dachte sie: Überhöhte Realität. Märchenhaft. Produzentenäffchen.
Sie musste mit jemandem reden oder vielmehr ihr Herz bei jemandem ausschütten, der sie verstand. Vielleicht eine Stippvisite bei Malou? Nein, besser nicht. Wenn es Julia nicht gut ging, hatte sie ein Patentrezept: ein Gespräch mit Irma.
Irma Ryding hatte dreißig Jahre mehr Erfahrung als Krimiautorin auf dem Buckel als sie, und ein paar ihrer Bücher waren zu halbgaren Filmen adaptiert worden. Noch dazu war sie Julias beste Freundin. Sie würde sie verstehen.
Irma ging nach dem zweiten Klingeln dran. Sobald Julia ihre spitze, dünne Stimme hörte, legte sie los. »Ich war bei TV4 und habe die Åsa-Fors-Serie gesehen …«
»Oje«, unterbrach Irma sie. »Du klingst, als hätten sie sich dir gegenüber nicht gut benommen. Komm zu mir, meine Liebe. Ich wäre gerne in die Stadt gefahren, aber die Hüfte macht mir immer noch Probleme.«
»Ich bin in einer Viertelstunde da.«
»Sehr schön. Wenn du Lust auf ein Teilchen hast, bring eins mit. Bis gleich.«
8. Juli, tagsüber
Seit sich die Untersuchungen im Fall Frode Moe beinahe ausschließlich um digitale Beweise drehten, war das Ermittlungsteam unter Jonny Munthers Führung aufgelöst worden und Christof Adler zu seinen normalen Aufgaben zurückgekehrt. Die bestanden derzeit aus Innendienst und allen Angelegenheiten, die über das Telefon hereinkamen.
Er war erst seit zwei Jahren bei der Kriminalpolizei und galt noch als Frischling. Deshalb hatte es ihn durchaus verwundert, als er für das Team angefragt wurde, das den Mord auf Knektholmen untersuchte. Vielleicht hatte Kriminalkommissar Jonny Munther ja etwas in ihm gesehen.
Christof hatte nie übertrieben dramatische Vorstellungen vom Polizeiberuf gehabt, nie von Verfolgungsjagden, Schusswechseln oder Geiselnahmen geträumt. Zwar hatten sich seine Aufgaben im Knektholmen-Fall auf ermüdend langweilige Wohnungs- und Häuserdurchsuchungen beschränkt, aber selbst das war spannender gewesen, als am Telefon zu sitzen und die Gespräche anzunehmen, die die Leitstelle nicht sofort an eine Streife weiterleitete. Als das Telefon an diesem Vormittag klingelte, hoffte Christof auf etwas Interessanteres als jemanden, der mal wieder »einen seltsamen Typen« gesehen hatte.
»Guten Tag, Sie sprechen mit Christof Adler von der Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Am anderen Ende der Leitung räusperte sich eine Person, bevor eine Männerstimme sagte: »Ich möchte jemanden als vermisst melden.«
Ein nicht völlig ungewöhnliches Anliegen, aber doch interessanter als einseltsamer Typ.
»Und wie ist Ihr Name?«, fragte Christof.
»Ich heiße Wilmer Syd, und es geht um meinen ehemaligen Lehrer, Martin Rudbeck.«
Rudbeck, Rudbeck … der Name kam ihm vertraut vor, aber Christof konnte ihn nicht einordnen.
»Gut«, antwortete Christof. »Und weshalb gehen Sie davon aus, dass er verschwunden ist?«
»Wir hatten gestern Nachmittag einen Termin, aber er ist nicht aufgetaucht. Etwas später erhielt ich eine Textnachricht, er sei nach Thailand gereist.«
»Und diese Nachricht kam von seinem Handy?«
»Ja. Aber glauben Sie mir, das ist absolut untypisch für ihn. Er würde so etwas nie tun, einfach so verschwinden.«
»Und da sind Sie sicher?«
»Vollkommen sicher. Er ist ein Mensch, der Dinge Monate im Voraus plant.«
»Haben Sie versucht, ihn anzurufen?«
»Ja. Er geht nicht dran.«
»Könnte ich seine Nummer bekommen? Und seine Personennummer, falls Sie die haben.«
»Warten Sie, ich muss …« Er gab Christof die Telefonnummer durch, danach drang Papierrascheln aus dem Hörer. Schließlich sagte Wilmer Syd: »Hier ist sie. Seine Personennummer lautet 550321-0151. Haben Sie das?«
»Ja. Was glauben Sie, könnte passiert sein?«
»Keine Ahnung. Ich war bei ihm zu Hause, aber es war niemand da. Ich habe SMS und E-Mails geschickt, aber keine Antwort bekommen.«
»Sie verstehen sicher, dass ich das fragen muss: Hat er irgendwelche … suizidalen Tendenzen gezeigt?«
»Überhaupt nicht. Und ich weiß, dass er sich auf dieses Treffen gefreut hat. Wir wollten uns mit einem ehemaligen Studenten von ihm treffen, der … na ja. Das gehört nicht hierher. Aber nein. Er würde sich niemals das Leben nehmen. Und niemals einfach so nach Thailand reisen. Völlig undenkbar. Es muss etwas passiert sein.«
»Okay, ich sehe, was ich tun kann.«
Auch wenn Christof keine Verfolgungsjagden oder Schusswechsel im Sinn hatte, dürfte die digitale Ermittlungsarbeit gern etwas mehr von Mission: Impossible haben. Einige Eingaben und Wischbewegungen auf einem Touchscreen, und schon hatte man alle Angaben, die man brauchte.
Christof hatte einen Bekannten, der bei der Fluggastinformationsstelle arbeitete. Wann immer eine Person von oder nach Schweden fliegen wollte, waren die Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, ihre Fluggastdatensätze an die Behörde zu übermitteln. Das sollte vor allem vor terroristischen Verbrechen schützen. Der sogenannte Passenger Name Record enthielt die gesamte Reiseroute sowie die Menge an Gepäck, die die Person dabeihatte.
Johan Åkerman hatte zeitgleich mit Christof die Polizeiausbildung an der Hochschule Södertörn begonnen, war aber schon nach einem halben Jahr abgesprungen, um stattdessen Datensicherheit zu studieren. Die Stelle bei der Behörde diente nur als Übergangslösung, bis er seine Weiterbildung als IT-Forensiker begann. Er hatte ihm schon früher ein paarmal geholfen, und Christof hoffte, dass sich auch diese Angelegenheit schnell klären ließe. Johan ging gleich nach dem ersten Klingeln dran. Nachdem sie ein paar Floskeln ausgetauscht hatten, rückte Christof mit dem eigentlichen Grund seines Anrufes raus: »Du, ich wollte dich um einen Gefallen bitten.«
»Schon wieder! Demnächst bist du mal dran!«
»Du musst nur fragen.«
»Ich werde mir was überlegen«, sagte Johan. »Worum geht es?«
»Eigentlich muss ich nur wissen, ob eine Person ins Ausland gereist ist.«
»Geht es um eine potenzielle terroristische Angelegenheit?«
»Wir könnten so tun, als wäre das der Fall.«
»Hm. Hast du die Pass- oder Personennummer?«
Christof gab ihm Martin Rudbecks Daten durch. Bei dem Namen klingelte es, aber genau wie eben konnte er ihn weder mit einem Ereignis noch mit einem Ort in Verbindung bringen. Am anderen Ende klackerte die Tastatur, dann sagte Johan: »Ja. Er ist geflogen.«
»Okay. Gestern?«
»Ja.«
»Ich weiß, dass das problematisch ist, aber könntest du … Lass mich so fragen. Ist er nach Asien gereist?«
»Hm. Ja.«
»Prima, danke.«
»Ich habe einen Hund«, sagte Johan plötzlich. »Einen Labrador. Musse heißt er.«
»Aha.«
»Manchmal finde ich es ziemlich mühsam, mit ihm Gassi zu gehen, und überlege: Was wäre, wenn jemand käme und Musse auf einen richtig langen Spaziergang mitnehmen würde?«
Christof lachte. »Ruf einfach an.«
Sie verabschiedeten sich und legten auf. Offenbar kannte dieser Wilmer Syd seinen ehemaligen Lehrer doch nicht so gut. Allerdings war er ziemlich hartnäckig gewesen und hatte behauptet, so eine kurzfristige Reise sei undenkbar. Deshalb entschied sich Christof für eine zweite Überprüfung. Er stand auf, ging hinüber zu Carmen Sánchez’ Büro und klopfte an den Türrahmen. Carmen sah von einem Ordner auf und winkte ihn herein.
Während der Ermittlungen der Knektholmen-Morde hatte Christof viel Zeit mit Carmen verbracht, und er fand sie attraktiv. Er war nicht verliebt in sie, eher angezogen von der Art, wie sie ihre Arbeit erledigte, ohne Theater und Umschweife. Er mochte sie einfach.
»Ich habe eine Frage«, begann er. »Du hast doch einen Kontakt bei Telia, oder?«
»Ja«, bestätigte Carmen. »Warum?«
Christof zeigte auf das Blatt in seiner Hand. »Ich habe hier eine Telefonnummer, eine Telia-Nummer. Können die überprüfen, wo sich das Handy befindet, zu dem die Nummer gehört? Es geht um eine Person, die als vermisst gemeldet wurde. Es hat zwar noch keine formale Anzeige gegeben, aber …«
»Um wen handelt es sich?«
»Äh … Rudbeck. Martin Rudbeck.«
»Martin Rudbeck?«, fragte Carmen und nahm das Blatt entgegen.
»Ja. Kennst du ihn?«
Carmen antwortete nicht, sondern betrachtete stattdessen die Nummer, als könnten die Ziffern ein Geheimnis preisgeben. »Für Telefonortungen braucht man einen Gerichtsbeschluss.«
»Klar, aber ich dachte, dass du vielleicht, du weißt schon … Was ist mit diesem Rudbeck?«
Carmen nahm ihr Telefon. »Googel ihn, ich telefoniere solange.«
Christof tat, was Carmen ihm aufgetragen hatte, und fand heraus, dass es sich bei Dr. Martin Rudbeck um den sogenannten Schockdoktor handelte, der Kim Ribbing und einige andere Jugendliche mit Methoden therapiert hatte, die an Sadismus grenzten. Kim Ribbing hatte verschlossen, aber intelligent auf Christof gewirkt, und er besaß das Talent, Jonny Munther allein schon durch seine Anwesenheit auf die Palme zu bringen.
Carmen kam in Christofs Büro und sagte: »Thailand. Er ist in Thailand.«
»Ah, das stimmt mit dem überein, was ich auch herausgefunden habe. Case closed.«
Carmen wies auf Christofs Computer, auf dem ein Artikel über den Prozess gegen den Schockdoktor geöffnet war. »Im Hinblick auf das da ist es beinahe schade, dass er sich in Pattaya aufhält. Aber das liegt leider außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs.«
7. Juli, vormittags
Sechsundzwanzig Stunden zuvor. Nachdem Kim Ribbing nach Martin Rudbecks Entführung alle notwendigen Maßnahmen getroffen hatte, ging er in den Keller hinunter, wo der Arzt jetzt auf der Pritsche festgeschnallt lag. Er war noch groggy und begriff nicht, was geschah, als Kim seinen Zeigefinger auf den Fingerprint-Leser des Smartphones legte, um es zu entsperren. Danach ließ er ihn allein.
Kim änderte die Einstellungen des Telefons so, dass es nicht mehr entsperrt werden musste, dann kopierte er den Inhalt auf sein eigenes Gerät. Auf seinem Laptop suchte er nach Last-Minute-Reisen und fand einen TUI-Charterflug nach Bangkok, der in drei Stunden ging. Dann nahm er Martin Rudbecks Pass, den er in dessen Haus eingesteckt hatte, gab die Personendaten ein, bezahlte das Ticket mit der Kreditkarte des Arztes und checkte direkt ein. Das war der einfache Teil.
Er sah auf die Uhr. Wenn der Flug sich nicht verspätete, würden die ersten Passagiere in zweieinhalb Stunden durch das Gate gehen, und Martin Rudbeck würde als einer der Fluggäste, die eincheckten, registriert. Vielleicht war er ein wenig zu optimistisch gewesen, als er einen so kurzfristigen Flug gebucht hatte, aber er wollte den Arzt so schnell wie möglich außer Landes bringen, noch bevor jemand seine Abwesenheit bemerkte.
Kim warf die Dinge, die er benötigte, in seinen Rucksack, dann drehte er die Honda auf dem Weg zum Flughafen Arlanda voll auf. Eigentlich musste er für die notwendigen Hacks nicht vor Ort sein, aber falls es ihm nicht gelang, würde er auf unsicherere, aber handfestere Methoden zurückgreifen.
Fünfundvierzig Minuten später stand Kim in Terminal 5. Er fand eine Nische mit einigen Bänken, von wo aus er die TUI-Schalter beobachten konnte. Das Check-in hatte gerade begonnen. Er setzte sich und klappte sein MacBook Air auf. Hoffentlich bereitete die schwache Prozessorleistung keine Schwierigkeiten.
Für anspruchsvollere Aufgaben griff er sonst auf ein Mitglied von HackPack zurück, vorzugsweise auf Moebius mit seinem Monsterrechner, aber dafür war eine bessere Internetverbindung nötig als die über sein Handy. Das kostenlose Wi-Fi war noch schlimmer. Kim könnte das Wi-Fi des Flughafens hacken, aber das würde ihn wertvolle Zeit kosten, die er für wichtigere Aufgaben brauchte.
Er startete Sn1per und ließ das Programm im Hintergrund nach Schwachstellen im System suchen, dann öffnete er John the Ripper und die Log-in-Seite für das Flughafenpersonal. Als er an den TUI-Schaltern vorbeigekommen war, hatte er sich die Namen der drei Mitarbeiter eingeprägt. Er tippte »Malin Malmberg« ein und ließ John einen Wörterbuchangriff auf ihr Passwort ausführen.
Während das Programm aus einer umfangreichen Wörterliste, die auch die zehntausend häufigsten Passwörter enthielt, Malins Passwort zu ermitteln versuchte, sah Kim nach, wie es beim Scharfschützen lief, bei Sn1per. Leider nicht gut. Bisher hatte das Programm noch keine einzige Schwachstelle gefunden.
Fuck.
In den knapp zwei Monaten, die Kim ohne Internetzugang in Kuba verbracht hatte, hatte man das Sicherheitssystem des Flughafens aktualisiert. Kommerziell wurde Sn1per dafür benutzt, um Datenlecks zu finden, die abgedichtet werden mussten. Und jetzt scheiterte sogar Kims modifizierte Version. Aufgrund der Angst vor Terrorangriffen waren insbesondere Flughäfen auf Datensicherheit bedacht, und Arlanda bildete da offenbar keine Ausnahme.
Die Schlange am Check-in war jetzt lang. Der Schalter würde noch eine Stunde geöffnet sein, und für Kims Back-up-Plan waren viele Menschen erforderlich. John the Ripper signalisierte, dass er die Suche erfolglos abgeschlossen hatte.
Fuck.
Kim biss auf seiner Nagelhaut herum. Vielleicht war das Personal im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen angewiesen worden, schwer zu hackende Passwörter wie Lr&h5?6Gs7 einzustellen, die selbst in der ausgefeiltesten Wörterliste nicht vorkamen. In diesem Fall wäre es zwecklos, es mit den Namen der beiden anderen Mitarbeiterinnen zu versuchen.
Er überlegte einen Moment, dann ließ er John einen Brute-Force-Angriff auf Malins Passwort starten, eine zufallsbasierte Durchsuchung aller denkbaren Kombinationen. Hier machte sich das Problem mit dem MacBook Air bemerkbar. Statt einiger hunderttausend Kombinationen mussten viele Milliarden ausprobiert werden, und mit der Leistung des Apple-Rechners war es reine Glückssache, das Passwort zu knacken, bevor es zu spät war. Wahrscheinlich würde er auf die handfestere Methode zurückgreifen müssen, um Martin Rudbeck an Bord des Flugzeugs zu bringen.
Auch die handfeste Methode basierte auf Glück, und Kim überlegte, ob er ausnahmsweise Opfer seiner schlechten Planung würde. Nein, falls er scheiterte, gab es noch eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die jemand auf der Suche nach Martin Rudbeck erst mal durchdringen musste, und bis dahin würde Kim ihn hoffentlich längst freigelassen haben. Es war keineswegs schon vorbei.
Nachdem John es eine Viertelstunde lang probiert hatte, gab Kim auf. Er klappte den Laptop zu, setzte ein Käppi und eine Sonnenbrille auf, nahm seine Tasche und ging zum Check-in. Er stellte sich unmittelbar neben die Warteschlange, um die Gesichter zu scannen, während er so tat, als wäre er mit Martin Rudbecks Telefon beschäftigt. Weiter vorn in der Schlange wurde er fündig. Ein grauhaariger Mann schaute sich um, und Kim betrachtete sein Gesicht genauer. Er sah aus wie eine verlebte Version von Martin Rudbeck, aufgeschwemmt und noch schlaffer, beinahe leblose Augen. Kim wollte lieber nicht darüber nachdenken, was der Mann in Thailand vorhatte, aber für den Moment war er hilfreich.
Kim wartete, bis der Mann an einen Schalter herantrat, dann setzte er sich in Bewegung. In dem Moment, als der Mann seinen Pass auf den Tresen legte, knallte Kim Martin Rudbecks Pass obendrauf. »Sorry, ein Notfall! Mein Flug geht in zwanzig Minuten!«, keuchte er.
Die Frau hinter dem Tresen runzelte die Stirn. »Ihr Reiseziel?«
»Bangkok! Schnell!«
Die Frau sah in ihren Computer, und Kim tauschte unter seiner Hand die Pässe aus, während der Mann ihm auf die Schulter tippte und sagte: »Hey, was tun Sie da?«
Jetzt lächelte die Frau ihn an. »Ihr Flug geht in einer Stunde und zwanzig Minuten. Alle hier warten auf den, also stellen Sie sich bitte hinten an.«
»Oh, aha!«, sagte Kim und nahm den Pass des Mannes, um ihn vermeintlich in seine Reisetasche zu stecken. Dabei ließ er die Tasche von der Schulter rutschen und so auf den Boden fallen, dass sie neben dem Gepäck des Mannes landete. »Oje«, jammerte Kim und ging in die Hocke.
Der Mann ignorierte ihn und fuhr mit seinem beziehungsweise Martin Rudbecks Check-in fort. Kim bewegte sich zur Seite, um den Wartenden die Sicht auf das Gepäck des Mannes zu verdecken, und ließ Martin Rudbecks Handy in das Außenfach der fremden Reisetasche gleiten, bevor er sich wieder aufrichtete, noch mal »Oje« sagte und dem Schalter den Rücken kehrte.
Der Mann hatte wie ein geübter, oder vielleicht einfach nur blasierter Reisender gewirkt, der wahrscheinlich nicht zu den nervösen Typen gehörte, die ihren Boardingpass fünfmal kontrollierten, bevor sie durchs Gate gingen. Denn sonst würde ihm auffallen, dass darauf der falsche Name stand. Er könnte auch in der Passkontrolle hängen bleiben. Der Plan hatte seine Schwächen, aber Kim hatte getan, was ihm unter diesen Bedingungen möglich war.
Er sah sich um und stellte fest, dass zumindest der erste Teil funktioniert hatte. Der Mann verließ den Schalter mit einer Boardingkarte, die im Pass steckte, während seine Tasche auf dem Förderband verschwand, um nach Thailand transportiert zu werden. Doktor Martin Rudbeck war unterwegs in seinen wohlverdienten Urlaub.
8. Juli, nachmittags
So ungern Kim Ribbing es zugab, aber der Mann, der vor ihm auf der Pritsche lag, hatte einen wesentlichen Einfluss darauf gehabt, was für ein Mensch Kim geworden war.
Martin Rudbeck hatte die Behandlung mit Elektroschocks geleitet, die Kims Gehirn ein halbes Jahr lang in aufgeweichten Schneematsch verwandelte. Das war während der prägenden Phase geschehen, in der ein Mensch die Kindheit hinter sich ließ und in die Welt hinausging, um zu verstehen, wer er war. Zunächst hatten die Schocks Kims Dunkelheit aufgehellt und etwas Licht hineingelassen, aber als sie stärker wurden, brach eine andere Art von Dunkelheit über ihn herein, die von Hass erfüllt war. Das war die Person, die Martin Rudbeck geschaffen hatte.
Kim war in die Obhut des Arztes gekommen, nachdem er seine Eltern und seinen Großvater bei einer Bootstour in die Luft gesprengt hatte. Niemand wusste, dass er für ihren Tod verantwortlich war, aber seine daraus resultierenden Depressionen, die Apathie und Selbstverletzungen führten schließlich dazu, dass er für eine EKT-Behandlung – besser gesagt Folter – eingewiesen wurde.
Kim hasste den Mann, der vor ihm lag, so sehr, wie man nur jemanden hassen konnte, der einem die Sicht auf das Leben verdunkelt hatte. Wenn er das Böse in ihm verstehen konnte, würde er vielleicht auch sich selbst besser verstehen.
Es war bereits vierundzwanzig Stunden her, dass Kim in Arlanda einen Rudbeck-Avatar erschaffen hatte, und jetzt sagte der echte Arzt: »Die Leute werden nach mir suchen.«
»Erst mal nicht«, erwiderte Kim und zog einen Stuhl an die Pritsche. »Derzeit bist du in Thailand.«
Mithilfe der auf sein eigenes Handy kopierten Daten hatte Kim über Find my device Rudbecks Smartphone geortet und wusste, dass sein Manöver erfolgreich gewesen war. Das Telefon befand sich jetzt – natürlich – in Pattaya, dem Mekka der Kinderprostitution.
»Thailand?«, fragte Martin Rudbeck. »Was meinst …«
»Halt’s Maul«, unterbrach ihn Kim. »Das ist unwichtig. Aber dir sollte klar sein, dass du nicht gerettet wirst. Du kommst hier nur weg, wenn ich dich gehen lasse.«
»Warum tust du das?«
»Das sagte ich schon. Ich will verstehen, wie ein Mensch wie du tickt. Wir können mit dem Film anfangen, zu dem du dir einen runtergeholt hast. Wie kann es dich befriedigen, wenn du dir ansiehst, wie ein Kind gefoltert wird?«
»Ich habe es doch erklärt«, sagte Martin Rudbeck und wand sich auf der Pritsche. »Meine Arbeit …«
Kim unterbrach ihn mit einer Geste, hob dann das Holzgestell einer alten Tischlampe hoch, bei der er den Schirm entfernt und die Bakelitfassung für die Glühbirne zerstört hatte, sodass die beiden spitzen Pole offen lagen. Ein langes Kabel verlief von der Lampe bis zur Steckdose. Kim stand auf und drückte die Pole oberhalb des Nabels in den Bauch des Arztes. Rudbeck schrie auf, und sein Körper zuckte spastisch, als er versuchte, sich um den Schmerzpunkt zu krümmen. Die Lederriemen hinderten ihn daran.
»Ob du es mir glaubst oder nicht«, sagte Kim, »eigentlich will ich dich nicht quälen, aber wenn es erforderlich ist, werde ich nicht zögern, damit du meine Fragen ehrlich beantwortest. Also noch mal. Worin besteht die Befriedigung, sich anzusehen, wie zwei Männer sich an einem Kind vergehen?«
Martin Rudbeck stöhnte und wimmerte noch eine Weile, dann erschlaffte sein Körper. Er starrte auf die Leuchtstoffröhre an der Decke und sagte: »Das ist schwer zu erklären.«
Kim zeigte ihm den Lampenfuß. »Versuch’s«, forderte er ihn auf.
Rudbeck räusperte sich. Räusperte sich wieder. Schließlich sagte er: »Da ist dieses starke Licht in der Dunkelheit.«
»Philosophischer Bullshit«, sagte Kim und hob die Lampe.
»Warte«, sagte Rudbeck, während er vergeblich versuchte, seinen Bauch mit den Armen zu schützen. »Stell dir einen extremen Übergriff vor, etwa so wie … ja, wie in diesem Film. Da ist die Dunkelheit so groß, dass sie auch Licht ist. Alles, was auf eine Art extrem ist, besteht gleichzeitig auch aus dem Gegenpol.«
Kim ließ die Lampe sinken. »Du sagst Übergriff. Aber es handelt sich um die Folter von Kindern, und du geilst dich daran auf.«
»Es geht nicht um Geilheit, sondern eher um … Ekstase.«
»Du findest also, das Ganze hat auch eine religiöse Dimension?«
»Ja. So könnte man es sagen.«
Kim stand auf und ging ein paar Schritte durch den Raum. Er nahm ein Skalpell und testete die Schneide am Daumennagel, während Rudbeck ihn mit großen Augen ansah. Kim konnte mit ihm machen, was er wollte, und der Arzt wusste das. Er ließ das Skalpell scheppernd auf das Tablett fallen. »Du hast von Ekstase gesprochen. Nimm einmal diese christlichen Mystiker, die in einer Grotte in der Wüste lebten und Heuschrecken aßen. Glaubst du, die holten sich einen runter, als die Engel des Herrn sich ihnen offenbarten?«
»Ganz sicher«, antwortete der Arzt. »Auch wenn die Maler das natürlich so nicht dargestellt haben. Es gibt einen sexuellen Aspekt im Geistlichen, genauso wie es einen geistlichen Aspekt im Sexuellen gibt. Hast du nie erlebt, dass …«
»Halt’s Maul«, sagte Kim. »Wir sprechen nicht über mich. Und es macht mich wütend, dass du anfängst, das Ganze zu theoretisieren. Wie du vielleicht weißt, bin ich unberechenbar, wenn ich wütend werde.«
»Ja. Du bist krank, Kim.«
Kim trat auf Rudbeck zu und beugte sich über ihn. »Du hast jedes Recht verwirkt, jemanden als krank zu bezeichnen. Du geilst dich an einem Kind auf, das in Ketten hängt, während zwei Männer verschiedene Dinge in es …«
Zu seinem Erstaunen und Ekel stellte Kim fest, dass Martin Rudbecks Penis bei der erneuten Erwähnung des Kinderpornos ein wenig anschwoll. Daraufhin verpasste er Rudbeck einen längeren Elektroschock direkt unterhalb des Nabels. Der Arzt heulte auf, und die Schwellung ging zurück.
»Wag es nicht, dich hier aufzugeilen«, rief Kim. »Antworte auf meine Fragen. Was. Gibt. Es. Dir?«
»Das Gleiche wie den Männern«, keuchte Rudbeck, während ihm Schweiß auf die Stirn trat. »Das Gleiche. Das Unschuldige zu schänden«, sagte er und nickte heftig, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Das Reine zu besudeln. Es bringt Verzückung.«
»Hast du je Mädchen gegroomt?«
»Was?«
»Du weißt, was das Wort bedeutet. Hast du es je getan? Kleine Mädchen dazu gebracht, sich vor der Webcam auszuziehen?«
Als Martin Rudbecks Blick flackerte, holte Kim das Skalpell. Er ließ die Klinge über die Konturen von Martin Rudbecks Eichel fahren, die sich unter der Unterhose abzeichneten. »Vergiss nicht, dass ich deinen Computer habe. Ich werde all deine dreckigen kleinen Geheimnisse aufdecken, also denk gut nach, bevor du antwortest. Wenn du mich anlügst, bekommst du das hier zu spüren.« Kim tippte mit der Spitze des Skalpells auf das sensible Fleisch. »Es wäre ein Segen für die Welt, dich davon zu befreien.«
Der Arzt schrie auf, als die Spitze den Stoff durchdrang und sein Geschlecht berührte. Dann sagte er: »Ja.«
»Ja was?«
»Was du gefragt hast. Ich habe es getan.«
Kim verspürte den starken Drang, seine Androhung in die Tat umzusetzen. Er sah sich die Unterhose aufschneiden und mit einem raschen Schnitt die Welt zu einem besseren Ort machen. Lediglich das Risiko, dass der Arzt verblutete, hielt ihn davon ab. Vielleicht ließe die Wunde sich mit einem heißen Bügeleisen verschließen. Beim Gedanken daran meinte er beinahe, dass ihm der Geruch von verbranntem Fleisch in die Nase drang, und dunkler Wahnsinn drohte sich in seinem Kopf auszubreiten.
»Okay«, sagte er und nahm das Skalpell weg. »Deshalb hast du deinen Computer also so gut geschützt. Weil er … ja, was? … Bilder enthält? Filme von kleinen Mädchen, die …«
»Ja.«
»Du könntest mir das Passwort geben, dann sparen wir uns Zeit.«
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Nein. Ich werde dir das Passwort nicht geben.«
»Aber, mein Lieber«, sagte Kim übertrieben erstaunt. »Hast du immer noch nicht verstanden, in was für einer Situation du dich befindest?«
»Du kannst sagen, was du willst. Du bekommst es nicht.«
Kim rieb sich das Gesicht und senkte die Stimme um eine Oktave. »Lass dich nicht davon täuschen, dass ich in einem normalen Tonfall mit dir plaudere. Für mich bist du nur ein Haufen Scheiße, ein Sack stinkender Eingeweide mit Sprechvermögen. Du kannst mir überhaupt nichts verweigern.«
»Doch, das kann ich. Du warst schon als Junge krank, Kim, und ich weigere mich …«
Irgendetwas an dem Wort »Junge« triggerte Kim. Dieser Mann hier hatte verhindert, dass Kim überhaupt ein Junge sein durfte. Er hatte ihm seine frühe Jugend genommen, und das alles im Namen seiner sogenannten Forschung.
Kim drückte die Pole des Lampenständers herunter, bis sie durch den Stoff der Unterhose Kontakt mit Rudbecks Eichel hatten. Der Arzt schrie und zuckte wie ein Besessener auf; Tränen traten ihm in die Augen, während seine Schreie in ein schwaches Quäken übergingen. Nach etwa fünf Sekunden stieg Rauch vom Geschlecht des Arztes auf, während die Unterhose noch dunkler wurde und nun tatsächlich ein Geruch von verbranntem Fleisch in Kims Nase stieg. Martin Rudbecks zuckender Kopf fiel zur Seite, und er erbrach sich auf den Boden.
Etwas in Kim stachelte ihn an, den Strom einfach weiter durch den Körper des Arztes zu jagen, bis sein Penis nur noch ein verkohltes Stück Fleisch war. Zorn und Wahnsinn wirbelten durch seinen Kopf, und er hatte einen metallischen Geschmack im Mund. Nur die Tatsache, dass er Kontrollverluste hasste, verhalf ihm, sich zu beherrschen. Kim warf die Lampe zur Seite und drückte sich die Handballen in die Augen.
Ruhig. Du hast das im Griff. Du bist kein Kind mehr. Bleib ruhig.
Kim wartete, bis das Rauschen in seinen Ohren nachließ, und wurde nur von einem geflüsterten »Mein Gott, mein Gooottt …« unterbrochen.
»Gott hört dich nicht, Martin Rudbeck«, sagte Kim. »Und wenn er dich hören würde, würde er sicher in die Vuvuzela blasen und mich anfeuern. Du bist hier mit mir allein, also lass dir eins gesagt sein: Ich werde dir weiter Schocks verabreichen, bis du dieses Passwort ausspuckst. Also nur zu, denn das ist nichts im Vergleich zu dem, was du mir angetan hast.«
Der Arzt räusperte sich und spuckte einen grünlichen Klumpen in das Erbrochene auf dem Boden, bevor er Kim mit zittriger Stimme eine lange, komplizierte Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern nannte, einen Code, für den Kim wahrscheinlich Wochen gebraucht hätte. Er prägte ihn sich sofort ein.
»Gut«, sagte er. »Und merk dir’s endlich: Das Wort ›Nein‹ bedeutet Schmerzen. Verstanden?«
Der Arzt nickte matt. »Ich dachte, wir würden über … über dich sprechen«, sagte er unter Schmerzen. Über deine … Erfahrungen, als ich … dich behandelt habe.«
Kim schnaubte. »Behandelt? Du hast mich nie behandelt. Nicht mehr, als ich dich jetzt behandle. Aber irgendwann werden wir auch darüber sprechen. Wir haben genügend Zeit, keine Sorge.« Kim ging zur Tür und zog sie mit einem metallischen Rasseln auf. »Jetzt lasse ich dich mit deinen ekelhaften Gedanken in Ruhe. Vielleicht fallen dir fürs nächste Mal ein paar weniger theoretische Erklärungen ein. Sonst könnte es passieren, dass ich wieder wütend werde.«
»Kann … kann ich was zu essen bekommen?«
Kim wies auf die Pfütze Erbrochenes auf dem Boden. »Vielleicht findest du noch ein paar Brocken. Ach nein, du bist ja angeschnallt. Nicht gerade angenehm, oder? Stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn man dreizehn ist.«
Kim schaltete das Licht aus, und der Raum wurde schwarz. Dann zog er die Tür zu und verriegelte sie.
8. Juli, nachmittags
Astrid Helander saß im Bus Nummer 69 in Richtung Zentrum, nachdem sie Kim Ribbing besucht und er ihr ein Zimmer in seinem großen Haus angeboten hatte. Sie trug immer noch das schwarze Tüllkleid von der Beerdigung ihrer Eltern am Vormittag, und in ihrem Inneren tobten widersprüchliche Emotionen.
Einerseits war die Beerdigung schrecklich gewesen. Auch wenn Astrid und ihre Eltern in den letzten Jahren häufig Meinungsverschiedenheiten gehabt hatten, war es doch furchtbar, dass die Menschen, mit denen sie aufgewachsen war, auf zwei Objekte in Holzkisten reduziert wurden, die verbrannt werden sollten. Als Astrid die Kapelle des Friedhofs Skogskyrkogården betrat und die Särge sah, klingelte es in ihren Ohren, als stünde sie in tiefem Wasser, und das Klingeln war während der gesamten Trauerfeier nicht verstummt.
Erst als man zum Sarg vortreten sollte und Astrid den Anfang machte, wurde der Ton schwächer. Die Beerdigung war gut besucht, und von den Bänken drang lautes Schluchzen über das Schicksal der armen Waise, die vor den Särgen mit den von Kugeln zerfetzten Leichen ihrer Mutter und ihres Vaters stand. Die Särge waren geschlossen, aber Astrid wusste nur zu gut, wie die Körper darin aussahen, denn sie war an jenem Tag dabei gewesen und dem Tod nur um Haaresbreite entkommen.
Das Schniefen und Schluchzen in der Kapelle wurde lauter, als Astrid je eine Rose auf die Särge legte. Sie selbst weinte nicht. Sie sah sich von außen und begriff, dass ein vierzehnjähriges Mädchen, das sich für immer von ihren Eltern verabschieden musste, so ziemlich das Traurigste war, das man sich vorstellen konnte. Auch wenn sie spürte, dass der Druck nachließ und sie langsam wieder an die Oberfläche kam.
Vielleicht erlebte sie, was in der Psychologie Need for closure genannt wurde. Seit der Schießerei vor zwei Wochen war der Tod ihrer Eltern für Astrid abstrakt gewesen, eine Art Nebel, der sie umgab, und kein abgeschlossenes Ereignis. Bei ihrem Onkel fühlte sie sich nicht wohl, und ihr ganzes Leben glich einem Provisorium, während sie auf etwas anderes wartete. Die beiden Särge und die Rosen hatten etwas Endgültiges, ein Bild, das Astrid in sich einschließen, an das sie sich klammern konnte.
Während der Tage nach dem Mord an ihren Eltern waren eigentlich nur zwei Dinge durch den Nebel gedrungen, und beide hatten mit Kim Ribbing zu tun. Zum einen der Moment, als Kim Astrid aus dem Krankenhaus Vamlinge geholt und mit ihr auf dem Motorrad davongefahren war. Da hatte sie wieder so etwas wie Lebendigkeit gespürt. Und dann das Angebot eines eigenen Zimmers in Kims Haus, eine Freistatt vom Provisorium.
Deshalb diese widerstreitenden Gefühle, als Astrid im Bus saß. Sie war immer noch sprachlos und niedergeschlagen nach der Beerdigung, von der sie geflohen war, als die Beileidsbekundungen sie zu überwältigen drohten. Auf der anderen Seite stimmte sie die Aussicht, mit Kim zusammenzuwohnen, leicht und hoffnungsfroh. Sie bewunderte ihn und war ein bisschen in ihn verliebt, auch wenn Kim fand, dass sie das besser nicht sein sollte.
Am Kungsträdgården stieg Astrid aus dem Bus und ging in Richtung Strandvägen. Eines der Probleme beim Zusammenleben mit ihrem Onkel bestand darin, dass er ihr nicht richtig vertraute. Seit Astrids zwölftem Lebensjahr durfte sie selbst über ihr Kindergeld verfügen, aber damit war jetzt Schluss.
Statt wie bisher tausendzweihundertfünfzig Kronen im Monat zur freien Verfügung zu haben, hing es jetzt vom Wohlwollen des Onkels ab, ob Astrid überhaupt Geld bekam. Derzeit besaß sie zweiundneunzig Kronen. Sie war Erbin eines wer weiß wie viele Millionen umfassenden Vermögens, einer ganzen Schäreninsel mit Architektenhaus, einer Sechszimmerwohnung am Strandvägen und eines Teslas. Unter anderem. Aber darauf zugreifen konnte sie erst mit achtzehn. Momentan waren es nicht mehr als zweiundneunzig Kronen.
Astrid Helander besaß zwei Superkräfte: Sie konnte die Luft anhalten, bis sie ohnmächtig wurde, was sie manchmal einsetzte, um ihren Panikattacken zu entkommen, die sie hin und wieder überfielen. Die andere Superkraft war die Fähigkeit, gezielt zu stürzen. Sie hatte lange trainiert und konnte einfach so hinfallen oder sogar eine Treppe herunterpoltern, ohne sich sonderlich stark zu verletzen. Das war cool, wenn man die anderen in der Klasse erschrecken wollte, und sehr nützlich in einer Situation wie der, die Astrid jetzt herbeiführen wollte.
In ihrem schwarzen Kleid fühlte sich Astrid wie ein Pechvogel, als sie durch den Kungsträdgården ging, wo Menschen in leichter, sommerlicher Kleidung Eis aßen oder in der Sonne auf Rollerblades herumfuhren. Ihr Beerdigungsgefühl machte die Sache nicht besser. Sie war die Dunkelheit im Licht.
Als Astrid auf die Hamngatan kam, bog sie nach links ab und ging zum Gallerian. In dem überhaupt nicht atmungsaktiven Kleid lief ihr der Schweiß den Rücken hinab, und es war schön, in das klimatisierte Shoppingzentrum zu kommen, wo sie zielstrebig auf die Clas-Ohlson-Filiale zusteuerte. Dort würde sie finden, was sie suchte, schließlich bekam man dort alles, was man brauchte – und nicht brauchte.
In der Brillenabteilung entschied sie sich unter den Gestellen, die neunundachtzig Kronen kosteten, für das Modell, das den niedrigsten Dioptrienwert hatte und am teuersten aussah. Mit zwölf hatte sie es eine Weile mal mit Klauen versucht, aber weil es ihr irgendwann keinen Kick mehr verschaffte und sie kurz danach ihr Kindergeld bekam, hatte sie damit aufgehört.
Jetzt sah die Situation anders aus, und es wäre ein Leichtes gewesen, die Brille in ihren Ausschnitt rutschen zu lassen und zwischen ihren Brüsten zu verbergen. Aber sie fand, das war das Risiko nicht wert. Wenn alles lief wie geplant, wären ihre finanziellen Sorgen ohnehin bald Geschichte.
Astrid bezahlte die Brille und fand eine verborgene Ecke zwischen zwei Geschäften. Sie hob die Brille hoch über den Kopf und ließ sie auf den Steinboden fallen. Ein Glas zersprang. Sie wiederholte die Prozedur, bis auf dem anderen Glas ebenfalls Risse zu sehen waren, dann steckte sie die Brille in die Tasche, in der sich auch ihr Handy befand, verließ das Einkaufszentrum und überquerte die Straße.
Nur fünfzig Meter weiter lag der Haupteingang des Kaufhauses Nordiska Kompaniet. Astrid durchquerte das Erdgeschoss und nahm die Rolltreppe hinunter in die Markthalle des NK, oder auch den Gastronomie-Hub, wie NK es nannte. Dann ging sie auf die Jagd.
Sie schlenderte zwischen den Regalen und Theken umher, die mit Köstlichkeiten aus aller Welt vollgestopft waren, und zwar in einer Fülle, die jeden vernünftigen Menschen zum Würgen bringen konnte. In solchen Fällen war Astrid ein vernünftiger Mensch. Von kleinen Kekstüten für mehr als hundert Kronen und zweihundert verschiedenen Käsesorten aus der Manufaktur zu Mondpreisen wurde ihr leicht übel. Bedachte man die Lage der Welt, war die Abteilung geradezu ekelerregend.