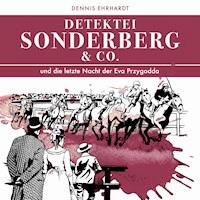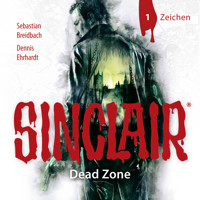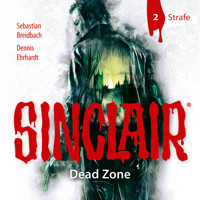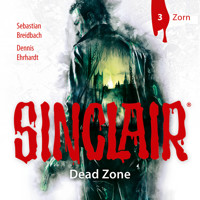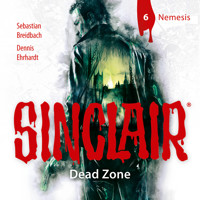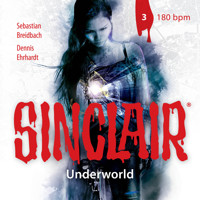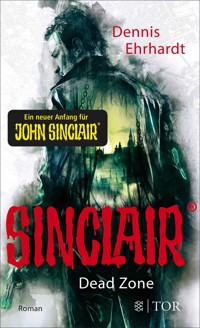
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sinclair
- Sprache: Deutsch
Die Wiedergeburt einer Kultfigur: John Sinclair ist zurück – zeitgenössischer, unheimlicher und düsterer als je zuvor. »Sinclair - Dead Zone« erzählt die Geschichte des berühmten Geisterjägers noch einmal völlig neu und von Anfang an. An einem abgelegenen Kai explodiert die Baltimore. Eines der Opfer an Bord: Detective Inspector John Sinclair, der zum Zeitpunkt des Unglücks in einem Serienkiller-Fall ermittelte. Sinclairs Tod wirft Fragen auf: Befand sich der Killer ebenfalls an Bord? Was hat Sinclair auf der Baltimore entdeckt? Sinclairs Partner Detective Sergeant Gan Zuko führt die Ermittlungen fort, zusammen mit Sinclairs Nachfolgerin Shao Sadako. Bald häufen sich die Widersprüche, und die Grenzen der Realität scheinen zu verwischen. Umso mehr, als den beiden bald klar wird, dass John Sinclair doch noch lebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dennis Ehrhardt | Sebastian Breidbach
Sinclair - Dead Zone
Roman
Über dieses Buch
Ein geheimnisvolles Artefakt auf dem Meeresgrund.
Eine rätselhafte Mordserie. Die Opfer sind bestialisch entstellt.
Eine uralte Macht, die nicht von dieser Welt zu sein scheint.
Und ein Mann, der im Kampf gegen das Böse seine Berufung findet: John Sinclair.
»Sinclair – Dead Zone« ist der Auftakt einer Serie und erzählt die Entstehungsgeschichte des Geisterjägers – völlig neu und von Anfang an. Noch nie war Sinclair zeitgenössischer, unheimlicher und düsterer.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Dennis Ehrhardt ist Verleger, Hörspielschaffender und Autor. Er schrieb die Krimi-Reihe »Sonderberg & Co.« und produzierte für Universal Music die Hörspielserien »Dorian Hunter« und »Die Elfen«. Für die John-Sinclair-Hörspiele von Lübbe Audio zeichnet er als Skriptautor und Regisseur verantwortlich.
Sebastian Breidbach ist Tontechniker und Sounddesigner. Neben zahlreichen Hörspiel-Vertongen wie »Star Wars – The Clone Wars« und »Die Elfen« kümmert er sich seit Jahren um die akustische Gestaltung der John-Sinclair-Hörspiele. Zusammen mit Dennies Ehrhardt entwickelt er die Geschichte von »Sinclair«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
»Die alte Welt liegt im Sterben,
die neue ist noch nicht geboren.
Es ist die Zeit der Monster.«
Antonio Gramsci
Teil EinsZeichen
Mein Name ist John Sinclair. Ich bin Detective Inspector des Metropolitan Police Service und Teil des Criminal Investigation Department auf dem Revier Forest Gate im Londoner Stadtteil Newham. Irgendwelche Schlipsträger haben unseren Bezirk vor einem Jahr mit den Nachtwächtern aus Waltham Forest zu einer Basic Command Unit zusammengelegt, aber unser Revier auf der Straße ist immer noch das gleiche: Auf der Landkarte sieht Newham aus wie ein betrunkenes Quadrat, das nach links wegzurutschen droht. Es reicht vom neuen Olympiagelände in Stratford bis runter zu den Beckton-Klärwerken am River Roding sowie von den Ganglands in Westham und Canning Town bis zur North Circular an der Grenze von Ilford.
In Newham arbeiten insgesamt 802 Beamte auf sieben Revieren, ein großer Teil davon bei uns auf dem Forest Gate. Unsere Unterabteilung des CID, zuständig für Mordermittlung, bestand bis vor kurzem aus fünfzig Leuten. Wenn man allerdings die Schreibtisch- und Hilfskräfte sowie die Sonderfahnder abzieht, blieben davon nur sechs, einschließlich meines Partners Detective Sergeant Zuko Gan und unseres Leiters Detective Superintendent James Powell. Es war eine kleine Einheit, aber ich würde mal behaupten, wir haben ganz gute Arbeit geleistet in einem der schwierigsten Distrikte von London.
Ich weiß, was Sie von mir wissen wollen.
Aber die Wahrheit ist: Ich habe keine Ahnung, wieso nur drei von uns überlebt haben.
1
11. Dezember 2018, 21.08 Uhr, 23 Seemeilen vor der portugiesischen Küste
Die Wasseroberfläche funkelte wie Diamanten, die man auf schwarzen Samt gebettet hatte.
Dr. Rachel Briscoe lehnte mit dem Rücken an der Reling des Ungetüms, bei dem es sich, wie sie im Laufe der Reise erfahren hatte, um einen LASH-Carrier handelte. Rachel konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Ein Schiff war für sie ein Schiff, und das, auf dem sie sich gerade befand, war mit seinen über 250 Yards Rumpflänge beängstigend groß und besaß neben einem Hubschrauberlandeplatz sogar einen beweglichen Portalkran. Die beiden Laufschienen des Krans ragten rechts und links fast 30 Yards über das Heck hinaus – wie die Hauer eines monströsen Wildschweins.
Fröstelnd rieb sie die Hände aneinander und strich eine blonde Haarsträhne nach hinten, die ihr der Regen auf die Stirn geklebt hatte. Vorhin, als sie ihre Kabine verlassen hatte, waren es drei Grad Außentemperatur gewesen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent, wie das Hygrometer anzeigte. Der andauernde feine Sprühregen bildete Schlieren auf Rachels Brillengläsern, was sie an Deck fast blind machte. Dazu der auffrischende Wind aus süd-südwestlicher Richtung: Laut Cartwright sollte noch vor Anbruch der Morgendämmerung ein Tief die See bürsten, gegen das der sprichwörtliche Azorenwinter mit seinen Stürmen ein laues Lüftchen war. Aber Cartwright war ein narzisstisches Arschloch, das auch einen Sommerwind zum Hurrikan hochgejazzt hätte, um seine Umgebung zu beeindrucken.
Und das alles für einen Forschungsauftrag, dessen Sinnhaftigkeit sich weder ihr noch irgendeinem anderen Mitarbeiter des Ägyptischen Instituts der University of London erschlossen hatte. Da der Dekan Prof. Allan Spencer sie allerdings förmlich angefleht hatte, die Reise mitzumachen, konnte sie nur vermuten, dass dahinter ein großer privater Spender steckte, der für die Arbeit des Instituts wichtig war. Wozu da noch nach dem Sinn der Expedition fragen? Man hatte sie nach Southampton verfrachtet, zusammen mit zwei anderen Kollegen, die ihr mysteriöser Geldgeber offenbar wie Äpfel von den verschiedensten Forschungsinstituten der Welt gepflückt und an Bord des LASH-Carriers verfrachtet hatte. Vor fünf Tagen waren sie ausgelaufen, und seit vorgestern schipperten sie nun 100 Seemeilen südwestlich von Lissabon auf stets derselben Position liegend gegen die südwärts driftenden Wassermassen des Portugalstroms an.
Da Rachel auf ihre Fragen grundsätzlich keine zufriedenstellende Antwort bekam, hatte sie beschlossen, die Rolle der stillen, nur mäßig interessierten Beobachterin zu spielen.
Vor acht Stunden war das Tauchboot zu Wasser gelassen worden – zum zweiten Mal. Es verfügte über einen Bergungsroboter, mit dem sich angeblich tonnenschwere Güter vom Meeresgrund heraufbefördern ließen. Sagte Cartwright. Seitdem spekulierte er mit seinen beiden Kollegen in der Bordkantine bei Venusmuscheln und Weißburgunder über einen großen Schatz, der zu heben sei. Rachel sah keinen Anlass, sich an den Spekulationen zu beteiligen. Zumal sie nicht erkennen konnte, wie sie in einem Gespräch mit einem Mediziner und Mathematiker, einem Meeresforscher und einem Geologen mit ihrem eigenen Fachwissen punkten sollte. Sie war Archäologin, verflixt nochmal, Spezialgebiet frühe vorderasiatische Kulturen, und für die naturwissenschaftlichen Machos am Tisch damit wahrscheinlich so etwas wie eine etwas besser bezahlte Bibliothekarin. Wobei selbst das »besser bezahlt« fraglich war.
So vertrieb sie sich die Zeit damit, auf ihrer Kabine zu lesen oder mit Nevison zu skypen, wofür sie ihr privates Handy benutzte, obwohl man sie dringend gebeten hatte, für die Dauer der Exkursion von privaten Gesprächen abzusehen. Natürlich war ihr klar, dass jedes Einloggen ins Netzwerk gespeichert wurde, aber wenigstens befanden sich anschließend nicht irgendwelche Chat- oder Videoprotokolle auf dem Dienstlaptop, den man ihr zur Verfügung gestellt hatte. Es ging schließlich verdammt nochmal niemanden was an, ob sie beide im Januar zum fünften und vermutlich letzten Mal in vitro versuchen oder sich zu einer Adoption durchringen würden. Sie wurde in einem halben Jahr vierzig, da hieß es, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Und zur Not blieb ihnen ja auch immer der Weg über eine Leihmutterschaft, die zum Beispiel in den USA …
»Da! Verdammt, das ist sie!«
Rachel blinzelte.
Cartwright natürlich. Sie hatte sich seinen Namen überhaupt nur gemerkt, weil er während der Gespräche am Nebentisch wiederholt betont hatte, sowohl seinen Doktorgrad in Mathematischer Statistik als auch den in Genommedizin mit summa cum laude in Cambridge abgeschlossen zu haben.
Jetzt bemerkte auch Rachel den Lichtschein in der Tiefe, der stetig heller wurde.
Es war Abby, die zu ihnen zurückkehrte.
Die Idee, das Tauchboot so zu nennen, wäre auch dann infantil gewesen, wenn sie nicht von Cartwright gestammt hätte. »Abby … von Abyss, verstehen Sie, Dr. Briscoe?«
Auf einmal aber verspürte auch Rachel die ansteigende Spannung, so dass sie das Flappen der Rotoren erst wahrnahm, als der Hubschrauber den Carrier fast erreicht hatte.
Er näherte sich aus nördlicher Richtung, und wer auch immer darin hockte, besaß ein perfektes Gefühl für Timing, denn die Kufen berührten die Landeplattform im selben Moment, in dem Abbys Rumpf die Wasseroberfläche durchbrach. Ein schlanker Mann in Regenkutte verließ das Cockpit und wurde sofort von einer Security-Meute umringt.
War das ihr geheimnisvoller Auftraggeber?
Rachel polierte ihre Brillengläser und versuchte, unter der Kapuze des beigefarbenen Regencapes die Konturen eines Gesichts zu erkennen. Nichts zu machen.
Mr Geheimnisvoll blieb oben auf der Plattform stehen und verfolgte, wie das Tauchboot zwischen den Wildschweinhauern aus dem Wasser gehoben wurde. Der Portalkran fuhr zurück, bis er genau über Abby positioniert war. Wenige Minuten später schwebte das Tauchboot über ihre Köpfe hinweg und setzte auf den fahl beleuchteten Stahlplanken des Carriers auf.
Mr Geheimnisvoll nickte einem seiner Begleiter zu. Worte wurden gewechselt und Befehle an die Besatzung und den technischen Stab weitergegeben.
Dann öffnete sich die Schleuse des Tauchboots. Cartwright reckte den Hals. Seine beiden Kollegen versuchten, näher heranzukommen, wurden aber von den Security-Typen abgeblockt, die sich in der Zwischenzeit an Bord verteilt hatten.
Mr Geheimnisvoll stieg von der Plattform herab wie einst Moses vom Berg Sinai und verschwand, flankiert von zwei Bodyguards, im Innern von Abby.
Dann passierte eine weitere Viertelstunde lang nichts. Unter den Wissenschaftlern machte sich Unruhe breit. Jemand forderte Aufklärung. Cartwright schlichtete wortreich, vermutlich um den Eindruck zu erwecken, dass er über mehr Informationen verfügte als alle anderen.
Bullshit, dachte Rachel.
Endlich kam jemand wieder heraus. Es war nicht der Mann im Regencape, sondern einer seiner breitschultrigen Begleiter. Er ließ den Blick über das Deck schweifen, als suche er jemanden.
Und nickte Rachel zu.
Sie blickte über ihre Schulter, nur sicherheitshalber, aber da war niemand mehr. Nur das offene Meer.
Verfolgt von Cartwrights missgünstigen Blicken, näherte sie sich Abby.
»Dr. Briscoe?« Es war keine Frage. »Mr Scott erwartet Sie bereits. Folgen Sie mir.«
Die Schleusenkammer des Tauchboots war von innen größer, als sie vermutet hatte. Salz- und Kondenswasser tropften von der Stahldecke auf das Bodengitter, das hinter der zweiten Schleuse in eine Art Frachtraum führte.
Weiter im Inneren stand der ominöse Mr Scott. Er hatte die Kapuze zurückgeschlagen, und Rachel erkannte ein scharfgezeichnetes Gesicht. Markantes Kinn, die Nase vielleicht etwas zu spitz. Die Wangen leicht eingefallen. Er besaß den Blick eines Mannes, der es gewohnt war, sich und anderen etwas abzuverlangen. Gelassen stand er vor dem Ding, das Abby aus der Tiefe geholt hatte, und blickte auf ein Tablet in seiner Hand, mit dem er offenbar gerade einige Fotos gemacht hatte.
Es war ein Stein.
Ein nachtschwarzer und auf den ersten Blick fugenlos glatter Stein, der glänzte wie Obsidian. Er hatte die Form eines Würfels mit einer Kantenlänge von mindestens sieben Yards, und seine Oberfläche schien sich ständig zu verändern, zu bewegen und ineinanderzulaufen wie … Nebelschleier?
Die Stahlstreben, auf denen er ruhte, ächzten unter dem Gewicht.
Das Ding muss Tonnen wiegen!
Tausend Fragen schossen Rachel durch den Kopf. Wie war es einer so zarten Konstruktion wie Abby gelungen, dieses Riesenteil vom Meeresgrund zu bergen? Und wer hatte es dort verklappt? Und woher wusste ihr Auftraggeber, dass sich das Ding genau an dieser Stelle befunden hatte?
»Kommen Sie ruhig näher, Dr. Briscoe.«
Sie folgte der Aufforderung, während der breitschultrige Begleiter zurückwich.
»Randolph Scott. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Möchten Sie?«
Sie begriff erst nicht, was er meinte, bis ihr Blick auf das Brillenputztuch in seiner Hand fiel.
Mechanisch griff sie zu. »Danke.«
»Ich bin froh, dass Sie hier sind.« Der warme, sonore Klang seiner Stimme umhüllte sie wie ein schützender Kokon, während sie mit zitternden Fingern ihre Gläser säuberte. »Sie ahnen gar nicht, wie wichtig es mir war, dass Sie an dieser Reise teilnehmen. Schließlich ist die Deutung der Schriftzeichen von entscheidender Bedeutung für den Erfolg unserer Expedition.«
Wovon zum Teufel redete er? Als sie merkte, dass sie immer noch ihre Gläser rieb, faltete sie das Tuch verlegen zusammen und setzte sich die Brille wieder auf.
Und auf einmal waren die Nebelschleier verschwunden, und sie erkannte die Strukturen auf der Oberfläche des Würfels. Es waren … Zeichen. Auf den ersten Blick erkannte Rachel Formen, die an das griechische Alphabet erinnerten, und wiederum andere, die eher Bildsymbolen glichen und eine entfernte Ähnlichkeit mit altägyptischen Hieroglyphen aufwiesen. Tatsächlich aber war es keins von beiden, sondern … eine Mischung?
»Das ist …«
»Überraschend? Erstaunlich?«
Sie nickte. Nein, eigentlich ist es absurd. Vollkommen absurd!
Jemand musste sich einen Scherz erlaubt haben, als er dieses Ungetüm auf dem Meeresgrund versenkt hatte. Gleichzeitig schienen die Zeichen, die nicht existieren durften, Rachel geradezu magisch anzuziehen. Sie merkte nicht einmal, wie sie die Hand ausstreckte und …
»Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun.«
Rachel zuckte zurück. Sie fühlte sich wie eine Zehnjährige, die mit der Hand in der Keksdose erwischt worden war.
»Es gibt Hinweise darauf, dass der körperliche Kontakt gefährlich ist.«
»Ich verstehe.«
Was gelogen war, denn sie verstand überhaupt nichts. Vor allem nicht, was in dem Moment geschehen war, in dem sie dem Würfel zu nahe gekommen war. Ein eigenartiges Gefühl hatte sie durchströmt, als ob seine unmittelbare Nähe etwas in ihr … ausgelöst hätte.
Erkenntnis?
Schmerz?
Die Worte beschrieben nicht einmal annähernd, was sie empfunden hatte.
»Wissen Sie, woraus er besteht, Sir?«
Scott schüttelte den Kopf. »Im Augenblick wissen wir noch überhaupt nichts. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern – mit Ihrer Hilfe, Dr. Briscoe.«
Ein schaler Geschmack in ihrem Mund. Natürlich wusste er etwas. Zum Beispiel, wo genau sich der Würfel am Meeresgrund befunden hatte. Und wie er ihn hatte bergen können. Die Erkenntnis, dass man ihr wichtige Informationen vorenthielt, war beunruhigend – und gleichzeitig wäre sie vor Scott auf die Knie gefallen, um die Zeichen auf dem Würfel untersuchen zu dürfen.
»Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Sie finden mich auf der Brücke. Ich erwarte einen ersten Bericht in drei Stunden.«
Rachel wollte etwas erwidern, aber da spürte sie bereits, wie seine Schritte das Bodengitter zum Schwingen brachten. Sie blieb allein zurück. Ihr Atem kondensierte zu weißen Schleiern, die die Oberfläche des Würfels zu umschmeicheln schienen. Es gab keine Stelle, die nicht von Zeichen übersät war. Je länger Rachel sie betrachtete, desto unsinniger wirkte der Vergleich mit dem griechischen Alphabet. Diese Symbole, die zusammen mit den Schleiern vor ihren Augen zu tanzen schienen, waren ungleich vielfältiger und komplexer. Wahrscheinlich handelte es sich gar nicht um Buchstaben im eigentlichen Sinne, sondern um eine Art logographische Zeichen, was bedeutete, das Scott eher eine Linguistin als eine Archäologin hätte zu Rate ziehen sollen.
Oder noch besser: eine Spezialistin für okkulten Schwachsinn.
Draußen vor dem Eingang erkannte sie den Schatten des Bodyguards, der sie hereingerufen hatte. Er wandte ihr den Rücken zu und sollte offenbar dafür sorgen, dass niemand außer Rachel das Innere von Abby betrat. Sie zückte das Handy, schaltete es stumm und überprüfte, dass auch der Blitz deaktiviert war. Sie fotografierte die gesamte Oberfläche, wobei sie einige Stellen näher heranzoomte, um jedes Detail der Schriftzeichen zu erfassen. Langsam ging sie um den Würfel herum. Auf der Rückseite existierte nur ein schmaler Spalt zwischen der Oberfläche des Würfels und der Rückwand von Abby. Rachel schob die Hand hinein, auch wenn es wahrscheinlich zu dunkel war, um brauchbare Bilder zu schießen. Als sie die Hand zurückzog, streifte sie die Würfelkante – und spürte, wie ein Schauer durch ihre Brust jagte.
Die Oberfläche war wärmer, als sie erwartet hatte … und sie schien minimal zu vibrieren, als wäre das unheimliche Ding von einer Art Leben erfüllt.
Rachel konnte nicht widerstehen und strich mit den Fingerkuppen über die Symbole. Veränderten sie sich wirklich, oder war der merkwürdig verschwommene Eindruck nur … Einbildung? Eines der Zeichen bestand aus einem liegenden Rechteck, an dessen schmalen Enden jeweils zwei gekrümmte Striche ansetzten, die Rachel an Fühler eines Insekts erinnerten. Allerdings hätte das Tier dann zwei Köpfe haben müssen: Die Seiten des Symbols waren spiegelverkehrt vollkommen symmetrisch. Sie hatte so etwas schon mal gesehen – als Zeichen der ägyptischen Göttin Neith, die …
Die Bilder brachen über Rachel herein wie ein Gewitter. Aus der schwarzen Oberfläche vor ihr wurde Finsternis und schließlich die endlose Tiefe eines … Stollens? Aus der Dunkelheit kam ein grellweißes Licht, das wie eine Kette von Glühwürmchen auf sie zuraste. Und dazwischen: ein monströses, schwarzes Ding, das sich über die Kette bewegte … auf ein Gesicht zu. Ein Mädchen. Brünett, die Augen vor Schreck geweitet. Schreie. Blut. Fleisch. Und wieder Dunkelheit. Dann ein zweites Bild. Ein Schild, das wie von einem Spot aus der Dunkelheit gerissen wurde. Zwei Worte standen darauf.
»THE STR…«
Rachel spürte noch, wie ihre Knie nachgaben. Sie knallte mit dem Hinterkopf auf. Jemand schrie etwas. Das Bodengitter vibrierte, als der Kerl von der Security näher kam.
Das Handy! Steck es weg!
Sie wusste nicht, ob es ihr gelang, denn im nächsten Augenblick war der Mann über ihr. Kurz darauf die Stimme von Randolph Scott, der einen zweiten Mann aufforderte, sofort einen Arzt zu holen.
Sie öffnete den Mund.
Wir dürfen den Würfel nicht mitnehmen.
Aber sie war zu schwach.
Und verlor das Bewusstsein.
2
Es war reiner Zufall, dass es Ramon Diaz zuerst erwischte.
Eigentlich hätte ein Geschichtsstudent namens Flynt die Wochenendschicht übernehmen sollen, aber der hatte sich neun Tage vor Weihnachten wegen »unbestimmter Gliederschmerzen« eine zweiwöchige Krankschreibung organisiert.
Schönen Dank auch, Arschloch.
Wobei Ramons Pechsträhne eigentlich schon vor zehn Jahren begonnen hatte, kurz nach dem Richtfest des Hotels Plaza del Mar.
Hotel Plaza del Mar in Torre del Mar, das klang nach einem guten Plan, leicht zu merken. Aber dann war die Finanzkrise über Andalusien hinweggefegt und hatte die neugeplanten Bettenburgen in eine Perlenkette von Bauruinen verwandelt. Ein Hotel, in dem keine Stromkabel mehr verlegt wurden, brauchte auch keinen Elektriker mehr, das war irgendwie einleuchtend.
Nach einem kurzen Intermezzo bei einem Lebensmittelhändler in Torremolinos westlich von Málaga hatte es Ramon schließlich nach London verschlagen, zu Onkel Pablo, der ständig Aushilfskräfte für sein Restaurant suchte. Plaza del Mar, da könne er doch kellnern, oder?
Sechs Tage Knochenarbeit pro Woche inklusive Rückenschmerzen und einem Lohn, von dem er monatlich 100 Euro an seine Eltern schickte. Auf der anderen Seite Onkel Pablo, der drei von vier Gerichten an der Kasse vorbei abrechnete und Stammgäste im Hinterzimmer Black Jack spielen ließ. Vor seinen Angestellten brüstete er sich ein paarmal zu oft mit seiner Art der Gewinnoptimierung, bis die Steuerfahndung die Akten kartonweise aus dem Büro schleppte.
Beim nächsten Job war die Bezahlung noch schlechter. »My Name is Rose« war ein heruntergekommener Blumenladen in der Nähe der Fleet Street, dessen Besitzerin sich einen aufopfernden Kampf gegen Ketten wie »Wild at Heart« und »Isle Of Flowers« lieferte. Im Vergleich zur Arbeit bei Pablo war der neue Job allerdings easy-peasy. Er arbeitete nur halbtags und musste nichts anderes tun, als Sträuße mit Grußkarten vor den Wohnungstüren irgendwelcher Business-Ladys aus der City abzulegen.
Zum Beispiel bei der zierlichen Schwarzhaarigen, die über der Strand Station nahe Surrey Street wohnte, in dem Wohnhaus, das nach der Schließung der U-Bahn-Station auf das zweigeschossige Stationshaus aufgesetzt worden war.
Name: Karen Cross.
Dreimal hatte er schon vor ihrer Tür im fünften Stock gestanden, für drei verschiedene Verehrer. Normalerweise las er sich nie die Grußkarten durch, Hand aufs Herz, aber nur beim ersten Mal hatte sie die Tür geöffnet und ihm ein Lächeln geschenkt, das eine Monatsration Oxytocin in ihm freigesetzt hatte. Wahrscheinlich war sie psychisch krank oder vorbestraft. Konnte es einen anderen Grund dafür geben, dass diese Frau Ende zwanzig noch Single war?
Als er heute ihren Namen auf einem der Umschläge gelesen hatte, war es wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gewesen, und er hatte sich ihren Strauß bis zum Schluss aufgehoben. Die Karte war ein Vordruck von HSBC und der Absender anscheinend Karens Boss, ein gewisser Vielen-Dank-für-die-angenehme-Zusammenarbeit-in-diesem-Jahr-Brian.
Ramon drückte auf den Fahrstuhlknopf.
Der Lift gehörte eigentlich zur U-Bahn-Station und war im Zuge der Renovierung wieder instand gesetzt worden. Er besaß eine riesige Kabine mit Holztüren und Sicherheitsgitter, das Ramon ratternd zuschob. Es gab sogar eine Sitzbank. Der Fahrstuhlkorb setzte sich in Bewegung.
Nach unten.
Da war wohl jemand im Keller schneller gewesen.
Ramon drückte noch mal auf die Taste und lugte durch einen Schlitz in der Papierverpackung. Die Rosen wirkten ziemlich vertrocknet. Ramon verspürte auf einmal einen pelzigen Geschmack auf der Zunge. Wann hatte er heute eigentlich zum letzten Mal was getrunken?
Der Fahrstuhl hielt auch nicht im Keller.
Es dauerte einen Moment, bis Ramon den Geruch bemerkte. Fäulnis und Schimmel, vielleicht von dem alten Mauerwerk, das jenseits des Gitters an ihm vorbeizog. Sein Blick glitt zu der altmodischen Knopfleiste, und erst jetzt fiel ihm auf, dass es überhaupt keine Taste für den Keller gab.
Ramon brach der Schweiß aus, was auch an der stickigen Wärme in der Kabine liegen konnte, und er dachte an Flynt, der total auf Lokalgeschichte stand und in den Mittagspausen jeden vollquasselte, der nicht schnell genug das Weite suchte. Hatte die Station vor der Schließung nicht mal anders geheißen? Aldwych oder so ähnlich? Und war sie nicht wegen des defekten Fahrstuhls überhaupt erst dichtgemacht worden?
Er drückte noch mal auf die Taste mit der »5«.
Etwas knisterte leise.
In seiner Hand.
Ramon riss das Papier auf, und Staub rieselte auf den Boden. Die Blumen waren … zerfallen.
Der Fahrstuhl hielt.
Ramon, dessen Brust sich auf einmal merkwürdig eng anfühlte, wischte sich die Finger am Hosenbund ab und drückte noch mal auf die Taste mit der 5.
Und noch mal.
Dann auf die anderen Tasten.
Die alte Glühbirne der Kabine flackerte …
Nur die Ruhe. Wenn ein Fahrstuhlschacht hier runterführte, gab es auch irgendwo eine Treppe nach oben. Blöd das alles, aber kein Beinbruch. Er versuchte mehrfach, das Gitter zu öffnen, bis er kapierte, dass er den Ausgang auf der anderen Seite der Kabine benutzen musste. Ein Schwall feuchtkalter Luft schwappte in die Kabine. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine U-Bahn-Station so tief unter der Erde lag, vor allem in den Bezirken Westminster und Holborn.
Der Fahrstuhlkorb schüttete einen Lichthof aus, der zwei, drei Yards in die Dunkelheit reichte. Matte, in altbackenem Grünbeige gestrichene Fliesen und Spinnenweben. Auf dem Boden Pfützen, in denen abgestandenes Wasser schimmerte.
Die Handytaschenlampe.
Dabei fiel Ramons Blick automatisch auf die Netzanzeige. Kein Signal, war ja klar. Er leuchtete in den Korridor.
An der Wand stand in sorgfältig handgemalten, leicht verblichenen Buchstaben Information. Ein verriegelter, von fauligem Holz gerahmter Schalter, der in die Wand eingelassen war. Dahinter ein Pfeil, der den röhrenförmigen Korridor entlangführte. Zu den Bahnsteigen.
Ramon verließ den Fahrstuhlkorb … und erwischte prompt eine der Pfützen. Sofort zog er den Fuß zurück, aber da war das Wasser schon durch seine Nikes gesickert. Er verspürte ein Ziehen am Fuß, als bestünde die Pfütze nicht aus Wasser, sondern aus einer klebrigen Flüssigkeit.
Er ging weiter, an dem Zugang zum U-Bahn-Gleis vorbei, das nach Holborn führte. Endlich erinnerte er sich, was Flynt erzählt hatte. Aldwych war früher eine Endstation gewesen. Dann gab es also nur dieses eine Gleis, oder? Der Gang geradeaus musste zu einer Treppe führen.
Die Luft wurde immer schlechter. Die Klamotten klebten Ramon auf der Haut, und er fror erbärmlich, als er den Treppenschacht erreichte.
Vergittert!
Er rüttelte an den Stäben, aber sie saßen fest in der Verankerung. So eine Scheiße.
Der Gang führte noch weiter und endete an einer Metalltür.
Die offen stand.
Ramon leuchtete hinein. Die Luft dahinter wirkte trotz der Kälte irgendwie drückend. Der Gang machte einen Bogen und führte … irgendwohin. Einen Versuch war es wert. Weitere Pfützen. Ramon umging sie, indem er sich an der gekachelten Wand abstützte.
Ein Wispern.
Da war etwas vor ihm – an der Wand. Irgendetwas Amorphes, Dunkles, das knapp unter der Decke hing und ihn zu beobachten schien. Ramon richtete das Licht darauf, und das Etwas verflüchtigte sich.
Unsinn. Da war nur die Wand.
Er erreichte eine Steintreppe. Sie führte weiter in die Tiefe. Ramon leuchtete hinunter.
Ein zweiter Schacht.
Ein zweiter Bahnsteig!
Dann gab es auf der anderen Seite vielleicht – einen Ausgang?
Die Stufen waren glitschig. Und wieder dieses merkwürdige Ziehen an den Füßen, als ob irgendwas mit seinem Gleichgewichtssinn nicht stimmte. Das Handylicht riss zehn, zwölf Yards der Tunnelröhre aus dem Dunkel. Da lag tatsächlich noch ein Gleisbett. Die Schienen waren verrostet. Alte, teilweise abgeplatzte Kacheln an den Wänden. Verblichene Plakate. Werbung für das Rugby-Finale in Wembley. Und Pepsodent. Du wirst dich fragen, wo das Gelb geblieben ist. An einer Stelle waren die Kacheln heller, als hätte jemand dort ein Schild entfernt. In altmodisch geschwungenen, dunkelroten Großbuchstaben stand dort: THE STRAND.
Der Name, den die Aldwych-Station Anfang des 20. Jahrhun…
Jahrhun…
Jahrhu…
Ramon versuchte, das Wort zu denken, aber ihm war, als hätte ihm jemand einen Amboss auf die Stirn gelegt. Wo kam dieser verdammte Druck her?
Der Impuls, auf dem Absatz kehrtzumachen und zum Fahrstuhl zurückzulaufen, wurde übermächtig. Aber der Fahrstuhl war kaputt, und auf dieser Seite gab es keinen Ausgang. Er musste zur anderen Seite, so einfach war das. Und notfalls weiter durch den Tunn…
Durch den Tun…
Durch den …
Er ging los.
Langsamer, als er sich vorgenommen hatte. Und ängstlicher.
Ihm war schwindlig, und seine Schritte in dem zähflüssigen Matsch verursachten keine Geräusche mehr. Als hätte jemand die gesamte Station in Watte gehüllt.
Langsam näherte er sich der anderen Seite, vor ihm das schwarze Loch des U-Bahn-Schachtes, der Richtung Holborn führte.
Richtung Holborn, da, wo Menschen waren.
Richtung Hol…
Etwas Feuchtes lief über sein Gesicht. Seine Oberlippe. Er wischte darüber und richtete den Lichtstrahl auf seine Fingerkuppen. Das war Blut.
Der Druck in seinem Kopf war jetzt so schlimm, dass er nicht mehr wusste, von welcher Seite des Bahnsteigs er gekommen war. Lief er etwa in die falsche Richtung?
Das Wispern kehrte zurück.
Über ihm.
Seine Halswirbelsäule kreischte wie ein rostiges Scharnier, als er den Kopf hob. Eine Spinne, die sich von der Decke herabhangelte. Sie war klein.
Kleiner als die andere, die neben ihr herabglitt.
Aber größer als die dritte.
Ramons Atem ging stoßweise, nur unter großem Druck gelang es ihm, die Luft aus seinen Bronchien zu pressen. Wispern überall. An der Decke. Auf dem Boden. Und auf seinen Beinen.
Ramon schüttelte sich. Spinnen fielen aus seinen Hosenbeinen. Dutzende.
Er schlug nach ihnen, aber viel zu langsam. Feuchtigkeit in seinem Nacken. Jetzt blutete er auch aus den Ohren. Er sah nichts mehr und hörte nichts mehr. Spürte nur noch die Spinnen, die über seine Wangen krabbelten und … darunter.
Er schlug nach ihnen und traf nackte Haut.
Sie waren in ihm!
Etwas riss.
Erst war es nur das Polyestergewebe seiner Jacke, die er in einem Secondhandladen in Shoreditch gekauft hatte. Dann sein Pullover. Reine Schurwolle.
Dann riss seine Haut.
3
»Ich respektiere Ihre Meinung, Dr. Briscoe, aber Sie wissen, dass ich das unmöglich tun kann.«
Randolph Scott hatte keinen Blick übrig für die eindrucksvolle Silhouette des LASH-Carriers, der unter ihnen immer kleiner wurde. Sein Interesse galt allein Rachel, die neben ihm mit klopfendem Herzen und Kopfschmerzen im Helikopter saß. Sie war nicht sehr lange bewusstlos gewesen, höchstens ein paar Sekunden. Puls und Blutdruck waren in Ordnung, aber Cartwright hatte natürlich auf seinem Auftritt bestanden. Wie fühlen Sie sich, Dr. Briscoe? Sehen Sie auf meine Hand. Wie viele Finger hebe ich?
Verfolgt von den Blicken der Kollegen und Besatzungsmitglieder, hatte er sie in seine Kajüte verfrachtet und ihr irgendein kreislaufstabilisierendes Zeug aus seiner Bordapotheke verabreicht. Zum Schluss noch der Hinweis, dass ein stationäres Krankenhaus wahrscheinlich über bessere Diagnosemöglichkeiten verfügte.
Wow, tatsächlich?
Eine halbe Stunde später hatte Randolph Scott sie zum Helikopter bringen lassen, der jetzt, von einem Windstoß geschüttelt, Kurs in Richtung Norden nahm. Außer dem Piloten befanden sich nur Rachel und Randolph Scott an Bord.
»Ja? Und warum nicht?«, nahm sie den Faden ihres Gesprächs wieder auf, in dem sie Scott beschworen hatte, den Würfel umgehend zurück auf den Meeresgrund zu werfen. Es hatte sie selbst gewundert, mit welcher Inbrunst sie auf ihn einredete. Schließlich waren die Bilder, die während ihrer seltsamen … Vision vor ihrem inneren Auge aufgeblitzt waren, alles andere als aufschlussreich gewesen. Und vor allem hatten sie dem ersten Anschein nach rein gar nichts mit dem Würfel zu tun gehabt. Alles, was blieb, war das diffuse Gefühl von Gefahr, das sie wie eine eisige Hand umklammert hielt.
»Nun, weil es uns Millionen Pfund gekostet hat, dieses Ding zu heben, die ich nicht einfach in den Sand setzen kann, ohne meinen Auftraggebern eine plausible Erklärung zu liefern. Ahnungen und Bauchgefühle reichen dafür leider nicht aus.«
»Wer sind Ihre Auftraggeber?«
Sein Lächeln blieb die einzige Antwort.
Rachel tat sich schwer mit dem Gedanken, dass dieser asketische, zielstrebig wirkende Mann eine Instanz über sich duldete, die ihm Befehle erteilte. »Was ist mit den Leuten, die sie hergebracht haben? Warum lassen Sie sie auf dem Schiff zurück?«
»Weil ich sie dort brauche, um das wissenschaftliche Team zu unterstützen. Und weil ich die Gelegenheit nutzen möchte, auf unserem Rückweg nach London mit Ihnen über das zu sprechen, was Sie in Ihrer Vision gesehen haben.« Wieder dieses Lächeln, das weder falsch noch echt war.
»Nach London? Haben wir überhaupt so viel Sprit?«
Er lehnte sich demonstrativ zurück. »Das ist unser sogenannter Greencopter. Eine Eigenentwicklung, die selbst ähnliche Neuentwicklungen von Airbus in den Schatten stellt. Die besondere Form der Rotoren und das Gehäuse aus Spezialkunststoff ermöglichen eine beeindruckende Leistung bei geringem Verbrauch. Und verhältnismäßig leise ist er auch, sonst könnten wir uns hier drinnen übrigens gar nicht ohne Kopfhörer unterhalten.«
Ach, wirklich. Wie interessant. Aber so leicht würde sie ihn nicht vom Haken lassen. »Schön. Dann sprechen wir darüber. Woher wussten Sie, dass dieses Teil da unten liegt?«
»Ich wusste es nicht.«
»Entschuldigen Sie, Sir, aber …« Das ist doch einfach Blödsinn! »Sie wussten zumindest, dass irgendetwas dort unten liegt! Sie wussten, wie groß und wie schwer es ist, und Sie wussten, was sie brauchen, um es zu bergen. Also, wie haben Sie davon erfahren?«
Sie war schon immer gut darin gewesen, andere niederzustarren, aber Randolph Scott hielt ihrem Blick mühelos stand.
Die Maschine wurde erneut von einer Bö erfasst. Sie wusste nicht, ob es an Cartwrights Medikamenten lag oder am Schaukeln des Hubschraubers, aber ihr wurde auf einmal speiübel.
Eins steht ja wohl mal fest. Er wusste, dass das Ding gefährlich ist. Deshalb hat er dich doch davor gewarnt.
Aber stimmte das wirklich?
Sie dachte an die Bilder, die sie gesehen hatte – der merkwürdige Tunnel, der an einen U-Bahn-Stollen erinnerte, das schwarze Ding zwischen den Lichtern –, doch sie entglitten ihr, sobald sie versuchte, sich die Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen.
»Was ist mit meinem Gepäck?« Sie war jetzt wirklich kurz davor, sich in den Schoß zu kotzen.
»Ich werde veranlassen, dass es abgeholt wird. Jetzt ist es erst einmal wichtig, dass Sie nach Hause kommen.«
»Nein! Ich muss zurück auf das Schiff.«
Er sah sie ehrlich erstaunt an. »Eben haben Sie mir doch noch gesagt, ich soll den Würfel auf der Stelle versenken.«
»Und Sie haben gesagt, dass Sie das nicht tun werden! Also muss ich zurück und herausfinden, was es mit diesem Ding auf sich hat!«
»Bedaure, aber das kann ich nicht zulassen.«
»Sie haben mich geholt, weil sie wussten, dass Sie mich brauchen. Also lassen Sie mich meine Arbeit machen!«
»Es existieren zahlreiche Aufnahmen, die ich Ihnen für eine Analyse der Zeichen zur Verfügung stellen kann.«
Aufnahmen habe ich selbst genug, dachte sie wütend und erinnerte sich, wie sie voller Erleichterung festgestellt hatte, dass sich ihr Handy tatsächlich immer noch in ihrer Hosentasche befand. »Das reicht aber nicht. Ich muss Materialproben nehmen. Ich muss feststellen, wie das Objekt verarbeitet ist und mit welchen Mitteln die Zeichen auf seiner Oberfläche angebracht wurden.«
»Ich werde Ihnen ermöglichen, das Objekt ausreichend gründlich zu analysieren. Das ist ein Versprechen. Aber vorher möchte ich sichergehen, dass von dem Würfel keine gefährlichen Einflüsse ausgehen. Das verstehen Sie doch, oder?«
Klang plausibel. Oder doch nicht? Denn was bedeutete das für die restliche Besatzung des LASH-Carriers?
»Woher stammt dieses Ding? Und aus welcher Zeit? Ist es von Menschen gemacht? Gibt es noch weitere solcher Artefakte, und wenn ja, wissen Sie, wo sie sind?«
Sie stellte die Fragen absichtlich schnell hintereinander, als würden sie ihr spontan in den Kopf schießen, aber Scott ließ sich nicht aufs Glatteis führen. Er sah aus dem Fenster und verzichtete auf eine Antwort –, als ahnte er, dass die Diktier-App auf ihrem Handy die ganze Zeit über eingeschaltet war.
4
»Und, Shao? Wann ist die Übergabe?«
Shepherd lehnte sich an den Bücherschrank – weitgehend unberührte Lexika und Polizeihandbücher sowie Gerüchten zufolge in der untersten Reihe hinter einer verschlossenen Schranktür eine Reihe exquisiter Single Malts – und sah durch die Scheibe, hinter der es sechzehn Stockwerke tief bis zum Broadway runterging. Der größte Teil des Central Drug Squad war im vierzehnten Stock des New Scotland Yard Building untergebracht. Nur der Superintendent und ein paar seiner Lieblinge aus Abteilung F saßen im sechzehnten, mit freiem Blick auf Westminster Abbey und Big Ben, so dass das Fußvolk aus A bis E vor jedem Rapport zwei Stockwerke nach oben laufen musste. Shao wusste nicht, wer auf die Idee gekommen war, den Abteilungen Buchstaben zu verpassen, als wären sie Straßenzüge in irgendeinem kalifornischen Kaff. Sie wusste nur, dass es in den Achtzigern mal eine legendäre siebte Abteilung mit einem richtigen Namen gegeben hatte, Operation Lucy, die am anderen Ufer hinter der Vauxhall Bridge untergebracht worden war und sich vorwiegend mit ausländischen Drogengangs beschäftigt hatte. Aber ausländische Drogengangs stellten nach Einschätzung des amtierenden Commissioners heutzutage offenbar kein nennenswertes Problem mehr dar.
»Irgendwann in der nächsten Woche. Den genauen Termin kriegen wir von ihr, sobald wir sie rausgeholt haben.«
»Ich hör immer ›rausgeholt‹.«
»Das war unsere Vereinbarung.«
»Servieren Sie sie ab, Shao. Ich brauche zuverlässige Informanten und keine Pokerspieler.«
Shao betrachtete den Kaktus, der auf der Fensterbank des Büros stand, und überlegte, ob man so einen im Seminar für überforderte Führungskräfte bekam. Sie beschloss, noch einen letzten Versuch zu unternehmen. Um Deirdres willen.
»Sir, sie hat uns schon gesagt, dass es in Creekmouth stattfinden soll. Als Entgegenkommen. Ich meine, für sie geht es um Kopf und Kragen. Den Termin kriegen wir nur, wenn wir sie rausholen. Das ist der Deal.«
»Und Sie sind absolut sicher, dass es um Stoff geht?«
»Absolut, ja.«
Die Wahrheit war, dass sie nicht mal mehr sicher sein konnte, die richtige Antwort zu erhalten, wenn sie Deirdre nach der Uhrzeit fragte. Und Shepherd wusste das. Sein Blick glitt über Shao hinweg wie über ein lästiges Insekt und weiter zu ihrem Partner Detective Sergeant Edward Dayton, der stumm wie ein Amphibienwesen auf dem Stuhl neben ihr saß.
»Was sagen Sie dazu, Eddie?«
Eddie versuchte, Zeit zu gewinnen, indem er sein streng zurückgekämmtes dunkelblondes Resthaar betastete. »Nun, Sir, also ich, äh … Ich glaube schon, dass wir Watkins immer noch vertrauen können, aber wir sollten …«
»Das finde ich auch, Eddie. Tut mir leid, Shao, aber wir können es uns absolut nicht leisten, unsere knappen Ressourcen für jemanden wie Deirdre Watkins zu verschwenden.«
Für jemanden wie Deirdre?
»Ich gebe zu, sie war zuletzt nicht ganz auf der Höhe, aber sie hat immer noch Einfluss auf Logan Costello, und sie weiß, wie wir …«
»Sie verarscht uns, Shao. Wann, sagten Sie noch mal, ist sie selbst auf den Geschmack gekommen? Das war irgendwann letzten Frühling, richtig?«
Es war exakt der Dienstag vor Ostern gewesen, als Deirdre ihr davon erzählt hatte, und zwei Tage später, pünktlich zum Fest, hatte sie die Info pflichtgemäß an Shepherd weitergegeben. Wofür sie sich seitdem verfluchte.
»Ich wette, in diesem Augenblick hängt sie auf dem Scheißsofa in ihrer Bude und ist high. Ihr hübsches Informanten-Häschen ist kein Teil der Lösung, Shao, sie ist Teil des Problems!«
Damit hatte er Shaos wunden Punkt getroffen. Deirdre war der neuen Synthetikdroge verfallen, die seit ungefähr einem Jahr unter dem Begriff Harmony die Straßen überschwemmte und den absoluten Trip garantierte, besser als Ketamin. Harmony oder Greater H, wie es auf der Straße hieß, war der heiße Scheiß des Jahres, und man musste sich nicht mal die Venen kaputtmachen dafür. Logan Costello, der anscheinend eine Art Patent auf das Zeug besaß, hatte das Gerücht streuen lassen, dass es auch bei langfristigem Gebrauch gesundheitlich unbedenklich war. Tja, Deirdre wusste es inzwischen wohl besser.
»Sir, ich bitte Sie, falls Sie Schwierigkeiten mit dem Papierkram haben, bin ich gern bereit, den Staatsanwalt persönlich zu überz…«
Shepherd wedelte mit der linken Hand vor ihrem Gesicht rum, als wäre sie ein Hund, dem man einen Platz in der Ecke zuwies. »Ich sage Ihnen, womit ich Schwierigkeiten habe. In diesem Raum sitzen drei Beamte mit zusammen mehr als fünfzig Jahren Ermittlungserfahrung, und die zählt mehr als Ihre Gefühle für Miss Watkins.«
Shao fragte sich, ob er den Kaktus in seine Aufzählung einbezogen hatte.
»Diese Exnutte, Exfreundin und inzwischen auch Exinformantin gefällt sich offenbar darin, den Hang runterzurutschen. Lassen wir sie doch. Ist nicht unser Problem.«
Shao warf einen Blick auf Amphibien-Eddie, der gerade hochkonzentriert das Tapetenmuster an der Wand hinter Shepherd studierte. »Sir, Sie tun gerade so, als ob es unser Geld wäre.«
Shepherds Blick wurde stechend. Bei allen anderen verfluchten Kleindealern, die sie im Laufe der letzten 36 Monate aus Costellos Organisation herausgefischt und ausgequetscht hatten, hatte er nämlich den Etat angezapft, um ihnen den Weg in den Zeugenschutz zu ebnen. Was allerdings nur zweimal vorgekommen war, weil Shepherd schon vor langem die Erste Goldene-Arschloch-Regel des Yard-Hauptquartiers verinnerlicht hatte: Halte die Fallzahl übersichtlich, dann steigt die Ermittlungsquote von ganz allein!
In einer Sache hatte Mr-Ich-leg-lieber-die-Hände-in-den-Schoss-bevor-noch-irgendwas-kaputtgeht allerdings recht. Shao nahm die Sache inzwischen persönlich. Das hätte wohl jeder getan, der ein halbes Dutzend Mal hintereinander mit dem Kopf gegen dieselbe Mauer gelaufen war. Costellos Märchen hin oder her, sie drei hier in diesem Raum wussten genau, was Harmony auf Dauer anrichtete. In zwei, drei Monaten würde Deirdre Watkins weniger Zähne im Mund haben als Shane MacGowan, und kurz darauf hätte sich ihr Gehirn so weit verflüssigt, dass sie sich gegenüber Costello verplapperte. Und dann würde Costello nachfragen, und es gab eine Menge, was Deirdre ihm zu erzählen hatte.
Shao warf Edward einen auffordernden Blick zu, aber Eddie zu motivieren war ungefähr so erfolgversprechend, wie einem Stoffteddy eine Einkaufsliste in die Hand zu drücken und darauf zu warten, dass er einem das Abendessen kochte. Also zog sie den letzten Trumpf, den sie noch hatte. »Wie Sie wollen, Sir. Dann gehen Eddie und ich wegen dem Termin eben zum Buchhalter. Ihre Entscheidung.«
Der Buchhalter von Costello hieß Quincy Hobart, war ein Arsch mit Krawattennadel und zweifachem Master in Jura und Business Administration, der in seiner fetten Kanzlei in Canary Wharf gern mit der Breitling am Handgelenk spielte. Natürlich ein Geschenk von Costello.
Shepherd war aus seinem Sessel hochgefahren wie eine Bulldogge, der man in den Hintern getreten hatte. »Eddie. Würden Sie uns mal für einen Moment allein lassen?«
Eddie erhob sich, als hätte sich unter ihm eine Feder gelöst. »Alles klar, Shao. Wir sehen uns dann drüben.«
»Ja, alles klar, Eddie.« Mach dich nur vom Acker. Wie immer, wenn’s ernst wird.
Sie wartete, bis die Tür hinter ihm zugeklappt war, dann legte sie los. »Hobart ist geschieden, aber er hat einen Sohn und eine kleine Tochter. Nicht zu vergessen diesen senilen Yorkshire-Terrier namens Carlisle, der regelmäßig in sein Vorzimmer pinkelt. Er liebt sie alle drei abgöttisch. Es wäre also kein Problem, ihm die Daumenschrauben anzulegen und damit Deirdres Ausfall zu kompensieren.« Shepherds Gesicht war jetzt dunkelrot, aber Shao machte weiter. »Ich schlage also vor, dass Eddie und ich einfach mal bei ihm auf den Busch klopfen und …«
»Erstens.« Shepherd unterbrach sie mit einer Stimme, mit der man Metall hätte schneiden können, und fuhr den Zeigefinger aus. »… ist Hobart unser größter Trumpf, so dass ich auf keinen Fall das Risiko eingehen will, ihn für diese Sache zu verbrennen.«
»Ich sagte ja, wir klopfen nur ein bisschen auf den …«
»Und zweitens«, der Mittelfinger schnellte hoch, »werde ich auf keinen Fall unsere Bordmittel auf eine ausrangierte Musikantin aus Costellos Blaskapelle verschwenden, die uns sowieso keine nennenswerten Infos mehr liefern kann. Als ich Sie hier eingestellt habe, dachte ich ehrlich, Sie hätten was drauf, Shao. Mein Fehler. Dann dachte ich, vielleicht könnten Sie wenigstens was lernen. Aber anscheinend können Sie nicht mal das.«
»Sir, ich …«
»Und drittens hab ich mir lange genug angesehen, wie Sie diese Junkie-Nutte päppeln. Damit ist Schluss. Sie werden den Kontakt zu Watkins abbrechen, oder Sie sind raus aus dem Team. Haben Sie mich verstanden?«
Sie suchte nach der richtigen Erwiderung. Oder überhaupt nach einer. Aber in ihrem Kopf herrschte nur Chaos. »Wenn wir Deirdre fallenlassen, ist das ihr Todesurteil.«
»Möglich. Na und?«
»Und sie wird Costello erzählen, dass wir … Denken Sie doch mal nach, verdammt! Deirdre hat uns schon so viel gegeben! Mit Sicherheit mehr, als wir aus diesem Penner Hobart jemals rauskriegen werden. Sie verdient es einfach, dass wir …«
Sie brach ab, weil sie begriff, dass sie sich mit jedem Wort nur tiefer in die Scheiße redete.
»Wissen Sie, worüber ich mich freue, Shao?« Er tippte mit seinen Wurstfingern zufrieden auf den Tisch. »Dass dieses unverwanzte Büro einer der letzten Orte ist, an denen ein Kerl noch offen seine Meinung sagen kann. Und die werden Sie jetzt von mir hören.«
Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Geh einfach, sagte eine Stimme in ihr, geh, bevor es noch schlimmer kommt. Aber sie ging nicht. Und es kam schlimmer.
»Ich habe Sie unterstützt, weil man mich dazu verpflichtet hat. Der Commissioner kriegt nämlich jedes Mal einen Ständer, wenn er im Fernsehen über die Frauenquote referieren darf, aber wir beide wissen, wer hier in der Abteilung die Arbeit macht und wer bloß so tut als ob.« Er breitete gönnerhaft die Arme aus. »Ich meine, bitte, wenn es Ihnen was gibt, gemeinsam mit der Nutte eine Konfliktkerze zu entzünden, lassen Sie sich nicht aufhalten … aber dann machen Sie das verdammt nochmal in Ihrer Freizeit, klar?«
Du Arsch, ich werd dich …
»Bis nächste Woche können Sie zu Hause bleiben. Besaufen Sie sich. Oder suchen Sie sich mal ein bisschen Entspannung. Ein Kerl würde verflucht nochmal wissen, was ich meine.«
Ihre Wut war so übermächtig, dass sie wie ein Klumpen Dreck in ihrem Hals steckte. Du wirfst mich nicht raus. Eher setz ich mich an den Schreibtisch und schreib meine Scheißkündigung!
Sie stand auf. »Sir.«
»Bis nächste Woche, Shao.«
Die Tür klappte hinter ihr zu wie ein Sargdeckel. Rechts und links auf dem Gang standen die Türen offen. Und wenn schon. Es war keine Neuigkeit, dass Shepherd versuchte, sie kleinzukriegen. Neu war, dass es ihm gelang.
Ihr Arbeitsplatz lag hinter Pappwänden in einem Großraumbüro am Ende des Ganges. Als sie ihren Schreibtisch erreichte, zitterten ihr die Knie. Eddie saß ihr gegenüber und blickte auf das Chaos, das auf ihrem Schreibtisch herrschte.
Sie ließ sich auf den Sitz plumpsen.
»Hey, alles in Ordnung?«
Halt deine beschissene Klappe.
»Wenn ich dir irgendwie helfen kann …«
»Ich hau ab.«
»So früh? Normalerweise gehst du doch immer erst, wenn …« Sein Grinsen erlosch, als er begriff, dass sie es ernst meinte. Sie konnte ihm ansehen, was er jetzt dachte. Jeanne d’Arc reitet wieder.
»Leck mich, Eddie. Du kannst dir den Scheißladen hier meinetwegen noch länger antun. Ich tu’s nicht!«
»Und was, wenn er recht hat?«
»Wie bitte?«
»Denk doch mal eine Sekunde nach! Wie oft hast du Deirdre angeboten, ihr da rauszuhelfen oder einen Therapieplatz für sie zu besorgen? Dass sie immer noch bei Costello ist, dafür gibt es aus meiner Sicht nur einen einzigen Grund: Sie ist genau da, wo sie sein will. Akzeptier’s einfach.«
»Schwachsinn.«
»Ja, Schwachsinn. Sicher. Du weißt, wie’s läuft. Okay, weißt du was? Mach doch einfach, was du willst. Wir sehen uns morgen.«
Sie ignorierte ihn, während er geräuschvoll seine Sachen zusammenpackte. Auf ihrer Liste für morgen standen noch ein paar Telefonüberwachungsdaten, die sie überprüfen musste. Das konnte sie genauso gut jetzt machen.
Er warf sich die Jacke über. »Ich bin mit dem Wagen da. Soll ich dich irgendwo absetzen?«
Shao reagierte nicht.
Er hob die Schultern. »Wie du willst.«
Sie hörte, wie er auf dem Flur verschwand, und starrte auf ihren Bildschirmschoner. Möglicherweise hatte Shepherd recht mit dem, was er über Deirdre gesagt hatte. Zum Henker, vielleicht hatte er sogar recht mit der Entspannung. Zwei kräftige Schultern zum Festhalten, gern von Idris Elba.
Oder, zweitbeste Möglichkeit, von Antwon.
Sie griff zum Telefon.
»Hey, Sadako.«
Sie hatte ihm beim letzten Mal versprochen, wenn er sie noch einmal bei ihrem Vornamen nannte, würde sie ihm den Hals umdrehen.
»Hast du heute Abend Zeit?«
»Sehr witzig.«
»Okay, dann irgendwann diese Woche.«
»Warte kurz.«
Ein Rascheln, dann irgendeine helle Stimme im Hintergrund, die sich beschwerte.
»Okay, bin wieder da. Die nächsten vier Tage und am Wochenende ist alles dicht, und nächste Woche haben wir auch schon Weihnachten.«
»Na, dann sagen wir doch Heiligabend?«
»Keine Chance. Hab eine Kundin, bei der ich Santa Claus spielen muss.«
Shao brauchte nicht mal die Augen zu schließen, um sich vorstellen, wie das ablaufen würde. »Okay, dann sag du was.«
»Silvester ginge.«
Fast genauso gut. »Ist notiert. 18 Uhr?«
»Ich freu mich auf dich, Sadako.«
Er legte auf, bevor sie ihn anfauchen konnte.
5
Es war eine Stunde her, dass Liv sich von Ken Harris verabschiedet hatte. Mit dem Versprechen, sie würde ihm sein rechtes Auge entfernen, wenn er es wagen sollte, sie noch mal anzurufen. Und vielleicht auch das linke. Mit einem Esslöffel.
Die Wut hatte sie überrollt wie eine Welle, und zwar direkt auf Haileys Geburtstagsparty, inmitten ihrer Freundinnen, und sie hatte Kenny einen Haufen Wörter entgegengespien, von denen sie die meisten glücklicherweise schon wieder vergessen hatte. Es waren nicht nur solche darunter gewesen, bei denen ihre Mutter bleich geworden wäre, die beim Bügeln meistens EWTN Catholic oder Gospel Channel guckte, sondern wirklich schlimme Wörter –, aber gottverdammt, ihr Zorn war gerechtfertigt gewesen! Schließlich hatte Kenny Arschloch Wright es tatsächlich fertiggebracht, vor den Augen aller anderen mit Zoe Monray rumzumachen.
Echt jetzt. Zoe.
Danach hatte Liv sich umgedreht, und die Menge aus Zuschauerinnen hatte sich vor ihr geteilt wie das Rote Meer, als sie Haileys Wohnung verlassen und zur U-Bahn-Station Holborn gelaufen war, um von dort mit der Central Line drei Stationen nach Westen zu fahren. In Bank vom U-Bahn-Gleis zum Bahnsteig der Dockland Light Railway zu gelangen dauerte zwar ungefähr so lange, wie den Jakobsweg von Burgos nach Santiago de Compostela zurückzulegen, aber das war immer noch besser, als den Rest ihres Taschengeldes für eine Fahrt mit dem Taxi auszugeben. Und das an so einem Tag.
Wenigstens wartete die DLR-Bahn abfahrbereit, als Liv endlich am Gleis eintraf. Sie ließ sich auf einen der Sitze fallen und starrte wutentbrannt aus dem Fenster, während sich die Türen schlossen und der Triebwagen beschleunigte.
War da nicht eben etwas Schwarzes draußen an der Scheibe gewesen?
Der Zug verschwand im Tunnel, aus dem er erst kurz vor der Station Shadwell wieder herauskam. Es waren noch sechs Stationen bis Canning Town, und Liv stellte sich vor, wie ihre Mutter einen Herzinfarkt bekam, wenn sie erfuhr, dass Liv vom Bahnhof zu Fuß nach Hause gegangen war.
Liv, Liebes, du weißt doch, wie gefährlich es ist, nachts allein in dieser Gegend unterwegs zu sein.
In Limehouse stiegen die letzten Fahrgäste aus. Sanft und seelenlos wie ein mechanischer Riesenwurm glitt der fahrerlose Zug zwischen den Bürotürmen von Canary Wharf hindurch wie durch eine Straßenschlucht von Gotham City.
Liv sah auf ihr Handy und stellte sich vor, wie Kenny darum bettelte, zu ihr zurückkehren zu dürfen, und wie sie sehr gründlich und sehr gewissenhaft darüber nachdachte, ob sie seiner Bitte nachkommen sollte. Vielleicht sollte sie Stacy Evans dazu befragen. Andererseits war das keine so gute Idee, weil Stacy selber verrückt nach Kenny war. So ziemlich jede von Livs Freundinnen war verrückt nach Kenny. Sogar Evelyn, die es überhaupt nicht nötig hatte, Jungs nachzulaufen, weil sich sowieso jeder Typ zwischen elfeinhalb und Anfang fünfzig auf der Straße nach ihr umdrehte. Was natürlich auch an ihren Brüsten lag, die, seien wir einfach ehrlich, absolut perfekt waren. Und das ganz ohne künstliche Nachhilfe, wie Evelyn ihr bei einem Gespräch unter vier Augen versichert hatte.
Livs Kiefer mahlten aufeinander, als sie sich vorstellte, wie diese ganze verdammte Weiberhorde Kenny in dieser Sekunde tröstete. Klar, dass er unter diesen Umständen nicht anrief, aber auch das würde er bereuen, wenn er morgen früh aufwachte.
Sie dachte wieder an den Esslöffel, und ein bisschen schämte sie sich dafür. In der kalten, trockenen Luft des klimatisierten Wagens war ihr heiliger Zorn bedenklich abgekühlt. Sie fächelte der Glut Sauerstoff zu, indem sie an den zwanzigminütigen Fußmarsch dachte, der ihr bevorstand.
Natürlich hatte ihre Mutter recht. Es war gefährlich, kurz vor Mitternacht in Canning Town allein unterwegs zu sein, aber was ihre Mutter nicht wusste, war, dass sie jemanden kannte, der jemanden kannte, der Kontakte zu den Chadds in Plaistow hatte, und mit denen legte man sich bekanntlich lieber nicht an. Und es gab noch einen zweiten Grund, weshalb man sie nicht anrühren würde. Sie war nämlich in diesem bescheuerten Viertel geboren worden und wusste, welche Straßen sie zu meiden hatte.
So einfach war das.
Der Zug spuckte sie auf der unteren Ebene des fahl ausgeleuchteten Geisterbahnhofs von Canning Town aus und fuhr sofort weiter. Liv sah den Rücklichtern nach, die zwischen den Brachflächen in Richtung Royal Victoria verschwanden – und glaubte wieder, etwas Unförmiges, Schwarzes auf dem letzten Wagen zu sehen, nicht weit von dem Fenster entfernt, an dem sie gesessen hatte. Das schwarze Ding schien von dem Zug herunterzufallen und verschwand im Schatten der Gleise.
Blödsinn, da ist nichts.
Sie blinzelte.
Du bist nur müde, Liv.
Aber dann hörte sie das Wispern, von dem sie im ersten Moment gar nicht zu sagen vermochte, ob es wirklich ein Wispern war oder ein Rascheln wie von ein oder zwei Dutzend Füßen, die über die Gleise huschten …
Füße. Sicher, Liv.
Aber das Geräusch war real. Da war jemand.
Liv wich einen Schritt zurück … aber was, wenn da jemand auf den Gleisen herumlag, der ihre Hilfe brauchte? Ein Betrunkener vielleicht?
Ein Betrunkener, der dort liegt, wäre exakt vor einer halben Minute gevierteilt worden.
Trotzdem, sie war neugierig.
Außerdem hingen hier überall Kameras.
Liv hatte das Ende des Bahnsteigs fast erreicht. Das Rascheln war lauter geworden, und Liv vermutete, dass es von der Ligusterhecke stammte, die das Gleisbett auf der gegenüberliegenden Seite begrenzte.
Nein, das Rascheln kam von unten, direkt vor ihren Füßen. Aus dem Gleisbett.
Ihr Handy meldete sich.
Sie erstarrte, als sie auf das Display sah.
Kenny.
Ihr Mund wurde trocken, aber den Anruf abzulehnen wäre nun wirklich kindisch gewesen. Ihr Daumen schwebte gerade über dem Annahmebutton, als sich der Kopf aus dem Gleisbett emporschob.
Die Augen waren blutunterlaufen und blickten in verschiedene Richtungen, was möglicherweise an dem fingerbreiten Spalt lag, der sich zwischen ihnen hindurch bis runter zum Oberkiefer zog und in dem Liv weiter hinten so etwas wie Hirnmasse glitzern sah.
Liv ließ das Handy fallen und schrie.
6
Die Absperrbänder flatterten auf der mittleren Plattform des DLR-Bahnhofs, so dass Sinclair und Zuko keine Schwierigkeiten hatten, den Weg zu finden.
Powell war bereits da. Er stand wie ein Turm in der Mitte des Bahnsteigs und instruierte einen Constable, sich um die wenigen Passagiere zu kümmern, die an der Südtreppe standen und sich darüber aufregten, dass keine Züge Richtung Osten fuhren. Dabei hatten sie freien Blick auf die Mitarbeiter der Spurensicherung, die in ihren weißen Plastikanzügen über die Gleise schlichen. Nur ein Idiot konnte darüber rätseln, wieso der DLR an diesem eisigen Dezembermorgen der Strom abgestellt worden war.
»Guten Morgen, John. Guten Morgen, Zuko.«
»Sir.«
»Morgen, Sir.«
Powell war fast sechs Fuß groß, und der Wind konnte seiner Silberfrisur nichts anhaben. Trotz der Kälte trug er lediglich einen beigefarbenen Übermantel über seinem geliebten grauen Anzug mit gleichfarbiger Weste. Nach Sinclairs Berechnungen hatte er davon mindestens fünfzehn Stück im Schrank hängen. Die Füße steckten in Schuhen aus dünnem Leder. Beim Yard war es nicht gerade üblich, dass sich ein Detective Superintendent der Mordermittlung bei einem neuen Fall an die Front bequemte, aber James Powell war kein Mensch, der sein Leben nach anderer Leute Gepflogenheiten ausrichtete. Vor ein paar Jahren hatte er von seinen Eltern eine Villa im Colebrooke Drive geerbt, einer kleinen Seitenstraße jenseits der Wandstead-Wiesen, in Sichtweite des Kricketareals. Er hatte sie saniert, ohne auch nur ein einziges Mal die Nummer eines Handwerkers zu wählen.
»Name?«, erkundigte sich Sinclair.
»Livia Parson. Kam wohl von einer Geburtstagsparty in der Stadt. Die Eltern leben hier in Canning Town. Denmark Street. Den Newham Way rauf bis zum Park und dann vor der Adventistenkirche links rein.«
»Weiß schon.«
»Die Mutter hat um drei Uhr früh bei Hailey Clarke angerufen. Das ist das Mädchen, das Geburtstag hatte. Sie war besorgt, weil Liv noch nicht zu Hause war.«
»Alter?«
»Knapp sechzehn.«
Sinclair wusste nicht, wieso er gerade jetzt daran dachte, dass nächste Woche Weihnachten war. Er stellte sich vor, wie Livias Eltern die Feiertage verbringen würden, und war nicht besonders unglücklich darüber, keine Familie zu haben. Es lag außerhalb seiner Vorstellungskraft, dass man einen Tag, wie Livias Mutter ihn gerade durchmachte, überleben konnte.
Zuko warf einen Blick auf sein Handy. »Die letzte Bahn trifft um null Uhr fünfzig ein. Wenn sie hier überrollt wurde, muss sie also mit einem der früheren Züge gekommen sein.«
Sinclair wollte schon fragen, warum der Fahrer den Unfall nicht bemerkt hatte, als ihm einfiel, dass die Züge der Dockland Light Railway vollautomatisch gesteuert wurden. »Wieso hat das Sicherheitssystem nicht reagiert? Der Zug hätte doch stoppen müssen.«
Powell zog eine frische Packung Chesterfield Red aus der Tasche und löste das Cellophan. Eigentlich verabscheute er Zigaretten, aber um eine anständige Partagas No. 16 anzuschneiden, war dies eindeutig der falsche Moment. »Ich fürchte, das passiert nur, wenn das Hindernis auf den Gleisen groß genug ist, um es als menschlichen Körper zu identifizieren.«
»Groß genug? Was soll das denn heißen?«
»Was wollen Sie zuerst sehen, Detectives? Die Beine oder den Kopf?«
Sinclair und Zuko hatten natürlich angenommen, was jeder in dieser Situation angenommen hätte. Dass die fünfzehnjährige Livia Person die Party ihrer Freundin kurz vor Mitternacht verlassen und ihrem Leben ungefähr eine Stunde später, hier auf dem Bahnhof der Dockland Light Railway in Canning Town, ein Ende gesetzt hatte. Tatsächlich hatte es auf der Party einen Streit gegeben, wie Hailey Clarke gegenüber einem der Sonderfahnder vom Forest Gate inzwischen bestätigt hatte, und zwar mit Livias Freund Kenneth Wright, der angeblich mit einem anderen Mädchen namens Zoe Monray geflirtet hatte, und zwei Zeuginnen namens Stacy und Evelyn soundso bezeugten den Flirt – Sinclair bekam Kopfschmerzen von den ganzen Namen –, und dann war Livia im Streit abgehauen, und Kenneth hatte ungefähr eine Stunde später versucht, sie anzurufen.
»Wann war das genau?«, fragte Sinclair, während Powell sie zum Tatort führte, den die Spurensicherung inzwischen freigegeben hatte. Die Rechtsmedizinerin Dr. Eszter Baghvarty bemühte sich gerade zusammen mit einem Assistenten, die Überreste von Livia Parson aus dem Gleisbett aufzusammeln.
»Hey, E«, ging Zuko dazwischen. »Könnten Sie damit vielleicht noch ein paar Minuten warten?«
»Für Sie doch immer.«
»Danke.«
Baghvarty wischte sich eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht und trat einen Schritt zurück. Zuko knipste fünf, sechs Fotos mit dem Handy, was nicht unbedingt den Bestimmungen entsprach, ihm aber später die Ermittlungen erleichtern würde.
»Ungefähr halb eins«, beantwortete Powell inzwischen Sinclairs Frage, »aber Livia ist nicht rangegangen. Vielleicht war sie zu diesem Zeitpunkt auch schon tot.«
Baghvarty fühlte sich offenbar angesprochen. »Ich würde eher sagen, nein, aber genauer weiß ich das erst, nachdem ich sie auf dem Tisch hatte.«
»Wir haben ja immer noch die Überwachungskameras.«
»Was ist das da eigentlich?« Zuko deutete auf ein paar weißliche, leicht fluoreszierende Gespinste, die wie Zuckerwatte an den Gleisen klebten.
»Sieht für mich aus wie Spinnenfäden, aber das werden sie dann in meinem Bericht erfahren.« Die Rechtsmedizinerin zog fröstelnd den Reißverschluss ihrer Jacke zu. Sie besaß ein hübsches Gesicht, mit einer Nase, die eine Spur zu knochig wirkte. Bei einem Bier hatte sie Sinclair mal erzählt, dass ihre Eltern aus Ungarn eingewandert waren, als sie zwölf gewesen war. Da war immer noch der verblassende Schimmer eines osteuropäischen Akzents, der ihre Stimme interessant machte. »Auf den Kameras dürfte jedenfalls ein ziemlich abgefahrener Film zu sehen sein. Umgebracht hat sie sich mit Sicherheit nicht.«
Die drei Beamten des MIT Forest Gate starrten sie an.
»Die Gebissabdrücke.« Baghvarty deutete auf Livia Parsons Oberkörper und Schultern, die von den Rädern des Zuges zerteilt worden waren. »Wahrscheinlich ein menschliches Gebiss.«
»Wahrscheinlich?«
»Erstaunlich große Klappe. Also auf jeden Fall männlich.«
Powells Mundwinkel zuckten kaum merklich, als er an seiner Zigarette sog.
»Aber es gibt noch ein Problem.«
»Immer heraus damit, Dr. Baghvarty. Wir lieben Probleme.«
»Wir haben schon das gesamte Gleisbett und die Liguster da hinten abgesucht, aber nichts gefunden.«
»Nichts gefunden?« Sinclair blickte sich um. »Was nicht gefunden?«
»Und ich dachte immer, als Detective eines MIT sollte man zumindest nicht blind sein.« Sie deutete auf das Gewirr aus Blut, Fleisch und zersplitterten Knochen zu ihren Füßen. »Keine Ahnung, wo die arme Livia ihr zweites Bein gelassen hat.«
7
Rachel hatte sich fast eine Woche lang Zeit genommen, um über das Gespräch mit Randolph Scott auf dem Rückflug nachzudenken.
Die Handyaufzeichnung hatte sich leider doch als unbrauchbar herausgestellt, weil das Flappen der Rotoren jedes Wort von Randolph Scott und ihr übertönt hatte. Von wegen Greencopter.
Am zweiten Tag nach ihrer Rückkehr war per Mail der Arbeitsvertrag eingetroffen, zeitgleich mit einem riesigen Rosenstrauß. Zum Glück war Nev nicht da gewesen, als der Bote von »My Name is Rose« an der Tür geklingelt hatte: ein nassgeschwitzter Typ, dem man auf den ersten Blick ansah, dass er ins Bett gehörte. Angeblich schob er Sonderschichten, weil ein Kollege spurlos verschwunden war.
Nevison hatte sie nichts von dem Vertrag erzählt. Das Problem war nicht die Geheimhaltungserklärung, die sie vor Beginn der Reise unterzeichnet hatte. Das Problem waren die berechtigten Fragen, die Nev stellen würde und von denen sie keine einzige zu seiner oder auch nur ihrer eigenen Zufriedenheit beantworten konnte.
Ihre Stelle an der Fakultät war sicher, und die Arbeit machte ihr Spaß, weil Professor Spencer ihr alle Freiheiten ließ. Sie war eine anerkannte Archäologin und Expertin zum Thema vorderasiatische Frühkulturen. Sogar eine Halbtagsstelle würde drin sein, falls sie doch noch einmal zu dritt sein sollten. Warum sollte sie also so verrückt sein, diesen Job aufzugeben?
Vielleicht weil Randolph Scott ein faszinierender Mensch mit Visionen und klaren Vorstellungen war – und das Gehalt, das er ihr bot, fast dreimal so hoch war?
Oder weil sie auf den ersten Blick erkannte hatte, dass dieser merkwürdige Würfel nicht einfach nur ein Geheimnis darstellte, sondern eine archäologische Sensation?
Oder wegen des sanften Drucks, den Mr Scott auf sie ausübte? Dreimal hatte in der letzten Woche das Telefon geklingelt, und jedes Mal war ein Mann namens Ernest Beaufort in der Leitung gewesen, der sich als Anwalt von Randolph Scott vorgestellt hatte. Ob sie sich schon entschieden habe. Und ob ihr klar sei, welches Vertrauen Scott in sie setze. Vielleicht ließe sich sogar etwas machen, um ihre privaten Pläne nachhaltig voranzutreiben …
Herrgott, das letzte Mal hatte er angerufen, als sie mit Nev beim Abendbrot saß. Anschließend hatte sie keinen Bissen mehr herunterbekommen.
Wo habe ich uns da nur reingeritten?
Natürlich hatte Nev ihre Unruhe bemerkt. Ihre Schlaflosigkeit, die durchgeschwitzten Laken am nächsten Morgen. Sie hatte ihn mit derselben Ausrede abgespeist, mit der sie auch ihre vorzeitige Rückkehr und den anschließenden Sonderurlaub erklärt hatte –, dass dem Auftraggeber der Expedition überraschend das Geld ausgegangen war.
Es gab Auseinandersetzungen an Bord. Sogar einen Streik. Ich meine, kannst du dir das vorstellen, Schatz – auf offener See? Jedenfalls hat die Uni dadurch einen Haufen Geld verloren. Spencer sagt, vielleicht müssen in der Fakultät sogar Stellen gestrichen werden.
Die Lüge fühlte sich schrecklich an, aber sie verschaffte ihr Zeit, die sie vordergründig nutzte, um Weihnachtsvorbereitungen zu treffen und das Haus auf Vordermann zu bringen. Es war gerade mal anderthalb Jahre her, dass sie das kleine süße Anwesen in einer Seitenstraße in Richmond bezogen hatten – gleich nachdem Nevison endlich seinen festen Vertrag als Erzieher in der Kindertagesstätte bekommen hatte. Zwei Zimmer im ersten Stock hatten immer noch keine Tapeten.
Die Vormittage verbrachte sie allerdings vor ihrem Arbeitsrechner im Souterrain und versuchte, alles über den Würfel herauszufinden. Es gab keine Bilder, keine Daten. Auch über die Symbole schien nichts bekannt zu sein. Die Ähnlichkeiten mit altägyptischen Hieroglyphen waren wahrscheinlich nur Zufall. Zum Beispiel das Rechteck mit den Insektenfühlern oben und unten, das sie an das Symbol der Göttin Neith erinnert hatte. Sie wusste, dass bei ihren Eltern in Norwich noch eine Kiste mit Zeichnungen aus ihrer Kindergartenzeit auf dem Dachboden lag. Die Hälfte der Klekse darauf sahen vermutlich so ähnlich aus.